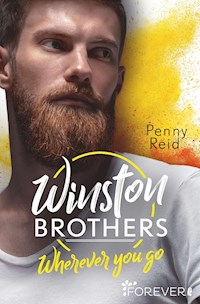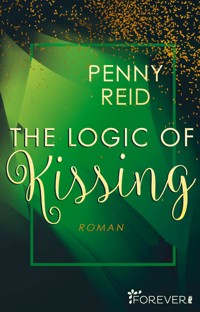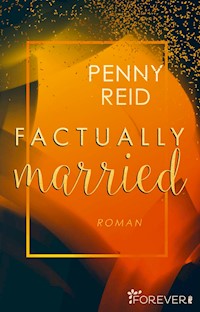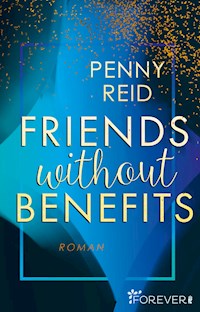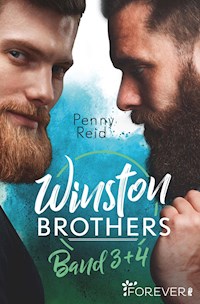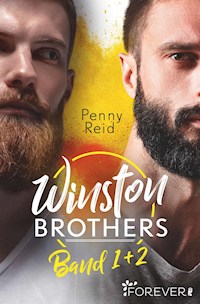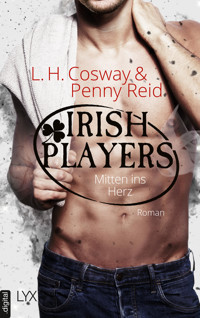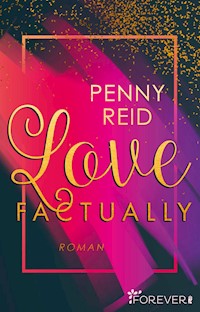
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knitting in the City
- Sprache: Deutsch
Die neue Serie der Smart-Romance-Queen Penny Reid! Nachdem Janie Morris am selben Tag Freund, Wohnung und Job verloren hat, fragt sie sich wirklich, welchen fiesen Plan das Schicksal für sie vorgesehen hat. Zu allem Überfluss ist Quinn Sullivan, der äußerst attraktive Securitymann, auch noch Zeuge ihres blamablen Abgangs. Und läuft ihr danach ständig über den Weg. Wie ein Paar Schuhe, das man gerne hätte, sich aber nicht leisten kann. Doch das letzte, was Janie von ihm erwartet hätte, ist ein Angebot, das sie einfach nicht ablehnen kann. "Ein wundervoller Liebesroman von Penny Reid. Wer die Winston Brothers mochte, der wird Love factually lieben! Ganz ehrlich: Ich kann mich nicht daran erinnern, beim Lesen jemals mehr gelacht zu haben! Großartig! Ich warte händeringend auf den nächsten Band! Volle Punktzahl und gern noch mehr!" Buchhändlerin Katrin P. auf NetGalley
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Love factually
Die Autorin
Penny Reid ist USA Today Bestseller-Autorin der Winston-Brothers-Serie und der Knitting-in-the-city-Serie. Früher hat sie als Biochemikerin hauptsächlich Anträge für Stipendien geschrieben, heute schreibt sie nur noch Bücher. Sie ist Vollzeitmutter von drei Fasterwachsenen, Ehefrau, Strickfan, Bastelqueen und Wortninja.
Das Buch
Nachdem Janie Morris am selben Tag Freund, Wohnung und Job verloren hat, fragt sie sich wirklich, welchen fiesen Plan das Schicksal für sie vorgesehen hat. Zu allem Überfluss ist Quinn Sullivan, der äußerst attraktive Securitymann, auch noch Zeuge ihres blamablen Abgangs. Und läuft ihr danach ständig über den Weg. Wie ein Paar Schuhe, das man gerne hätte, sich aber nicht leisten kann. Doch das letzte, was Janie von ihm erwartet hätte, ist ein Angebot, das sie einfach nicht ablehnen kann.
Von Penny Reid sind bei Forever erschienen:In der Winston-Brothers-Reihe:Wherever you goWhatever it takesWhatever you needWhatever you wantWhenever you fallWhen it countsWhen it's real
In der Knitting-in-the-City-Reihe:Love factually
Penny Reid
Love factually
Roman
Aus dem Amerikanischen vonPeter Groth
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Neuausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin April 2020 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Copyright © 2013. Neanderthal seeks Human by Penny ReidTitel der amerikanischen Originalausgabe: Neanderthal seeks Human (Penny Reid 2013)Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-95818-519-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Epilog
Leseprobe: Winston Brothers
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Kapitel 1
Widmung
Meinem Computer: Ohne dich hätte ich das nicht schreiben können.
Den Softwareentwicklern der Rechtschreibprüfung: Ihr seid meine ewigen Helden.
Karen: Ich hoffe, es bringt dich zum Lachen und macht dich stolz.
Meinen Lesern (allen dreien): Vielen Dank.
Kapitel 1
Auf der Toilette verlor ich die Nerven.
Ich saß gerade auf dem Klo und geriet in Panik, als ich den Friedhof leerer Klorollen bemerkte. Die braunen Röhrchen waren aufrecht hingestellt worden und bildeten einen Halbkreis auf der glatten, glänzenden Oberfläche des Klorollenhalters aus Edelstahl. Wie ein Recycle-Stonehenge in Miniatur, ein Denkmal zur Erinnerung an die Stuhlgänge vergangener Zeiten.
Es war gegen 14:30 Uhr, als mein Tag den Bereich des schlecht-wie-in-einem-Countrysongverließ und in das benachbarte Terrain von schlecht-wie-Tante-Ethels-jährlicher-Weihnachtsbriefüberging. Letztes Jahr hatte Tante Ethel mit aufrichtiger, unerschütterlicher Ehrlichkeit von Onkel Joes Gichtarthritis und ihrem einen oder eigentlich sogar zwei Autounfällen berichtet, von der neuen Sickergrube hinterm Haus, der drohenden Zwangsräumung aus dem Trailerpark und der Scheidung meiner Cousine Serena. Serena ließ sich eigentlich jedes Jahr scheiden, sodass dieser Punkt bei der unglückseligen Aufzählung ihrer Jahreskatastrophen nicht unbedingt ins Gewicht fiel.
Ich holte tief Luft und griff in den Klorollenhalter, um nach Toilettenpapier zu suchen, doch mit den Fingern ertastete ich nur eine weitere leere Rolle. Ich beugte mich in einer bemerkenswert heiklen Neigung nach vorn und versuchte, in die Tiefen des Behälters zu spähen, wobei ich hoffte, weiter oben doch noch eine bisher unbemerkte Rolle zu finden. Zu meiner großen Enttäuschung war der Halter leer.
»Scheiße«, flüsterte ich knurrend und musste lachen. Das passte einfach zu dieser Notlage. Mit bitterem Grinsen und zusammengebissenen Zähnen fielen mir wieder die drei Worte ein, die mir schon den ganzen Tag durch den Kopf gegangen waren:
Schlimmster. Tag. Überhaupt.
Es war, ohne jedes Wortspiel, ein extrem beschissener Tag.
Wie alle guten Countrysongs hatte er mit einem betrügerischen Trottel begonnen. Die »Betrogene« war dabei ganz offensichtlich niemand anderes als ich, und der Betrüger war mein langjähriger Freund Jon. Der verräterische Hinweis auf seine Untreue bestand aus einer leeren Kondompackung in der hinteren Hosentasche seiner Jeans, die ich entdeckt hatte, nachdem ich – als die pflichtbewusste blöde Freundin – beschlossen hatte, ihm eine Freude zu machen und seine Kleidung zusammen mit meiner zu waschen.
Ich erinnerte mich an die anschließende Diskussion, als ich ihm die Kondompackung an die Stirn geknallt hatte. Allerdings musste ich zugeben, dass Jon dabei nicht ganz unrecht hatte: War ich wütend darüber, dass er mich betrogen hatte, oder war ich eher enttäuscht, weil er ein solcher Dummkopf war und die Packung in die Tasche gesteckt hatte, nachdem er das Kondom herausgenommen hatte? Ich überlegte, was ich am Morgen gesagt hatte.
»Also wirklich, Jon, wer macht denn so was? Wer denkt sich: Ich werde meine Freundin betrügen, doch ich habe ein zu großes Umweltbewusstsein, als dass ich meine Kondompackung auf den Boden werfe – ich will doch nicht alles vollmüllen.«
Ich starrte auf die blau-weiße Resopaltür der Toilettenkabine, biss auf meiner Unterlippe herum, überdachte meine Optionen und fragte mich, ob ich den restlichen Tag in der Kabine bleiben konnte. Verdammt, in diesem Moment schien es eine ziemlich gute Option zu sein, für den Rest meines Lebens in der Kabine zu bleiben, denn eigentlich gab es keinen Ort, wo ich noch hingehen konnte.
Die Wohnung, die ich mir mit Jon geteilt hatte, gehörte seinen Eltern. Ich hatte darauf bestanden, meine Miete zu bezahlen, doch die jämmerlichen 500 Dollar plus der Hälfte der Nebenkosten deckten wahrscheinlich nicht mal ein Sechzehntel für diese zentral gelegene Etagenwohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern.
Ich glaube, irgendwo tief in mir hatte ich schon immer geahnt, dass er fremdging, denn sonst wäre es einfach zu schön gewesen, um wahr zu sein. Er schien all das zu verkörpern, was ich von einem Mann erwartete (und eigentlich noch immer wollte). Er war klug, witzig, süß, nett zu seiner Familie und sah auf eine sympathisch schusslige Weise gut aus. Außerdem hatten wir fast die gleichen politischen Ansichten, ideologischen Überzeugungen und Werte. Wir hatten sogar dieselbe Religion.
Er kam mit meinen Schrulligkeiten zurecht und fand mich sogar niedlich, wobei ich sonst eher als schräg bezeichnet wurde.
Er tat romantische Dinge und war ein altmodischer Verehrer in einer Zeit, wo das eigentlich längst out war. Im College schrieb er mir Gedichte, noch bevor wir miteinander ausgingen. Es waren schöne und zeitgemäße Gedichte, die sich auf meine Interessen bezogen und auf das gegenwärtige politische Klima. Sie waren herzerwärmend, ohne dass mir davon das Herz überging. Andererseits war ich auch nie ein Mädchen mit übergehendem Herzen gewesen.
Ein großer Unterschied bestand jedoch zwischen uns. Seine Familie war reich, verdammt reich. Von Anfang an war das wie ein Stachel in unserer Beziehung. Ich überlegte mir jede Ausgabe und überdachte pflichtbewusst mein monatliches Budget. Er dagegen kaufte sich alles, was er wollte und wann immer er es wollte.
Sosehr mir der Gedanke missfiel, so musste ich doch zugeben, dass ich ihm wahrscheinlich eine Menge verdankte. Ich fragte mich, ob er oder sein Dad – der mich immer dazu drängte, ihn Jeff zu nennen, obwohl ich mich besser damit fühlte, ihn weiterhin als Mr Holesome anzusprechen – die Finger im Spiel gehabt hatte, damit ich zu einem Vorstellungsgespräch für meinen jetzigen Job eingeladen wurde.
Selbst nach unserem Streit heute Morgen – der in unserer ganzen Beziehung am nächsten an etwas herankam, was diese Bezeichnung verdiente – hatte er mir gesagt, dass ich bleiben könnte, dass ich bleiben sollte, dass er gemeinsam mit mir eine Lösung finden wollte. Er meinte, er wollte sich weiter um mich kümmern und dass ich ihn brauchte. Ich hatte die Zähne zusammengebissen, das Kinn gereckt und war fest entschlossen geblieben.
Völlig ausgeschlossen, bei ihm zu bleiben.
Es war mir egal, wie klug, witzig oder wohlwollend er war. Es spielte auch keine Rolle, wie sicher ich mir bisher gewesen war, dass er der Richtige für mich sei, da er meine vielen Eigenarten akzeptierte. Und es war ebenfalls irrelevant, dass es sehr angenehm war, von der drückenden Last der Chicagoer Mieten befreit zu sein, sodass ich das verfügbare Geld für meine geliebten Cubs Tickets, Comics und Designerschuhe ausgeben konnte. Es war vollkommen ausgeschlossen, dass ich bei ihm blieb.
Auf gar keinen Fall!
Eine unangenehme Hitze, die ich schon den ganzen Tag unterdrückt hatte, breitete sich jetzt in mir aus und schnürte mir die Kehle zu. Die leere Klopapierrolle, die das Fass zum Überlaufen gebracht hatte, starrte mich aus ihrer Halterung an. Ich kämpfte mit dem unbändigen Bedürfnis, mich an ihr zu rächen, indem ich sie vom Halter zerrte und in Fetzen riss. Danach würde ich mich dem Stonehenge der Klopapierrollen widmen.
Ich sah es genau vor meinem inneren Auge: Der Sicherheitsdienst des Gebäudes wird gerufen, um mich aus der Damentoilette in der zweiundfünfzigsten Etage zu holen, um mich verstreut die Pappfetzen der zerstörten Klopapierrollen, mein Slip noch immer an den Knöcheln, während ich anklagend auf meine Arbeitskollegen zeige und schreie: »Das nächste Mal tauscht ihr die Klorolle aus! Tauscht einfach die Klorolle aus!«
Ich schloss die Augen. Streich das – meine Ex-Kollegen.
Die Kabinentür verschwamm, während sich meine Augen mit Tränen füllten. Zugleich drängte sich mir ein schrilles Lachen über die Lippen. Ich merkte, dass ich kurz davor war, mich in eine Irre zu verwandeln.
Während ich mich in Gedanken methodisch durch die Checkliste der bisherigen Geschehnisse arbeitete, stellte ich fest, dass sich die Tragödie dieses Tages wie bei einem Countrysong in einem sorgfältig ausgearbeiteten gleichmäßigen Rhythmus entfaltet hatte:
Kein Conditioner, was zu einer zerzausten, aufgebauschten, nestartigen Frisur führte: Check!
Am Gullygitter einen Absatz meiner neuen Schuhe abgebrochen: Check!
Der Bahnhof wegen unangekündigter Bauarbeiten geschlossen: Check!
Kontaktlinse verloren, als ich von der Menge angerempelt wurde, die aus dem Fahrstuhl drängte: Check!
Kaffee auf meiner besten weißen Lieblingsbluse verschüttet: Das kann ich wohl auch von der Bucket List streichen.
Und schließlich zum Chef gerufen werden und erfahren, dass die eigene Stelle weggekürzt wurde: Doppelcheck!
Genau deshalb hasste ich es, auf persönlichen Problemen herumzureiten. Genau deshalb war das Ignorieren und Umschiffen unverarbeiteter Gedanken und Gefühle so viel sicherer als die Alternative davon. Seit dem Tod meiner Mutter war ich nicht mehr in Selbstmitleid zerflossen – und ich meine, mich aus ganzem Herzen darin gesuhlt –, und kein Mann, kein Job und keine Aneinanderreihung beschissener Ereignisse würden mich jetzt dazu bringen. Schließlich hatte ich im Verlauf meines Lebens gelernt, damit umzugehen.
Zumindest musste ich mir das einreden.
Zunächst versuchte ich, mir die Feuchtigkeit aus den Augen zu blinzeln. Dann schloss ich sie jedoch und nutzte – mindestens zum dritten Mal an diesem Tag – die Bewältigungsstrategie, die ich während meines Pflichtjahres in Jugendpsychologie gelernt hatte.
Ich stellte mir vor, wie ich den Ärger und Schmerz und die wunden ausgefransten Ränder meiner Zurechnungsfähigkeit in ein großes, buntes Strandtuch einwickelte. Dann legte ich das Bündel in einen Karton und verschloss ihn. Den Karton stellte ich auf das oberste Regalbrett meines imaginären Wandschranks. Ich löschte das Licht im Schrank. Danach schloss ich die Schranktür.
Ich nahm der Situation die Emotionen, ohne der Realität aus dem Weg zu gehen.
Nach ein paar angestrengten Versuchen, die Tränen runterzuschlucken, gelang es mir schließlich, indem ich die drohende Verzweiflung unterdrückte und die Augen öffnete. Ich blickte an mir hinunter und betrachtete meine Aufmachung: geliehene rosa Flip-Flops, um das kaputte Paar Jimmy Choos zu ersetzen; knielanger grauer Rock, von Kaffeeflecken übersät; geliehenes, viel zu enges, tief ausgeschnittenes rotes Oberteil, als Ersatz für meine Lieblingsbluse; dazu mein wilder, ungeplanter Afro auf dem Kopf.
Ich schob die alte, schwarz gerahmte Brille – als Ersatz für die verlorene Kontaktlinse – auf der Nase hoch. Trotz meiner fragwürdigen Kleider(-nicht-)wahl fühlte ich mich jetzt etwas ruhiger und gefasster.
Während ich in der Kabine hockte, legte sich die Benommenheit wie ein willkommener kühler Abgrund über mich. Ich wusste, dass mein Toilettenpapierproblem überwindbar war. Fest entschlossen straffte ich die Schultern.
Alle anderen Probleme würden eben warten müssen. Sie würden kaum weggehen.
Als ich zu meinem Schreibtisch kam – Streich das, meinem Ex-Schreibtisch –, bemerkte ich die neugierigen Gesichter, die mit großen Augen um meine Arbeitsnische herumlungerten und verstohlen in meine Richtung blickten. Sie verharrten innerhalb eines angemessenen Radius: nahe genug, um mich in der peinlichen Situation gut beobachten zu können, doch zugleich weit genug entfernt, dass es noch als gesellschaftlich akzeptabel galt. Ich fragte mich, was ein solches Verhalten über meine Spezies aussagte. Gab es irgendwas Vergleichbares zwischen diesem Verhalten und dem Gebaren anderer Spezies im Tierreich?
Waren es Haifische, die um eine Blutspur kreisten? Bei dieser Analogie stellte ich mir vor, wie die Haie darauf warteten, sich an meinem Drama satt zu fressen, an meinem Entsetzen und meinem Unbehagen. Ich gab meiner ethnografischen Neugierde nach und betrachtete die wartende Gruppe eingehend, wobei ich die befürchtete Peinlichkeit über meinen Abgang gar nicht spürte. Während ich die Beobachter selbst beobachtete, suchte ich auf ihren Gesichtern nach irgendwelchen Hinweisen, da ich wissen wollte, was sie damit beabsichtigten.
Diese nüchterne Distanziertheit umgab mich wie ein schützender Mantel, den ich jetzt enger um mich zog.
Ich bemerkte nicht das Geräusch der näher kommenden Schritte hinter mir, und mir fiel auch nicht auf, dass es im ganzen Raum und den Arbeitsnischen still geworden war, bis mir zwei lange Finger sanft, aber entschieden auf die Schulter tippten. Entschlossen und etwas verwirrt drehte ich mich um und blickte von der Hand, die jetzt meinen Ellbogen hielt, an einem kräftigen Arm entlang, über die sperrige Schulter und einen kantigen Kiefer, bis mein Blick die atemberaubende Ansicht der durchdringenden blauen Augen von Sir McHotpants erreichte.
Ich zuckte zusammen.
Im Grunde war es ein Erschauern, gefolgt von einem Zusammenzucken. Und sein Name war auch nicht McHotpants. Seinen richtigen Namen wusste ich gar nicht, doch ich erkannte ihn als einen der Männer vom Sicherheitsdienst am Nachmittag – er war derjenige, den ich während der vergangenen fünf Wochen harmlos bewundert Schrägstrich gestalkt hatte.
Seinen Namen hatte ich bisher nicht zu erfahren versucht, denn ich hatte einen Freund, ganz zu schweigen davon, dass McHotpants in einer Liga spielte, die ungefähr zwanzigtausend Ligen von meiner eigenen entfernt war (zumindest, was das Aussehen betraf), und laut meiner Freundin Elizabeth wahrscheinlich sowieso schwul war. Elizabeth hatte mir einmal erzählt, dass Männer, die wie McHotpants aussahen, meist mit anderen Männern zusammen sein wollten, die aussahen wie McHotpants.
Wer konnte es ihnen verdenken?
Öfter, als mir lieb war, hatte ich darüber nachgedacht, dass er einer dieser Menschen war, die entschieden zu gut aussahen. Eine solche Perfektion durfte in der Natur gar nicht möglich sein. Dabei war es gar nicht so, dass er ein hübscher Typ war. Wenn er sich Fummel anziehen würde, dann würde er auch nicht besser aussehen als neunundneunzig Prozent der Frauen, die ich kannte.
Es war vielmehr so, dass einfach alles an ihm – von seinen konsequent perfekt zerzausten hellbraunen Haaren über seine erstaunlich kräftigen, kantigen Gesichtszüge bis hin zu seinem makellosen Mund – überwältigend perfekt war. Es tat mir in der Brust weh, ihn zu betrachten. Selbst seine Bewegungen waren mühelos und anmutig, wie bei jemandem, der sich in dieser Welt zu Hause fühlte und sich seines Platzes darin völlig sicher war.
Er erinnerte mich an einen Falken.
Ich dagegen bewegte mich zwischen Befangenheit und steriler Distanziertheit, und meine Anmut ähnelte der eines Vogelstrauß. Wenn ich nicht mit dem Kopf im Sand steckte, sahen mich die Leute an und dachten: Was für ein seltsamer Vogel!
Ich hatte mich in der Umgebung von wirklich umwerfenden Mitgliedern meiner Gattung nie besonders wohlgefühlt. Deshalb war ich während der letzten fünf Wochen natürlich nicht in der Lage gewesen, ihn anzublicken, und hatte mich immer weggedreht oder den Kopf gesenkt, bevor ich Gefahr lief, es zu tun. Der Gedanke daran war so, als würde man unmittelbar in etwas schmerzhaft Grelles blicken.
Deshalb hatte ich ihn wie ein wirklich erstaunliches Kunstwerk, das man nur auf Fotografien oder hinter Glas im Museum zu sehen bekommt, aus der Ferne bewundert. Meine Freundin Elizabeth und ich nannten ihn liebevoll McHotpants, genauer gesagt tauften wir ihn eines Abends auf Sir McHotpants, nachdem wir zu viele Mojitos getrunken hatten.
Als ich jetzt durch meine schwarz gerahmten Brillengläser in die unergründlichen Tiefen seiner blauen Augen blickte, musste ich mit meinen großen Augen blinzeln und spürte, wie der schützende Mantel der Benommenheit langsam von mir abrutschte. Ein ziehendes Gefühl, das direkt unter meiner linken Rippe entsprang, verwandelte sich in schwelende Hitze, die zu meinen Fingerspitzen ausstrahlte, mir dann den Hals hinaufwanderte, auf die Wangen und bis hinter meine Ohren.
Warum musste es Sir McHotpants sein? Warum hatten sie nicht Colonel schwarzer Schnauzer oder Lady Jelly O’Belly schicken können?
Er ließ die Hand sinken und räusperte sich, löste den Blick von mir und sah sich im Raum um. Ich spürte, wie ich plötzlich rot im Gesicht wurde, was ich noch gar nicht bei mir kannte, und senkte das Kinn auf die Brust, während ich innerlich über mich spottete.
Endlich war es mir peinlich.
In Gedanken machte ich eine Bilanz des Tages und meinen Reaktionen auf jedes Ereignis.
Ich wusste, dass ich bewusster am aktuellen Geschehen teilnehmen musste, ohne mich überwältigen zu lassen. Ich erkannte, dass ich angesichts einer Toilettenkabine ohne Klopapier oder der Anwesenheit eines umwerfenden männlichen Wachmanns mehr Verzweiflung empfinden konnte als bei der Erkenntnis, dass mich mein Freund betrogen hatte, was zu meinem gegenwärtigen Status der Obdachlosigkeit geführt hatte, ganz zu schweigen von meinem neuen Status der Arbeitslosigkeit.
Währenddessen schien sich Sir McHotpants mit meiner Umgebung und der Situation genauso unwohl zu fühlen, wie ich mich eigentlich fühlen sollte. Mit zusammengekniffenen Augen schweifte sein Blick über die wartende Menge. Er räusperte sich erneut, diesmal etwas lauter, und plötzlich wurde es im Raum lebendig mit befangenen Bewegungen und bewusst abgewandter Aufmerksamkeit der Anwesenden.
Nach einem weiteren angriffslustigen Blick durch den Raum wandte er mir seine Aufmerksamkeit zu, als wäre er mit dem Effekt zufrieden. Die umwerfenden blauen Augen begegneten meinem Blick, und sein Ausdruck schien milder zu werden, vermutlich aus Mitleid. Meines Wissens war es das erste Mal, dass er mich überhaupt direkt angesehen hatte.
Während der letzten fünf Wochen hatte ich ihn an jedem Arbeitstag beobachtet. Er war der Grund, weshalb ich mein Mittagessen später aß, da seine Schicht erst um halb zwei begann. Er war der Grund, weshalb ich jetzt immer in der Lobby aß. Er war der Grund, weshalb ich an den Tagen, wenn ich mich nach der Arbeit mit Elizabeth traf, ab siebzehn Uhr dreißig in der Lobby bei den Bäumen und dem Springbrunnen herumhing. Ich spähte dann zwischen den gedrungenen Baumstämmen und tropischen Palmen zu ihm hinüber, wobei ich genau wusste, dass meine Freundin nicht vor achtzehn Uhr in die Lobby kommen würde.
McHotpants und ich standen uns jetzt eine Weile unbehaglich gegenüber und betrachteten einander. Meine Wangen waren noch immer von dem vorherigen Erröten verfärbt, doch ich war darüber erstaunt, dass ich seinem Blick standhalten konnte, ohne mich abwenden zu müssen. Vielleicht kam es daher, dass ich bereits den Großteil meiner Gefühle in einen unsichtbaren Wandschrank in meinem Kopf gesperrt hatte. Vielleicht war es auch deshalb, weil ich erkannte, dass dies wahrscheinlich die Abenddämmerung unserer gemeinsamen Zeit sein würde, der letzte Stalker-Moment, da meine Berufstätigkeit gerade beendet worden war. Was auch immer der Grund dafür war, ich wollte nicht wegsehen. Schließlich legte er die Hände an seine schmalen Hüften und neigte das Kinn zu meinem Schreibtisch. Mit seiner tiefen rauen Stimme, die kaum lauter war als ein Flüstern, fragte er: »Brauchen Sie Hilfe?«
Ich schüttelte den Kopf, wobei ich mich wie eine verstummte Naturkatastrophe fühlte. Ich wusste, er war nicht hier, um mir zu helfen. Er war vielmehr gekommen, um mich aus dem Gebäude zu begleiten. Ich schnaubte und verschmähte sein Angebot, wild entschlossen, diesen Weg der Schande hinter mich zu bringen. Ich drehte mich um, schob die schwarz gerahmte Brille auf meiner leicht sommersprossigen Nase hoch und ging zu meinem Schreibtisch. Die geliehenen Flip-Flops machten bei jedem schnellen Schritt ein klatschendes Geräusch an meinen Fußsohlen: Flapp, flapp, flapp.
Meine privaten Sachen waren alle von jemandem aus der Personalabteilung in einen braun-weißen Karton gepackt worden, während ich wie befohlen in einem Konferenzzimmer gewartet hatte. Ich spähte auf den leeren Schreibtisch. Ich bemerkte die Stelle, auf der mein Stiftbecher gestanden hatte. Dort war jetzt ein von einem Staubring umgebener sauberer runder Fleck. Ich fragte mich, ob sie die Stifte herausgenommen und dann den Becher in den Karton getan hatten.
Ich schüttelte den Kopf über mein albernes, sinnloses Nachdenken und nahm den Karton, der tatsächlich die letzten zwei Jahre meiner beruflichen Bestrebungen enthielt, und ging ruhig an McHotpants vorbei zum Empfangsschalter und den Fahrstühlen dahinter. Ich sah ihn nicht an, wusste aber, dass er mir folgte, noch bevor er so nahe neben mir stehen blieb, dass sein Ellbogen meinen streifte, während ich den Karton gegen die Hüfte stemmte und mit einem Finger auf den Fahrstuhlknopf drückte.
Es kam mir vor, als spürte ich seine interessierten Blicke an meinem Profil, ich drehte mich aber nicht zu ihm. Stattdessen betrachtete ich die roten Ziffern, die die aktuelle Etage der einzelnen Fahrstühle anzeigten.
»Soll ich das tragen?« Seine tiefe Stimme, fast wie ein Flüstern, erklang von rechts.
Ich schüttelte den Kopf und blickte verstohlen zur Seite, ohne mich umzudrehen. Da waren ungefähr vier weitere Personen neben uns, die auch auf den Aufzug warteten.
»Nein danke. Es ist nicht so schwer. Offenbar haben sie die Stifte rausgenommen.« Erleichtert bemerkte ich den neutralen, gleichförmigen Tonfall meiner Stimme.
Es vergingen ein paar Augenblicke, die meinem Verstand eine gefährliche Menge freier Zeit zum Nachdenken gaben. Meine Konzentrationsfähigkeit nahm ab. Das war bei mir ein häufig auftretendes Problem. Zeit zum Nachdenken wirkte nie zu meinen Gunsten, vor allem dann nicht, wenn ich nervös war.
Ich hatte gehört, dass die meisten Menschen in stressigen Situationen dazu neigten, sich wie besessen mit den gegenwärtigen Umständen zu beschäftigen. Sie fragen sich, wie sie in die aktuelle Lage geraten waren, und ringen damit, was sie tun können, um diese oder ähnliche Situationen in der Zukunft zu vermeiden.
Bei mir war es anders: Je stressiger eine Situation für mich war, desto weniger dachte ich darüber oder über die damit in Verbindung stehenden Dinge nach.
Im Augenblick überlegte ich mir, dass Aufzüge wie mechanische Pferde waren, und ich fragte mich, ob sie irgendwer liebte oder ihnen einen Namen gab. Ich überlegte mir, welche Maßnahmen ich ergreifen konnte, um die Worte »Feuchtigkeit« und »feucht« aus der englischen Sprache zu entfernen, da ich ihren Klang hasste und es darum grundsätzlich vermied, sie auszusprechen. Genauso wenig mochte ich das Wort »Buxe«, doch kürzlich hatte ich mich bestätigt gefühlt, als die Organisation Mensa eine offizielle Erklärung gegen dieses schreckliche Wort abgegeben und vorgeschlagen hatte, es aus der Umgangssprache zu entfernen.
Sir McHotpants räusperte sich erneut und unterbrach mein Nachdenken über schrecklich klingende Worte. Einer der Fahrstühle war aufgegangen, der rote Pfeil darüber zeigte nach unten, und ich stand noch immer reglos da, verloren in Gedanken und völlig ahnungslos. Es war noch niemand in den Fahrstuhl gestiegen, und ich spürte, dass mich alle ansahen.
Ich schüttelte mich leicht, um wieder zurück in die Gegenwart zu gelangen. Ich spürte die Hand von McHotpants an meinem Rücken, mit der er mich mit sanftem Druck vorwärtsschob. Die Wärme seiner Handfläche war wohltuend, doch sie jagte mir auch einen beunruhigenden Elektroschock durch die Wirbelsäule. Er legte die andere Hand an die Stelle, wo die Schiebetür in die Wand geglitten war, und hielt den Fahrstuhl für mich auf.
Ich löste mich schnell aus seiner Berührung und stellte mich im Fahrstuhl in die Ecke. Sir Sexy folgte mir, blieb jedoch vorn im Fahrstuhl stehen und versperrte den Eingang. Er drückte den Türschließer, bevor noch jemand anderes eintreten konnte. Die Schiebetüren glitten zusammen, und wir waren allein. Er nahm einen Schlüssel an einem Gummiband von seinem Gürtel und steckte ihn in eine Öffnung am Bedienfeld in der Wand des Aufzugs. Ich sah zu, wie er auf einen mit BB gekennzeichneten Knopf drückte.
Ich runzelte die Stirn und fragte: »Fahren wir in den Keller?«
Er gab kein Zeichen der Bestätigung, als er sich zu mir wandte und mich unverwandt ansah. Wir standen uns in den Ecken gegenüber. Für einen Moment stellte ich mir vor, dass wir zwei Preisboxer wären, der geräumige Aufzug war unser Ring und die Messinggeländer am Rand die Seile. Mein Blick wanderte in gleichermaßen unverhohlener Begutachtung zu ihm. Er würde sicherlich gewinnen, wenn es zu einem Schlagabtausch käme.
Ich war recht groß für eine Frau, doch er war bestimmt einen Meter neunzig oder sogar dreiundneunzig groß. Außerdem hatte ich seit meiner Fußballzeit auf dem College nicht mehr ernsthaft oder anhaltend Sport getrieben. Wenn man von seiner Schulterbreite ausgehen konnte, dann wirkte er dagegen wie jemand, der keinen Tag im Fitnessstudio verpasste und der mich sicher mitsamt meinem Karton beim Bankdrücken stemmen könnte, selbst wenn die Stifte noch drin wären.
Er war mit seiner Begutachtung noch nicht fertig, und sein Blick verweilte an meinem Hals. Das ziehende Gefühl unter der linken Rippe kehrte zurück. Ich merkte, wie ich wieder errötete.
Ich versuchte es mit Konversation. »Ich wollte nicht unpräzise sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Gebäude mehr als einen Keller hat, ohne dass ich die Baupläne gesehen hätte. Fahren wir zu einem der Keller, und wenn dem so sein sollte: Warum fahren wir zu einem der Keller?«
Er erwiderte meinen Blick, ohne dass man daraus etwas lesen konnte.
»Standardprozedur«, murmelte er.
»Ach so.« Ich seufzte und kaute wieder an meiner Lippe. Natürlich gab es eine Standardprozedur. Für ihn war das wahrscheinlich ein ganz gewöhnlicher Vorgang. Ich fragte mich, ob ich die einzige Ex-Angestellte war, die er heute begleitete.
»Wie oft haben Sie das schon gemacht?«, fragte ich.
»Was?«
»Sie wissen schon, Leute aus dem Gebäude zu begleiten, nachdem sie wegrationalisiert wurden. Passiert das an jedem Wochentag? Entlassungen finden gewöhnlich freitagnachmittags statt, um die Verrückten davon abzuhalten, in derselben Woche wieder zurückzukommen. Heute ist Dienstag, deshalb können Sie sich vorstellen, wie überrascht ich war. Basierend auf dem internationalen Standard, der in den meisten westlichen Ländern übernommen wurde, ist Dienstag der zweite Tag der Woche. In Ländern, wo die Konvention den Sonntag als ersten Tag hat, wird der Dienstag als dritter Tag der Woche angesehen.«
Halt den Mund, halt den Mund, halt den Mund!
Ich sog tief die Luft ein, klappte den Mund zu und presste meine Lippen zusammen, um mich vom Reden abzuhalten. Ich betrachtete ihn, wie er mich betrachtete, wobei seine Augen etwas kleiner wurden, und mein Herz pochte mit lauter Aufrichtigkeit in meiner Brust in Anbetracht dessen, was ich – zum zweiten Mal an diesem Tag – als Beschämung erkannte.
Ich wusste genau, wie ich mich anhörte. Meine echten Freunde schwächten ihre Beschreibung immer ein wenig ab, indem sie darauf bestanden, dass ich einfach nur sehr belesen war. Alle anderen sagten dagegen, dass ich völlig gaga sei. Auch wenn ich wiederholt dazu gedrängt wurde, bei Wer wird Millionär? vorzusprechen, und auch wenn ich ein idealer und bewährter Partner bei Spielabenden mit Trivial Pursuit war, halfen mir mein Streben nach trivialem Wissen und die Lawine verbalen Blödsinns, die ich ungeprüft von mir gab, wenig dabei, bei Männern das Richtige zu sagen.
Es verging ein stiller Moment, und zum ersten Mal versuchte ich nicht, meine Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zu richten. Der Blick aus seinen blauen Augen durchbohrte mich mit einer beunruhigenden Intensität und hielt die übliche Wanderlust meines Verstands im Zaum. Es kam mir so vor, als hätte er einen Mundwinkel nach oben gezogen, obwohl die Bewegung kaum wahrnehmbar war.
Schließlich brach er das Schweigen. »Internationale Standards?«
»ISO 8601, Datumsformate und Zeitangaben. Es erlaubt den nahtlosen Verkehr zwischen verschiedenen Körperschaften, Regierungen, Agenturen und Unternehmen.« Ich konnte es nicht verhindern, dass die Worte aus mir herauspurzelten. Es war eine Krankheit.
Dann lächelte er. Es war ein kleines schmallippiges, schnell unterdrücktes Lächeln. Wenn ich geblinzelt hätte, dann hätte ich es womöglich verpasst, doch ein Ausdruck von Interesse blieb. Er lehnte sich mit seinem großen Körper gegen die Rückwand des Aufzugs und verschränkte die Arme vor der Brust. Die Ärmel seiner Wachuniform zogen sich in strammen Linien über seine Schultern.
»Erzählen Sie mir von diesem nahtlosen Verkehr.« Sein Blick wanderte langsam nach unten, dann kam er in derselben Geschwindigkeit wieder hoch und begegnete meinem.
Ich öffnete den Mund, um ihm zu antworten, schloss ihn dann jedoch gleich wieder. Mir war plötzlich und unerwartet heiß.
Seine geheimnisvolle, zugleich offene und amüsierte Begutachtung meiner Körpermerkmale ließ mich langsam glauben, dass er genauso schräg war wie ich. Er war der Grund, weshalb mir sehr unbehaglich zumute war, seine Aufmerksamkeit wie ein blendender Scheinwerfer, dem ich nicht entkommen konnte.
Ich schob mir den Karton auf die andere Hüfte und schaute weg. Ich wusste jetzt, dass ich gut daran getan hatte, den direkten Augenkontakt zu vermeiden. Die Gepflogenheit und Akzeptanz von Augenkontakt variierte stark in Abhängigkeit von der Kultur. In Japan zum Beispiel, wo Schulkinder …
Der Aufzug blieb stehen, und die Türen öffneten sich, was mich aus meinem Nachdenken über japanische Kulturnormen riss. Ich eilte sofort in Richtung Aufzugtür, bevor ich mir bewusst wurde, dass ich gar nicht wusste, wo ich hingehen sollte. Ich drehte mich stumm um und spähte durch meine Wimpern zu Sir Sexy.
Erneut legte er die Hand an meinen unteren Rücken und lenkte mich. Ich verspürte denselben Stromschlag wie zuvor. Wir gingen einen Flur entlang, der in einem unscheinbaren Beige-Grau gestrichen und mit niedrig hängenden Neonleuchten versehen war.
Das Flapp, Flapp, Flapp meiner Flip-Flops hallte durch den verlassenen Gang. Als ich meine Schritte beschleunigte, um der Elektrizität seiner Berührung zu entkommen, beeilte er sich auch, sodass der feste Druck blieb. Ich fragte mich, ob er glaubte, dass bei mir Fluchtgefahr bestand, oder ob er mich nur für einen der zuvor erwähnten Verrückten hielt.
Wir gingen an ein paar Räumen vorbei, und ich erstarrte innerlich, als seine Hand zu meinem nackten Oberarm wanderte. Ich musste schlucken, da mir meine Reaktion auf diesen simplen Kontakt einfach lächerlich vorkam. Schließlich war es nur seine Hand an meinem Arm.
Er zog mich in einen der Räume und geleitete mich zu einem braunen Holzstuhl. Mit einem Anflug autoritärer Entschiedenheit nahm er mir den Karton aus den Händen und stellte ihn auf den Sitz zu meiner Linken. In dem Raum befanden sich Leute in Arbeitsnischen, und in der Mitte stand ein großer Empfangstisch, dahinter eine Frau in derselben blauen Wachuniform, wie McHotpants sie trug, die mich anschaute. Ich erwiderte ihren Blick. Sie blinzelte einmal, dann runzelte sie die Stirn.
»Nicht bewegen. Warten Sie hier auf mich«, befahl er.
Interessiert beobachtete ich, wie er zu der Frau ging und sich mit ihr austauschte. Bei seiner Ankunft erstarrte sie und erhob sich. Dann beugte er sich über den Schreibtisch und zeigte etwas auf dem Computerbildschirm. Sie nickte und sah erneut zu mir, wobei sie die Augenbrauen nach oben zog, was ich als Irritation interpretierte, dann setzte sie sich wieder und begann zu tippen.
Er drehte sich um, und ich machte den Fehler, ihn erneut direkt anzublicken. Für einen Moment hielt er inne, und dieselbe beunruhigende Beharrlichkeit in seinem Blick verursachte dieselbe Hitze, die mir in die Wangen stieg. Am liebsten hätte ich die Hände vors Gesicht gelegt, um mein Erröten zu verbergen. Er kam durch den Raum in meine Richtung, wurde jedoch von einem älteren Mann in einem gut geschnittenen Anzug aufgehalten, der ein Klemmbrett bei sich hatte. Ihren Wortwechsel beobachtete ich ebenso interessiert.
Nachdem die Frau ein paar Seiten aus dem Drucker gezogen hatte, kam sie zu mir. Dabei lächelte sie mich mit geschlossenem Mund an, und es wirkte sogar echt.
Ich stand auf, und sie streckte mir die Hand entgegen. »Ich bin Joy. Sie müssen Ms Morris sein.«
Ich nickte kurz und schob mir eine widerspenstige Haarsträhne hinter das Ohr. »Ja, aber nennen Sie mich bitte Janie. Es freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Ich kann mir denken, dass Sie einen schweren Tag hinter sich haben.« Joy nahm sich den leeren Platz neben mir. Sie wartete nicht darauf, dass ich antwortete. »Keine Sorge, Honey. Das geschieht den Besten von uns. Sie müssen nur diese Papiere unterschreiben. Ich brauche Ihr Namensschild und die Schlüssel, und dann holen wir den Wagen für Sie.«
»Äh … den Wagen?«
»Ja, er bringt Sie dahin, wohin Sie wollen.«
»Ach so, okay.« Ich war überrascht, dass man ein Auto bereitstellte, wollte aber auch keine große Sache daraus machen.
Ich nahm den Stift, den sie mir entgegenhielt, und überflog die Papiere. Sie schienen harmlos zu sein. Ich riskierte einen Blick in Richtung Sir Sexy und stellte fest, dass er mich beobachtete, während er dem Mann im Anzug zuzuhören schien. Ohne den Text wirklich zu lesen, unterschrieb ich an den Stellen, die sie mir zeigte, zog mir das Band mit meinem Namensschild und dem Schlüssel über den Kopf und reichte es ihr. Sie nahm die Papiere entgegen und unterschrieb an verschiedenen Stellen neben meinem Namen.
Sie hielt inne, als sie zu dem Adressfeld des Formulars kam. »Ist das Ihre gegenwärtige Adresse und Telefonnummer?«
Ich sah, dass ich bei meiner Anstellung Jons Adresse angegeben hatte. Ich verzog das Gesicht. »Nein, das ist sie nicht. Warum?«
»Die Firma braucht eine Adresse, um Ihren letzten Gehaltsscheck zu schicken. Wir brauchen auch eine aktuelle Adresse, falls sie Ihnen irgendwas schicken müssen, was womöglich zurückgelassen wurde. Könnten Sie mir daneben Ihre aktuelle Adresse aufschreiben?«
Ich zögerte. Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. »Es tut mir leid, ich …« Ich schluckte angestrengt und betrachtete eingehend die Seite. »Ich bin nur gerade, äh, ich bin beim Umzug. Gibt es die Möglichkeit, dass ich wegen der neuen Adresse zurückrufe?«
»Wie steht es denn mit einer Handynummer?«
Ich biss die Zähne zusammen. »Ich habe kein Handy. Ich glaube da nicht dran.«
Joy runzelte die Stirn. »Sie glauben nicht daran?«
Ich wollte ihr erklären, wie sehr ich Handys verabscheute. Ich hasste es, mich ihretwegen rund um die Uhr verfügbar zu fühlen. Es war genauso, als hätte man dir einen Chip ins Gehirn eingepflanzt, der deinen Standort verfolgte und dir sagte, was du zu denken und zu tun hast, bis du schließlich von dem kleinen Touchscreen vollkommen besessen bist als der einzigen Verbindung zwischen dir und der echten Welt.
Existierte die echte Welt überhaupt, wenn alle nur noch per Handy interagierten? Würde Angry Birds eines Tages zu meiner Wirklichkeit werden? War ich das ahnungslose Schweinchen oder der explodierende Vogel? Diese auf Descartes basierenden Überlegungen machten mich auf Partys nur selten beliebt. Vielleicht las ich einfach zu viel Science-Fiction und zu viele Comics, doch Handys erinnerten mich irgendwie an die Gehirnimplantate im Roman Neuromancer. Als weiteren Beleg hätte ich ihr auch gern von dem neulich erschienenen Artikel in Unfallbewertung & -verhütung über riskantes Fahrverhalten berichtet.
Stattdessen sagte ich nur: »Ich glaube nicht an sie.«
»Äh, okaaaayyy«, sagte sie langsam. »Kein Problem.« Joy griff in ihre Brusttasche und zog ein weißes Kärtchen heraus. »Hier ist meine Karte. Rufen Sie einfach an, wenn Sie das erledigt haben, und ich trage die Daten dann ins System ein.«
Ich stand mit ihr auf und nahm die Karte entgegen, wobei sich die spitzen Ecken in meine Daumen- und Zeigefingerspitzen drückten. »Vielen Dank. So werde ich es machen.«
Joy nahm sich den Karton, dann bedeutete sie mir mit einer Schulterbewegung, dass ich ihr folgen sollte. »Kommen Sie. Ich bringe Sie zum Wagen.«
Ich folgte ihr, erlaubte mir aber wie ein unartiges Kind einen zögernden Blick über die Schulter zu Sir Sexy McHotpants. Er war mir seitlich zugedreht, spähte nicht länger mit diesem verwirrenden Blick in meine Richtung, da seine Aufmerksamkeit jetzt vollständig auf den Mann im Anzug gerichtet war.
Ich war zugleich erleichtert und enttäuscht. Wahrscheinlich war dies das letzte Mal, dass ich ihn sah. Ich freute mich darüber, ihn noch ein Mal bewundern zu können, ohne die blendende Intensität seiner blauen Augen. Doch ein wenig fehlten mir auch das erhitzte Ziehen in der Brust und das intensive Gefühl, das ich verspürt hatte, als sich unsere Blicke begegneten.
Kapitel 2
Das Auto war eine Limo.
Ich hatte noch nie zuvor in einer Limo gesessen, deshalb stand ich natürlich die ersten paar Minuten unter Schock, spielte die nächsten paar Minuten an allen Knöpfen herum und verbrachte die darauffolgenden paar Minuten damit, alles wieder aufzuwischen, was ich mit einer explodierenden Wasserflasche verursacht hatte. Sie war mir aus der Hand gerutscht, als der Fahrer wegen eines Taxis plötzlich auf die Bremse treten musste.
Der Fahrer fragte mich, wohin ich wollte. Zunächst wollte ich eigentlich »Las Vegas« sagen, doch ich hatte den Eindruck, dass das nicht so gut ankommen würde. Doch schließlich war er gnädigerweise damit einverstanden, mich ein wenig herumzufahren, während ich ein paar Anrufe über das Autotelefon tätigte. Eins der guten Dinge – oder auch weniger guten, je nach Perspektive –, wenn man kein Handy hat, war die Tatsache, dass man sich alle Telefonnummern merken musste.
Außerdem hielt es einen davon ab, bedeutungslose Bekanntschaften zu schließen.
Für die meisten Menschen war es fast unmöglich, sich eine Telefonnummer zu merken, außer sie benutzten sie regelmäßig. Mobiltelefone und die anderen Social-Media-Instrumente unserer Zeit verstärkten das Sammeln sogenannter Freunde und Kontakte, wie meine Großmutter Teetassen gesammelt hatte, um sie in ihrer Vitrine auszustellen. Nur heute war die Teetasse durch Personen und die Porzellanvitrine durch Facebook ersetzt worden.
Der erste Anruf galt meinem Dad. Ich hinterließ ihm eine Nachricht, in der ich ihn darum bat, nicht bei Jons Wohnung anzurufen oder eine Nachricht zu hinterlassen, wobei ich ganz knapp erklärte, dass wir uns getrennt hatten. Im Rückblick war der Anruf bei meinem Vater eher oberflächlich und nicht so lebenswichtig. Er rief nie an und schrieb auch nie, außer, um mir Mails weiterzuleiten. Dennoch wollte ich ihn wissen lassen, wo ich war und dass es mir gut ging.
Der nächste Anruf ging an Elizabeth. Zum Glück war sie gerade in der Pause, als ich anrief. Das war ein echter Glückstreffer, da sie Assistenzärztin in der Notaufnahme im Chicago General Hospital war. So konnte ich ihr die entscheidenden Fakten mitteilen: Jon hatte mich betrogen, ich war obdachlos, musste mir Conditioner für die Haare kaufen, hatte die Arbeit verloren.
Sie war empört über Jon, bot mir großzügig ihre Wohnung und ihren Conditioner an und äußerte bestürztes Mitleid wegen meines Jobs. Sie hatte eine nette Wohnung im Norden Chicagos, zu klein für einen längeren Zeitraum, doch groß genug, dass ich nicht nach drei Tagen wie eine Sardine stinken würde.
Ich war erleichtert, als sie mir sofort beteuerte, dass ich in ihrer Wohnung bleiben könnte, da ich ehrlich gesagt gar keinen Alternativplan hatte. Elizabeth erwähnte auch, dass sie ohnehin oft dazu gezwungen war, im Krankenhaus zu übernachten, weshalb ich wahrscheinlich öfter in der Wohnung sein würde als sie.
Wir beschlossen dann die nächsten Schritte: Ich würde bei Jon vorbeifahren, mir schnell das Nötigste einpacken und dann zu ihr kommen. In der nächsten Woche würde ich noch einmal zu Jon fahren, um alles andere abzuholen. Ich hatte ausreichend Zeit, da die Beschränkungen des Arbeitsalltags für mich im Augenblick wenig Bedeutung hatten.
Ich zögerte, den Fahrer zu bitten, auf mich zu warten, während ich eine Tasche packte, doch am Ende musste ich das gar nicht. Er hatte das Gespräch mitbekommen und bot mir an, nach zwei Stunden zurückzukehren.
Beim Packen war ich über das bescheidene Ausmaß meiner materiellen Besitztümer überrascht. Drei Kartons und drei Koffer waren alles, um meine gesamten weltlichen Güter einzusammeln. Ein Koffer – der größte – war voller Schuhe. Ein Karton – der größte – war voller Comichefte. Dazu noch der braun-weiße Karton von der Arbeit, das war die Gesamtsumme meines Lebens.
Als ich schließlich ein paar Stunden später bei Elizabeths Wohnung ankam, half mir der Limofahrer – sein Name war Vincent, er hatte vierzehn Enkelkinder und kam ursprünglich aus Queens –, meine Sachen die zwei Etagen zur Wohnung hinaufzutragen.
Elizabeth empfing uns an der Wohnungstür und half Vincent mit den Koffern. Sie wechselte dabei fließend zwischen Freundlichkeiten und lautstarken Flüchen ab.
Als wir den letzten Karton aus dem Fahrzeug geholt hatten, überraschte mich Vincent damit, dass er meine Hand nahm und mir einen Kuss auf die Handrückenseite drückte. Er blickte mich aus seinen dunkelbraunen Augen an und sprach mit dem wissenden Unterton der Erfahrung: »Wenn ich jemals meine Frau betrügen würde, dann würde sie mir die Eier abschneiden. Wenn Sie diesen Kerl nicht dafür kastrieren wollen, was er Ihnen angetan hat, dann ist er wohl nicht der Richtige.« Er nickte, wie zur Bestätigung seiner Worte, und drehte sich abrupt zur Fahrertür.
Dann ließ er uns wie am Ende eines B-Movies am Straßenrand stehen und der Limousine hinterhersehen, wie sie in den Sonnenuntergang tauchte.
An jenem Abend erzählte Elizabeth diese Geschichte noch viele Male unserer Strickgruppe. Sie war als Gastgeberin an der Reihe, und ich hatte ihr dabei geholfen, Snacks und Rotwein zu besorgen. Bei jeder neuen Wiedergabe wurde Vincent jünger, größer, muskulöser, und sein Haar wurde dichter. Sein Queens-Akzent wurde durch einen sinnlichen sizilianischen Zungenschlag ersetzt, seine schwarze Jacke verschwand, bis schließlich nur noch ein hauchdünnes weißes Hemd übrig blieb, das bis zur Mitte der Brust geöffnet war.
Bei ihrer letzten Erzählung blickte er verlangend in meine Augen und bat mich, mit ihm wegzulaufen. Ich erwiderte natürlich, dass er für mich kastriert nutzlos wäre.
Es störte mich nicht, dass Elizabeth den anderen so freimütig von meinem Tag erzählte. Für mich war es unsere Strickgruppe, auch wenn ich keine einzige Masche stricken konnte. Ich fühlte mich ihnen näher als meinen eigenen Schwestern, und zwar aus zwei einfachen Gründen: Keine von ihnen war eine Schwerverbrecherin (soweit ich das wusste), und ich genoss ihre Gesellschaft von ganzem Herzen.
Ich liebte es, wie offen und mitfühlend und vorurteilsfrei sie waren. Es ist etwas Besonderes, wenn Frauen unzählige Stunden damit verbringen, mit irrsinnig teurem Garn einen Pullover zu stricken, den sie sich zu einem Bruchteil des Preises auch einfach kaufen könnten – ganz zu schweigen von der Zeit, die sie damit sparen würden –, was von ganz allein zu Akzeptanz und Geduld gegenüber dem menschlichen Befinden führte.
»Wer steckt denn die Kondomverpackung zurück in die Hosentasche? Ich meine, hallo, Mister Vollpfosten!« Sandra, eine quirlige Rothaarige mit einem meist versteckten texanischen Tonfall, schürzte die Lippen und hob erwartungsvoll die Augenbrauen, während sie sich umsah. Sie war Psychiatrie-Assistenzärztin im Chicago General und sprach von sich selbst am liebsten als Dr. Psycho.
»Ganz genau.« Ich fühlte mich ein wenig bestätigt, deshalb nickte ich, wie auch alle anderen im Raum.
»Ich finde, ohne ihn bist du sowieso viel besser dran.« Ashley ließ den Schal zwischen ihren Stricknadeln nicht aus den blauen Augen, während sie ihre Gedanken kundtat. Sie hatte ihr langes, glattes braunes Haar zu einem raffinierten Zopf gebunden. Sie war Krankenschwester und kam ursprünglich aus Tennessee, und ich liebte ihren Akzent. »Ich würde niemals einem Jon ohne h im Namen trauen. John sollte J-o-h-n geschrieben werden, und nicht J-o-n.«
Sandra zeigte auf Ashley und fügte hinzu: »Und sein Nachname: Holesome. Er sollte Assholesome heißen, oder Unholdsome. Er ist ein Mistkerl.«
»Ich finde, wir sollten Janie fragen, wie sie sich wegen der Trennung fühlt.« Fionas pragmatische Feststellung wurde zustimmend aufgenommen. Fiona war von ihrer Ausbildung Maschinenbau-Ingenieurin, hatte sich aber für das Dasein als Hausfrau und Mutter entschieden und war eigentlich die Anführerin der Gruppe, die jedem das Gefühl von Wertschätzung und Geborgenheit gab. Sie besaß eine autoritäre Präsenz, obwohl sie nur etwas über eins zweiundfünfzig groß war. Mit ihren großen, lang bewimperten Augen, die perfekt in ihrem kleinen spitzbübischen Gesicht saßen, das von einem praktischen Kurzhaarschnitt gekrönt wurde, wirkte sie wie eine Fee. Elizabeth und ich kannten sie vom College, sie war die Betreuerin im Wohnheim unseres ersten Jahrs gewesen, schon immer ein wenig Mutterglucke.
Ich zuckte mit den Schultern, als sich alle Blicke auf mich richteten. »Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich darüber gar nicht so böse, sondern einfach nur … genervt.«
Marie sah mich über ihrem halb gestrickten Pulli scharf an. »Du wirktest aber recht mitgenommen, als ich ankam.« Ich sah ihr in die großen blauen Augen, bevor sie fortfuhr: »Ich glaube, dass du wegen der Sache mit Jon und dem Jobverlust aufgebrachter bist, als du es zugeben willst.« Marie war freie Autorin und Künstlerin. Ich beneidete sie darum, dass sich ihre blonden Locken immer zu benehmen schienen. Wann immer ich sie traf, sah sie aus, als hätte sie gerade einen Shampoo-Reklamespot gedreht.
Ich seufzte. »Das ist es nicht. Ich meine, na klar – ich wünschte, ich hätte meinen Job nicht verloren, denn jetzt muss ich mir einen neuen suchen. Doch es ist auch nicht so, dass ich dort wirklich das machen konnte, was ich eigentlich wollte. Ich habe studiert, um als Architektin und nicht als Buchhalterin bei einer Architekturfirma zu arbeiten.«
»Immerhin eine Anstellung bei einer Firma. Feste Jobs sind selten geworden.« Kat, die von der Gruppe am leisesten sprach, schüttelte ihren Kopf voller brauner Locken. Ich hatte Kat Elizabeth vorgestellt, als ich ihre Leidenschaft für das Stricken entdeckte. Kat arbeitete auch in meiner Firma – Streich das, Ex-Firma –, und zwar als Assistentin der Geschäftsführung für zwei der Partner. »Doch sie werden dich vermissen, Janie. Du warst mit Abstand die Fähigste des ganzen Unternehmens.«
»Geben sie ihren entlassenen Angestellten eigentlich immer eine Limo für den Nachmittag?«, fragte Ashley Kat aus reinem Interesse.
»Nicht, dass ich je davon gehört hätte. Doch Entlassungen geschehen immer in Gruppen von fünf oder mehr Angestellten.« Kat kräuselte die Nase. »Das ist wirklich seltsam. Ich werde es mir mal ansehen.«
Ich hatte mich ebenfalls über die Limo gewundert. Doch der ganze Tag grenzte ans Absurde, deshalb schienen mir im Vergleich dazu die Limo und Vincent wie ein winziger Hüpfer auf meiner Achterbahn der Gefühle.
»Hast du irgendeine Idee, warum sie das gemacht haben – warum sie sie entlassen haben?« Sandra griff nach ihrem Rotwein, während sie die Frage sowohl an Kat als auch an mich richtete.
»Nein, aber ich werde sehen, was ich herausfinden kann.« Kat zog die Augenbrauen hoch und warf mir einen irgendwie argwöhnischen Blick zu. »Obwohl ich gehört habe, dass du von einem der Wachmänner von unten begleitet wurdest. Stimmt das?«
Ich nickte und fühlte mich unbehaglich, weshalb ich mein Weinglas mit verstärktem Interesse betrachtete.
»Warte, was? Security?« Elizabeth setzte sich auf und legte mir eine Hand an den Arm. »Wer war es denn?«
Ich trank einen Schluck Wein und hob die Schultern zu einem unentschiedenen Achselzucken. »Ach, nur einer der Wachmänner.«
Im Raum war es still, während ich tiefer in die Couch zu sinken versuchte. Elizabeth warf ihr Strickzeug zur Seite und hüpfte aufgeregt auf und ab. »Oh … mein … Gott! Er war es, oder? Es war ER!« Ihr blonder Pferdeschwanz schwang vor und zurück.
»Wer ist ER?« Sandra hörte zu stricken auf und verschränkte die Arme vor der Brust, während sie von Elizabeth zu mir und dann zu Kat blickte, wobei der Blick ihrer großen grünen Augen wie ein Tischtennisball durch den Raum hüpfte.
Elizabeth stand abrupt auf und lief in die Küche. »Moment! Ich habe ein Bild!«
Ich riss die Augen auf, während ich hinter ihr hersah. »Was meinst du damit, du hast ein Bild?«
Alle hörten plötzlich auf zu stricken. Beim letzten Mal, als alle mitten in der Reihe zu stricken aufgehört hatten, war ein gut aussehender Pizzabote aufgetaucht, und alle wollten ihm Trinkgeld geben. Diesmal fingen alle gleichzeitig zu reden an, doch ihr Geschnatter versiegte, als Elizabeth mit ihrem Telefon zurück in den Raum kaum und sich neben mir aufs Sofa fallen ließ.
»Ich habe ihn ein paarmal gekinneart«, sagte Elizabeth, während sie durch die Fotos auf ihrem Handy wischte. Sie blickte hoch und sah in unsere stummen, ausdruckslosen Gesichter und hob eine Augenbraue. »Ihr wisst schon, >Kinnearn<: Verstohlen ein heimliches Foto von jemandem machen, ohne dass der es bemerkt. Hallo? Lest ihr denn alle gar nicht den Blog von Yarn Harlot?«
»Ach doch, davon habe ich gehört. Hat das nicht Yarn Harlot mit Greg Kinnear am Flughafen oder so gemacht?« Ashley legte ihr Strickzeug in den Schoß und zeigte auf Elizabeth.
»Ja klar. Sie hat auf ihrem Blog darüber geschrieben, dann kam es ins Slang-Lexikon und wurde im Jahresrückblick der New York Times oder so erwähnt.« Elizabeth drehte sich zu mir und blickte von meinem offenen Mund zu meinen Augen. »Ach, jetzt guck doch nicht so schockiert.«
»Ich will immer noch wissen, wer ERist.« Sandra stand auf und beugte sich über Elizabeths Schulter, während sie bei dem ersten einer Reihe von Bildern von Sir Sexy McHotpants verweilte. Ich nahm noch einen Schluck Wein. Alle Frauen sammelten sich um die Couch, während Elizabeth mit ihrem Daumen über den Touchscreen des Handys strich. Nur Fiona blieb sitzen und wartete darauf, dass das Drama vorbeiging.
Die ganze Gruppe seufzte hörbar.
»Ach, du lieber Scholli, wow! Wer ist das denn?« Ashleys blaue Augen waren so groß wie Untertassen.
»Das ist Sir Sexy McHotpants.« Elizabeth klang fast stolz. »Er ist Wachmann in dem Gebäude, wo Kat und Janie arbeiten. Janie ist schon heiß auf ihn, seit er vor ein paar Wochen angefangen hat. Ich kenne seinen richtigen Namen nicht, aber vielleicht Janie.«
Kat nickte und verzog die Lippen zu einem kleinen Lächeln. »Ich erkenne ihn. Janie ist nicht die Einzige, die ihn bemerkt hat.«
Marie lachte, als sie sich aufrichtete und wieder zu ihrem abgelegten Garn zurückkehrte. »Kein Wunder, dass du jetzt schon fragst: Äh, wer war noch gleich Jon?«
»Verdammt, Janie, hat er dir Handschellen angelegt?« Sandra knuffte mir in die Schulter. »Hattet ihr im Aufzug Gedankensex? Und ist das der Grund, weshalb du jetzt wie mein roter Pulli aussiehst?«
Bis zu diesem Moment hatte ich gar nicht bemerkt, dass ich rot geworden war. Ich stellte mein Weinglas beiseite und drückte die Hände an die Wangen. Es war nicht so, dass ich wegen ihrer Kommentare peinlich berührt war, ganz im Gegenteil. Ich genoss ihr wohlmeinendes Necken.
Ich wusste, dass es die Erinnerung an seine eindringlichen Augen und seinen über mich streifenden Blick war, die mich erröten ließ, und der Gedanke an die warme aufgeladene Kraft seiner Hand an meinem Rücken und meinem Arm. Von ihm fühlte ich die Auswirkungen stärker als von all den anderen Ereignissen während meines Tags der Hölle, die seiner Anwesenheit vorangegangen waren, selbst noch so viele Stunden später. Ich verdeckte mein Gesicht mit den Händen und schüttelte den Kopf.
»Janie, ist etwas passiert?« Ich spürte, wie Elizabeth ihr Gewicht auf der Couch verlagerte, als sie mich ansprach, wobei ihre Stimme sowohl aufgeregt als auch besorgt klang.
»Nein, es nichts passiert. Ich habe nur mit ihm gesprochen, und ihr wisst alle, wie gut das bei mir klappt.« Ich ließ die Hände auf dem Gesicht und seufzte.
»Worüber habt ihr denn gesprochen?« Bei Fionas sanfter Stimme fühlte ich mich etwas besser.
»Ich … ich habe über die Wochentage gesprochen und den internationalen Standard, um die Wochentage zu nummerieren.« Ich nahm die Hände vom Gesicht und sah sie alle an.
»Du liebe Güte, Janie! Wie bist du denn darauf gekommen?« Ashley schnaubte beim Lachen und widmete ihre Aufmerksamkeit wieder der weichen Masse abgesteppten Garns auf ihrem Schoß.
»Nein, warte, erzähl mir alles«, sagte Elizabeth, während sie das Handy an Fiona weiterreichte, damit sie sich die Bilder ansehen konnte. Elizabeth nahm meine Hände in ihre und zwang mich, ihr in die blassblauen Augen zu blicken. »Lass aber nichts aus. Fang am Anfang an, und wiederhole Wort für Wort, was geschehen ist – vor allem alles, was er gesagt hat.«
Also tat ich es. Ich versuchte, mich zu konzentrieren, während ich die Geschichte wiederholte, ohne meine Gedanken wandern zu lassen und irgendeine bedeutungslose Abzweigung auszuweiten. Als ich den Teil über ISO 8601 wiederholte und wie er mich darum bat, mehr über den nahtlosen Verkehr zwischen Staatsorganen zu erzählen, japsten alle nach Luft.
»Ah! Und was hast du gesagt?« Sandra beugte sich vor. »Ich kann einfach nicht glauben, dass er mit dir geflirtet hat! Hast du auch mit ihm geflirtet?«
»Was? Aber nein, er hat überhaupt nicht mit mir geflirtet!« Ich schüttelte energisch den Kopf.
»Oh, Janie, au contraire, mon frère, er hat ganz sicher mit dir geflirtet.« Ashley wackelte mit den Augenbrauen und verzog den Mund zu einem spitzbübischen Grinsen. Alle kicherten über ihren dicken Tennessee-Akzent bei dem französischen Spruch. »Er klingt ganz wie der starke, schweigsame Typ. Du musst ihn wohl beeindruckt haben. Trotzdem etwas schräg – mit dir zu flirten, so kurz nach deiner Entlassung.«
Kat nickte. »Da stimme ich dir zu, sein Timing hätte wirklich besser sein können, doch du hast offenbar Eindruck auf ihn gemacht.«
»Natürlich hast du das. Guck dich doch an – du bist umwerfend.« Fionas Tonfall und Ausdruck waren ganz sachlich, während sie mit der Hand auf mich zeigte.
Ich starrte sie mit aufgerissenen Augen an. »Du nennst meinen dicken Hintern umwerfend?«
Marie kicherte. »Der dicke Hintern des einen ist die Vorstellung von umwerfend bei dem anderen. Du kannst es dem Kerl nicht vorwerfen, wenn er ein paar Kurven mag. Du kannst sie ihm höchstens vorführen.«
Der Raum dröhnte vor Lachen, und ich konnte mir ein kleines, atemloses Kichern nicht verkneifen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er mich anziehend fand, ganz zu schweigen davon, dass er mit mir geflirtet hatte. Das war viel zu abwegig. Ich unterbrach ihre Heiterkeit, um die Geschichte zum Ende zu bringen, und alle runzelten die Stirn, als ich erklärte, dass ich mit der Frau weggegangen sei und nicht mehr mit ihm gesprochen oder mich von ihm verabschiedet hätte.
»Aber er hat dir doch gesagt, dass du warten sollst«, sagte Kat. »Warum hast du denn nicht auf ihn gewartet?«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es nicht so gemeint hat. Er meinte ›Warten Sie hier‹ oder ›Warten Sie auf die Papiere‹«, erklärte ich.
Ashley schüttelte den Kopf. »Nein, das hat er nicht gesagt.« Sie senkte die Stimme zu einer männlichen Tonlage, die ziemlich nach Batman klang. »›Bewegen Sie sich nicht. Warten Sie auf mich.‹?«
»Ich glaube, ihr interpretiert da zu viel hinein.« Ich stand auf und begann, die leeren Weingläser einzusammeln, während ich mich streckte. Vom Gewicht des Tages fühlten sich meine Schultern ganz schwer an. Ich war müde.
»Ich weiß nicht.« Fiona sah mich schief von der Seite an. »Du bist immer so ahnungslos mit den Männern.«
»Ach, wirklich?«, erwiderte ich.
»Ja, wirklich«, sagte Elizabeth und mischte sich ein. »Du bist hübsch, auch wenn du das nicht glaubst. Viele Männer, und ich meine viele Männer, mögen diese Amazonensache mit großem Busen, schmaler Taille, großem Hintern, langen Beinen, wie du sie hast. Nimm dazu noch dein lockiges kastanienbraunes Haar und die großen braun-grünen Augen, und manche Leute – mich eingeschlossen – würden dich als umwerfend bezeichnen.«
Während der Abend fortschritt, versuchte ich mehrfach und mit unterschiedlichem Erfolg, das Thema zu wechseln. Es waren alles Frauen, die mich so liebten, wie ich war. Natürlich glaubten sie, dass ich hübsch war. Doch in Wahrheit mochte ich es einfach nicht besonders, wenn man sich über mein Äußeres ausließ. Also tat ich es selbst auch nicht.
Als ich in jener Nacht auf Elizabeths Couch lag, war ich von meinen eigenen Gedanken überrascht. Ich konnte einfach nicht aufhören, an ihn zu denken. Ich ließ das doch recht einseitige Gespräch im Aufzug immer wieder in meinem Kopf abspielen und versuchte herauszufinden, ob er wirklich geflirtet hatte. Nicht dass es irgendeine Rolle gespielt hätte, da ich ihn höchstwahrscheinlich niemals wiedersehen würde.
Ich fühlte mich fast normal, während ich mich in etwas so Banales hineinsteigerte, ob ein Mann, den ich allein aufgrund seiner körperlichen Anziehung mochte, den Eindruck hatte, dass ich attraktiv genug sei, um mit mir zu flirten. Doch kurz bevor ich selbst davon überzeugt war, mich für vollkommen vernünftig zu halten, erinnerte ich mich daran, dass ich gerade eine Langzeitbeziehung mit jemandem beendet hatte, von dem ich annahm, dass ich ihn heiraten würde. Und dass ich am selben Tag meinen Job verloren hatte. Ein normaler Mensch würde sich intensiv mit einem oder beiden dieser lebenseinschneidenden Ereignisse beschäftigen.
Bevor mich der Schlaf überkam, war mein letzter Gedanke, dass ich bei Wikipedia die Definition von Kinnearn nachschlagen wollte.
Kapitel 3
Am Freitagmorgen – anderthalb Wochen nach meinem schlimmsten Tag überhaupt – kündigte mir Elizabeth an, dass der Abend ungeheuerlich werden würde. Und sie erklärte, dass sie uns VIP-Ausweise beschafft hatte für eine heiß begehrte »Club Experience«, wie sie es nannte und von der ich annahm, dass es die hippe Umschreibung war für »wir gehen in eine neue Bar«.
Ich war hoch motiviert, einen neuen Job und eine neue Wohnung zu finden, obwohl sich Elizabeth noch nicht über meine Anwesenheit beschwert hatte. Tatsächlich erwähnte sie sogar, dass ihr aktueller Mietvertrag bald ablaufen würde, und schlug vor, dass wir uns etwas Größeres suchen und weiter gemeinsam wohnen sollten. Die Idee gefiel mir. Eine Wohnung mit Elizabeth wäre die perfekte Prophylaxe gegen meine angeborenen einsiedlerischen, agoraphobischen Tendenzen.
Auch in meiner Beziehung mit Jon hatten wir beide gemerkt, dass ich ausreichend Raum und Zeit für mich selbst brauchte, um mit angemessener Zuneigung zu reagieren, wenn wir zusammen waren.
Vielleicht war das der Grund, weshalb er das Bedürfnis verspürt hatte, mich zu betrügen.
Das schien mir nachvollziehbar, weshalb ich darüber später noch einmal nachdenken wollte.
Während der letzten Tage hatte ich mich eingehend mit meiner von »Losigkeiten« geprägten Situation beschäftigt – Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Beziehungslosigkeit. »Losiger« ging es fast nicht und bezeichnete einen unsicheren, unangenehmen Ort.
Jon war mein erster Freund gewesen. Auf der Highschool und im College war ich zwar mit anderen Jungen ausgegangen, doch das waren alles nur erste Verabredungen. Jon war der Erste, der sich nicht von meinem ausufernden Chaos an scheinbar arbiträren Gedankengängen abschrecken ließ. Er schien es sogar zu genießen. Ich fragte mich, ob er der Einzige wäre.
Der Gedanke beunruhigte mich jedoch weniger, als er es eigentlich hätte tun sollen. Tatsächlich störte er mich viel weniger als der Gedanke, niemals wieder die schwelende Hitze zu erleben, die ich während meiner sieben bis zwölf Minuten mit dem blauäugigen Wachmann verspürt hatte.
Seit unserer Trennung hatte ich nur kurz mit Jon gesprochen, und ich musste noch einordnen, was ich eigentlich während unseres Gesprächs empfunden hatte. Er war wütend auf mich, tatsächlich war er geradezu empört, und er hatte mich während der ersten paar Minuten unseres Gesprächs angeschrien. Er meinte, er hätte über seinen Dad von meinem Jobverlust erfahren und wollte wissen, warum ich ihn nicht um Hilfe gebeten hätte.
Ich traute meinen Ohren nicht, weshalb ich ein paar Sekunden brauchte, bevor ich antwortete: »Jon, ist das wirklich eine Frage? Und woher hat Mr Holesome – ich meine, woher wusste dein Dad davon?«
»Ja. Das ist wirklich eine Frage. Du brauchst mich, du bist meine Freundin …«
»Nein …« Ich schüttelte den Kopf, als wollte ich mich selbst überzeugen.
»Es ist noch nichts entschieden. Ich will mich um dich kümmern. Ich liebe dich noch immer. Wir gehören zusammen.« Er klang entschlossen und ein wenig mürrisch.
»Du hast mich betrogen. Wir sind nicht mehr zusammen.« Ich wurde etwas ungehalten, was bei mir fast schon der höchste Grad an Verärgerung war.
Ich hörte ihn am anderen Ende der Leitung seufzen, dann wurde sein Ton sanfter. »Janie, weißt du denn nicht, dass sich für mich nichts geändert hat? Es war doch nur ein Mal. Es hat nichts bedeutet. Ich war betrunken.«
»Du warst nüchtern genug, um die Kondompackung wieder in die Tasche zu stecken.«
Halb knurrte er, halb lachte er. »Ich will mich noch immer um dich kümmern – bitte lass mich.«
»Das ist nicht mehr deine Aufgabe …«
»Können wir denn Freunde sein?«Er unterbrach mich, seine Stimme etwas freundlicher.