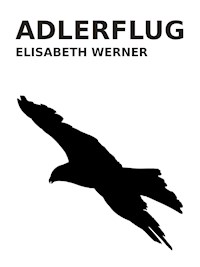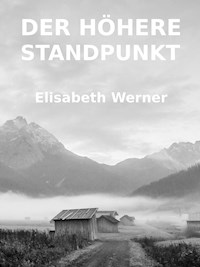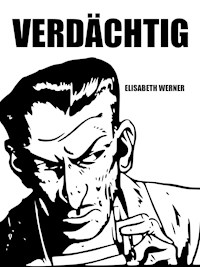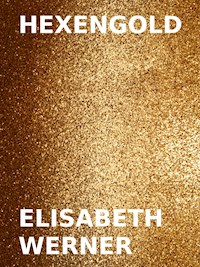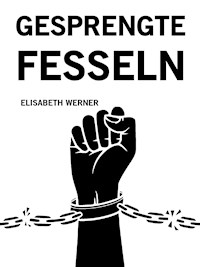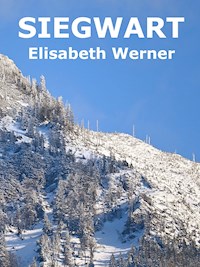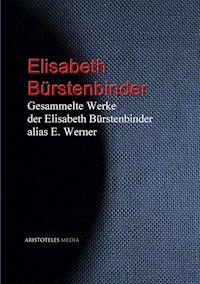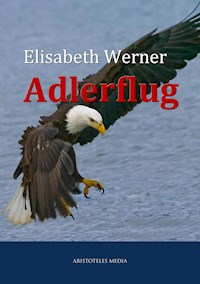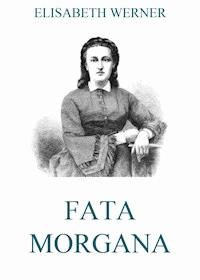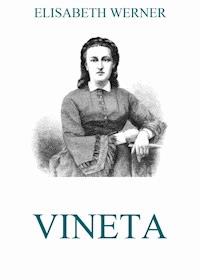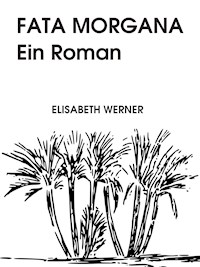
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fata Morgana ist ein spannender Roman von Elisabeth Werner. Ein Klassiker der Unterhaltungsliteratur im allerbesten Licht! Auszug: Die Bahn war geöffnet, und Reiter wie Zuschauer harrten erwartungsvoll auf das Zeichen zum Beginn des Rennens. Die Schranken umlagerte eine dichte Volksmenge, und auf den Tribünen war jeder Platz besetzt. Es war jenes bewegte, farbenreiche Bild, das man bei solcher Veranlassung auf allen europäischen Rennplätzen sieht, aber hier, unter einem fremden Himmel, in einer ganz andern Welt, erschien es in so eigenartigem Rahmen, daß sich das oft Gesehene zu einem ganz neuen, fesselnden Schauspiel gestaltete.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fata Morgana
Fata MorganaAnmerkungenImpressumFata Morgana
Die Bahn war geöffnet, und Reiter wie Zuschauer harrten erwartungsvoll auf das Zeichen zum Beginn des Rennens. Die Schranken umlagerte eine dichte Volksmenge, und auf den Tribünen war jeder Platz besetzt. Es war jenes bewegte, farbenreiche Bild, das man bei solcher Veranlassung auf allen europäischen Rennplätzen sieht, aber hier, unter einem fremden Himmel, in einer ganz andern Welt, erschien es in so eigenartigem Rahmen, daß sich das oft Gesehene zu einem ganz neuen, fesselnden Schauspiel gestaltete.
Im Hintergrunde dehnte sich weit und hellschimmernd die Stadt aus, ein Meer von Straßen, Palästen und Häusern, aus dem die Kuppeln der Moscheen, die schlanken, zierlichen Minarets überall emportauchten. Dazwischen Gruppen von mächtigen Palmen und, über dem Ganzen thronend, auf der Höhe die Citadelle mit ihren Türmen. Wie eine Märchenstadt lag das schöne Kairo da, überflutet von dem heißen Lichtglanze der afrikanischen Sonne, und darüber wölbte sich der Himmel mit einem so tiefen, leuchtenden Blau, wie es selbst der Süden Europas nicht kennt.
In der Volksmenge, welche sich an den Schranken der Rennbahn drängte, waren alle Völker und Stämme des Orients vertreten. Eine Fülle von seltsamen Gestalten, in der malerisch phantastischen Tracht ihrer Heimat, ein Gewoge von leuchtenden, oft schreienden Farben, von gelben, braunen, tiefschwarzen Gesichtern, deren dunkle, brennende Augen bald an der beim Start versammelten Reiterschar, bald an den Tribünen hingen.
Dort unter den weit ausgespannten Sonnendächern war die ganze vornehme Welt von Kairo versammelt, eine Gesellschaft, die vielleicht nicht weniger bunt zusammengesetzt war als jene, die sich da unten vor den Schranken drängte. Neben den vornehmen Orientalen sah man die ganze Fremdenkolonie der Stadt, und ihr hatte sich der große Strom der europäischen Touristen angeschlossen, die Reiselust oder Erholungsbedürfnis hierher gezogen. Auch hier waren alle Länder vertreten, alle Sprachen schwirrten durcheinander, Nord- und Südländer fanden sich zusammen und neben der reichsten, gewähltesten Toilette zeigte sich der einfachste Reiseanzug. Man sah und hörte es ringsum, daß man sich in einer der großen Fremdenstationen des Orients befand.
Vor den Tribünen stand eine Gruppe von Herren in angelegentlicher Unterhaltung, die selbstverständlich das bevorstehende Rennen betraf. Der mutmaßliche Verlauf desselben wurde sehr lebhaft erörtert und die Meinungen darüber schienen geteilt zu sein, bis ein englischer Oberst, der soeben herangetreten war, mit voller Bestimmtheit erklärte: »Ich kann Ihnen den Ausgang vorhersagen, meine Herren. Bernried schlägt mit seinem ›Darling‹ all die übrigen.«
»Wirklich?« – »Das ist doch noch die Frage.« – »Halten Sie das für so ausgemacht?« klang es von verschiedenen Seiten.
»Gewiß. Ich kenne ›Darling‹, er ist ein vorzüglicher Renner. Wenn ich nur wüßte, wie Bernried zu dem prächtigen Tiere gekommen ist! Ich hätte es gern gehabt, aber mir war der Preis zu hoch – er hat es vor acht Tagen gekauft.«
»Aber schwerlich bezahlt,« warf ein junger Offizier ein, der gleichfalls englische Uniform trug. »Dieser deutsche Baron hat ein großartiges Talent, alles schuldig zu bleiben, obwohl man ihm nirgends mehr Kredit geben will.«
»Da sind Sie doch wohl im Irrtum, Hartley,« sagte der Oberst. »In diesem Falle hat man es sicher gethan, denn Bernried ist bekannt als der beste Reiter, und wenn er nun vollends ›Darling‹ reitet, so gilt sein Sieg als beinahe zweifellos. Die meisten Wetten stehen ja auf den Fuchs. Sie halten gleichfalls auf ihn, Lord Marwood?«
Er wandte sich an einen Herrn, der neben ihm stand und dem Gespräche zuhörte, ohne sich daran zu beteiligen. Auch jetzt fand er es nicht für nötig, eine Antwort zu geben, sondern bejahte nur mit einem leichten Kopfnicken.
»Ich glaubte, du würdest auf die ›Faida‹ des deutschen Generalkonsuls halten, Francis,« sagte Hartley. »Wie steht es denn eigentlich damit? Du mußt es doch wissen, du bist ja oft genug im Hause des Herrn von Osmar.«
»›Faida‹ hat gar keine Aussichten,« ließ sich Lord Marwood jetzt endlich vernehmen. »Sie hat noch kein Rennen mitgemacht und ist überhaupt noch nicht ordentlich trainiert. Aber Miß Zenaide wollte ihr Lieblingspferd durchaus auf der Rennbahn sehen.«
»Und du hältst trotzdem nicht auf ›Faida‹?« neckte der junge Offizier. »Du würdest die Wette verloren haben, aber geschadet hatte dir das durchaus nicht bei deiner Dame, ganz im Gegenteil.«
Dem jungen Lord schien die Neckerei nicht angenehm zu sein, er erwiderte keine Silbe darauf.
Francis Marwood mochte am Ende der Zwanzig stehen. Groß und schlank, mit Zügen, die in ihrer strengen Regelmäßigkeit unbedingt Anspruch auf Schönheit machen konnten, mit den hellen, nur etwas matten Augen und dem vollen aschblonden Haar war er das echte Bild eines vornehmen Engländers. Haltung, Sprache, Bewegung, alles war kühl, förmlich und abgemessen, aber die Erscheinung des jungen Mannes wäre eine sehr angenehme gewesen ohne die kalte, hochmütige Zurückhaltung, die einen hervorstechenden Zug seiner Persönlichkeit bildete und selbst seinen Landsleuten und Standesgenossen gegenüber hervortrat.
»Nun gegen ›Darling‹ hat jedes Pferd einen schweren Stand,« nahm der Oberst wieder das Wort. »Wer reitet denn ›Faida‹?«
Lord Marwood zuckte die Schultern und seine Lippen kräuselten sich verächtlich, als er im wegwerfenden Tone sagte: »Ein Fremder, ein ganz junger Bursche, den Sonneck eingeführt hat und der wahrscheinlich gar nichts vom Reiten versteht!«
»Ah, der junge Deutsche!« rief Hartley. »Wie heißt er doch? Ich habe den Namen vergessen. Ein hübscher, kecker Bursche ist er jedenfalls und reiten wird er wohl auch können, sonst würde ihn Sonneck schwerlich auf seinem Zuge in das Innere mitnehmen. Der berühmte Afrikaforscher pflegt sonst sehr wählerisch zu sein mit seinen Gefährten.«
»Möglich, daß er für den Wüstenzug taugt, aber man führt den ersten besten Abenteurer nicht in ein Haus wie das Osmarsche ein und etwas anderes ist dieser Mensch schwerlich. Niemand weiß, woher er kommt. Man kann da auf sehr unliebsame Enthüllungen gefaßt sein, aber Sonneck schlägt mit seinem Einfluß und seinen Verbindungen jeden Einwand nieder.«
Es lag ein unglaublich verletzender Hochmut in den Worten des jungen Lords, der Oberst aber sagte leichthin: »Ja, Sonneck setzt so ziemlich alles durch, was er will, zumal bei Herrn von Osmar. - Ah, da gibt man das Zeichen! Jetzt gilt's!« Das Zeichen zum Beginn des Rennens war in der That soeben gegeben worden, und die Reiter brausten in vollem Laufe dahin. Alle Gespräche verstummten, und aller Augen richteten sich auf die Bahn, wo der Wettkampf seinen Anfang genommen hatte.
»Sehen Sie, meine Herren, ich behalte recht,« rief der Oberst lebhaft, »Bernried führt, ›Darling‹ ist allen voran!«
»Und ›Faida‹ ist die letzte!« ergänzte Marwood mit herbem Spott. »Ich dachte es mir. Freilich, bei einem solchen Reiter ist nichts anderes zu erwarten. Ich begreife den Konsul nicht, daß er das immerhin kostbare Pferd solchen Händen anvertraut hat.«
»Ja, der Reiter verspricht allerdings nicht viel,« stimmte Hartley bei. »Wenn er das schöne Tier nur nicht zu Fall bringt bei einem der Hindernisse.«
Die Pferde wurden meist von den Besitzern selbst geritten, und die edlen Tiere gehorchten dem leisesten Schenkeldruck. Die Herren waren sämtlich vortreffliche Reiter, aber sie jagten schon nicht mehr in geschlossener Reihe dahin. Gleich nach dem ersten Hindernis hatte sich das Feld gelockert, und die Zurückgebliebenen suchten das Verlorene mit leidenschaftlichem Eifer wieder einzubringen. Das Bild wurde mit jedem Augenblick stürmischer und bewegter. Die Führung hatte ein englischer Fuchs übernommen, ein prächtiges Tier, das sich seiner Ueberlegenheit bewußt zu sein schien. Er hatte, allen voran, das erste Hindernis genommen und jagte nun in langgestrecktem Galopp dahin, die anderen weit hinter sich zurücklassend. Auf ihn waren hauptsächlich von Anfang an die Augen der Zuschauer gerichtet, und der Reiter wurde mit lebhaftem Zuruf begrüßt. Es war ein Mann von einigen dreißig Jahren, mit scharf ausgeprägten Zügen, in denen etwas Herbes, Düsteres lag. Jetzt freilich spielte ein leises triumphierendes Lächeln um seine Lippen. Herr von Bernried schien im Vertrauen auf die Schnelligkeit seines Pferdes seines Sieges vollkommen sicher zu sein.
Da schoß einer von den Nachzüglern, der letzte von allen, plötzlich vorwärts, mit einer so jähen, blitzartigen Schnelligkeit, daß alles aufmerksam wurde. In kurzer Zeit hatte er seine Gefährten erreicht, bald überholte er sie, einen nach dem andern. Jetzt nahm er das Hindernis, leicht und sicher, ohne jede Anstrengung und jagte nun weiter, dem führenden Reiter nach, so daß der Raum zwischen ihnen kleiner und kleiner wurde.
Bernried hatte sich umgesehen und ein halb erstaunter, halb zorniger Blick traf den unerwarteten Gegner. Es war ein noch sehr junger Mann, den man bisher kaum bemerkt, jedenfalls nicht beachtet hatte; er saß wie festgewachsen im Sattel. Der Schimmel, den er ritt, erschien fast klein gegen den riesigen Fuchs, war aber unstreitig von edelster Rasse. Der schlanke Bau des schönen Tieres, der zierliche Kopf mit den großen klugen Augen verrieten das arabische Blut. Jetzt war er dicht hinter »Darling«, jetzt wieder jenes jähe, blitzartige Vorwärtsschießen und beide Pferde waren auf gleicher Höhe.
Der Kampf wurde ernst. Bernried hatte nur eines Blickes bedurft, um zu erkennen, daß der so plötzlich aufgetauchte Gegner ihm ebenbürtig war, daß er absichtlich sein Roß geschont und zurückgehalten hatte, um jetzt erst die volle Kraft einzusetzen. Ein Zucken ging wie Wetterleuchten über sein Gesicht und seine Stirn faltete sich drohend, aber er war nicht der Mann, sich den Sieg so leicht streitig machen zu lassen. »Darling« fühlte die Sporen und setzte seine ganze Kraft ein, aber umsonst. Der Araber blieb dicht an seiner Seite, und Seite an Seite nahmen sie das nächste Hindernis.
Das anfängliche Interesse der Zuschauer an diesem überraschenden Verlauf des Rennens hatte sich längst zur leidenschaftlichen Teilnahme gesteigert. Die anderen Reiter, die in größerer oder geringerer Entfernung nachjagten, wurden kaum mehr beachtet, man sah nur auf die beiden, die so hartnäckig um den Siegespreis rangen. Alles andere trat zurück vor diesem Wettkampfe zwischen dem anerkannt ersten Reiter in der Sportswelt von Kairo und dem jungen Fremden, den die wenigsten kannten. Aber gerade dies Unerwartete, Blitzähnliche seines Erscheinens gewann ihm die Sympathie der Menge, der vornehmen Zuschauer wie des Volkes da unten; wo er vorüber kam, wurde stürmischer Zuruf laut.
Herr von Bernried mochte es wohl fühlen, wem diese Rufe jetzt galten, und je zweifelloser sein Sieg im Anfang geschienen hatte, desto schwerer empfand er die Möglichkeit einer Niederlage. Sein Gesicht war flammendrot, jede Fiber an ihm bebte in wilder Erregung, aber diese Erregung drohte ihm verhängnisvoll zu werden. Er verlor mit der Herrschaft über sich selbst auch die über sein Roß. Wie im Sturmwind jagten die beiden Reiter vorwärts, »Darling« in langen, mächtigen Sätzen, neben ihm »Faida« leicht dahinfliegend wie ein Vogel, so daß ihre zierlichen Hufe kaum den Boden zu berühren schienen.
Da endlich gewann der Araber einen Vorsprung, der Fuchs blieb zurück, erst um Kopfeslänge, dann weiter und weiter, er schien zu ermatten. Gelang es »Faida«, vor ihm das letzte Hindernis zu nehmen, so war der Sieg entschieden. Vielleicht war es dieser Gedanke, der Bernried den letzten Rest von Besinnung und Selbstbeherrschung raubte. Die dunkle Glut in seinem Antlitz wich einer Totenblässe. Mit fest zusammengebissenen Zähnen, jede Muskel gespannt, peitschte er wie wahnsinnig sein Roß. Der Schaum floß am Gebiß »Darlings« nieder, seine Flanken bebten, aber er gehorchte. Mit einer letzten äußersten Anstrengung gelang es ihm, den Araber wieder zu erreichen, und beide setzten fast gleichzeitig zum Sprunge an.
In weitem, mächtigem Satze flog »Faida« über das Hindernis hinweg. Ein halb erstickter Aufschrei, der in demselben Augenblick ertönte, ging unter in dem jubelnden Beifall, mit dem die Zuschauer dies tollkühne Reiterstück begrüßten, dann jagte der Reiter dem Ziele, dem Siege zu, den ihm niemand mehr streitig machte.
Niemand! – »Darling«, der nur einige Sekunden später das Hindernis zu nehmen sich anschickte, war gestürzt bei dem Sprunge. Er lag zusammengebrochen an der Hürde, und sein Herr, aus dem Sattel geschleudert, lag einige Schritte davon, regungslos auf dem Boden ausgestreckt. Rasch hob man den Bewußtlosen auf, trug ihn aus der Bahn und übergab ihn den Händen eines Arztes. Das Rennen selbst erlitt keine Unterbrechung, auf dergleichen Unfälle muß man ja bei jedem Rennen gefaßt sein!
Lauter, stürmischer Jubel empfing den Sieger, der soeben durchs Ziel ritt, von allen Seiten wurde er mit Beifall und Zurufen überschüttet, und die wehenden Tücher der Damen grüßten ihn von den Tribünen her. Er hatte allerdings glänzend gesiegt, denn es vergingen Minuten, ehe die anderen Reiter anlangten.
Der junge Mann – er konnte höchstens drei- oder vierundzwanzig Jahre zählen – hatte die Mütze abgenommen, um zu danken. Es war eine schlanke, aber kraftvolle Gestalt, dichtes blondes Kraushaar legte sich in überreicher Fülle um die Stirn, das leicht gebräunte Antlitz war nicht eigentlich schön, eher das Gegenteil, aber es lag etwas eigentümlich Fesselndes in diesen vollkommen unregelmäßigen Zügen. In den dunklen, feurigen Augen blitzte kecker Uebermut, stolzes Selbstvertrauen, und als er jetzt nach allen Seiten hin sich verbeugte, noch glühend erhitzt von dem wilden Ritte, strahlend im Triumph des Sieges, da erschien er wie die leibhaftige Verkörperung der stürmischen Jugend, in ihrer ganzen Kraft und Schönheit.
Er grüßte nach den Tribünen hinüber, wo in der vordersten Reihe ein älterer Herr und eine junge Dame ihm lebhaft zuwinkten. Der erstere verließ jetzt rasch feinen Platz und kam ihm entgegen.
»Das nennt man ja im Sturme siegen!« rief er in freudiger Erregung. »Meinen Dank, Herr Ehrwald! Da überschüttet man mich mit Glückwünschen von allen Seiten - nein, meine Herren, hier an diesen jungen Reitersmann müssen Sie sich wenden! Er allein hat meiner ›Faida‹ zum Siege verholfen.«
Er hatte deutsch gesprochen und wandte sich bei den letzten Worten an einige Herren, die ihm gefolgt waren und nun den jungen Landsmann gleichfalls mit Glückwünschen umringten.
»Und Sie haben uns beiden den Sieg doch nicht zugetraut, Herr Konsul,« sagte Ehrwald lachend, indem er auf dem Platz vor der Wage aus dem Sattel sprang. »Sie fürchteten im vollen Ernste eine Niederlage und zuckten die Achseln, als ich mich erbot, Ihre ›Faida‹ in acht Tagen für das Rennen zuzureiten.«
»Hätte ich eine Probe Ihrer Reitkunst gesehen, ich wäre wohl zuversichtlicher gewesen,« entgegnete der Konsul, ein älterer Mann von vornehmer Erscheinung. »Nun, in diesem Falle war die Ueberraschung eine sehr angenehme. Aber jetzt gehen Sie zu meiner Tochter, Zenaide möchte ihre ›Faida‹ sehen, sie ist sehr stolz auf deren Sieg.«
Herr von Osmar, der augenscheinlich ebenso stolz war, winkte freundlich mit der Hand und wandte sich dann zu den beiden englischen Herren, die jetzt auch herantraten, während Ehrwald nach einer kurzen Begrüßung derselben das Pferd am Zügel nach der Tribüne führte. »›Faida‹ möchte sich nun auch einen Dank von ihrer Herrin holen,« sagte er, mit einer leichten Verneigung vor der jungen Dame, deren Hand sich liebkosend dem Tiere entgegenstreckte. Es senkte schmeichelnd den schönen Kopf und ließ ein leises Wiehern hören, als sei es sich bewußt, die Liebkosung verdient zu haben.
»Und der Reiter? Will er keinen Dank für seinen kühnen Ritt?« fragte die Dame lächelnd.
»Im Gegenteil, mein gnädiges Fräulein, ich habe Ihnen zu danken,« versetzte Ehrwald, »denn ohne Ihre Fürsprache hätte man mir ›Faida‹ gar nicht anvertraut. Der Herr Konsul war ja anfangs entschieden dagegen und gab nur Ihrer Bitte nach.«
»Spotten Sie nur, Sie haben ja all die Zweifler glänzend geschlagen und auch den armen Herrn von Bernried. Sein Sturz ist doch nicht gefährlich gewesen?«
»Ich hoffe: nicht. Ich habe mich bereits danach erkundigt, aber Lord Marwood, den ich fragte, geruhte nicht, mir eine Antwort zu geben. Ich stand zwar nie in Gnaden bei Seiner Lordschaft, seit Sie aber gesehen haben, daß ich doch einigermaßen fest im Sattel bin, scheinen Sie mich mit Ihrer vollen Ungnade zu beehren. Ich bin ganz untröstlich darüber.« Es lag ein übermütiger Spott in den Worten und eine gewisse Absichtlichkeit in der Bewegung, mit welcher der junge Mann jetzt dicht an die Schranke trat und den Arm darauf stützte. Er hatte recht gut gesehen, daß Lord Marwood, der drüben im Gespräch mit dem Konsul stand, ihn und die junge Dame beobachtete.
Zenaide von Osmar mochte etwa zwanzig Jahre zählen. Es war eine schlanke, zarte Erscheinung, in der trotz der deutschen Abkunft etwas von der fremdartigen, glühenden Schönheit des Landes lag, in dem sie geboren war. Auf dem tiefschwarzen Haar, das einfach gescheitelt und am Hinterhaupt in einem griechischen Knoten aufgenommen war, ruhte ein leichter bläulicher Schimmer und die großen Augen hatten gleichfalls jenes tiefdunkle, sammetartige Braun, das man nur bei den Kindern des Südens findet. Der Blick war sanft und träumerisch, und doch schlummerte darin ein verborgenes leidenschaftliches Feuer. Das Antlitz erschien etwas bleich, es fehlte ihm die rosige Frische, aber mit seinen weichen, zarten Linien hatte es einen ganz bezaubernden Reiz. Die junge Dame hätte wahrlich nicht die Tochter eines der reichsten Männer von Kairo zu sein brauchen, um begehrenswert zu erscheinen.
Das mochte auch Lord Marwood finden, der unausgesetzt hinüberblickte. Seine Lordschaft konnten es augenscheinlich nicht begreifen, daß der »junge Bursche« es wagte, so vertraulich mit der Tochter des Generalkonsuls zu plaudern. Herr von Osmar schien das jedoch nicht zu bemerken, er sprach gerade mit den beiden englischen Offizieren, die ihn gleichfalls beglückwünscht hatten, von dem Sturze des Herrn von Bernried.
»Nun, er scheint noch ziemlich glücklich davongekommen zu sein,« äußerte der Konsul. »Seine Verletzungen sind nicht gefährlich, wie ich hörte. Aber ›Darling‹ ist wirklich verloren?«
»Leider!« bestätigte der Oberst. »Er hat das eine Hinterbein gebrochen. Schade um das prächtige Tier, aber Bernried spornte es ja wie ein Unsinniger. Er ist selbst schuld an dem Verlust, der für ihn den Ruin bedeutet.«
»Er setzte eben alles dran, zu siegen,« sagte Hartley. »Und dieser Ehrwald ritt ja wie auf Tod und Leben. Wer ist denn eigentlich dieser Herr?«
»Ein junger Landsmann, der sein Glück in der weiten Welt versuchen will,« entgegnete Herr von Osmar heiter. »Viel mehr weiß ich auch nicht über ihn. Sonneck hat ihn aus Deutschland mitgebracht und will ihn auf seinem Zuge in das Innere mitnehmen. Mir gefiel er gleich bei der ersten Vorstellung. Ein prächtiger, gescheiter Junge, er sprüht nur so von Feuer und Leben!«
»Ja, solche Leute kann Sonneck brauchen,« sagte der Oberst. »An Tollkühnheit fehlt es diesem Ehrwald jedenfalls nicht. War das ein Sprung, mit dem er über das letzte Hindernis wegsetzte!«
Der Name, auf den die Herren sich vorhin nicht besinnen konnten, war ihnen jetzt sehr geläufig geworden. Er ging ja auch seit einer Viertelstunde wie ein Lauffeuer von Mund zu Mund, der junge unbeachtete Fremde hatte sich auf einmal in den Vordergrund gestellt. Sein Gespräch mit Fräulein von Osmar wurde bald genug unterbrochen, der Konsul rief ihn ab, um ihn noch einigen Bekannten vorzustellen, und er wurde von neuem mit Glückwünschen überhäuft, während sich »Faida« der gleichen Aufmerksamkeit erfreute.
Man war so ausschließlich mit den beiden beschäftigt, daß niemand sich um den geschlossenen Wagen kümmerte, der soeben im langsamen Schritt davonfuhr und die Richtung nach der Stadt einschlug. Nur ein einzelner Herr befand sich in der Nähe, er hatte dem Kutscher die nötigen Weisungen gegeben und wollte eben nach der Bahn zurückkehren, als er unvermutet angeredet wurde.
»Nun, Herr Doktor Walter, Sie haben leider Arbeit bekommen bei dem heutigen Vergnügen. Es ist wohl Herr von Bernried, der dort nach der Stadt fahrt? Die Sache scheint bei alledem noch verhältnismäßig gut abgelaufen zu sein. Der Unfall ist nicht ernst, wie es heißt.«
»Er scheint im Gegenteil sehr ernst, Herr Sonneck,« sagte der Arzt, der sich rasch umgewandt hatte, und seine Miene bestätigte nur zu sehr die Worte. »Wir haben einstweilen einen Notverband angelegt, die eingehende Untersuchung werde ich erst im deutschen Hospital vornehmen, wohin Herr von Bernried jetzt gebracht wird.«
»Nach dem Hospital?« wiederholte Sonneck betroffen. »Können Sie ihn nicht in seiner Wohnung behandeln?«
»Nein, er hat überhaupt keine eigene Wohnung mehr seit dem Tode seiner Frau, nur ein paar Zimmer im Hotel. Da kann von einer ordentlichen Pflege nicht die Rede sein. Wenn ich nur wüßte, was aus dem Kinde, seinem kleinen Töchterchen, werden soll! Im Hotel kann sie nicht bleiben, denn es kann lange dauern, bis der Vater zurückkehrt – wenn es überhaupt geschieht!«
Sonneck, der mit gespannter Aufmerksamkeit zuhörte, schien bei den letzten Worten zu erschrecken.
»Sie fürchten doch nicht etwa einen tödlichen Ausgang?« fragte er rasch und gepreßt. »Das wäre allerdings sehr traurig.«
»Wer weiß!« sagte der Arzt ernst. »Vielleicht wäre es das beste für den Mann. Der Verlust seines »Darling« hat ihn ja doch ruiniert, und ich glaube nicht, daß er selbst noch Freude gehabt hat an dem Leben, das er in der letzten Zeit führte. Für das Kind war es auch kein Segen, in solchen Verhältnissen und Umgebungen aufzuwachsen, obgleich der Vater es abgöttisch liebte. Ich werde jedenfalls mein möglichstes thun, ihn zu retten, aber viel Hoffnung habe ich nicht.«
Es trat eine Pause ein. Sonneck sah stumm zu Boden, endlich begann er wieder in einem Tone, durch den eine mühsam unterdrückte Bewegung zitterte: »Herr von Bernried scheint nicht besonders beliebt zu sein in Kairo. Man kümmert sich sehr wenig um ihn und seinen Unfall und spricht fast mehr von seinem ›Darling‹ als von ihm. Man begegnete ihm ja auch nie in der eigentlichen Gesellschaft, und Herr von Osmar empfing ihn überhaupt nicht in seinem Hause.«
Der Arzt zuckte mit sehr bezeichnender Miene die Achseln.
»Das ist begreiflich, der deutsche Generalkonsul hat seine Stellung zu wahren und muß sich Persönlichkeiten fernhalten, denen doch mehr oder weniger Bedenkliches anhaftet. Bernried ist ja allerdings von altem deutschen Adel und spielt in der Sportswelt eine Rolle; Freunde hat er aber nie besessen und sein Treiben war auch nicht danach. – Doch da kommt Herr Ehrwald, er scheint Sie zu suchen. Ich will nur noch mit meinem Kollegen sprechen und fahre dann sofort nach dem Hospital hinaus.«
Der Arzt grüßte und ging. Es war in der That Ehrwald, der jetzt den Gesuchten entdeckt hatte und rasch näher kam. Sonneck fuhr mit der Hand über die Stirn, als wollte er irgend eine quälende Erinnerung fortscheuchen, dann ging er dem jungen Manne entgegen und bot ihm die Hand.
»Kann man endlich deiner habhaft werden, du Held des Tages,« sagte er. »Ich konnte dir vorhin nur aus der Ferne zuwinken, so umdrängt warst du von allen Seiten. Meinen Glückwunsch, Reinhart! Du hast ja glänzend gesiegt!«
»Habe ich es gut gemacht?« fragte Reinhart mit aufleuchtenden Augen.
»Beinahe zu gut, denn ich fürchte, man wird dich gründlich verderben mit all der Bewunderung und den Schmeicheleien. Aber warum hast du denn mit aller Welt Komödie gespielt und dich für einen höchst mittelmäßigen Reiter ausgegeben, um erst heute zu zeigen, was du kannst?«
»Weil es mir Spaß machte,« versetzte Ehrwald. »Was war das für eine Verwunderung und für ein Achselzucken, als es bekannt wurde, daß ich mich mit ›Faida‹ in die Bahn wagen wollte, wo der vielbewunderte ›Darling‹ lief! Kein Mensch ahnte, was das Tier wert war, am wenigsten der Konsul selbst, nur Fräulein von Osmar hatte unbedingtes Vertrauen.«
»Fräulein von Osmar – so?« Sonneck streifte mit einem eigentümlich forschenden Blick das Gesicht des jungen Mannes. »Nun, vielleicht galt ihr Vertrauen ebensosehr dem Reiter wie dem Roß.«
»Vielleicht! Jedenfalls habe ich es nicht getäuscht,« sagte Reinhart leichthin.
Sie hatten während des Gespräches den Rückweg angetreten, blieben aber diesmal außerhalb der Schranken, mitten unter der Volksmenge. Sonneck, dessen Namen man in ganz Europa kannte als den eines der kühnsten und erfolgreichsten Afrikaforscher, schien auch hier in Kairo vielfach gekannt zu sein, denn man machte ihm überall ehrerbietig Platz.
Er war kleiner als der schlanke, hochgewachsene Ehrwald, eine mittelgroße, sehnige Gestalt. Das dunkelgebräunte Antlitz mochte in der Jugend schön gewesen sein, jetzt war es tief durchfurcht von all den Linien, die ein ganzes Leben voller Kämpfe und Gefahren, voll Anstrengungen und Entbehrungen darin eingegraben hatte. Das dunkle Haar des kaum vierzigjährigen Mannes zeigte an den Schläfen schon einen weißen Schimmer und in den tiefen grauen Augen lag ein schwermütiger Ernst, der nur selten von einem flüchtigen Lächeln verdrängt wurde.
Er sah schweigsam und zerstreut dem Wettfahren zu, das jetzt auf der Rennbahn stattfand, und plötzlich wandte er sich an seinen jungen Gefährten mit der Frage: »Weißt du, daß der Sturz des Herrn von Bernried ein sehr schwerer gewesen ist?«
Ehrwald sah betroffen auf. »Nein, ich hörte das Gegenteil. Man sagte, daß seine Verletzungen nicht bedenklich sind.«
»So sagte man; aber Doktor Walter, den ich soeben sprach, scheint die Sache sehr ernst zu nehmen. Wir wollen morgen zu ihm gehen und uns erkundigen, wie es steht. – Uebrigens, Reinhart, es war nicht nötig, daß du das letzte Hindernis in dieser tollkühnen Weise nahmst, anstatt einfach darüber hinwegzusetzen. Der Luftsprung hätte dir den Hals kosten können und der armen ›Faida‹ dazu. Solche Kunststücke gehören in den Cirkus, für die Rennbahn passen sie nicht.«
»Ich habe es auch im Cirkus gelernt,« sagte Reinhart lachend.
Sonneck stutzte und sah ihn befremdet an.
»Wo hast du das gelernt?«
»Im Cirkus, bei den Kunstreitern. Ich bin ja fast ein Jahr lang mit ihnen herumgezogen.«
»So? Und das erfahre ich erst heute?«
»Sie fragten mich ja nicht, und ich hatte bisher noch keine Veranlassung, davon zu sprechen. Ein Geheimnis wollte ich Ihnen nicht daraus machen, oder – nehmen Sie Anstoß daran?«
»Nein,« entgegnete Sonneck ruhig. »Ich schenke selten einem Menschen unbedingtes Vertrauen, geschieht es aber einmal, dann pflege ich auch nicht viel mehr zu fragen und zu forschen. Du hast mir offen bekannt, was dich aus deiner Heimat fortgetrieben hat, das ist mir genug, aber du scheinst dich doch bisweilen in etwas bedenklicher Gesellschaft umhergetrieben zu haben. Ich glaube, es war Zeit, daß du wieder in andere Kreise kamst.«
Ueber die Züge des jungen Mannes legte sich ein tiefer Schatten und seine Stimme klang in unterdrückter Bewegung, als er antwortete: »Ja, es war hohe Zeit! Man fühlt es ja selbst, wie man verwildert in solchen Umgebungen, und kann's doch nicht ändern. Ich hatte keine Wahl, wie ich mein Brot verdienen wollte, und leben mußte ich doch. Aber wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn Sie mir nicht rechtzeitig die Hand gereicht und mich emporgerissen hätten! Viel Worte habe ich freilich nicht gemacht mit meinem Danke. Sie wollen es ja nicht; aber ich hoffe, ihn dereinst abtragen zu können.«
»Schon gut,« wehrte Sonneck ab, »du wirst auf unserem Zuge Gelegenheit genug dazu haben. Nun weiß ich doch wenigstens, woher dein tolles Reiten stammt! Aber diese Kunstreiterstücke verbitte ich mir ein für allemal. Ich bestreite dir entschieden das Recht, dir schon hier in Kairo Hals und Beine zu brechen, später geben sich solche Thorheiten von selbst. Wenn man von Gefahren aller Art umringt ist und sich sein Leben täglich erst erkämpfen muß, dann setzt man es nicht mehr so leichtsinnig aufs Spiel um einer bloßen Eitelkeit willen.«
»Wären wir nur erst draußen!« rief Reinhart aufflammend. »Sie ahnen nicht, wie ich mich danach sehne. Wann endlich ziehen wir hinaus?«
»Sobald ich die nötigen Leute und die nötigen Mittel zur Verfügung habe, und das kann noch wochenlang dauern. Mir macht das wahrlich kein Vergnügen, denn mit jeder Woche geht ein Teil der besten Reisezeit verloren. Aber dir ist Kairo ja noch neu und fremd, du mußt ja förmlich berauscht sein von all den Eindrücken, und nach dem heutigen Tage wirst du vollends Glück in der Gesellschaft machen – zumal bei den Frauen!«
Es war derselbe forschende Blick wie vorhin, der bei den letzten Worten das Antlitz des jungen Mannes streifte; aber dieser warf beinahe unwillig den Kopf zurück und seine Lippen kräuselten sich verächtlich. »Was kümmern mich die Frauen. Mich zieht es in die Ferne. Hier ist alles noch so zahm und europäisch, hier ist man noch eingeengt von tausend Formen und Fesseln; aber wenn ich droben auf jenen Höhen stehe und in die Wüste hinausblicke, die sich so weit, so endlos vor mir ausdehnt, dann ist's mir immer, als wäre dort allein, in dieser grenzenlosen Weite die Freiheit zu finden – die Freiheit und das Glück!«
Ueber Sonnecks Gesicht zog ein flüchtiges Lächeln bei diesem stürmischen Ausbruch, aber seine Stimme klang tiefernst, als er sagte: »Du wirst dich auch noch bescheiden lernen. Fesseln gibt es überall, und wenn man sie sich selbst schmieden sollte, und ein Glück ist diese schrankenlose Freiheit nicht! Es kommt eine Zeit, wo man sie gern hingäbe für – doch was nützt das Predigen! Solch ein vierundzwanzigjähriger Feuerkopf glaubt ja doch nicht, was ihm der Erfahrene sagt, und will alles besser wissen. Dich muß das Leben erst in die Schule nehmen, einstweilen bin ich dein Mentor und werde dafür sorgen, daß du nicht gar zu tolle Streiche machst.«
Die Volksmenge kam jetzt in Bewegung, das Wettfahren war zu Ende und damit die letzte Nummer des Programms erledigt, auch die Zuschauer auf den Tribünen brachen auf. Der ganze Platz vor der Rennbahn war gefüllt mit an- und abfahrenden Wagen und dazwischen drängten sich Reiter und Fußgänger.
Herr von Osmar saß mit seiner Tochter bereits im Wagen, und am Schlage stand Lord Marwood, der sich etwas umständlich von der jungen Dame verabschiedete. Er mußte aber leider die Bemerkung machen, daß sie sehr zerstreut war und kaum zuhörte. Sie schien irgend etwas in der Menge zu suchen und mußte es wohl jetzt gefunden haben, denn die dunklen Augen strahlten plötzlich auf, während eine leise Röte das schöne Antlitz färbte. Francis folgte der Richtung jenes Blickes, dort drüben stand Sonneck mit Reinhart Ehrwald und beide grüßten herüber. Der junge Lord biß sich auf die Lippen, er brach plötzlich das Gespräch ab und trat mit kühlem Gruße zurück. Der »Abenteurer«, auf den er so vornehm herabsah, war ihm bisher nur unbequem gewesen, jetzt sah es beinahe aus, als könne er gefährlich werden.
»Erlauben Sie, daß wir uns Ihnen vorstellen, Herr Doktor! Sie sind zwar ein Arzt, aber Herr Sonneck sagt, Sie wären trotzdem ein guter Mensch, und ich hoffe, daß er recht hat. Sie sehen wirklich nicht schlimm aus.«
Doktor Walter, dem diese merkwürdige Anrede galt, verneigte sich leicht vor den beiden Damen, die soeben in sein Sprechzimmer getreten waren, und erwiderte, ein Lächeln unterdrückend: »Ich kann Ihnen die Versicherung geben, daß ich in der That nicht schlimm bin. Sie scheinen das leider bei meinen sämtlichen Kollegen vorauszusetzen.«
»Ich habe meine Erfahrungen!« sagte die Dame mit Nachdruck. »Aber, wie gesagt. Sie sehen ganz menschenfreundlich aus, und überdies sind Sie ein Deutscher, da werden Sie Ihre Landsmänninnen, zwei verlassene, hilflose Frauen, die nach diesem schändlichen Wüstenlande verschlagen sind, nicht schlecht behandeln.«
Die Bezeichnungen »verlassen« und »hilflos« paßten eigentlich nicht zu der Persönlichkeit der Sprechenden, die schon in vorgerückten Jahren stand. Sie war schwarz gekleidet und trug einen ungeheuren Sonnenschirm in der Hand, sah aber nichts weniger als hilfsbedürftig aus. Es war eine lange, hagere Gestalt, mit scharfen Zügen und sehr energischem Gesichtsausdruck. Ihre junge Begleiterin, ein zartes kleines Wesen, mit einem lieblichen, etwas blassen Gesicht, blondem Haar und hellen Augen, war gleichfalls in Trauer gekleidet. Sie sah ungemein schüchtern und ängstlich aus und hielt sich dicht an der Seite ihrer Gefährtin, als müßte sie Schutz bei derselben suchen.
»Es ist durchaus nicht meine Gewohnheit, meine Patienten schlecht zu behandeln,« erklärte der Doktor, der Mühe hatte, ernst zu bleiben, »also, meine gnädige Frau –«
»Unvermählt!« unterbrach ihn die Dame in einem beinahe entrüsteten Tone.
»Ich bitte um Entschuldigung. Also, mein Fräulein, womit kann ich Ihnen dienen?«
Das Fräulein sah ihn noch einmal scharf an, wie um sich zu versichern, ob es ihm mit der zugesagten guten Behandlung ernst sei, schien dann aber in der That Vertrauen zu fassen und begann nun in aller Form die Vorstellung.
»Mein Name ist Mallner, Fräulein Ulrike Mallner, aus Martinsfelde in Hinterpommern. Mein seliger Bruder war Gutsbesitzer, vor zwei Jahren ist er gestorben, und dies hier ist seine Witwe, Frau Selma Mallner, geborene Wendel. Vor acht Tagen sind wir in Kairo angekommen und wir wären wie verraten und verkauft hier, wenn sich Herr Sonneck nicht unser angenommen hätte. Wir wohnen in dem gleichen Hotel und er ist der einzige Mensch dort, unter all den Engländern und Amerikanern, er hat uns zu Ihnen geschickt. So, Herr Doktor, nun wissen Sie Bescheid und nun geben Sie uns Ihren ärztlichen Rat!«
»Sehr gern,« entgegnete Walter, während er mit einem etwas verwunderten Blick die junge Witwe streifte, die höchstens zwei- oder dreiundzwanzig Jahre alt sein konnte. »Wenn Sie mir nur erst sagen wollten, wem ich diesen Rat geben soll und wer von Ihnen eigentlich die Patientin ist.«
»Nun, Selma natürlich,« sagte Fräulein Mallner, in deren Schätzung der Arzt offenbar bedeutend sank, weil er das nicht gleich herausfand. »Sie hustet, und deshalb mußten wir nach Afrika schwimmen. Wenn man in meiner Jugendzeit den Husten hatte, trank man Brustthee, und das half immer; jetzt wird man nach allen möglichen Weltteilen geschickt, und das hilft natürlich nicht, denn wir sind schon eine volle Woche hier und Selma hustet noch immer! Die Aerzte wissen ja gar nicht mehr, was sie alles erfinden sollen, um die arme Menschheit zu plagen –«
»Aber, Ulrike, ich bitte dich!« mahnte die junge Frau leise und ängstlich und zupfte ihre Schwägerin am Kleide; diese nahm sich denn auch zusammen und lenkte ein.
»Ja so! Nun, Sie sind natürlich nicht gemeint, Herr Doktor, Sie dürfen mir das nicht übelnehmen, denn –«
»Die Anwesenden sind immer ausgenommen!« ergänzte Walter, dem die Sache außerordentlichen Spaß machte. »Seien Sie unbesorgt, mein Fräulein, Ihnen nehme ich nichts übel. Jetzt aber möchte ich doch einiges Nähere wissen. Seit wie lange sind Sie leidend, gnädige Frau, und wie äußert sich dies Leiden?«
Er wandte sich direkt an die junge Frau, und diese machte auch einen schüchternen Versuch, zu antworten, aber die Schwägerin schnitt ihr ohne weiteres das Wort ab.
»Bei Selmas Lunge ist etwas nicht in Ordnung,« erklärte sie. »Der rechte Flügel oder der linke, oder alle beide, ich weiß das nicht mehr so genau, genug, irgend etwas ist los mit den Flügeln. Es heißt, sie hätte sich bei der Pflege meines Bruders überanstrengt. Er war jahrelang krank und wir haben zwei Aerzte gehabt, aber helfen konnten sie ihm natürlich nicht. Die Aerzte können ja alles mögliche, nur nicht ihre Patienten gesund machen. Beruhige dich, Selma, du hörst es ja, der Herr Doktor nimmt nichts übel.«
Walter verlor diesem letzten Ausfall gegenüber denn doch einigermaßen die Geduld. Er hatte eine scharfe Antwort auf den Lippen, aber die Augen der jungen Frau waren so bittend und ängstlich auf ihn gerichtet, daß er beschloß, die rücksichtslose Dame von der komischen Seite zu nehmen. Sie ließ sich auch in ihrem Redefluß durchaus nicht stören.
»Unser Hausarzt hatte sich in den Kopf gesetzt, daß ein Klimawechsel notwendig wäre, und wollte uns durchaus nach Italien schicken. Ich lachte ihn natürlich aus und wir blieben, wo wir waren. Wir haben die gesundeste Luft in Martinsfelde, nie mehr als sechzehn Grad Kälte im Winter, und das bißchen Sturm von der See ist nicht der Rede wert! Aber Selmas Husten wurde immer ärger, und da ließ ich mir unglücklicherweise beikommen, eine sogenannte Autorität zu fragen, den Geheimrat Felder aus Berlin, der auf einem Nachbargute bei Verwandten zum Besuche war. Er kam, untersuchte und dann sagte er kurz und bündig: ›Nach Kairo!‹«
»So, Geheimrat Felder hat Sie hergeschickt!« schaltete der Doktor ein. Fräulein Ulrike nickte grimmig mit dem Kopfe.
»Ja, der! Die große Autorität hat uns auf dem Gewissen! Ich dachte, mich sollte der Schlag treffen, und sträubte mich mit Händen und Füßen, aber da wurde die Autorität grob – so grob ist noch niemand zu mir gewesen – und sagte mir ins Gesicht, wo die Mittel so reichlich vorhanden wären, könnte von einer Weigerung überhaupt nicht die Rede sein. Unser Hausarzt stand ihm natürlich in allen Stücken bei und schließlich drohten sie mir, meine Schwägerin auf eigene Hand nach Kairo zu schicken. Da blieb mir denn nichts anderes übrig als zu packen. Wir reisten ab, schwammen über das Mittelmeer, und nun« – sie trat einen Schritt vor und sah den Arzt herausfordernd an – »nun sind wir da!«
»Das sehe ich,« sagte Walter ruhig. »Und da Sie nun meinen Rat wünschen, so werde ich Frau Mallner zuvörderst untersuchen, dann wird sich das weitere finden. Ich bitte, hier einzutreten, gnädige Frau!«
Er öffnete die Thür des Nebenzimmers, ließ die junge Frau vorangehen und wollte folgen, war aber genötigt, ihrer Schwägerin den Weg zu vertreten, die schon auf der Schwelle stand.
»Ich gehe mit,« erklärte sie sehr entschieden.
»Bitte, Sie bleiben hier,« versetzte der Doktor noch weit entschiedener und schlug ihr die Thür vor der Nase zu.
»Einer wie der andere!« sagte Ulrike entrüstet und setzte sich so nachdrücklich in einen Armstuhl, daß dieser in allen Fugen krachte.
Zum Glück blieb sie nicht lange ihren grollenden Gedanken überlassen, denn der arabische Diener öffnete die Thür des Vorzimmers und ließ Sonneck ein, der sich mit freundlichem Gruße näherte.
»Ah, Fräulein Mallner! Sie haben von meiner Empfehlung Gebrauch gemacht, wie ich sehe. Wo ist denn Ihre Frau Schwägerin?«
Das Fräulein begrüßte den Landsmann, der offenbar hoch in ihrer Gunst stand, wie einen guten Kameraden, indem sie ihm derb die Hand schüttelte, und deutete dann auf die geschlossene Thür.
»Da drinnen, bei dem Doktor! Er will ihre Lunge untersuchen, und mich hat er ohne weiteres ausgesperrt. Ihr vielgerühmter Doktor Walter ist auch kein weißer Rabe, trotz all seiner Höflichkeit und Liebenswürdigkeit. Sobald der Arzt zum Vorschein kommt, wird er grob – so sind sie alle!«
»Ja, so sind sie nun einmal,« stimmte Sonneck lächelnd bei. »Ich kann Ihnen aber die Versicherung geben, daß Frau Mallner sich in den besten Händen befindet. Doktor Walter hat einen ganz bedeutenden Ruf und gilt für eine Autorität –«
»Bleiben Sie mir mit den Autoritäten vom Leibe!« rief Ulrike zornig. »Ich habe genug an dem Berliner Geheimrat. Wenn mein seliger Martin wüßte, daß ich mit seiner Frau hier in Afrika umherlaufe, er würde sich im Grabe umdrehen, dreimal hintereinander!«
»Frau Mallner hat wohl sehr jung geheiratet?« fragte Sonneck, während er neben der erzürnten Dame Platz nahm.
»Mit siebzehn Jahren. Wir hatten sie als Kind in das Haus genommen, als arme Waise, weil wir mit ihren Eltern weitläufig verwandt waren, und als sie herangewachsen war, setzte mein Bruder es sich auf einmal in den Kopf, sie heiraten zu wollen. Ich sagte anfangs nein.«
»Und Sie hatten natürlich die entscheidende Stimme im Hause,« warf der Zuhörer mit kaum verhehltem Spotte ein.
»Natürlich, Martin that nichts ohne meine Zustimmung, aber er grämte sich, denn er hatte sich im vollen Ernste verliebt in das junge Ding, trotzdem er längst graue Haare hatte. Er war auch schon lange kränklich, ich hatte die Gutswirtschaft fast allein in Händen und konnte nicht auch noch Krankenpflegerin sein. Ich überlegte mir also die Sache noch einmal und fand, daß es schließlich das beste sei, ihm den Willen zu thun.«
»Und das junge Mädchen hat gleichfalls eingewilligt?«
»Eingewilligt?« wiederholte Ulrike mit unermeßlichem Erstaunen. »Nun, ich hoffe, sie hat Gott auf den Knieen gedankt für das große Glück, das er einer armen Waise zu teil werden ließ! Sie war auch anfangs ganz bestürzt, als wir ihr die Sache ankündigten, und weinte – vor Freude natürlich! Leicht hat sie es freilich nicht gehabt in ihrer dreijährigen Ehe. Mein seliger Martin war kein geduldiger Kranker, da hieß es Tag und Nacht auf den Beinen sein, und im letzten Jahre ist sie überhaupt nicht aus dem Krankenzimmer herausgekommen. Ich war im ganzen mit ihr zufrieden, sie that, was sie konnte.«
»Und dann erkrankte die junge Frau infolge der Ueberanstrengung?« Es lag ein tiefes Mitleid in der Frage; das Fräulein zuckte verächtlich die Schultern.
»Jawohl, solch ein schwächliches Ding kann ja gar nichts aushalten! Es war ja nicht so arg mit Selmas Krankheit, sie war bald wieder auf den Beinen, aber der Husten blieb. Das dauerte Jahr und Tag, und dann kam die große Autorität, der Geheimrat, und da war's aus, rein aus, wir mußten nach Kairo!«
Es sprach eine so grimmige Verzweiflung aus den letzten Worten, daß Sonneck ein Lächeln nicht unterdrücken konnte.
»Sie scheinen das als ein großes Opfer zu betrachten,« bemerkte er. »Aber Sie haben mir ja selbst erzählt, daß Martinsfelde ganz einsam liegt und Sie fast gar keinen Verkehr dort haben. Da müßte es doch eine Freude sein für Sie und besonders für die junge Frau, einmal in die weite Welt hinauszukommen und fremde Länder und Menschen zu sehen.«
»Für Selma?« wiederholte Fräulein Mallner in gedehntem Tone. »Nun, ich wollte ihr nicht raten, Geschmack daran zu finden! Denken Sie, ich werde der Witwe meines Bruders erlauben, in der Welt umherzureisen? Einmal habe ich nachgegeben, weil es hieß, ihr Leben stände auf dem Spiel; aber zum zweitenmal geschieht es nicht wieder. Im Frühjahr reisen wir nach Martinsfelde zurück, mit oder ohne Husten! Dahin gehört Selma und da soll sie bleiben, ihr Leben lang!«
Sie stieß zur Bekräftigung der Worte nachdrücklich ihren Schirm auf den Boden. In diesem Augenblick trat der Arzt mit seiner Patientin wieder ein, begrüßte Sonneck und wandte sich dann zu der harrenden Dame, die ihn mit einem erwartungsvollen »Nun?« empfing.
»Ich schließe mich ganz der Meinung meiner Kollegen an,« erklärte er. »Der Winteraufenthalt in Aegypten ist unbedingt notwendig für Frau Mallner. Augenblicklich ist sie noch sehr angegriffen von der Reise, ich werde sie deshalb einige Wochen lang hier in Kairo behandeln und später nach einer der großen Nilstationen, wahrscheinlich nach Luksor, schicken.«
»Schicken Sie uns doch lieber gleich zu den Botokuden!« rief das Fräulein wütend. »Selma, du bringst mich noch um mit deinem Husten, nach Afrika hast du mich schon damit gebracht!«
»Ich kann ja nicht dafür, liebe Ulrike,« bat die junge Frau so demütig, als habe sie wirklich ein Unrecht begangen. »Du weißt, ich habe es nicht gewollt.«
»Nein, du wolltest es nicht,« grollte das Fräulein, »aber die Aerzte wollten es, diese Autoritäten, diese –« sie verschluckte die ferneren Liebenswürdigkeiten und sah den Doktor nur mit einem vernichtenden Blicke an, was dieser in großer Gemütsruhe ertrug.
»Wenn Ihnen der Aufenthalt hier so unangenehm ist, so ließe sich ja wohl ein Ausweg finden,« bemerkte er kühl. »Es wird nicht schwer sein, eine ältere deutsche Dame ausfindig zu machen, die die Stelle einer Gesellschafterin bei Frau Mallner übernimmt. Ich mache mich anheischig, das zu vermitteln. Also reisen Sie in Gottes Namen zurück nach Ihrem Hinterpommern, mein Fräulein, Ihre Schwägerin ist hier ganz gut aufgehoben.«
»Ohne mich?« rief Ulrike starr vor Erstaunen und Empörung. »Ohne mich? Ja, was denken Sie sich denn eigentlich, Herr Doktor? Mein seliger Bruder hat mir auf dem Sterbebette seine Frau übergeben und mir das Versprechen abgenommen, nicht von ihrer Seite zu weichen, und Sie muten mir zu, sie allein zu lassen hier in dem fremden Weltteil! Oder möchtest du das etwa, Selma?«
»O gewiß nicht,« versicherte die junge Frau, mit einem halb furchtsamen, halb dankbaren Aufblick zu der gestrengen Schwägerin. »Ich habe ja niemand als dich auf der Welt, Ulrike! Laß mich nicht allein!«
»Sei ruhig, ich bleibe bei dir,« erklärte das Fräulein gnädig und warf einen triumphierenden Blick auf den Doktor, der nur die Achseln zuckte.
»Wenn Frau Mallner Ihr Bleiben wünscht, habe ich natürlich nichts dagegen einzuwenden. Also ich komme übermorgen zu Ihnen, gnädige Frau, und bitte, einstweilen meine Verordnungen pünktlich zu befolgen. Ihnen aber, mein Fräulein, möchte ich zu bedenken geben, daß Ihre Schwägerin eine sehr zarte Natur ist, die der äußersten Schonung bedarf. Auf Wiedersehen, meine Damen!«
Er begleitete die beiden Damen bis zur Thür und kehrte dann zu Sonneck zurück, der ein schweigsamer Zuhörer geblieben war.
»Das ist ja eine merkwürdige Praxis, die Sie mir da zugewiesen haben,« sagte er lachend. »Dies streitbare Fräulein aus Hinterpommern, das mit allen Aerzten in wütender Fehde lebt und unsereinem fortwährend Injurien ins Antlitz schleudert, ist wirklich ein Original.«
»Das ist sie,« stimmte Sonneck bei. »Sie steht auch fortwährend auf dem Kriegsfuße mit dem Direktor unseres Hotels und der arabischen Dienerschaft. Ich habe da schon verschiedenemal Frieden stiften müssen und die arme kleine Frau scheint sich willenlos ihrem Scepter zu beugen. – Ist der Fall ein schwerer?«
»Nein, durchaus nicht. Ich habe der jungen Frau die besten Hoffnungen geben können und hoffe, sie vollständig herzustellen. Aber über einen anderen Fall kann ich Ihnen leider nichts Tröstliches berichten. Sie wollen doch wohl hören, wie es mit Herrn von Bernried steht?«
»Allerdings, deshalb komme ich zu Ihnen. Nun?«
»Sein Zustand ist hoffnungslos. Ich sah und wußte es schon gestern, als ich die Untersuchung im Hospital vorgenommen hatte, und als ich heute morgen wieder bei ihm war, sah ich, daß auch ein Hinfristen nicht möglich ist. Ich gebe ihm höchstens noch vierundzwanzig Stunden, und wahrscheinlich geht es noch weit schneller zu Ende, denn die Kräfte sinken ungemein rasch.«
»Also doch!« murmelte Sonneck, und als verließe ihn plötzlich die Selbstbeherrschung, trat er rasch an das Fenster und preßte die Stirn gegen die Scheiben.
»Sie nehmen tieferen Anteil an dem Manne,« sagte Walter nach einer kurzen Pause. »Ich sah es schon gestern bei unserem Gespräch. Haben Sie ihn früher gekannt?«
Sonneck wandte sich um, und man las es in seinen Zügen, wie tief ihn der Ausspruch getroffen hatte.
»Ja, Doktor, wir sind einst Freunde gewesen, Jugendfreunde – bis etwas geschah, was uns trennte. Erlassen Sie es mir, Ihnen das zu erzählen, ich kann es nicht über mich gewinnen in dieser Stunde und ich will nichts aussprechen, was wie eine Anklage klingt. Wir haben uns lange Jahre hindurch nicht wiedergesehen, bis ich ihm vor einigen Wochen hier in Kairo begegnete. Von seinem äußeren Leben erfuhr ich genug, er ist ja bekannt in der ganzen Sportswelt, aber Sie scheinen ihn doch näher gekannt zu haben. Ich hörte, Sie seien früher oft in sein Haus gekommen.«
»Allerdings, denn ich habe Frau von Bernried bis zu ihrem Tode behandelt. Sie war schon krank, als sie vor drei Jahren hierher kamen, und siechte langsam dahin. Man sah es noch, daß sie sehr schön gewesen war, und es heißt ja auch, Bernried habe um ihretwillen mit seiner Familie gebrochen.«
»Ja, er warf damals alles hin, um seiner Leidenschaft zu folgen. Wenn sie nur wenigstens stand gehalten hat! War die Ehe glücklich?«
»Ich glaube kaum. Ein Mann vergibt es der Frau selten, wenn er um ihretwillen Reichtum und Lebensstellung opfern muß. Mag sie noch so schuldlos daran sein, sie muß das früher oder später büßen, wenn die Leidenschaft verraucht ist. Als ich Bernried kennen lernte, war er schon tief verbittert, zerfallen mit sich und der Welt, angewidert von dem Leben, das doch seine einzige Hilfsquelle war. Ich fürchte, die arme Frau hat das oft entgelten müssen. Wahrhaft geliebt hat er wohl nur eins auf Erden – sein Kind!«
Sonneck erwiderte nichts, er nickte nur stumm, als habe er diese Auskunft erwartet, wahrend der Arzt fortfuhr: »Wie oft habe ich später versucht, ihn zu bestimmen, die Kleine irgend einer deutschen Familie zur Erziehung anzuvertrauen. Was sollte denn aus ihr werden, wenn sie den größten Teil des Tages einer unwissenden Bonne überlassen blieb, während der Vater sich in den Spielklubs und auf den Rennplätzen umhertrieb. Aber alle Vorstellungen waren umsonst; er behauptete, nicht leben zu können ohne die Nähe des Kindes, an dem er mit unsinniger Zärtlichkeit hing. Ich glaube, er hatte ein instinktmäßiges Gefühl, daß diese Nähe allein noch ihn vor dem Schlimmsten, vor dem völligen Sinken bewahrte, und klammerte sich daran wie an einen Rettungsanker.«
»Ich war heute morgen in seinem Hotel, um nach dem Kinde zu sehen,« sagte Sonneck gepreßt. »Ich hörte aber, Sie seien bereits dagewesen und hätten es mit sich genommen.«
»Ja, ich habe die Kleine zu meiner Frau gebracht, die von jeher eine große Zuneigung für sie hegte, und einstweilen bleibt sie bei uns. Kennen Sie die Verhältnisse näher? Bernried war in dieser Hinsicht sehr verschlossen und sprach nie von seiner Familie, und doch wird man sich an sie wenden müssen.«
»Von den Bernrieds ist nichts zu erwarten,« erklärte Sonneck mit Bestimmtheit. »Sie haben sich dieser Heirat von Anfang an mit vollster Feindseligkeit gegenübergestellt, und das Kind gilt in ihren Augen ebensowenig für ebenbürtig wie die Mutter. Es ist ein hochmütiges, ahnenstolzes Geschlecht. Ich werde dem Großvater der Kleinen, dem Professor Helmreich, Nachricht geben, der jetzt in Kronsberg lebt. Aber vielleicht trifft Bernried selbst noch irgend eine Bestimmung. Ist er bei Besinnung?«
»Bis jetzt nur auf Minuten; aber ich glaube, daß vor dem Tode noch einmal volle Klarheit eintreten wird. Das geschieht oft in solchen Fällen und dann wird er zweifellos nach seinem Kinde verlangen.«
Sonneck schien einige Sekunden lang mit sich zu kämpfen, dann sagte er: »Darf ich ihn sehen?«
»Wenn Sie es wünschen, gewiß. Eine Aufregung ist hier nicht mehr zu fürchten, und vielleicht ist Ihr Kommen noch eine letzte Freude für den Mann, um den sich sonst wohl keiner kümmern wird. Ich fahre heute gegen Abend noch einmal hinaus nach dem Hospital, Sie brauchen mich dort nur aufzusuchen. – Aber jetzt kommen Sie mit hinunter in den Garten, meine Frau ist dort mit der kleinen Elsa, ich möchte Ihnen das Kind zeigen.«
Als die beiden die Treppe hinunterschritten, begegnete ihnen Reinhart Ehrwald, der beim Doktor ein Zusammentreffen mit Sonneck verabredet hatte und ebenfalls kam, um zu hören, wie es mit dem Manne stehe, dem die gestrige Niederlage so verhängnisvoll geworden war. Er schloß sich auf die Einladung des Doktors den Herren an.
Der Garten des Walterschen Hauses lag wie eine kleine grüne Oase mitten in dem Häusermeer der Stadt. Hier duftete und blühte alles in tropischer Fülle und Pracht, und der zierlich gedeckte Frühstückstisch gab dem Orte etwas ungemein Trauliches und Behagliches. Eine Dame war eben beschäftigt, den Thee zu bereiten, und ein kleines Mädchen von sieben oder acht Jahren jagte sich im lustigen Spiel mit einem winzigen weißen Hündchen umher.
»Da bringe ich dir die beiden Wüstenhelden!« sagte der Doktor scherzend, indem er mit seinen Gästen an den Tisch trat. Frau Walter, eine noch junge Frau mit feinen, anmutigen Zügen, begrüßte die beiden Herren, die sie bereits kannte, mit einfacher Liebenswürdigkeit und lud sie freundlich ein, an dem Frühstück teilzunehmen.
»Ich kann leider noch nicht den mindesten Anspruch auf den Titel machen, den mir der Herr Doktor gibt,« sagte Ehrwald, indem er den angebotenen Platz einnahm. »Ich habe vorläufig nur den guten Willen, ihn zu verdienen.«
»Und die nötige Tollkühnheit dazu, das haben wir gestern bei dem Rennen gesehen,« ergänzte Walter und wandte sich dann zu dem Kinde, das sein Spiel unterbrochen hatte und neugierig herbeikam, um die Fremden anzuschauen.
»Komm her, Elsa, und gib diesem Herrn die Hand, es ist ein Freund deines Papa!«
Die Kleine gehorchte und bot Sonneck zutraulich das Händchen. Es war ein allerliebstes kleines Geschöpf, schlank und zierlich wie eine Elfe, mit einem rosigen Kindergesicht, aus dem ein Paar großer dunkelblauer Augen hervorblickte. Das blonde Haar, das einen leicht rötlichen Schimmer hatte, fiel offen über Hals und Schultern, deren zarte Farbe es nicht verriet, daß das Kind schon mehrere Jahre lang unter der afrikanischen Sonne lebte. Sein weißes Kleidchen war reich mit Spitzen besetzt, und an seinem Halse funkelte ein Medaillon von feinster arabischer Goldarbeit. Das ganze kleine Wesen war Lust und Leben, und als es jetzt, erhitzt vom Spiel, mit beiden Händen die Haare aus dem Gesicht strich und die Fremden anlachte, da sah es so reizend aus, daß Sonneck es mit einer fast leidenschaftlichen Zärtlichkeit an sich zog und küßte.
Klein-Elsa ließ sich das ruhig gefallen und mit jener Wichtigkeit, mit der Kinder eine Neuigkeit erzählen, sagte sie: »Mein Papa ist verreist, aber er kommt bald zurück, sehr bald, und dann bringt er mir etwas Schönes mit, sagt der Onkel Doktor. Du kennst auch den Papa?«
»Ja, mein Kind,« entgegnete Sonneck, und sich niederbeugend, setzte er so leise, daß nur das Kind ihn verstehen konnte, hinzu: »Ich habe deinen Papa einst lieb gehabt, sehr lieb!«
Elsa sah ihn an, es war, als habe sie eine Ahnung davon, was in diesen Worten lag, denn plötzlich bot sie, ohne jede Aufforderung, dem fremden Manne den kleinen roten Mund zum Kusse dar.
»Nun will ich aber auch eine Hand und einen Kuß haben, kleine Landsmännin,« sagte Ehrwald. »Ich will nicht leer ausgehen, komm zu mir!«
War es der übermütige, etwas befehlende Ton, oder mißfiel dem Kinde sonst etwas an dem jungen Manne, genug, es rührte sich nicht.
»Nun, Elsa, willst du dem Herrn Ehrwald nicht auch die Hand geben?« mahnte Frau Walter, aber Elsa schüttelte den Kopf und ließ ein sehr entschiedenes »Nein!« hören.
Jetzt legte sich Sonneck ins Mittel und redete der Kleinen freundlich zu, aber vergebens. Sie glitt von seinen Knieen auf den Boden nieder und stand nun da wie ein vollendeter Trotzkopf. Sie stampfte mit dem Füßchen und wiederholte mit vollster Heftigkeit: »Nein! Ich will nicht! Ich will ihn nicht küssen!«
»Ei, wie feindselig!« spottete Reinhart. »Da werde ich mir den versagten Kuß wohl erobern müssen.«
Er streckte die Arme nach dem Kinde aus, aber dies entglitt ihm blitzschnell und lief in den Garten. Der junge Mann sprang ihm nach, und nun begann eine förmliche Jagd zwischen den Bäumen und Gebüschen.
Klein-Elsa machte es ihrem Verfolger schwer genug. Wie ein Pfeil schoß sie vor ihm hin, tauchte dann plötzlich im Gebüsch unter, kam an einer ganz andern Stelle wieder zum Vorschein und entwischte ihm immer wieder, wenn er sie zu fassen glaubte. Das weiße Röckchen und die blonden Haare flatterten, während das Kind wie ein großer weißer Falter durch die blühenden Gesträuche huschte, und Ehrwald hatte so viel Mühe, es zu fangen, wie nur irgend ein Schmetterlingsjäger. Endlich aber erreichte er es doch und trug es zu dem Tische zurück.
»Da habe ich sie!« rief er triumphierend und hielt seine Beute mit beiden Händen hoch empor. »Willst du mich nun küssen, Elsa? Ja oder nein?«
»Nein!« rief die Kleine zornig, während sie vergebliche Versuche machte, sich zu befreien. »Laß mich los! Du sollst mich loslassen!«
»Erst den Kuß!« lachte Reinhart, und ohne sich an das Sträuben seiner kleinen Gefangenen zu kehren, drückte er einen Kuß auf das widerstrebende Gesichtchen.
Das Kind schrie auf, so laut und angstvoll, als habe man ihm irgend ein Leid angethan. Dann aber ballte es die kleine Faust und schlug dem jungen Manne so nachdrücklich in das Gesicht, daß er es betroffen, fast bestürzt aus seinen Armen gleiten ließ. Diesmal machte Elsa keinen Versuch, zu flüchten, sie stand regungslos da, aber all die sonnige Liebenswürdigkeit war plötzlich wie ausgelöscht in dem Wesen des Kindes. Die Hände waren noch geballt, die Zähne zusammengebissen, und das waren auch keine Kinderaugen mehr, die zu Reinhart aufblickten. Es sprühte darin seltsam, beinahe unheimlich, er mußte unwillkürlich an die Augen Bernrieds denken, als dieser gestern seinen Gegner maß, während er jene letzte verzweifelte Anstrengung machte, die ihm den Tod bringen sollte.
»Aber Elsa, wie kannst du so unartig sein! Was soll der fremde Herr von dir denken?« rief Frau Walter. Da regte sich das Kind, es lief zu ihr, barg den Kopf in ihrem Schoß und begann laut und bitterlich zu weinen, sein ganzer Körper bebte in krampfhaftem Schluchzen.
»Das ist die Erziehung oder vielmehr der Mangel an Erziehung von seiten des Vaters,« sagte Walter, aber Sonneck schüttelte leise den Kopf.
»Nein, Doktor, es ist das Blut des Vaters, das sich in dem Kinde verrät. Gerade so wild und maßlos bäumte sich Bernried auf, wenn ihm von Menschen oder Verhältnissen ein Zwang geschah, und seine Tochter hat diese unselige Charakteranlage geerbt.«
»Wenn ich nur wüßte, was mit Elsa in der nächsten Woche geschehen soll,« nahm Frau Walter wieder das Wort, während sie sich bemühte, das noch immer schluchzende Kind zu beruhigen. »Wir haben einen Besuch in Ramleh versprochen, wo in der Familie eines uns befreundeten Landsmannes eine Hochzeit gefeiert wird, und mein Mann hat sich mit Mühe für acht Tage frei gemacht. Mitnehmen können wir die Kleine nicht und ebensowenig sie allein unserer arabischen Dienerschaft überlassen. Ich weiß für den Augenblick wirklich niemand –«
»Ueberlassen Sie das mir,« fiel Sonneck rasch ein. »Ich werde Fräulein von Osmar bitten, sich des Kindes anzunehmen, und bin überzeugt, sie thut es mit Freuden.«
»Das wäre freilich ein Ausweg. Aber der Konsul? Wird es ihm recht sein?«
»Gewiß, er läßt seiner Tochter volle Freiheit in solchen Dingen. Ich verbürge mich für seine Zustimmung.«
»Es wäre nur für acht Tage, dann hole ich mir meinen kleinen Liebling wieder. Am liebsten behielte ich ihn ganz, aber das wird wohl nicht möglich sein.«
»Nein, gnädige Frau, denn der Großvater, Professor Helmreich, wird das Kind jedenfalls beanspruchen. Das düstere Haus des alten, strengen Mannes wird freilich ein trauriger Aufenthalt sein für das sonnige kleine Wesen, aber er überläßt seine Enkelin schwerlich fremden Händen.«
Er hatte mit gedämpfter Stimme gesprochen, um von der Kleinen nicht gehört zu werden, aber diese achtete gar nicht auf das Gespräch. Sie hatte sich nach und nach beruhigt und tröstete sich jetzt mit einem Stück süßen Backwerks, das sie gewissenhaft mit dem bittenden Hündchen teilte.
Am Frühstückstische entspann sich jetzt eine lebhafte Unterhaltung, bei der sich nur Sonneck schweigsam und zerstreut zeigte. Man sah es, wie schwer die Nachrichten über Bernried, die er von dem Arzte empfangen hatte, auf ihm lasteten. Ehrwald sprühte dagegen wie gewöhnlich von Uebermut und spielte den Liebenswürdigen bei Frau Doktor Walter, die sich so wenig wie ihr Mann dem Zauber seiner Persönlichkeit entziehen konnte. Endlich brachen die Herren auf, Sonneck verabredete noch mit dem Doktor die Stunde, wo sie im Hospital zusammentreffen wollten, und wandte sich dann wieder zu dem Kinde.
»Nun, Elsa, willst du mir nicht lebewohl sagen?« fragte er freundlich.
Klein-Elsa besaß jedenfalls einen stark ausgesprochenen Eigenwillen. So entschieden sie sich von Ehrwald abgewandt hatte, so zutraulich zeigte sie sich seinem älteren Freunde gegenüber. Sie kam sofort herbei, bot ihm die Hand und ließ sich zum Abschied küssen.
»Nun, kleine Landsmännin, wollen wir nicht auch Frieden schließen?« sagte Reinhart scherzend. »Du hast mich zwar sehr schlecht behandelt, aber ich will es dir nicht nachtragen.«
Er machte Miene, sich gleichfalls zu nähern, aber es bedurfte nur dieser Bemühung, um sofort wieder die ganze Feindseligkeit des Kindes zu entfesseln. Es flüchtete hinter Sonneck und rief angstvoll und zornig zugleich: »Er soll mich nicht wieder küssen! Nicht wahr, du leidest es nicht?«
»Gewiß nicht,« beschwichtigte Sonneck. »Laß das Kind in Ruhe, Reinhart, du siehst ja, es fürchtet sich vor dir!«
»Fürchten?« wiederholte der junge Mann, halb ärgerlich, halb belustigt durch diesen Widerstand. »Da sind Sie doch im Irrtum. Sehen Sie nur, wie das kleine Ding dasteht, als wolle es sich auf Leben und Tod gegen mich verteidigen! Was habe ich dir denn gethan, du Trotzkopf? Ich habe dich ja nur geküßt.«
Da flammte es wieder auf in den Augen des Kindes, ebenso seltsam wie vorhin, und mit der ganzen früheren Leidenschaftlichkeit rief es: »Ich wollte, du hättest mich lieber geschlagen!«
Reinhart trat unwillkürlich einen Schritt zurück, aber seine Stirn zog sich finster zusammen, er schien förmlich beleidigt zu sein.
»Nun, schmeichelhaft ist das gerade nicht für dich,« sagte Sonneck mit leisem Spott. »Du bist etwas verwöhnt in dieser Beziehung, und nun findest du auf einmal eine junge Dame, die lieber einen Schlag als einen Kuß von dir hinnehmen will. Merke dir das, Reinhart!«
Der junge Mann lachte laut auf, aber das Lachen klang etwas gezwungen, und dabei fiel ein tiefgereizter Blick auf das Kind, das ihn unverwandt anschaute.
»Nun, ich werde mich wohl zu trösten wissen über meine Niederlage,« entgegnete er achselzuckend und wandte sich zu dem Doktor und seiner Frau, um sich zu verabschieden.
»Was war denn das heute mit Elsa?« sagte Frau Walter, als sie allein waren. »Das Kind ist sonst so liebenswürdig, so habe ich es ja noch niemals gesehen.«
Der Doktor blickte nachdenklich auf die Kleine, die ihr Spiel mit dem Hündchen wieder begonnen hatte, und entgegnete ernst: »Ich fürchte, Sonneck hat recht, es ist das Blut des Vaters, das sich da verrät. Aber wir wollen Klein-Elsa nicht schelten, heute nicht – denn vielleicht wird sie schon heute abend eine Waise sein.«
Der überraschende Verlauf des Rennens bildete noch am nächsten Tage das Hauptgespräch in der Gesellschaft von Kairo. Man sprach überall von der »Faida« des deutschen Generalkonsuls, von Reinhart Ehrwald und auch von dem vielbeklagten »Darling«, der infolge seiner Verletzung hatte getötet werden müssen, von seinem Herrn war nur sehr wenig die Rede. Man fand jenen ersten Ausspruch, daß der Sturz wohl keine schweren Folgen haben werde, sehr bequem, denn nun war man der Mühe überhoben, sich eingehend um den Gestürzten zu kümmern, und konnte in einigen Tagen wieder nachfragen. Es fiel niemand ein, sich näher zu erkundigen oder den Kranken aufzusuchen. Bernried hatte in der That keinen einzigen Freund in Kairo, nur Bekannte, die mit ihm verkehrten, weil er doch nun einmal ein deutscher Baron war und sich in der Sportswelt geltend zu machen wußte.
Seine Abkunft war allerdings zweifellos. Er war der jüngere Sohn einer alten, süddeutschen Adelsfamilie und schien in seiner Jugend ein echtes Kind des Glückes gewesen zu sein. Schön, reich begabt, mit allen möglichen blendenden Eigenschaften ausgestattet, gewann er sich alle Herzen. Er stand als junger Offizier mit seinem Regimente in der Universitätsstadt, wo Sonneck sich kürzlich als Dozent niedergelassen hatte, und dort knüpfte sich die Freundschaft zwischen den beiden an.
Lothar Sonneck, der nur einige Jahre älter war, galt für ernst und verschlossen, aber er hatte schon damals den Kopf voll von all den Zukunftsplänen, die er später so glänzend verwirklichte. Er stammte von armen Eltern, hatte mit eisernem Fleiße seinen Studien obgelegen und gab sich nun mit demselben Eifer seinem Berufe hin. Kurz, er war in allen Stücken der Gegensatz zu dem jungen, lebenslustigen Offizier, dem die reichsten Mittel zu Gebote standen, und vielleicht war es gerade diese Verschiedenheit, die sie zu Freunden machte.
Professor Helmreich, der damalige Rektor der Universität, nahm an dieser wie in der Gesellschaft eine der ersten Stellen ein. Er war mit dem Vater Sonnecks befreundet gewesen und blieb auch dem Sohne ein väterlicher Freund. Lothar verkehrte oft und viel in seinem Hause, wo eine einzige Tochter aufwuchs, und vielleicht war es der geheime Wunsch des Professors, daß der junge hochbegabte Mann, für den er eine glänzende Zukunft voraussah, ihm einst noch näher treten möge. Vorläufig aber gab sich von beiden Seiten keine tiefere Neigung kund und es blieb bei einem fast geschwisterlichen Verhältnis zwischen den jungen Leuten.
Da brachte Sonneck seinen Freund in das Helmreichsche Haus und führte damit, ohne es zu ahnen, das Unheil über dessen Schwelle. Bernried, der leicht entflammt und hingerissen war, verliebte sich leidenschaftlich in das schöne Mädchen und gewann im Sturme dessen Herz, fand aber dann, vielleicht zum erstenmal in seinem Leben, eine unübersteigliche Schranke in dem Widerstande des Professors. Die Bernriedsche Familie war als hochmütig und adelsstolz bekannt und der jüngere Sohn war mit seiner Zukunft ganz auf den Vater angewiesen. Helmreich sah eine endlose Reihe von Kämpfen und Demütigungen für seine Tochter voraus und versagte mit aller Entschiedenheit seine Einwilligung so lange, bis der Bewerber die volle rückhaltlose Zustimmung seiner Eltern bringe.
Bernried wußte am besten, daß man ihm damit eine unmögliche Bedingung stellte, denn, ganz abgesehen davon, daß seine Eltern eine derartige Heirat niemals zugegeben hätten, standen hier noch ganz andere Familieninteressen auf dem Spiel. Da die Güter Majorat waren, das nur der ältere Sohn erbte, hatte man beizeiten Sorge getragen, auch dem jüngeren dasselbe glänzende Los zu sichern. Ihm war bereits die Hand einer entfernten Verwandten, einer reichen Erbtochter, zugesagt, die noch in sehr jugendlichem Alter stand und die er erst in einigen Jahren heimführen sollte. Von einer Preisgabe dieser Pläne von seiten seiner Eltern konnte nicht die Rede sein.
Lothar Sonneck war selbstverständlich der Vertraute des jungen Paares und that, was er nur konnte, um den Freund zum Abwarten, zum ruhigen Ausharren zu bestimmen, bis er wenigstens die Einwilligung des Professors erlangt haben werde; aber er predigte tauben Ohren. Der vom Glück verwöhnte junge Baron war gewohnt, alles im Sturme zu erreichen und zu erringen, und glaubte, das auch hier durchsetzen zu können. Als das erste schroffe Nein von seinem Vater eintraf, zugleich mit dem Befehl, sofort nach Hause zu kommen, damit den »tollen Streichen« ein Ende gemacht werde, griff er ohne Besinnen zu einem Gewaltmittel.
Er bestürmte den Freund, ihm eine letzte Zusammenkunft mit der Geliebten zu ermöglichen, von der ihn das strenge Verbot ihres Vaters fernhielt. Sonneck entschloß sich nur widerstrebend dazu, und erst als Bernried ihm versprach, daß es nur ein Abschied sein sollte, vertraute er und gab nach. Das Vertrauen wurde getäuscht und das gegebene Wort gebrochen. Die beiden jungen Leute benutzten die Zusammenkunft zu einer heimlichen Flucht und gingen auf und davon.
Der Vorfall machte ungeheures Aufsehen in der Universitätsstadt, gerade wegen der hervorragenden Stellung des Professors, und dieser, den der Schlag wie ein Blitz aus heiterm Himmel traf, brach fast zusammen darunter. Er war von jeher ein ernster, strenger Mann gewesen, dessen starre Ehrbegriffe bis zur Härte gingen, und nun that ihm die einzige Tochter das an! Es änderte nichts an seinen Anschauungen, als nach einigen Wochen zugleich mit der Nachricht, daß die beiden im Auslande getraut seien, die Bitte um Verzeihung eintraf. Er zeigte sich jedem Versöhnungsversuche unzugänglich, beantwortete keinen der Briefe der jungen Frau, auch den letzten nicht, in dem sie ihm die Geburt eines Kindes anzeigte – für ihn gab es hinfort keine Tochter mehr.
Die Familie Bernrieds zeigte sich ebenso unversöhnlich.
Sie verzieh dem ungehorsamen Sohne nicht den eigenmächtigen Schritt und vergab ihm noch viel weniger die Vernichtung ihrer Zukunftspläne, sie sagte sich völlig los von ihm. Der junge Baron seinerseits war viel zu stolz und eigenwillig, um da um Verzeihung zu bitten, wo er nur sein Recht der freien Selbstbestimmung auszuüben geglaubt hatte. Er antwortete auf jene Lossagung in der schroffsten Weise und damit war der Bruch endgültig vollzogen.
Man hatte dem jungen Ehepaare selbstverständlich alle Mittel entzogen, aber für die ersten Jahre reichte das Vermächtnis eines alten Verwandten hin, über das Bernried freie Verfügung hatte. Es wäre vielleicht ausreichend gewesen, irgendwo eine bescheidene, aber sichere Existenz damit zu begründen, doch der im Schoße des Reichtums erzogene Mann, der nie Mangel und Sorge gekannt hatte, dachte nicht an eine solche Verwendung. Er lebte in gewohnter Weise weiter mit seiner Frau, und als die Summe reißend schnell zu Ende ging, verfiel er nach und nach dem Abenteurerleben, zog mit Weib und Kind unstet bald hierhin, bald dorthin und wurde endlich nach Kairo verschlagen, wo seine Laufbahn ein so jähes Ende finden sollte. –
Das deutsche Hospital lag weit draußen in der Vorstadt, in einer Umgebung von Gärten und Villen. Hier sah und hörte man nichts von dem bunten, lärmenden Treiben der Stadt und das helle, freundliche Gebäude lag so friedlich da, als berge es nur Ruhe und Frieden in seinem Innern.