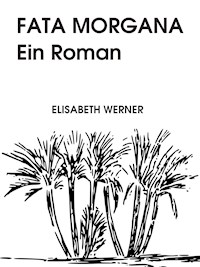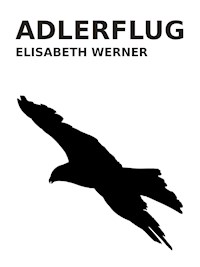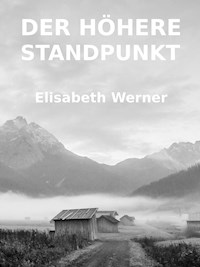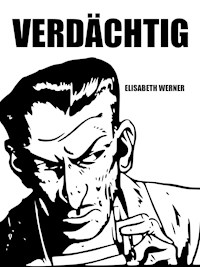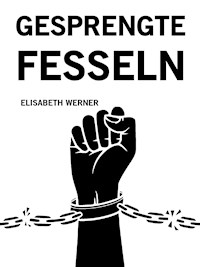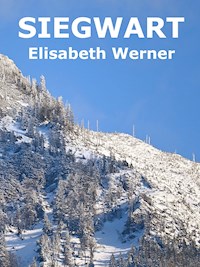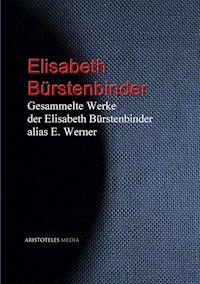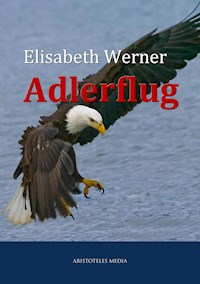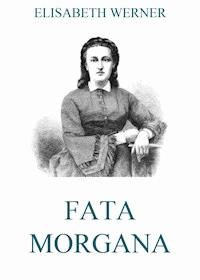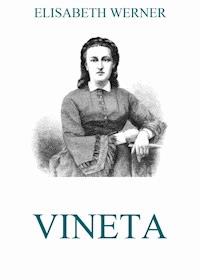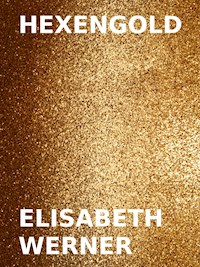
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hexengold ist ein spannender Roman von Elisabeth Werner. Auszug: »Also das ist nun deine Heimat und hier hast du wirklich zehn Jahre lang gesessen, in diesem gottverlassenen kleinen Neste? So schlimm habe ich mir die Sache doch nicht gedacht!« »Gottverlassenes kleines Nest! Das laß unsere Heilsberger hören, die so stolz sind auf ihre Stadt und deren historische Vergangenheit! Sie thun dich in Acht und Bann, wenn ihnen derartiges zu Ohren kommt.« Die beiden Herren, die dies Gespräch führten, befanden sich in einem kleinen Stadtgarten, eng umschlossen von den hohen Giebelhäusern des altertümlichen Städtchens, der eine groß und schlank, mit dunklem Haar und Bart und ernsten dunklen Augen, der andere etwas kleiner, aber eine stattliche, kraftvolle Erscheinung, das Haar voll und blond, das Antlitz gebräunt von der Sonne. Er zuckte lachend die Achseln. »Ja, sie sind allesamt Philister, die braven Heilsberger, und der ehrengeachtete und hochwohllöbliche Herr Notar Raimar - so lautet ja wohl dein voller Titel? - der ist leider auch einer geworden.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hexengold
HexengoldAnmerkungenImpressumHexengold
»Also das ist nun deine Heimat und hier hast du wirklich zehn Jahre lang gesessen, in diesem gottverlassenen kleinen Neste? So schlimm habe ich mir die Sache doch nicht gedacht!« »Gottverlassenes kleines Nest! Das laß unsere Heilsberger hören, die so stolz sind auf ihre Stadt und deren historische Vergangenheit! Sie thun dich in Acht und Bann, wenn ihnen derartiges zu Ohren kommt.« Die beiden Herren, die dies Gespräch führten, befanden sich in einem kleinen Stadtgarten, eng umschlossen von den hohen Giebelhäusern des altertümlichen Städtchens, der eine groß und schlank, mit dunklem Haar und Bart und ernsten dunklen Augen, der andere etwas kleiner, aber eine stattliche, kraftvolle Erscheinung, das Haar voll und blond, das Antlitz gebräunt von der Sonne. Er zuckte lachend die Achseln. »Ja, sie sind allesamt Philister, die braven Heilsberger, und der ehrengeachtete und hochwohllöbliche Herr Notar Raimar – so lautet ja wohl dein voller Titel? – der ist leider auch einer geworden.« Raimar lächelte flüchtig, es lag eine gewisse Müdigkeit in seinen Zügen und seiner ganzen Haltung, auch die Stimme hatte einen müden, halb verschleierten Klang, als er erwiderte: »Spotte nur, Arnold, du hast ja recht. Ein Notar von Heilsberg nimmt allerdings keine weltbewegende Stellung ein, aber wie findest du die Lage unserer Stadt?« »Recht hübsch, recht idyllisch,« gestand Arnold zu. »Aber wenn ich jahrelang immer nur diese Idylle anschauen müßte und dazu diese stillen, sonnenbeschienenen Straßen und ringsherum die biederen Heilsberger – ich glaube, ich würde verrückt!« »Das habe ich im Anfang auch geglaubt,« sagte Raimar gelassen. »Aber man gewöhnt sich schließlich an alles.« »Das ist ja eben das Unglück, daß du dich daran gewöhnt hast,« brauste der andere auf. »Ernst, was ist aus dir geworden! Wenn ich denke, was du einst gewesen bist, damals, als wir uns kennen lernten, wie du da mit vollen Segeln hinaussteuertest in das Leben – und hier bist du gelandet!« »Gescheitert meinst du,« ergänzte Ernst. »Ja, es macht nicht jeder Karriere, wie Herr Major Hartmut, der mir jetzt so nachdrücklich den Text liest.« »Zum Kuckuck, du hattest aber das Zeug dazu,« fiel der Major ein. »Ich war ja dabei, als du deine erste Probe bestandest, eigentlich noch blutjung als Verteidiger, aber du warst der geborene Redner. Und welch ein Erfolg bei diesem ersten öffentlichen Auftreten!« »Es war auch mein letztes,« sagte Raimar mit schwerer Betonung. »Gleich darauf brach die Katastrophe herein. Du weißt es ja, was mich aus meiner Laufbahn gerissen hat.« »Ja, ich weiß, der Bankrott deines Vaters.« Das Gesicht Hartmuts wurde plötzlich ernst. »Das war allerdings eine schlimme Geschichte, aber du hättest die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen sollen. Du mußtest dableiben, standhalten und die Zähne zusammenbeißen. Leicht wäre es ja nicht gewesen, aber es galt deine ganze Zukunft.« »Die war ohnehin vernichtet! Dem jähen Glückswechsel hätte ich standgehalten, aber der Schande –« »Ach was Schande! du warst doch schuldlos, das wußte jeder. Du warst nicht einmal Kaufmann, sondern Jurist und standest dem Bankgeschäft deines Vaters ganz fern.« »Aber ich trug seinen Namen, und der war fortan verfemt. Meinst du, ich hätte die Stirn gehabt, wieder hinzutreten und das Recht und die Ehre anderer zu verteidigen, wenn mir jeder in das Gesicht schleudern konnte, daß meine eigene Ehre befleckt, daß mein Vater ein Dieb sei? – das war vorbei, für immer!« »Ja, das Unglück war, daß die sämtlichen Depots fehlten,« sagte der Major halblaut. »Ein Bankrott ist ja noch keine Schande, aber ein solcher Vertrauensbruch – du hast freilich nie an die Schuld deines Vaters glauben wollen.« »Nein!« Das Wort klang dumpf, aber fest. »Er hatte große Verluste gehabt,« warf Hartmut ein. »Da verliert mancher die Besinnung. Er glaubte zweifellos, alles ersetzen zu können, und dann brach die Katastrophe so jäh herein – « »Nein, sage ich dir!« unterbrach ihn Ernst. »Er ließ mir ja noch ein paar Zeilen zurück, ehe er in den Tod ging, und den Weg geht man nicht mit einer Lüge auf den Lippen. Ein Schuldiger hat nicht die letzte, verzweifelte Mahnung an den Sohn: ›Rette mein Andenken und meine Ehre, wenn du kannst!‹ – ich habe es nicht gekonnt!« Man hörte es an dem qualvoll gepreßten Ton, wie die Erinnerung noch heute den Mann erregte, jetzt richtete er sich mit einem tiefen Atemzuge empor. »Lassen wir das ruhen! Aber siehst du, Arnold, das ist es, was mir die Schwingen gelähmt hat. Ich konnte damals keinem Menschen mehr ins Auge sehen, ich kann es noch heute nicht, aber ich mußte fort aus Berlin, fort um jeden Preis!« »Aber warum gerade nach Heilsberg?« rief der Major heftig. »Ich wäre an deiner Stelle in die weite Welt gegangen, meinetwegen in die afrikanische Wüste oder in die australischen Urwälder, oder in sonst eine kulturbedürftige Gegend – in die Heilsberger Kanzlei wäre ich nicht gegangen.« »Und meine Mutter?« fragte Raimar ernst, »und Max, der damals noch ein Knabe war? Sollte ich mich hinüberretten in ein neues Leben und sie dem Mangel preisgeben, denn das war doch ihr Los, wenn ich nicht für sie eintrat. Für mich gab es überhaupt keine Wahl, ich mußte froh sein, daß ich unser Wrack hier landen durfte.« »Sie haben es dir aber nicht einmal gedankt, deine lieben Angehörigen,« grollte Hartmut, »Deine Frau Mutter machte dir fortwährend das Leben schwer, mit ihrem Jammer über die verlorene glänzende Vergangenheit. Sie hat dir überhaupt immer den dummen Jungen, den Max, vorgezogen. Der war ihr Liebling, der sollte mit aller Gewalt ein großer Künstler werden, und du mußtest die Mittel schaffen. Sie fand es ganz in der Ordnung, daß du dich halb zu Tode arbeitetest für sie und ihren vielgeliebten Max.« »Arnold, ich bitte dich!« unterbrach ihn der Freund. »Nun ja, es war deine Mutter – Gott hab' sie selig! Aber jetzt ist sie tot und dein Bruder endlich fertig mit seinen Studien. Nun wirfst du hoffentlich die ganze Jammergeschichte hier über Bord.« Ernst sah ihn befremdet an. »Was soll ich über Bord werfen?« »Nun, deine hochwohllöbliche Kanzlei, inklusive Schreiber und Akten. Oder willst du vielleicht zeitlebens hier sitzen, um zu beurkunden, daß Hinz dem Kunz einen Acker verkauft hat, oder ähnliche welterschütternde Thatsachen? Jetzt bist du frei, jetzt fort mit der ganzen Heilsberger Erbärmlichkeit und wieder hinaus in das Leben!« Raimar lächelte, aber es war ein müdes, hoffnungsloses Lächeln. »Jetzt noch? In meinem Alter? Dazu ist es zu spät.« »Unsinn!« sagte der Major kurz und bündig, »In deinem Alter? Bist wohl schon ein Greis mit deinen siebenunddreißig Jahren? Da sieh mich an! Ich bin drei Jahr älter, aber es soll sich einer unterstehen, mich alt zu nennen!« Er sprang auf und stellte sich mit militärischer Strammheit vor den Freund hin. Die stattliche, kraftstrotzende Gestalt zeigte in der That noch nichts vom Alter, und in das dichte blonde Haar mischte sich noch kein einziger Silberfaden, Raimar streifte ihn mit einem langen, düstern Blick. »Ja, du – das ist etwas anderes! Du warst stets mit Leib und Seele bei deinem Beruf, du hast immer mitten im Leben und Wirken gestanden. Ich habe zehn Jahre lang meine Kraft vergeudet, an die erbärmlichsten Alltäglichkeiten – vergeuden müssen, da bleibt nichts mehr übrig für das Leben.« »Ernst, thu mir den Gefallen und sieh nicht so entsagungsvoll aus!« brach Hartmut los. »Werde meinetwegen grob gegen das Schicksal und den schändlichen Streich, den es dir gespielt hat, aber diese elegische Miene kann ich nicht aushalten, die treibe ich dir aus und müßte ich mit einem Donnerwetter dreinfahren!« Das angekündigte Donnerwetter kam glücklicherweise nicht zum Ausbruch, denn soeben trat ein junger Mann aus dem Hause und näherte sich mit einem etwas schläfrigen »Guten Morgen!« den beiden Herren. »Guten Morgen, Max!« sagte Raimar, sich umwendend. »Kommst du endlich zum Vorschein?« »Ja, es ist elf Uhr,« bestätigte der Major. »So lange hat der junge Herr in den Federn gelegen.« Max Raimar zog einen Stuhl heran und ließ sich darauf nieder. Er war bedeutend jünger als der Notar und auffallend hübsch, schien sich dessen aber auch vollkommen bewußt zu sein. Die Brüder hatten eigentlich nur die dunkle Farbe des Haars gemeinsam und die dunklen Augen, die bei dem älteren nur viel tiefer und ausdrucksvoller waren, sonst bestand kaum eine Aehnlichkeit zwischen ihnen. Ernst war in seinem Aeußeren die Einfachheit selbst, aber es lag eine unbewußte Vornehmheit darin, die sich nie verleugnete. Max hatte einen gewissen genialen Anstrich, der ein klein wenig theatralisch war, ebenso wie sein, übrigens sehr sorgfältiger Anzug, aber das stand ihm sehr gut. Der junge Künstler war jedenfalls das, was man in den Salons eine interessante Erscheinung nennt. »Ich war angegriffen von der gestrigen Reise,« erwiderte er. »Die lange Eisenbahnfahrt von Berlin und dann noch drei Stunden im Wagen, von Neustadt bis hierher, da wird man ja todmüde, das halten meine Nerven nicht aus.« »Nerven hast du auch mitgebracht, Maxl?« fragte Hartmut. »Du scheinst ja recht modern geworden zu sein. Laß dich einmal anschauen, du siehst freilich etwas abgetakelt aus.« »Herr Major!« sagte der junge Mann mit etwas gereizter Betonung. »Ach so, du nimmst das übel? Man darf den Herrn Künstler und angehenden Raffael wohl gar nicht mehr beim Vornamen nennen?« Max machte eine halbe Verneigung. »Bitte, Herr Major, dem alten Freunde meines Bruders gestatte ich gern die alte Vertraulichkeit.« »Gestattest du? Freut mich, ich werde von deiner gütigen Erlaubnis Gebrauch machen. Aber du kommst ja wie vom Himmel geschneit. Was verschafft uns denn eigentlich die ganz plötzliche Ehre deiner Gegenwart?« »Ja, Max, das möchte ich auch fragen,« mischte sich Raimar ein, »Du kommst ganz unerwartet, ist irgend etwas vorgefallen?« »O nein, durchaus nichts,« versicherte Max. »Ich fühlte nur, daß ich des Ausruhens, der Erholung bedurfte. Du kennst das freilich nicht, Ernst! Danke Gott, daß du ruhig hier in deinem stillen Heilsberg sitzest und nichts siehst und hörst von dem Wogen und Treiben der Großstadt. Diese ewige, ruhelose Hetzjagd, dieser tägliche, aufreibende Kampf ums Dasein!« »Ist der dir so schwer geworden?« spottete der Major. »Ich dachte, das wäre bisher Sache deines Bruders gewesen. Du hast in unentwegter Tapferkeit nur immer die Geldbriefe angenommen, die er dir schickte.« »Ich werde Ernst nicht mehr lange in Anspruch nehmen,« erklärte der junge Künstler mit beleidigter Miene. »Ich hoffe, mich sehr bald schon auf eigene Füße stellen zu können.« »Es wäre auch Zeit, Max,« sagte der ältere Bruder ernst, aber ohne Vorwurf. »Ich habe seit sechs Jahren deine sämtlichen Ausgaben in Berlin bestritten, und das ist mir nicht immer leicht geworden, denn du hast sehr viel gebraucht. Ich wollte dir aber die Möglichkeit geben, dich frei zu entwickeln, wollte dir die volle Unabhängigkeit sichern bei deinen Studien. Jetzt ist die Bahn offen, nun zeige, was du kannst.« »Ja, wenn das Fach nur nicht so überfüllt wäre!« versetzte Max in einem höchst prosaischen Tone. »Alles drängt ja jetzt zur Kunst, es ist gar kein Raum da für den einzelnen und sein Talent. Und dann dieser Neid, diese Eifersucht bei jedem Erfolge und vor allem diese boshafte Kritik mit ihren ewigen Nergeleien – es ist ein jämmerliches Dasein!« Ernst zog die Brauen zusammen. »Ist das deine ganze Begeisterung für deinen Beruf?« »Begeisterung!« Max nahm eine tragische Miene an. »O, die verlernt man bald genug. Die Kunst, der Ruhm, das sind doch im Grunde auch nur Chimären. Es ist furchtbar dies Erkennen, aber es ist unausbleiblich. Ich habe überhaupt keine Ideale mehr! Das Leben verzehrt sie alle. Mir ist oft zu Mute, als wäre ich ein ausgebrannter Krater.« Der Major hatte sich zurückgelehnt und blickte höchst belustigt auf den jungen Herrn, der sich offenbar sehr interessant vorkam bei diesen pessimistischen Geständnissen. »Sehr schön gesagt!« bemerkte er. »Ausgebrannter Krater ist gut, es fragt sich nur, ob da etwas zu verbrennen war. Ernst, was sagst du denn eigentlich zu deinem Herrn Bruder mit der Kraterseele?« »Ich und Max, wir verstehen uns schon längst nicht mehr,« sagte Raimar kalt. »Ich möchte nur wissen, wie er mit solchen Ansichten die geplante Selbständigkeit durchsetzen will.« »Das wird sich ja finden,« erklärte Max mit einem vielsagenden Lächeln. »Ich bin noch nicht ganz im reinen mit meinen Zukunftsplänen, aber das klärt sich hoffentlich bald. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich einige Wochen hier bleibe?« »Die Heimat steht dir immer offen, das weißt du, aber was willst du denn wochenlang in Heilsberg? Sonst hast du jeden Besuch hier als ein Opfer betrachtet und ihn möglichst abgekürzt.« »Ich suche ja diesmal nur Erholung,« erklärte der junge Künstler. »Und dann hoffe ich auch Bekannte hier zu treffen, du verkehrst ja wohl in Gernsbach, bei Frau von Maiendorf?« »Bisweilen und meist nur geschäftlich,« lautete die kühle Antwort. »Ich bin ihr Rechtsvertreter.« »Gleichviel, wir müssen in den nächsten Tagen hinüberfahren. Ich habe die Dame in Berlin kennen gelernt, im Hause ihrer Verwandten, die sie jetzt zum Besuch erwartet, Herrn Marlow nebst Tochter.« Den Notar schien diese Nachricht nicht im mindesten zu interessieren, Hartmut aber wiederholte nachsinnend: »Marlow? Etwa den Chef des Bankhauses in Berlin?« »Jawohl – ein Millionär!« Max sprach das Wort mit einer gewissen Feierlichkeit aus. »Eine alte, sehr solide Firma und sehr angesehen in den Finanzkreisen. Ich verkehre viel im Marlowschen Hause, der Sohn ist vor einigen Jahren gestorben, jetzt ist nur noch eine einzige Tochter da. Ein sehr schönes Mädchen, und natürlich von allen Seiten umschwärmt und umworben, da sie dereinst Alleinerbin ist – eine brillante Partie!« Raimar stutzte und richtete einen forschenden Blick auf den Bruder. »Du scheinst ja sehr genau unterrichtet –« hob er an, doch der Major unterbrach ihn mit einem lauten Auflachen. »Aber Ernst, merkst du denn nicht, was der geniale Maxl da ausgeheckt hat? Heiraten will er die Erbin und den Kampf ums Dasein als Millionär fortsetzen. Darum ist er dir wie eine Bombe ins Haus gefallen – und das nennt er, sich auf eigene Füße stellen!« Ernst antwortete nicht, er blickte noch fragend auf Max, der jetzt mit einer halb beleidigten, halb selbstbewußten Miene den Kopf hob. »Ich wüßte nicht, Herr Major, was daran so Merkwürdiges wäre. Ich verkehre, wie gesagt, sehr viel bei den Marlows und werde demnächst die junge Dame malen, auf ihren ausdrücklichen Wunsch. Ich glaube ihr nicht gleichgültig zu sein, aber in Berlin sind immer so viel andere in ihrer Nähe, mit den vornehmsten Namen und Titeln, da kann man sich nie zur Geltung bringen. In Gernsbach, auf dem Lande, ist das leichter, da steht man allein im Vordergrunde.« »Nun, mein Geschmack wärst du nicht, Maxl, so hübsch du auch bist,« sagte der Major trocken. »Aber der Geschmack ist verschieden und die Millionärin kann ja in ihren sonstigen Ansprüchen bescheiden sein.« Max hielt es unter seiner Würde, den Ausfall zu bemerken, er wandte sich zu seinem Bruder, der noch kein Wort gesprochen hatte. »Dir gegenüber brauche ich ja kein Geheimnis aus meinen Wünschen und Hoffnungen zu machen, aber das bleibt natürlich unter uns. Ich habe vorläufig noch gar keine Gewißheit, aber ich glaube hoffen zu dürfen. Dann brauchte ich dich allerdings nicht länger in Anspruch zu nehmen, du hast Opfer genug gebracht für mich –« »Für deine künstlerische Zukunft habe ich sie gebracht!« unterbrach ihn Raimar. »Damit scheint es jetzt vorbei zu sein. Nach deinen Aeußerungen von vorhin wirst du der Kunst einfach den Rücken kehren, wenn du eine Million heiratest.« Der junge Mann geriet einen Augenblick in Verlegenheit bei diesen mit voller Schärfe gesprochenen Worten, die durchaus das Richtige zu treffen schienen, dann aber zuckte er mit überlegener Miene die Achseln. »Ich glaube, du willst mir einen Vorwurf daraus machen, daß ich das Glück nehme, wo ich es finde. Nimm es mir nicht übel, Ernst, aber du sitzest seit zehn Jahren in Heilsberg, und was weiß man denn hier, in dem abgelegenen kleinen Orte von der Welt und ihren Anforderungen! Du kennst sie überhaupt nur in der Vergangenheit, wo sie vielleicht noch einen romantischen Schimmer hatte, aber wir Kinder der Gegenwart haben keine Illusionen mehr. Wir sehen Welt und Leben, wie sie wirklich sind, und rechnen damit, deshalb gehört uns die Zukunft. – Du hast mit der deinigen ja eigentlich schon abgeschlossen.« Damit stand er auf und trat in einer Haltung, die schon sehr an den künftigen Millionär erinnerte, zu einem der Blumenbeete, wo er eine Knospe abpflückte und sie in das Knopfloch steckte. »Höre, Ernst,« der Major sprach halblaut, aber es grollte bedenklich in seiner Stimme. »Läßt du dir von dem dummen Jungen den Text so weiter lesen und dich als eine Art Urahn aus der Vorzeit behandeln, dann sage ich ihm die Wahrheit!« Raimar machte nur eine abwehrende Bewegung, dann erhob er sich gleichfalls. »Max!« Der Gerufene wendete sich etwas erstaunt um, der Bruder stand ihm ruhig gegenüber, aber in seiner Stimme klang die tiefste Bitterkeit und Verachtung. »Ich wünsche dir Glück zu deinen Zukunftsplänen, aber mich, laß aus dem Spiele dabei, und vor allem verschone mich mit deinen weisen Belehrungen. Es ist das erste Mal, daß du dir einen derartigen Ton erlaubst, und ich wünsche, daß es auch das letzte Mal ist, denn ich dulde ihn nicht, solange du in meinem Hause bist!« »Aber, Ernst, ich bitte dich –« Max war offenbar eingeschüchtert durch diese strenge Zurechtweisung, die er bei dem allzeit nachsichtigen Bruder gar nicht gewohnt war, und wollte einlenken, doch Ernst schnitt ihm das Wort ab. »Du hast wohl ganz vergessen, was mich in Heilsberg festgekettet hat! Ich wollte dich und die Mutter vor Not bewahren, ich wollte dir eine große Laufbahn öffnen, die sich mir verschloß, und jetzt, wo du am Eingange stehst, machst du nur Jagd auf eine reiche Frau, für die du offenbar gar keine Neigung hast. Jetzt willst du dein Talent, die Kunst, deine ganze Zukunft über Bord werfen, um dir mit dem Gelde dieser Frau das zu erkaufen, was du Lebensgenuß nennst. Ein Leben ohne Arbeit, ohne Zweck und Ziel, ein träges Prassen im Schoße des Reichtums, den andere erworben haben. Ich sage dir gerade heraus, daß ich deine klugen Berechnungen erbärmlich finde, durch und durch, erbärmlich – und dich dazu!« »Amen! Schäm dich, Maxl!« sagte Major Hartmut, dann folgte er dem Freunde, der seinem Bruder den Rücken gewandt hatte und in das Haus getreten war. Maxl stand da und sah ganz verblüfft den beiden nach. Er begriff gar nicht, weshalb er sich schämen sollte, aber allmählich kam es ihm doch zum Bewußtsein, daß man ihn, der gar keine Illusionen mehr hatte und auf der Höhe der modernen Anschauungen stand, wie einen Schuljungen behandelt und ausgescholten hatte. Er war natürlich empört darüber, aber an das Fortgehen dachte er trotzdem nicht. Der Aufenthalt in Heilsberg war notwendig, um sich bei der besagten Millionärin in den Vordergrund zu stellen, da mußte man sich notgedrungen fügen. Aber es war wirklich Zeit, daß man loskam von dieser Kette der Abhängigkeit von dem Bruder, die allerhöchste Zeit! Inzwischen machte Major Hartmut im Hausflur, wo er seinen Freund eingeholt hatte, seinem Herzen Luft, in sehr nachdrücklicher Weise. »Der Maxl ist ja ein recht nettes Gewächs geworden! Das hast du davon, daß du ihn nach Berlin geschickt hast, während du hier sitzen bliebst, um für ihn und die Frau Mama zu arbeiten. Der Junge hat ja all die modernen Schlagworte auswendig gelernt und plappert sie nach wie ein Starmatz, verstehen thut er natürlich nichts davon. Du scheinst ihn auch heut erst in seiner ganzen Pracht kennen gelernt zu haben, sonst hättest du ihm hoffentlich schon früher die Wechsel entzogen.« Ernst zuckte die Achseln, der bittere, verächtliche Ausdruck von vorhin lag noch in seinen Zügen, als er erwiderte: »Max ist immer nur selten und flüchtig hier gewesen, und da war er klug genug, sich die nötige Rücksicht aufzuerlegen – solange er mich brauchte. Jetzt scheint er das überflüssig zu finden.« »Ja, die Million, die er noch gar nicht hat, ist ihm zu Kopfe gestiegen,« spottete Hartmut. »Schade, daß der Bengel so bildhübsch ist! Eine Millionärin zeichnet sich gewöhnlich nicht durch hohe Geistesgaben aus, und da hat er mit dem Gesicht und der Geniekomödie möglicherweise Aussichten, da wird seine sonstige Dummheit mit in den Kauf genommen. Uebrigens warst du noch viel zu zahm in deiner Predigt, ich hätte ihn ganz anders ins Gebet genommen. Wenn er mir einmal kommt mit der ›eigentlich schon abgeschlossenen Zukunft‹, dann gnade ihm Gott!« Raimar wollte antworten, da wurde die Hausthür geöffnet, und ein alter Herr trat herein, so eilig, daß er sich kaum Zeit nahm, zu grüßen. »Aber, Ernst, was soll das heißen?« rief er vorwurfsvoll. »Maxl ist hier, die halbe Stadt weiß es schon, und ich erfahre es eben erst durch den Bürgermeister, der hat es von der Frau Doktor, und die weiß es von dem Apotheker, der den Maxl vorbeifahren sah. Warum hast du denn nicht zu mir geschickt?« »Max kam gestern spät abends und ganz unerwartet,« sagte Ernst. »Er wäre heut jedenfalls zu dir gekommen, Onkel Treumann.« Herr Notar Treumann, der bereits in der Mitte der Sechzig stand, war ein kleines, bewegliches Männchen, mit grauen Haaren und scharfen grauen Augen, noch sehr rüstig und lebhaft für seine Jahre. Er wandte sich jetzt erst an den Freund seines Neffen, den er bereits kennen gelernt hatte. »Ihr Diener, Herr Major! Nun, wie gefällt Ihnen unser Heilsberg? Interessant, nicht wahr, hochinteressant! Und die Hauptsachen haben Sie noch gar nicht gesehen. Sie müssen nach dem Rathaus kommen, da haben wir eine historische Sammlung, Urkunden, Waffen, Marterinstrumente aus den Hexenprozessen, wir haben eine ganze Folterkammer zusammengestellt, die müssen Sie sehen!« »Danke, ich inkliniere nicht für Folterkammern,« sagte der Major trocken. »Wenn Sie einen historischen Burg- oder Klosterkeller hätten – mit Inhalt natürlich – das wäre eher mein Fall.« »Bedaure, den haben wir nicht,« gestand der alte Herr, »aber im ›goldenen Löwen‹ finden Sie auch einen guten Tropfen. Dort haben wir heute abend Zusammenkunft, Sitzung des historischen Vereins. – Du bringst deinen Freund natürlich mit, Ernst.« »Du wirst uns wohl entschuldigen müssen, Onkel,« warf Ernst ein. »Arnold ist erst seit vorgestern hier, und da möchten wir doch –« »Was, du willst wieder nicht kommen?« unterbrach ihn der Onkel entrüstet, »Zwei Sitzungen hast du schon versäumt, heute werden wir wohl endlich auf die Ehre deiner Gegenwart rechnen dürfen. Freilich, du interessierst dich ja weder für das Historische noch für Heilsberg überhaupt, da hat der Maxl mehr Herz für seine Heimat. Denken Sie nur!« wandte er sich triumphierend an den Major. »Er hat seine Heilsberger Studien in Berlin im Kunstverein ausgestellt, alle Welt hat sie gesehen, die Zeitungen haben sie besprochen. Ja, unser Maxl, das ist ein Talent! Der wird die Familie noch zu Ehren bringen und Heilsberg berühmt machen mit seinem Genie. Aber wo ist er denn?« »Das Familiengenie sitzt im Garten,« sagte der Major. »Wir haben es schon gebührend bewundert.« »So, da will ich doch gleich zu ihm. Also heut abend um sieben Uhr, im goldenen Löwen! Sitzung – Vorträge und dann ein gemütliches Zusammensein. Da bringen wir dem Maxl eine Ovation für seine Heilsberger Studien, habe ich schon abgemacht mit dem Bürgermeister, alles abgemacht!« Damit schoß der Herr Notar davon und in den Garten, um das Familiengenie gleichfalls zu bewundern. Hartmut sah ihm ärgerlich nach. »Der Herr Onkel scheint das Geschäft deiner Frau Mama fortzusetzen,« bemerkte er. »Die ging auch ganz auf in der Anbetung ihres genialen Maxl.« »Ja, er steht sehr in Gunst bei dem Onkel,« sagte Ernst. »Was gibt es denn?« Die letzten Worte waren an den Schreiber gerichtet, der eben aus der Kanzlei trat und eintönig meldete: »Herr Notar, Anton Lechner und Johann Obermaier sind da und wollen einen Vergleich schließen wegen des Feldheimer Ackers – und vom Herrn Bürgermeister ist auch Bescheid gekommen wegen Verpachtung der Viehweide auf dem Gemeindeanger – und um zwölf Uhr kommt der Herr Apotheker wegen seiner Erbschaftssache –« »Es ist gut, ich weiß schon,« sagte Raimar müde. »Auf Wiedersehen, Arnold!« Er ging in seine Kanzlei und der Major stieg die Treppe hinauf, aber dabei brummte er wütend. »Und das hält er nun Tag für Tag aus! Bauernacker und Viehweide auf dem Gemeindeanger und apothekerliche Erbschaft – eigentlich ist es ein Wunder, daß Ernst nicht verrückt geworden ist dabei. Ich wäre es längst schon!« Inzwischen saß Notar Raimar in seiner Kanzlei und hörte zu, wie Anton Lechner und Johann Obermaier ihm weitschweifig auseinandersetzten, daß sie sich jetzt wegen des Feldheimer Ackers, um den sie so lange gestritten, vergleichen wollten. Dabei gerieten sie aber aufs neue in Hader und Zank und kamen beinahe bis zu Thätlichkeiten. Dann wurde die Verpachtung des Gemeindeangers erledigt, und zum Schluß erschien der Herr Apotheker, von dessen Erbschaft die ganze Stadt seit vier Wochen sprach, feierlich, im schwarzen Rock, einen Flor um den Arm, um die notarielle Beglaubigung einiger Unterschriften vollziehen zu lassen, mit denen jene welterschütternde Thatsache bestätigt werden sollte. Heilsberg war ein altertümliches Städtchen, das sich sogar einer historischen Vergangenheit rühmen konnte. Es hatte im Mittelalter bei den Fehden des in der Gegend ansässigen Adels öfter eine Rolle gespielt, die Stadtchronik gab beglaubigte Kunde davon. Die noch erhaltenen Reste des ehemaligen Wallgrabens und seiner Türme, das Rathaus und verschiedene Bürgerhäuser stammten noch aus der alten Zeit, und der nahe Burgberg trug die zerfallenen Mauern eines alten Grafenschlosses. Für die undankbare Gegenwart war das freilich verschollen und vergessen, denn Heilsberg lag abseits von allen Verkehrslinien. Die nächste Eisenbahnstation war mehrere Stunden entfernt, und sonst gab es keine größeren Orte in der Nachbarschaft, nicht einmal eine Sommerfrische. Die bescheidenen Reize der Landschaft zogen die Fremden nicht an, und so kam es, daß das Städtchen sich einer idyllischen Ruhe und Abgeschlossenheit erfreute, wie sie im Zeitalter des Verkehrs selten sind. Die Heilsberger waren freilich nicht einverstanden damit, sie empfanden diese Abgeschlossenheit als eine Zurücksetzung, um so mehr, als Neustadt, die erwähnte Bahnstation, sie längst überflügelt hatte. Dort lagen die Steinfelder Gruben und Hüttenwerke in unmittelbarer Nähe, fast vor den Thoren der Stadt, und das brachte dieser unberechenbare Vorteile. Das große industrielle Unternehmen war förmlich aus dem Boden emporgeschossen und hatte in wenigen Jahren einen Umfang und eine Bedeutung erlangt, zu der andere ein halbes Menschenalter brauchten. Dem Besitzer der Werke standen freilich der Einfluß und die Mittel zu Gebote, um jeder seiner Schöpfungen den Erfolg zu sichern, Felix Ronald spielte eine erste Rolle in der Finanzwelt und galt für einen der kühnsten, aber auch der genialsten Spekulanten. Er hatte sich in unglaublich kurzer Zeit zu der Höhe des Reichtums emporgeschwungen. Vor zehn Jahren noch in einer abhängigen Stellung in einem Bankhause, hatte er durch glückliches Börsenspiel den Grund zu seinem Vermögen gelegt und damit Unternehmungen begonnen, die bald genug in das Große gingen. Was andere erst nach jahrelanger Arbeit erreichten, das gewann er mit einem kecken Wagnis in Monaten. Das alte Sprichwort vom Wagen und Gewinnen bewährte sich auch hier. Ronald schien in der That das Geheimnis zu besitzen, Glück und Erfolg an sich zu fesseln, sie blieben ihm treu, mochte der Einsatz auch noch so hoch sein, und er wagte oft genug ein hohes Spiel. Jetzt war er eine Macht geworden, deren Einfluß sich nicht nur an der Börse, auch in der Presse, selbst bei der Regierung geltend machte, deren rastlose Thätigkeit sich auf alle möglichen Gebiete erstreckte. Er wußte alles an sich zu ketten, alles seinen Zwecken dienstbar zu machen und beherrschte das ganze weite Feld seiner Unternehmungen mit bewundernswerter Energie. Nach den Steinfelder Werken kam er nur selten, die technische Leitung lag in den Händen seiner Oberbeamten, die geschäftliche in Berlin, wo der Chef seinen Wohnsitz hatte. Jedenfalls wurde der Betrieb in großartigster Weise geführt. Neustadt war eigentlich nur der Vorort der großen Steinfelder Kolonie geworden, aber die zahlreichen Beamten, die sämtlichen Arbeiter verkehrten in der Stadt, wohnten sogar zum Teil dort. Neustadt hatte die Bahnlinie erhalten und spielte eine große Rolle in der Provinz, Das kannte jeder, davon sprach alle Welt – von Heilsberg wußte man auf einige Kilometer Entfernung kaum mehr, daß es auf der Welt sei, und Heilsberg war doch »historisch«! Dort gab es meist nur Bauerngüter in der Umgegend, der einzige herrschaftliche Besitz war Gernsbach, das eine Stunde von der Stadt entfernt lag. Es gehörte einer verwitweten Dame, die es mit ihrem kleinen Töchterchen bewohnte, und das geräumige, etwas altertümliche Herrenhaus, mit der breiten Steinterrasse und dem großen, schattigen Park war in der That ein behaglicher Wohnsitz. Die ziemlich umfangreiche Gutswirtschaft war verpachtet für eine recht ansehnliche Summe. Frau von Maiendorf galt überhaupt, wenn nicht für reich, doch für sehr wohlhabend. Es war in den Morgenstunden eines sonnigen Maitages, auf der Terrasse des Herrenhauses saßen zwei Damen am Frühstückstisch, während ein kleines, etwa siebenjähriges Mädchen sich mit Ballspielen vergnügte und dabei lustig die steinernen Stufen auf und ab sprang. »Ich fürchtete schon, du würdest nicht Wort halten mit dem versprochenen Besuche,« sagte die ältere. »Freilich, was kann ich dir bieten, du verwöhnte Prinzessin, hier in der Stille und Einsamkeit des Landlebens!« »Du ahnst nicht, Wilma, wie wohl mir diese Stille thut,« erwiderte die jüngere. »Wenn du wüßtest, was man uns alles zugemutet hat in dieser Saison – es war wirklich etwas zu viel.« »Ja, ich hielte diesen ewigen Strudel des Gesellschaftslebens nicht aus,« erklärte Wilma. »Du bist freilich daran gewöhnt, Edith, Du hast ja schon seit dem Tode deiner Mutter die Dame des Hauses vertreten müssen, eine schwere Aufgabe, du warst damals erst sechzehn Jahre alt.« »Das lernt sich,« sagte Edith ruhig. »Wenn es nur auf die Dauer nicht so ermüdend wäre! Immer neue Gesichter und immer dieselben Menschen, dieselben Redensarten und Komplimente! Wie selten findet man einen darunter, mit dem es sich überhaupt lohnt, zu reden, und wenn man näher zusieht, hält das Interesse auch nicht stand – er ist eben wie all die anderen.« Das herbe Urteil kam aus dem Munde einer jungen Dame von zwanzig Jahren. Edith Marlow war in der That ein schönes Mädchen, mit regelmäßigen, etwas kalten Zügen und großen braunen Augen, die sehr klug in die Welt blickten. Kühle, vornehme Ruhe war überhaupt der hervorstechende Zug in ihrem Aeußeren, und dazu gesellte sich eine gewisse Herablassung gegen alles, was ihr nicht als ebenbürtig erschien. Sie war im hellen Morgenkleide, das braune Haar nur lose aufgesteckt, aber sie verleugnete selbst hier, in dieser zwanglosen Umgebung, nicht die Weltdame. Wilma von Maiendorf stand dagegen schon am Ende der Zwanzig, sah aber noch sehr jugendlich aus. Die zierliche Gestalt mit dem blonden Haar und den hellen Augen konnte freilich nicht auf Schönheit Anspruch machen, aber es lag ein eigener Reiz in diesen weichen Zügen, der selbst neben der blendenden Erscheinung ihrer Cousine noch standhielt. »Du wohnst recht behaglich hier,« hob die letztere wieder an. »Gernsbach ist ein sehr hübscher Sommersitz, aber wie hältst du es nur das ganze Jahr hier aus?« »Ich komme ja in jedem Jahre nach Berlin,« warf Wilma ein. »Auf sechs oder acht Wochen, und dann sitzest du wieder allein hier in Schnee und Einsamkeit. Weshalb denn? Dein Vermögen erlaubt dir doch einen regelmäßigen Winteraufenthalt in Berlin. Papa meint überhaupt, du solltest dich wieder vermählen, du bist ja seit fünf Jahren Witwe. Es hat sich schon so mancher um dich bemüht, aber du läßt es nie zu einer Bewerbung und Aussprache kommen.« »Weil ich stets im Zweifel war, ob diese Bewerbung mir oder Gernsbach galt.« »Vermutlich beiden! Das ist nun einmal nicht anders in unserer Zeit. Die Männer rechnen alle, müssen es meist thun, deine Eltern haben es auch gethan, als sie dir Maiendorf zum Gatten auswählten. Er rechnete allerdings nicht, denn das Vermögen war auf seiner Seite, aber – warst du denn so glücklich mit dem Manne, der dich nur um deiner selbst willen nahm?« Wilma blieb die Antwort schuldig auf diese kluge, kühle Auseinandersetzung. Edith war ja noch ein Kind gewesen, als ihre Cousine sich vermählte, aber sie wußte durch ihren Vater, daß jene kurze Ehe keine glückliche gewesen war. Der derbe, rohe Landjunker, dem das junge Mädchen auf Andrängen der Eltern die Hand gereicht hatte, war ein sehr tyrannischer Ehemann gewesen. Er hatte die Zeit mit Trinken und Spielen vergeudet und, nachdem die erste verliebte Tändelei vorüber war, sich kaum mehr um Frau und Kind gekümmert. Die junge Frau hatte das schweigend getragen, ohne zu klagen, aber ein Geheimnis war es auch für ihre Verwandten nicht geblieben, und die Erinnerung that ihr noch jetzt weh, das sah man an dem schmerzlichen Zucken ihrer Lippen, auch Edith sah es und lenkte ein. »Verzeih, ich wollte dich nicht kränken, aber du bist achtundzwanzig Jahre, da hat man doch noch ein Anrecht an das Leben.« »Soll ich meiner Lisbeth einen Stiefvater geben, der kein Herz für sie hat, dem sie vielleicht sogar im Wege ist, mit ihren Ansprüchen an Gernsbach?« fragte Wilma gepreßt. »Um keinen Preis! Dein Vater meint es gut, ich weiß es – er kommt also erst übermorgen?« »Jawohl, er ist erst noch mit Herrn Ronald nach Steinfeld gefahren, in Geschäften natürlich. Die Werke sollen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden, und Papa wird die Finanzierung übernehmen, sie haben da weitgehende Pläne. Vermutlich kommt Ronald auch einmal nach Gernsbach herüber, wenigstens sprach er davon bei seiner Abreise. Du hast ihn ja in unserem Hause kennen gelernt, da wird er dir wohl einen Besuch machen.«