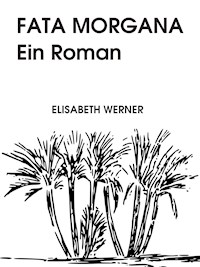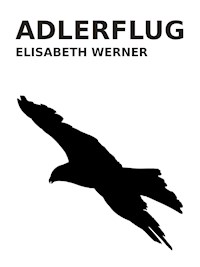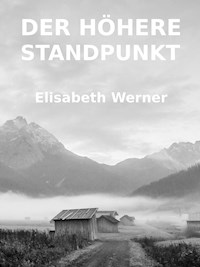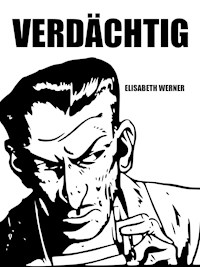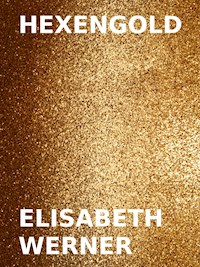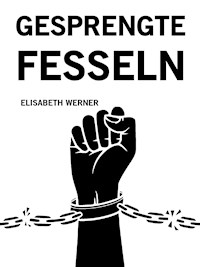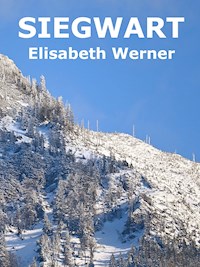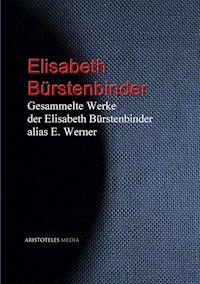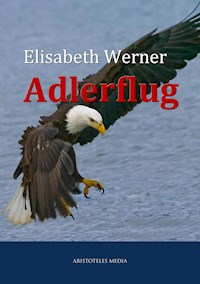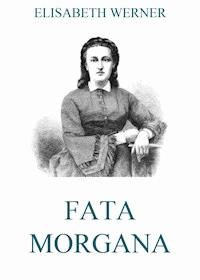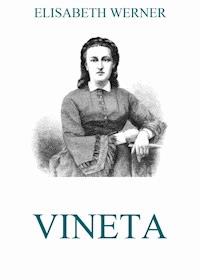Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein spannender Roman in historischem Setting von Elisabeth Werner! Auszug: Auf dem Meere draußen lag die tiefe, stille Ruhe der Mondnacht, im Hafen aber und am Ufer herrschte noch das regste Leben und Treiben. Blendender Lichtglanz strömte über die Piazzetta hin, und dichtes Menschengewoge erfüllte den weiten, beinahe tageshellen Raum. Das ganze Leben des Südens entfaltete sich an diesem Herbstabende, dessen weiche, schwüle Luft den heißen Sommerabenden des Nordens nichts nachgab. In immer neuen, wechselnden Bildern zog das bunte Gewühl vorüber, wie bewegt und getragen von den Klängen der Musik, und über diesem Meer von Licht, Glanz und Tönen ragten die mächtigen Kirchen und Paläste der Stadt empor, hell beschienen vom Mondlicht, das sie wie mit geisterhaftem Schimmer umfloß und jede Linie klar und deutlich hervortreten ließ gegen den sternfunkelnden Nachthimmel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gebannt und Erlöst
Gebannt und Erlöst - Teil 1Gebannt und Erlöst - Teil 2AnmerkungenImpressumGebannt und Erlöst - Teil 1
Der Dampfer lag zur Abfahrt bereit. In einer Stunde sollte er den Hafen verlassen, um nach der nahen deutschen Küste zu steuern, die bei einer schnellen und günstigen Fahrt schon mit Tagesanbruch zu erreichen war.
Auf dem Meere draußen lag die tiefe, stille Ruhe der Mondnacht, im Hafen aber und am Ufer herrschte noch das regste Leben und Treiben. Blendender Lichtglanz strömte über die Piazzetta hin, und dichtes Menschengewoge erfüllte den weiten, beinahe tageshellen Raum. Das ganze Leben des Südens entfaltete sich an diesem Herbstabende, dessen weiche, schwüle Luft den heißen Sommerabenden des Nordens nichts nachgab. In immer neuen, wechselnden Bildern zog das bunte Gewühl vorüber, wie bewegt und getragen von den Klängen der Musik, und über diesem Meer von Licht, Glanz und Tönen ragten die mächtigen Kirchen und Paläste der Stadt empor, hell beschienen vom Mondlicht, das sie wie mit geisterhaftem Schimmer umfloß und jede Linie klar und deutlich hervortreten ließ gegen den sternfunkelnden Nachthimmel.
Die Zeit war schon ziemlich weit vorgerückt, als eine Gruppe von jungen Männern sich aus dem Gewühl löste und die Richtung nach dem Ufer einschlug. Sie gehörten offenbar verschiedenen Nationalitäten an; denn die sehr laute und lebhafte Unterhaltung wurde bald deutsch, bald italienisch geführt, verrieth aber die übermüthigste Stimmung. Die Neckereien flogen unaufhörlich hin und her, und jeder Einfall, jede Bemerkung wurde mit hellem Gelächter aufgenommen. Am Ufer, das die kleine Gesellschaft jetzt erreichte, harrte bereits eine Gondel mit verschiedenem Reisegepäck. Scharf und dunkel hoben sich die Umrisse des Dampfers ab, der in geringer Entfernung lag, während das Licht und die Musik von der Piazzetta her nur gedämpft herüberdrang.
»Jetzt heißt es, all dieser Schönheit Lebewohl sagen,« rief einer der jungen Männer, indem er nach jenem Lichtkreise zurückblickte. »Wenn ich daran denke, daß ich fort muß, um für diese Sonnentage und Mondesnächte die eisigen Herbstnebel und Winterstürme unserer deutschen Hochgebirge einzutauschen, dann möchte ich den Einfall meines Onkels verwünschen, der mich zurück ruft.«
Er war bei den letzten Worten stehen geblieben, und das Licht des Gascandelabers fiel hell auf seine Gestalt, eine schlanke, elegante Gestalt im dunklen Reise-Anzuge. Die blonden Haare und blauen Augen des jungen Mannes verriethen den Nordländer, wenn auch seine ursprünglich helle Hautfarbe jetzt gebräunt erschien; seine Züge hätten nur etwas ausdrucksvoller sein müssen, um für wirklich schön zu gelten. Man suchte in diesen edel gezeichneten Linien unwillkürlich einen tieferen Ausdruck, der nicht vorhanden war, aber sie waren voll Jugend, Heiterkeit und Leben, dabei anziehend, wie die ganze Persönlichkeit.
»Warum gehst Du denn überhaupt?« fragte einer der Begleiter, eine echt italienische Erscheinung mit südlichem Teint und dunklen, brennenden Augen. »Ich würde mich viel um die Einfälle eines alten Menschenfeindes kümmern, der auf seinem langweiligen Felsennest da oben mit sich und aller Welt im Kriege lebt. Ich würde ihm in aller Hochachtung melden, daß mir die Gesellschaft der Uhus und Fledermäuse nicht behagt und einfach hier bleiben. Ich habe Dir das schon vorgestern gerathen, Paul, als die Abberufungsordre eintraf, aber Du wolltest ja nichts davon hören.«
»Mein lieber Bernardo,« sagte Paul lachend, »dieser weise Rathschlag beweist sonnenklar, daß Du nicht weißt, was es heißt, einen Verwandten zu besitzen, von dessen Wohlwollen Deine gegenwärtige Existenz und Deine ganze Zukunft abhängt sonst würdest Du anders urtheilen.«
»Ich wollte, ich hätte ihn!« rief Bernardo. »Solch ein alter Erbonkel, der mindestens eine Million hinterläßt, ist unter allen Umständen eine schätzenswerthe Sache, selbst wenn er mit verschiedenen Uhu-Eigenthümlichkeiten behaftet ist. Leider befindet sich in meiner ganzen Verwandtschaft kein derartiges kostbares Exemplar; Du hast eben darin Glück, wie in allen Dingen.«
»Was ist es denn eigentlich mit diesem Anverwandten, Herr von Werdenfels?« mischte sich jetzt ein Dritter in das Gespräch. »Ich war, ehe ich Deutschland verließ, zufällig in seiner Heimath, wo die tollsten und abenteuerlichsten Gerüchte über ihn im Gange sind. Dieser Burgherr von Felseneck ist so recht eigentlich das Märchen der ganzen Umgegend. Ihnen gegenüber wird er doch seine sonstige Unzugänglichkeit und Unsichtbarkeit nicht festhalten.«
Der junge Werdenfels zuckte die Achseln.
»Ich kann Ihnen darüber keine Auskunft geben, lieber Osten; denn ich weiß nicht mehr als jeder Andere. Es ist ein Vetter meines verstorbenen Vaters, aber die Beiden standen sich stets fern, und ich selbst habe ihn überhaupt nur ein einziges Mal gesehen und gesprochen. Das war vor Jahren, als ich nach dem Tode des Vaters seiner Vormundschaft übergeben wurde. Seitdem beschränkt sich unser Verkehr auf die Briefe, in denen ich ihm regelmäßig von meinem Leben und Treiben Nachricht gebe, und auf die kurzen, flüchtigen Antworten, die er mir bisweilen zu Theil werden läßt. Ich habe kaum jemals erwartet, ihm nahe treten zu müssen, und begreife nicht, weshalb er mich jetzt auf einmal zu sich ruft.«
»Wahrscheinlich will er sein Testament machen!« rief ein junger Officier, der gleichfalls zu der Gesellschaft gehörte. »Das wäre wenigstens eine vernünftige Idee, und hoffentlich hast Du Aussicht, ihn bald zu beerben. Wir wollen Dir helfen, die Million etwas flüssiger zu machen; vorläufig laden wir uns allesammt bei Dir zur Gemsenjagd ein, wenn Du dort drüben erst Herr und Meister bist. Schlag' ein, Paul, auf nächsten Sommer!«
Er hielt ihm übermüthig die Hand hin, aber Paul zog mit einer halb unwilligen Bewegung die seine zurück.
»Nicht solche Scherze! Mein Onkel ist noch keineswegs so alt, wie Ihr glaubt, und trotz all seiner Sonderlingslaunen ist er doch gegen mich die Güte selbst gewesen. Er hatte immer eine offene Hand für mich und gewährte mir mit vollster Freigebigkeit Alles, was ich brauchte.«
»Und Du hast sehr viel gebraucht,« warf Bernardo ein. »Dein Aufenthalt in Italien mag eine hübsche Summe gekostet haben.«
Paul warf ihm einen spöttischen Blick zu.
»Das mußt Du allerdings am besten wissen: denn Du hast mir redlich geholfen. Die Hälfte all meiner Ausgaben kommt auf Dein Conto, Bernardo.«
»Ja, ich habe mich Deiner nach Kräften angenommen,« versicherte dieser. »Du verstandest überhaupt gar kein Geld auszugeben; Du hast das erst unter meiner vorzüglichen Leitung gelernt. Dein Herr Onkel scheint aber doch jetzt ernstlich für seine Casse besorgt zu werden und will sie vor weiteren Attentaten sicher stellen.«
«Gleichviel aus welchem Grunde er mich zurückruft! Ich muß gehorchen, aber ich gehe mit schwerem Herzen.«
»Gilt dieser Seufzer dem schönen Venedig?« neckte Osten, »oder gilt er der noch schöneren Landsmännin, die jetzt in unseren Mauern weilt? Leugnen Sie es nicht, Werdenfels! Sie sind ja der einzige Bevorzugte von uns Allen, dem es vergönnt war, ihr zu nahen.«
»Ja, das ist wieder Pauls unerhörtes Glück!« rief Bernardo dazwischen. »Was gäbe ich darum, dieses wundervolle goldbraune Haar und diese Augen auf der Leinwand festhalten zu dürfen! Es ist ja, als ob ein Bild eines unserer alten Meister aus dem Rahmen gestiegen wäre. Aber es war nicht möglich, die hartnäckige Zurückgezogenheit zu durchbrechen, in der diese stolze Schönheit sich gefällt. Konnte denn nicht ich die verlorene Brieftasche finden, die doch wohl von Werth gewesen sein muß; denn die ausgesetzte Belohnung war ziemlich hoch. Paul findet sie sofort; er überbringt natürlich den Fund persönlich, wird vorgelassen, bleibt eine volle Stunde dort und verliebt sich ebenso natürlich sterblich in seine schöne Landsmännin. Das Letztere finde ich übrigens durchaus begreiflich, denn ich habe nur fünf Minuten dazu gebraucht.«
»Ja, er kam ganz verklärt zurück,« fiel der junge Officier ein. »Und seitdem schwebt er fortwährend in höheren Regionen und versteht es nicht einmal mehr, den Wein zu schätzen. Ich bin überzeugt, daß sich da Mondschein-Serenaden und allerlei sonstige zarte Beziehungen angesponnen haben, aus denen man uns leider ein Geheimniß macht.«
»Spottet nur!« sagte Paul Werdenfels, halb belustigt, halb ärgerlich über die Neckereien. »Ihr wäret doch allesammt gern an meiner Stelle gewesen. Wenn mir aber Bernardo ein unerhörtes Glück zuspricht, so muß ich doch ernstlich dagegen protestiren. Nennt Ihr es vielleicht Glück, aus dem Bannkreise dieser Augen fortgerissen zu werden, wenn man nur ein einziges Mal hineingeschaut hat? Ich habe bei meinem heutigen Abschiedsbesuche Frau von Hertenstein nicht angetroffen; vielleicht ließ sie sich auch vor mir verleugnen; jedenfalls habe ich sie nicht wiedergesehen. Ich kenne kaum mehr von ihr als den Namen, weiß nur, daß sie Wittwe ist und noch Trauer um ihren Gatten trägt. Alles, was sonst ihre Person betrifft, ist mir fremd und geheimnißvoll und so muß ich abreisen.«
Die letzten Worte wurden mit einer komischen Verzweiflung gesprochen, welche natürlich die Neckereien verdoppelte. Inzwischen aber war aus dem Dunkel, in welchem die Gondel lag, eine ziemlich kleine Gestalt aufgetaucht, ein alter Mann mit grauen Haaren, der einfach dunkle Livrée trug und jetzt in mahnendem Tone sagte:
»Herr Paul, jetzt ist es aber die höchste Zeit. Der Dampfer fährt in einer halben Stunde ab.«
»Wir sind noch mit den Abschiedsfeierlichkeiten beschäftigt,« erklärte Bernardo. »Stören Sie uns nicht darin, Arnold! Sie danken ja doch Gott und allen Heiligen, daß Sie Ihren jungen Herrn unserer verderblichen Gesellschaft entführen und nach Deutschland in Sicherheit bringen können«
Er hatte Deutsch gesprochen, um von dem alten Diener verstanden zu werden, aber dieser ließ sich durch den Spott nicht beirren; er erwiderte trocken und gleichfalls in deutscher Sprache:
»Ja, es thut auch noth, daß er endlich wieder zu vernünftigen Menschen kommt.«
Die jungen Männer schienen diesen Ausfall sehr amüsant zu finden; denn sie brachen sämmtlich in ein lautes Gelächter aus, in welches auch Paul Werdenfels einstimmte.
»Bedankt Euch doch für das Compliment!« rief er. »Es ist vollkommen ernst gemeint. Aber Du nimmst Dir wirklich etwas viel heraus, Arnold!«
»Ich thue nur meine Pflicht,« lautete die nachdrückliche Antwort. »Als die selige Frau Baronin auf dem Sterbebette lag, hat sie mir feierlich den Junker Paul übergeben. ›Arnold!‹ sagte sie zu mir –«
»Um des Himmels willen hören Sie auf!« unterbrach ihn Osten. »Sie haben uns die Geschichte mindestens schon zwanzig Mal erzählt. Wir wissen es ja längst, daß Sie bei Herrn von Werdenfels Vater- und Mutterstelle vertreten und daß er einen ganz heillosen Respect vor Ihnen hat, wie wir übrigens Alle.«
»Vor allen Dingen ich!« ergänzte Bernardo, »denn ich war von Euch allen am häufigsten Gegenstand seiner Predigten und fühle mich am tiefsten dadurch getroffen.«
Die Blicke des alten Dieners überflogen mit einem nichts weniger als freundlichen Ausdrucke den ganzen Kreis und blieben zuletzt auf dem übermüthigen Maler haften.
»Signor Bernardo,« sagte er feierlich. »Die Freunde meines jungen Herrn sind allesammt schlimm, aber Sie sind der Schlimmste!«
Diese Erklärung rief einen neuen stürmischen Ausbruch der Heiterkeit hervor, aber urplötzlich verstummte dieser, und ebenso plötzlich wichen die jungen Herren rechts und links zur Seite, um einer kleinen Reisegesellschaft Platz zu machen, die gleichfalls nach dem Ufer schritt. Es war eine Dame in tiefer Trauerkleidung; sie hatte den Schleier herabgelassen, aber das reiche Haar drängte sich unter dem Hute hervor, und als es beim Vorüberschreiten einen Moment lang von dem Strahl der Gasflamme getroffen wurde, schimmerte es auf diesen anscheinend dunklen Flechten wie in goldigem Glanze. An der Seite der Fremden ging eine ältere sehr einfach gekleidete Frau, offenbar eine Untergebene, und ein Hôteldiener mit mehreren Reise-Effekten folgte den Beiden. Paul Werdenfels grüßte tief und ehrerbietig; die Uebrigen folgten seinem Beispiel. Die Dame neigte leicht das Haupt zur Erwiderung und nahm dann mit ihrer Begleiterin in einer seitwärts liegenden Gondel Platz, die gleich darauf abstieß.
»Jetzt leugne es noch, daß Du ein Glückskind bist!« raunte Bernardo seinem Freunde zu. »Da fährt sie hin, zu demselben Dampfer, auf dem Du die Ueberfahrt nach Deutschland machst.«
Pauls Augen hingen längst an dem kleinen Fahrzeug, das jetzt aus dem Schatten des Ufers in das helle Mondlicht hinausglitt und in der That die Richtung nach dein Dampfer nahm.
»Wahrhaftig, sie geht an Bord!« sagte er mit aufleuchtenden Blicken. »Ich hatte keine Ahnung davon; denn sie deutete auch nicht mit einer Silbe auf ihre Abreise hin. Aber Arnold hat Recht es ist die höchste Zeit, daß ich aufbreche; also Lebewohl Euch Allen!«
Er wollte den Abschied möglichst kurz und hastig abmachen, aber das gelang ihm nicht; denn die sämmtlichen Herren wurden von einer ebenso plötzlichen wie rührenden Zärtlichkeit für den scheidenden Freund ergriffen und fühlten das dringende Bedürfniß, sich bis zum letzten Momente seiner Gegenwart zu erfreuen.
»Wozu uns jetzt schon trennen!« rief Bernardo. »Es ist noch eine halbe Stunde bis zur Abfahrt, und die können wir gemeinschaftlich verleben. Ich begleite Dich an Bord.«
»Ich gleichfalls,« fiel Osten ein. »Es wäre unverantwortlich, wenn wir Ihnen nicht bis zum Dampfer das Geleite gäben.«
»Wir gehen Alle mit an Bord,« entschied der Officier, ein Vorschlag, der mit stürmischer Acclamation aufgenommen wurde, aber Der, dem er galt, zeigte sich nichts weniger als dankbar dafür. Paul protestirte anfangs lachend, dann ernster und verbat sich zuletzt entschieden die beabsichtigte Begleitung. Einige der Herren machten bereits Miene, das übel zu nehmen, als Bernardo sich in das Mittel legte.
»Laßt ihn gehen!« sagte er. »Ihr seht es ja, er steuert mit vollen Segeln in das Abenteuer hinein und gönnt uns nicht den geringsten Antheil daran. Wir sind ihm lästig bei diesem Rendez-vous auf dem Dampfer; denn man wird uns doch nicht einreden wollen, daß diese gemeinschaftliche Abreise eine zufällige ist.«
Paul zog die Stirne kraus, und seine Stimme klang sehr scharf und bestimmt, als er erwiderte:
»Ich begreife nicht, wie Du dazu kommst, an meinen Worten zu zweifeln. Es ist hier weder von einem Abenteuer noch von einem Rendez-vous die Rede, und ich bitte Dich ernstlich, mich und Frau von Hertenstein mit solchen Voraussetzungen zu verschonen.«
»Ich lege Euch Beiden meine allertiefste Hochachtung zu Füßen,« spottete der unverbesserliche Bernardo. »Du scheinst die Sache von der sentimentalen Seite zu nehmen und vorläufig noch aus der Ferne anzubeten. Jedenfalls ist der Mondscheinroman, der Dich da auf dem Meere erwartet, von einer beneidenswerthen Romantik Ich wünsche Dir alles Glück dazu.«
Paul wandte sich in sichtbarer Verstimmung ab und zu den Anderen, welche ihn jetzt von allen Seiten umdrängten. Abschiedsworte und Händedrücke wurden gewechselt, Neckereien geflüstert, und man gab den Scheidenden nicht eher frei, als bis vom Dampfer das erste Glockenzeichen herübertönte. Jetzt endlich riß Paul sich los und sprang in die Gondel, von wo er den Zurückbleibenden noch einen letzten Gruß zuwinkte.
Er athmete unwillkürlich auf, als das Boot ihn hinaustrug und das ruhige Mondlicht ihn umfing. Um keinen Preis wäre er auf dem Dampfer in Begleitung der ausgelassenen Gesellschaft erschienen, in der er sich bisher so wohl befunden und die ihm heute zum ersten Male lästig geworden war. Er wußte, welcher Magnet sie dorthin zog, und empfand dieses Herandrängen als eine Tactlosigkeit, die er auf jeden Fall verhüten wollte.
Schon nach wenigen Minuten legte das Boot an der Schiffstreppe an, und der junge Mann stieg rasch und leicht hinauf, während der alte Diener langsamer folgte. Der größte Theil der Passagiere befand sich bereits an Bord, aber noch dachte Niemand daran, die heißen, dumpfigen Kajütenräume aufzusuchen; die herrliche Mondnacht hielt noch Alles auf dem Verdecke fest. Doch vergebens durchforschte Paul die plaudernden Gruppen, die einzelnen Gestalten, die sich hier und da niedergelassen hatten; vergebens stieg er selbst in den Salon der Kajüte hinab, der augenblicklich ganz leer war. Die eine Gestalt, welche er suchte, war und blieb unsichtbar; Frau von Hertenstein hatte sich jedenfalls schon zurückgezogen und kam vermuthlich erst morgen früh beim Landen wieder zum Vorschein.
Sehr verstimmt und mißmuthig begab sich der junge Mann endlich wieder auf das Verdeck und ließ sich dort auf einer Bank nieder. Soeben wurde das Zeichen zur Abfahrt gegeben; rasselnd lösten sich die Ketten, die Maschine begann zu arbeiten, und das Schiff glitt langsam an der Stadt vorüber. Noch einmal tauchte die Piazzetta auf mit ihrem strahlenden Lichtglanze und ihrem Menschengewoge; noch einmal grüßten die Thürme und Paläste im Mondenlichte herüber. Einige Minuten lang stand das Bild in voller Klarheit da; dann begann es allmählich zurückzuweichen, während der Dampfer zu schnellerer Fahrt einsetzte und seinen Cours nach Norden nahm.
Auf dem Verdecke wurde es nach und nach stiller und einsamer. Die Passagiere suchten, Einer nach dem Andern, die Schlafräume auf, auch Paul Werdenfels erhob sich jetzt in der gleichen Absicht, als er auf einmal dicht an der Kajütentreppe wie gefesselt stehen blieb. Nicht weit von ihm, im hinteren Theile des Schiffes, stand ganz allein eine Dame, die er auf den ersten Blick erkannte, obgleich sie ihm den Rücken zuwandte. Sie mußte erst im Momente der Abfahrt herauf gekommen sein und völlig unbemerkt jenen Platz ausgesucht haben. Der junge Mann machte eine rasche Bewegung dorthin, hielt aber plötzlich inne. So wenig die Schüchternheit sonst zu seinen Fehlern gehörte, hier empfand er doch eine gewisse Scheu, sich zu nahen. Es lag etwas Unnahbares in dieser hohen schwarzgekleideten Gestalt, die da so einsam an der Brüstung lehnte und in das Meer hinausblickte. Das Geräusch der Schritte hatte sie jedoch aufmerksam gemacht; sie wandte sich um, und das Mondlicht fiel voll und klar auf ihre Züge.
Es war ein Antlitz von ungewöhnlicher Schönheit, das aus dem schwarzen, leicht um das Haupt geworfenen Schleier hervorblickte, aber es sprach ein eigenthümlicher, strenger Ernst daraus, der in dem Gesichte einer so jungen Frau wohl befremden konnte. Vielleicht war es der Nachhall jenes schweren Verlustes, von dem die Trauerkleider erzählten, vielleicht auch der gewöhnliche Ausdruck dieser Züge, die bei aller Zartheit der Linien doch keine Weichheit zeigten. Auf der weißen Stirn und um die rosigen Lippen lag im Gegentheil ein Zug energischer Willenskraft, und so schön die braunen Augen auch waren, die sich unter den langen Wimpern aufschlugen, sie blickten so kühl und ernst, als könnten sie niemals in Leidenschaft aufflammen Das Haar verschwand fast ganz unter dem Schleier, welcher Kopf und Schultern bedeckte, aber Paul kannte dieses wundervolle, leuchtende Goldbraun, das sich in den dunklen Falten barg; er hatte es im hellen Tageslichte bewundert.
In dem Gesichte der jungen Frau zeigte sich eine leichte Ueberraschung, als sie den Reisegefährten erblickte.
»Sie hier, Herr von Werdenfels?« fragte sie. »Sie sind gleichfalls auf der Rückreise nach Deutschland?«
Paul verneigte sich bejahend.
»Ich ahnte nicht, daß mir aus dieser Fahrt das Glück beschieden würde, Ihr Reisegefährte zu sein, gnädige Frau. Es war mir nicht vergönnt, Sie noch einmal zu sehen. Sie waren ausgegangen wie man mir sagte.«
Es lag eine gewisse Empfindlichkeit in den letzten Worten, Frau von Hertenstein nahm jedoch keine Notiz davon. Sie ließ das »wir man mir sagte!« unerörtert und erwiderte ruhig:
»Ich habe Ihre Abschiedskarte erhalten, nahm aber an, daß Sie nach Rom gehen würden. Es war ja wohl Ihre Absicht, den Winter dort zuzubringen?«
»Ich hoffte es wenigstens, aber ich erhielt vor einigen Tagen Nachrichten aus der Heimath, die mich unerwartet zurückrufen.«
Paul von Werdenfels war inzwischen näher getreten und stand jetzt neben der jungen Frau. Sie befanden sich allein auf dem Verdecke, welches die letzten Passagiere soeben verlassen hatten. Ruhig, mit kaum sichtbarer Bewegung, glitt der Dampfer dahin; kein Windhauch regte sich, und aus dem Meere, das in tiefer Ruhe dalag. spann die Mondnacht ihren geheimnißvollen Zauber. Der Vollmond erfüllte alles ringsum mit seinem geisterhaften Glanze und tauchte Himmel und Meer in eine weiße träumerische Lichtfluth. In seinen Strahlen flossen die Wellen wie leuchtende Silberströme dahin, und in den Furchen, die das Schiff zog, sprühten und tanzten Millionen von Silberfunken. Weiter hinaus woben Nebel und Mondesstrahlen ihre leichten duftigen Schleier um die Ferne, aber an dem dunklen Horizont stand noch deutlich erkennbar die Stadt, wie eine leuchtende Fata Morgana, die aus den Wellen zu schweben schien und langsam immer weiter und weiter zurück wich. Allmählich begannen sich die Züge dieses strahlenden Nachtgemäldes zu verwischen; die Linien wurden undeutlicher und nebelhafter, und die Hunderte von Lichtern flossen in einen Kreis zusammen, der mit jeder Minute enger ward.
»Ein echtes Märchenbild!« sagte Paul halblaut. »Und wie ein Märchen entschwindet es auch den Blicken.«
»Der Anblick hat in der That etwas Märchenhaftes,« stimmte Frau von Hertenstein bei. »Ich kenne nichts Aehnliches in unseren deutschen Städten.«
»Sie leben also in Deutschland, gnädige Frau?" fragte der junge Mann, hastig den gebotenen Anknüpfungspunkt ergreifend »Ich wußte allerdings schon bei unserer ersten Begegnung, daß ich eine Landsmännin begrüßte, aber Sie sprachen das Italienische mit so vollkommener Reinheit, daß ich auf einen jahrelangen Aufenthalt in Italien schloß.«
Er hielt inne, wie um eine Antwort zu erwarten, und fuhr, als diese nicht erfolgte, rascher fort:
»Bei dieser ruhigen See werden wir voraussichtlich schon mit Sonnenaufgang landen und dann noch rechtzeitig den Courierzug nach W. erreichen. W. ist vermuthlich unser gemeinschaftliches Reiseziel.«
Er glaubte sehr geschickt zu manövriren, aber es glückte ihm trotzdem nicht, etwas über dieses gemeinschaftliche Reiseziel zu erfahren; denn statt der Antwort erfolgte die Gegenfrage:
»Sie reisen also dorthin, Herr von Werdenfels?«
»Nur auf einige Tage, dann kehre ich nach meinem eigentlichen Vaterlande zurück.«
Frau von Hertenstein schien eine Frage thun zu wollen, aber sie unterdrückte dieselbe. Ihre schon halb geöffneten Lippen preßten sich auf einmal mit einem herben Ausdrucke zusammen, während ihr Blick sich zugleich auf den jungen Reisegefährten richtete. Es war ein seltsamer langer Blick, der wie fragend und suchend wohl eine Minute lang auf seinen Zügen verweilte, und sich dann wieder in die Meeresweite verlor, aber Paul hatte ihn nur zu gut bemerkt, und seine Eitelkeit fühlte sich nicht wenig geschmeichelt durch diese Aufmerksamkeit der schönen Frau.
»Wir werden nur zu bald die sonnigen Küsten Italiens vermissen,« hob er wieder an. »Zumal ich; denn mein Weg führt mich geradewegs in das Hochgebirge.«
Die junge Frau wendete sich mit einer jähen Bewegung um.
»Ja das Hochgebirge? Jetzt im Spätherbst?«
»Allerdings,« entgegnete Paul, etwas befremdet über die Lebhaftigkeit der Frage. »Und vielleicht muß ich sogar einen Theil des Winters dort zubringen. Nicht wahr, es ist ein furchtbarer Gedanke, sich in solcher Jahreszeit in den Alpen zu vergraben, mitten unter Schnee und Eis? Es gehört eine Sonderlingsnatur wie die meines Onkels dazu, um daran Geschmack zu finden.«
Frau von Hertenstein hatte sich über die Brüstung gelehnt und verfolgte mit anscheinender Aufmerksamkeit die sprühenden Silberfunken im Kielwasser des Schiffes.
»Sie haben also Verwandte dort?« fragte sie. »Verwandte Ihres Namens?«
»Nur einen einzigen, meinen Onkel Raimund von Werdenfels, unter dessen Vormundschaft ich bis jetzt stand. Er ist gegenwärtig der alleinige Vertreter der älteren Linie unseres Hauses und Herr der sehr bedeutenden Güter, aber er hat sich längst von jedem Verkehr mit den Menschen zurückgezogen und ist nicht einmal zu bewegen, sein Stammschloß, das prachtvolle Werdenfels, zu bewohnen. Er lebt jahraus, jahrein mitten in dem Hochgebirge, auf seinem Lieblingsorte Felseneck, und dort soll ich ihn aufsuchen.«
Die junge Frau verfolgte noch immer das glitzernde Spiel der Wellen, das sie sehr zu fesseln schien; erst nach einer secundenlangen Pause sagte sie:
»Kennen Sie dieses Felseneck?«
»Nein, ich war niemals dort, aber der Beschreibung nach muß es ein düsteres unheimliches Felsennest sein, fast unzugänglich, abgeschieden von aller Welt, kurz, ein echtes Spuk- und Gespensterschloß. Ich habe leider gar keinen Sinn für eine derartige Romantik und würde sie von Herzen gern mit den Salons unserer Residenz vertauschen, wenn ich denn doch einmal Italien verlassen muß.«
»Das scheint Ihnen schwer genug zu werden. Sie folgen wohl nur sehr ungern dem Rufe nach Deutschland?«
»O nein, jetzt nicht mehr!« brach Paul mit leidenschaftlicher Wärme aus. Es war nicht schwer, dieses »jetzt« zu deuten. Blick und Ton sprachen deutlich genug, aber Frau von Hertenstein verstand entweder nicht oder wollte nicht verstehen; denn sie erwiderte mit kühler Ruhe:
»Das läßt sich begreifen. Sobald man auf dem Wege nach dem Vaterlande ist, erwacht das Heimathsgefühl.«
So hatte es der junge Mann nun allerdings nicht gemeint, aber gegen diese Auffassung ließ sich schlechterdings nichts einwenden. Das Compliment über sein Heimathsgefühl verstimmte ihn aber doch einigermaßen, und es trat ein längeres Schweigen ein.
Der Dampfer hatte jetzt die Küsten hinter sich gelassen und steuerte in die offene See hinaus. Es lag in der That etwas Märchenhaftes in dieser nächtlichen Meeresfahrt. Ringsum nichts als die schweigende mondbeglänzte Weite, die, leise wogend und schimmernd, sich endlos auszudehnen schien, darüber der Himmel mit seinen mattfunkelnden Sternbildern und beides überfluthet von dem bleichen klaren Lichte, das alle Formen und Farben in weichen Nebelduft auflöste und auch die ganze Wirklichkeit zu lösen schien in weiches, süßes Träumen. Nur dort drüben, in weiter Ferne, ruhte es noch wie ein großer flammender Stern aus den dunklen Wogen, aber auch dieser begann jetzt zu versinken; in wenigen Minuten mußte er erloschen sein.
»Da entschwindet uns Venedig!« sagte Paul hinüberdeutend. »Wer weiß, wann ich es wiedersehe!«
»Lieben Sie diesen Ort so sehr?« fragte Frau von Hertenstein.
»Unbeschreiblich! Ich sah Venedig zum ersten Male, wie überhaupt ganz Italien, und für mich sinkt dort vor uns ein Jahr voll Glück und Sonnenschein mit der herrlichen Dogenstadt hinab.«
»Ich war schon einmal dort vor Jahren!« sagte die junge Frau langsam. »Und auch damals tauchte es in die mondbestrahlten Wogen nieder, wie in diesem Augenblick.«
So ruhig die Worte auch gesprochen wurden, sie hatten einen eigenthümlich schweren Klang, und in dem Blick, der unverwandt auf jenem schwindenden Lichtkreise haftete, lag es wie ein düsterer Schatten. Vielleicht war auch damals ein Jahr voll Glück und Sonnenschein versunken!
Paul verstand jenen Ton nicht; er war überhaupt kein tieferer Beobachter, und seine heitere Natur hielt elegische Stimmungen nie lange fest; auch jetzt wußte er sie rasch abzuschütteln.
»Nun, wenigstens entschwindet es unseren Blicken als ein Stern,« sagte er scherzend. »Ich will das als ein glückverkündendes Zeichen nehmen und hoffen, daß der Jugendtraum, den ich dort geträumt, dereinst zur Wahrheit wird. Seinen Sternen muß man vertrauen!«
Die Worte waren vielleicht nicht ohne eine gewisse Beziehung, aber nur im Tone leichten Scherzes gesprochen, dennoch schienen sie die junge Frau eigenthümlich zu berühren. Sie schauerte leise zusammen, wie von einem kühlen Nachthauch angeweht, und zog den Schleier dichter über die Schultern. Wieder traf jener räthselhafte Blick den Reisegefährten, jenes seltsame Forschen in seinen Zügen, obgleich diese heiteren offenen Züge nicht gemacht waren, irgend etwas zu verschleiern, und dann wandten die dunklen Augen sich hinüber zu jenem Lichtschein, der noch einen Moment lang aufzuflammen schien und dann verschwand, als sei er in der Fluth selbst erloschen.
»Steine versinken!« sagte die junge Frau leise, aber mit einem unendlich herben Ausdruck. »Und Jugendträume auch. Das Leben ist überhaupt nicht zum Träumen geschaffen; man muß ihm klar und voll in das Auge sehen und Niemand vertrauen als sich selbst. Gute Nacht, Herr von Werdenfels!«
Sie wandte sich um und schritt nach der Kajütentreppe, in der sie gleich darauf verschwand Paul blickte ihr befremdet und bestürzt nach. Was sollte das heißen? Galten diese Worte ihm? Sein harmloser Scherz hatte diese herbe Zurückweisung sicher nicht herausgefordert oder verdient. So mächtig die Anziehungskraft auch war, welche die schöne Frau auf ihn ausübte, in diesem Augenblick fühlte er sich doch bis in das Innerste hinein erkältet; es legte sich wie ein Reiffrost aus seine jugendlich warme Empfindung.
»Eine räthselhafte Frau!« sagte er halblaut. » Will sie vielleicht erkalten und abstoßen, um mich von ihrer Spur abzuschrecken? Es war entschieden Absicht, daß sie jedem Gespräch über ihre Heimath und ihr Reiseziel auswich, und dennoch, dieser seltsame Blick, der unzweifelhaft ein tieferes Interesse kundgiebt! Freilich, ich habe dabei ein Gefühl, als sei ich es gar nicht, den sie ansieht, als suche dieser Blick etwas ganz Anderes, das weit hinter mir liegt. Gleichviel mag sie sich noch so sehr in Räthsel und Geheimniß hüllen, ich werde es erfahren, wohin sie sich wendet!«
Er erhob sich mit einer raschen Bewegung und verließ gleichfalls das Verdeck. Der Nachtwind, der sich jetzt erhob, strich mit leisem Wehen darüber hin; die See wogte stärker, und leise rauschten und flüsterten die Wellen am Kiel des Schiffes, das sie hinübertrugen zu der deutschen Küste.
*
»Das ist ja ein halsbrechender Weg! Immer aufwärts und immer am Abgrunde entlang, und dabei geht es fortwährend durch Nebel und Wolken. Ich habe mir die Sache doch nicht so schlimm gedacht, Herr Paul; ich will Gott danken, wenn wir erst glücklich droben sind!«
Mit diesen Worten machte der alte Arnold all der Noth und Angst Luft, die er bei der ungewohnten Bergfahrt ausstand. Er saß seinem jungen Herrn gegenüber hatte er doch ein- für allemal das Privilegium mit im Wagen sitzen zu dürfen und blickte entsetzt in die Tiefe, die sich zur Rechten des Weges aufthat, während zur Linken die Felswand emporstieg. Die Fahrstraße war zwar in einem vorzüglichen Zustande und die kleinen, aber kräftigen Bergpferde trabten munter und sicher dahin; trotzdem gehörte die Fahrt an diesem düsteren und nebelumschleierten Herbsttage nicht zu den angenehmen, und auch Paul Werdenfels, welcher in der Ecke des Wagens lehnte, schien sehr übler Laune zu sein.
»Wenn das so fort geht, werden wir wohl endlich bei den Schneegipfeln oben anlangen,« sagte er ärgerlich. »Hatte ich nicht Recht, mich gegen die Fahrt nach dem verwünschten Felseneck zu sträuben? Wir müssen in unmittelbarer Nähe sein, und noch sieht man nicht das Geringste davon, so dicht ist das Schloß von den Wolken umlagert.«
»Und der Herr Onkel sitzen immer da oben in den Wolken?« fragte Arnold. »Ein curioser Geschmack!«
»Du fandest es ja so nothwendig, daß ich wieder zu vernünftigen Menschen käme,« spottete Paul. »Hältst Du es für so sehr vernünftig, sich auf diesem Felsen anzusiedeln, wenn man das schöne Werdenfels und noch drei oder vier andere Schlösser zur Verfügung hat? Gieb Acht, Arnold, wenn Dir da oben erst die Fledermäuse um den Kopf schwirren und die alten Raubritter der ehemaligen Burg Nachts in voller Gespensterrüstung umgehen, dann wirst Du noch die ›gottlose‹ italienische Zeit und sogar den Signor Bernardo zurückwünschen!«
»Den gewiß nicht!« sagte Arnold feierlich. »Denn der ist ärger als der ärgste Raubritter. Aber wenn es da oben auch noch so schlimm aussieht, Herr Paul, hinauf müssen wir doch. Der gnädige Herr Onkel haben es befohlen, und wir müssen ihn bei guter Laune erhalten; denn wir haben trotz all seiner Geldsendungen so viel Schulden gemacht, daß ihm die Haare zu Berge stehen werden.«
Paul stieß einen Seufzer aus.
»Wenn ich nur wüßte, wo das Geld eigentlich geblieben ist! Ich habe nie geglaubt, daß die Summen so riesig anwachsen würden. Die verwünschten Wucherzinsen!«
»Und der Signor Bernardo!« ergänzte Arnold. »Der hat uns allein auf dem Gewissen. Wie oft habe ich nicht gewarnt und gebeten, aber der gottlose Mensch lachte mir in's Gesicht, und Sie waren sein gelehriger Schüler. Sie –«
»Um Gotteswillen, fange nicht schon wieder an zu predigen!« unterbrach ihn Paul. »Du weißt, es hilft doch nichts.«
»Aus meinem Munde freilich nicht, aber der Herr Onkel wird hoffentlich eine Predigt halten, die man nicht so ohne Weiteres in den Wind schlägt, und wenn er mich fragt, so werde ich ihm reinen Wein einschenken über unsere italienische Reise und über unsere sogenannten Freunde. Dann giebt es sicher einen Sturm, aber das geschieht Ihnen recht, Herr Paul, ganz recht: vielleicht hilft es auf eine Weile.«
»Ich glaube, Du bist im Stande, Dich darüber zu freuen,« rief der junge Mann ärgerlich. »Untersteh' Dich nicht, den Onkel noch mehr gegen mich aufzubringen! Es ist übrigens sehr die Frage, ob Du ihn zu Gesichte bekommst. So viel ich weiß, liebt er nicht den Verkehr mit Fremden.«
Arnold sah aus, als traue er seinen Ohren nicht. Er, der seit vierzig Jahren in den Diensten des Werdenfels'schen Hauses war und sich vollständig als ein Mitglied desselben betrachtete, der den jungen Herrn »erzogen« hatte und jetzt gewissermaßen Vaterstelle bei ihm vertrat, er sollte den eigentlichen Chef des Hauses gar nicht zu Gesichte bekommen, sollte nicht wegen seiner Fürsorge und Umsicht belobt und in seinen Privilegien feierlich bestätigt werden! Das war unerhört, unmöglich! Welch ein Sonderling der Freiherr von Werdenfels auch sein mochte, einer solchen Mißachtung aller Tradition konnte er sich unmöglich schuldig machen.
Paul hatte inzwischen das Wagenfenster niedergelassen und sah hinaus, er erblickte freilich nichts anderes, als was er bereits seit zwei Stunden sah, nämlich dunkle Tannen und wogenden Nebel; auf einmal zeigten sich jedoch mitten in diesem Nebel die Umrisse eines Schlosses, das nur einen Moment lang sichtbar war und dann in der Biegung des Weges wieder verschwand.
»Das ist ja das alte Eulennest!« sagte der junge Mann. »Ich glaubte schon, wir würden es nie erreichen. Wenn es nur wenigstens bewohnbar ist! Es ist keine angenehme Aussicht, bei solchem Wetter zwischen triefenden Mauern mit Moos und Grasbüscheln zu wohnen, und die freundschaftlichen Besuche der Molche und Kröten zu zu empfangen.«
»Um Gottes-willen, glauben Sie das wirklich?« rief Arnold erschrocken. »Das wäre ja schrecklich!«
»Aber originell!« versetzte Paul kaltblütig, »und mein Onkel liebt nun einmal die Originalität über alles. Da er selbst als Einsiedler lebt, so wird er wohl auch seine geehrten Gäste zu einem solchen Leben verurtheilen. Ich wenigstens mache mich auf alles gefaßt. Wenn wir da oben auf einem Lager von Tannenzapfen schlafen und zum Diner nur Waldbeeren und Gletscherwasser erhalten, so Ah! Das ist also Felseneck!«
Der letzte Ausruf verrieth eine so lebhafte Ueberraschung, daß Arnold schleunigst dem Beispiel seines jungen Herrn folgte und den Kopf auf der anderen Seite hinaussteckte. Der Wagen hatte soeben die letzte Windung der Bergstraße hinter sich gelassen, und unmittelbar vor ihnen lag nun das Reiseziel, das allerdings den gehegten Befürchtungen nicht entsprach.
Aus dem Nebel tauchte eine mächtige Burg auf, in mittelalterlichem Stile erbaut, aber offenbar neueren Datums, mit Thürmen und Zinnen, mit blinkenden Fenstern und einem hochgewölbten Eingangsthor. Sie hob sich ungemein wirkungsvoll ab von dem Hintergrunde der Felsen und Tannen, ein einsamer, aber jedenfalls ein stolzer Wohnsitz.
»Gott sei Dank, das sieht ja ganz menschlich aus!« sagte Arnold aufathmend.
»Ein prachtvolles Bauwerk!« rief Paul enthusiastisch. »Was hat Raimund aus dieser alten, halbverfallenen Ruine geschaffen! Ich war einmal als Knabe mit meinem Vater hier oben und erinnere mich noch deutlich des öden alten Gemäuers. Aber welch eine Riesensumme muß ein derartiger Bau gekostet haben das ist ja mehr als großartig!«
Im Schlosse mußte die Ankunft des Erwarteten bereits bemerkt worden sein; denn die schweren Thorflügel waren weit geöffnet. Der Wagen rollte in den Schloßhof, der mit seinen vorspringenden Pfeilern und Erkern, seinen steinernen Gallerien und Treppen einen nicht minder imposanten Eindruck machte. Auch die Empfangsanstalten erwiesen sich als »menschlich«, wie Arnold sich ausdrückte. Zwei Diener in voller Livree warteten am Fuße der Treppe, und auf derselben erschien ein alter Herr mit weißen Haaren in tadellos schwarzem Anzuge, der sich als Haushofmeister vorstellte und respectvoll den jungen Verwandten seines Herrn empfing. Er führte ihn sofort nach den bereit gehaltenen Zimmern, die in der Hauptfront des Schlosses lagen. Es waren zwei große, reich ausgestattete Räume, denen sich ein kleines Gemach für Arnold anschloß. Es fehlte nichts darin, was zur Bequemlichkeit des Bewohners dienen konnte, aber man sah und fühlte es, daß sie überhaupt zum ersten Male bewohnt wurden. Die Diener, welche das Reisegepäck herausbrachten, kamen und gingen lautlos, und der Haushofmeister sprach so leise und gedämpft, daß Paul Mühe hatte ihn zu verstehen, als er nach den Befehlen des Herrn Baron fragte.
»Ich will vor allen Dingen zu meinem Onkel,« entgegnete der junge Mann. »Ich habe ihm Tag und Stunde meiner Ankunft angezeigt; er erwartet mich also jedenfalls. Führen Sie mich zu ihm!«
»Das ist für jetzt nicht möglich,« war die leise, höfliche Antwort. »Der gnädige Herr schläft noch.«
»Jetzt um die Mittagszeit?« Paul warf einen Blick auf die Kaminuhr, die gerade die zwölfte Stunde zeigte. »Er ist doch nicht etwa krank?«
»Das nicht! Der Herr schläft stets bis in die Nachmittagsstunden hinein, da er gewöhnlich die Nächte hindurch wacht.«
»Das wußte ich in der That nicht,« sagte Paul, etwas erstaunt über diese Eröffnung. »So werde ich ihn also erst bei Tische sehen.«
»Ich bedaure sehr der Herr pflegt stets allein zu speisen.«
»Auch jetzt, wo er einen Gast eingeladen hat?«
Der Haushofmeister zuckte die Achseln.
»Ich habe Befehl, dem Herrn Baron allein zu serviren.«
»So? Nun, dann bitte ich wenigstens, meine Ankunft dem Freiherrn zu melden wenn er erwacht.«
Es lag ein unverkennbarer Spott in den letzten Worten, aber in dem Gesicht des Haushofmeisters veränderte sich keine Miene.
»Ich bitte um Verzeihung, aber die Meldung kann nicht eher gemacht werden, bis der Herr selbst sie verlangt. Es darf Niemand ungerufen sein Zimmer betreten.«
»Auch Sie nicht?« fragte Paul, indem er den alten weißhaarigen Mann ansah, der mindestens so lange in den Diensten seines Onkels war, wie Arnold in den seinigen.
»Auch ich nicht, der Befehl gilt für Alle ohne Ausnahme. Darf ich jetzt das Frühstück serviren lassen?«
»Serviren Sie!« sagte Paul resignirt, und der Haushofmeister verschwand. Kaum aber hatte sich die Thür hinter ihm geschlossen, so warf sich der junge Mann in einen Sessel und brach in ein lautes Gelächter aus.
»Das wird ja recht unterhaltend werden! Ich bin also bei sämmtlichen Mahlzeiten ausschließlich auf meine eigene Gesellschaft angewiesen und ich bin bescheiden genug, das sehr langweilig zu finden. Arnold, was machst Du für ein Gesicht! Habe ich es Dir nicht gesagt, daß wir uns hier auf alles gefaßt machen müssen?«
Arnold stand noch immer da, mit einer Reisetasche in der Hand, jetzt aber kam er langsam näher und sagte mit sehr bedenklichem Kopfschütteln.
»Also der gnädige Herr Onkel schlafen den ganzen Tag hindurch?«
»Ja, und das werde ich in Zukunft auch thun,« erklärte Paul. »Es ist jedenfalls das einzige Vergnügen, was Felseneck bietet. Man scheint hier vollständig zum Murmelthier zu werden.«
»Herr Paul, man spricht nicht in solchem Tone von dem Chef der Familie,« ermahnte Arnold.
»Der Chef der Familie ist wirklich mit allen möglichen Uhu-Eigenthümlichkeiten behaftet!« rief Paul, ganz unbekümmert um die Zurechtweisung. »Aber jetzt trage die Reisetasche in das Schlafzimmer und sieh zu, daß Du gleichfalls ein Frühstück erhältst! Auf Waldbeeren werden wir wohl nicht zu rechnen brauchen, aber es wird dennoch eine trübselige Mahlzeit werden.«
Die beiden Voraussetzungen erwiesen sich als richtig. Der Haushofmeister erschien auf's Neue, lautlos, feierlich und ernst mit einem Diener, der das Frühstück servirte, und lautlos, feierlich und ernst ging der Art vorüber. Paul aß vorzüglich, langweilte sich entsetzlich und berechnete dabei, wie viel Stunden und Minuten diese Woche enthielt, die er anstandshalber hier zubringen mußte. Siebenundsechzig Minuten waren schon vorüber Gott sei Dank!
Die nächsten Stunden vergingen mit der Orientirung in dem neuen Aufenthalt. Paul durchwanderte die sämmtlichen Räume des Schlosses, dessen Besichtigung der Haushofmeister zuvorkommend anbot, aber es wurde dem jungen Manne mit jeder Minute unheimlicher in der Oede und Einsamkeit all dieser Zimmer und Säle und bei diesem schweigsamen Führer, der jede Thür öffnete, jede Frage beantwortete, aber nicht ein Wort mehr sprach, als unbedingt nöthig war.
Da waren ganze Reihen von Gemächern, deren Einrichtung, streng im Stile des Schlosses gehalten, ebenso viel Pracht wie künstlerischen Geschmack verrieth. Sie schienen nur der Bewohner zu harren, aber sie wurden nicht bewohnt, und man merkte es ihnen an, daß sie monatelang gar nicht betreten wurden.
Da gab es einen vorzüglich ausgestatteten Marstall, mit den edelsten Pferden und ein halbes Dutzend Reitknechte, deren Aufgabe darin bestand, die Thiere, welche nie benutzt wurden, spazieren zu führen. Da zeigte sich eine zahlreiche Dienerschaft, die Niemand bediente, sondern nur für das Schloß und dessen Räume da war kurz, es war ein Haushalt in großem Stile und auf wahrhaft verschwenderischem Fuße zum Dienste eines Einzigen eingerichtet aber dieser Einzige machte keinen Gebrauch davon.
Freiherr von Werdenfels wohnte drüben in dem alten noch erhaltenen Theile der ehemaligen Burg, den er hatte restauriren lassen, und betrat nie das neue Schloß. Wenn er überhaupt ausritt, so benutzte er stets ein und dasselbe Lieblingspferd, das zu seinem ausschließlichen Dienste bestimmt war. Seine Dienerschaft sah er gar nicht, da es ihr streng verboten war, seine Zimmer zu betreten, und er selbst blieb größtentheils unsichtbar für sie. Das erfuhr Paul nach und nach auf seine Fragen, und als er endlich in sein Zimmer zurückkehrte, war er zu dem Resultate gekommen, daß ganz Felseneck verhext sei, der unsichtbare Herr desselben gleichfalls, und daß man so schleunig wie möglich diesen verfänglichen Ort fliehen müsse, um nicht demselben Schicksal zu verfallen.
Die unbehagliche Stimmung des jungen Mannes steigerte sich mit jeder Minute. Jetzt, wo es darauf ankam, dem Onkel selbst gegenüber zu treten, wollte es ihm nicht mehr gelingen, dessen Eigenthümlichkeiten, wie bisher, von der komischen Seite zu nehmen, und eine peinliche Empfindung gewann in ihm immer mehr die Oberhand: Welch ein Empfang wartete seiner bei diesem offenbaren Menschenfeinde, der nicht einmal mit seiner nächsten Umgebung verkehrte! Er bemühte sich vergebens, in seiner Erinnerung ein klares Bild des Mannes herzustellen, den er nur ein einziges Mal gesehen hatte, und das war vor zehn Jahren gewesen, an der Leiche seines Vaters, als der Schmerz des Verlustes jede andere Empfindung in den Hintergrund drängte.
Damals war Raimund von Werdenfels allerdings erschienen, um die Vormundschaft über den verwaisten Sohn seines Verwandten zu übernehmen und der Wittwe, die ganz mittellos dastand, seinen Beistand zu sichern. Er hatte sein Versprechen auch in vollstem Maße gehalten, dabei aber jeden persönlichen Verkehr vermieden. Seine Vormundschaft über Paul existirte nur dem Namen nach; dieser wurde gänzlich von seiner Mutter erzogen, der Werdenfels eine sehr reiche Rente ausgesetzt hatte. Nach ihrem Tode ging diese Rente unverkürzt auf den Sohn über, nicht gerade zum Vortheil des jungen Mannes, der sich dadurch gewöhnte, über sehr bedeutende Mittel zu verfügen, während er selbst vermögenslos war und gänzlich von der Großmuth des Onkels abhing.
Er machte unbedenklich von dieser Großmuth Gebrauch, hatte sich aber bisher stets in den ihm gezogenen Grenzen gehalten. Erst der Aufenthalt in Italien und die lockere Gesellschaft dort verleiteten ihn zu einer Verschwendung, die er jetzt bitter bereute. Er erschrak selbst, wenn er an die Höhe der Summen dachte, die doch nothwendig gedeckt werden mußten, und in solchen Momenten war er sogar geneigt, seinen Freund Bernardo und dessen Einfluß auf ihn mit sehr kritischen Blicken zu betrachten. So leichtsinnig Paul auch sein mochte, er empfand doch tief das Peinliche eines derartigen Bekenntnisses vor dem Manne, dem er alles verdankte, und er hätte viel darum gegeben, wenn die nächsten Stunden erst vorüber gewesen wären.
Endlich, gegen drei Uhr, kam die Botschaft, daß Freiherr von Werdenfels seinen jungen Anverwandten zu sehen wünsche. Diesmal war es der Kammerdiener des Freiherrn, der die Nachricht brachte, ein Mann gleichfalls in höheren Jahren, der dem Haushofmeister seine einsilbige Höflichkeit abgelernt zu haben schien. Er ersuchte den jungen Baron, ihm zu folgen, und ging voran, um den Weg zu zeigen, der ziemlich lang war. Sie schritten durch hallende Gänge, stiegen Treppen hinauf und hinunter und passirten endlich die Gallerie, die den neuerbauten Theil des Schlosses mit den noch erhaltenen Resten der alten Burg verband. Hier ging es wieder eine enge gewundene Treppe hinauf, dann durch ein kleineres Vorzimmer; endlich öffnete der Diener eine Thür und ließ den jungen Mann eintreten, während er selbst zurückblieb.
Paul sah sich mit einem Gemisch von Neugierde und Beklemmung in dem Raume um, wo er augenblicklich noch allein war; wenn er aber erwartet hatte, irgend etwas Ungewöhnliches zu finden, so täuschte er sich darin, wie in seinen übrigen Voraussetzungen. Es war ein ziemlich großes, halbrundes Gemach, dessen Fenster zu beiden Seiten den vollen Ausblick aus das Gebirge gewährten, während die Thür zwischen ihnen auf einen Altan führte, von dem aus man eine noch unbeschränktere Aussicht genoß. Die Einrichtung erschien auf den ersten Blick viel einfacher, als in den übrigen Zimmern des Schlosses, obgleich sie in Wirklichkeit einen weit höheren Werth hatte; denn hier bildete jeder Gegenstand ein Kunstwerk für sich. Erst bei näherer Betrachtung gewahrte man, welch eine Fülle der kostbarsten Schnitzereien an diesen Möbeln verschwendet war, wie reich und schwer die Gewebe all dieser Vorhänge, Decken und Teppiche waren. Die tiefdunklen Farben, die überall vorherrschten, ließen die Pracht der Ausstattung gar nicht zur Geltung kommen und liehen ihr den Charakter einer düsteren Einfachheit. Das Tageslicht vermochte nur gedämpft hereinzudringen; denn die Fenster wie die Thür lagen so tief in den Mauernischen, daß sie eigene kleine Räume für sich bildeten, und das schwere Eichengetäfel der Wände gab dem Raume vollends etwas Bedrückendes, den der trübe Nebeltag da draußen schon jetzt in dämmernde Schatten zu hüllen begann.
Die Thür, durch welche Paul eingetreten war, hatte sich geräuschlos wieder hinter ihm geschlossen; jetzt öffnete sich ebenso geräuschlos eine andere Thür, welche in die inneren Gemächer führte, und der Herr des Schlosses trat ein. Der junge Mann ging ihm rasch, aber doch mit einer gewissen Befangenheit entgegen, und während er sich verneigte, haftete sein Blick mit verzeihlicher Neugierde auf dem Vielbesprochenen.
Vor ihm stand ein hoher, schlanker Mann, dessen Aeußeres in keiner Weise den Sonderling verrieth. Was an diesem Aeußeren zunächst auffiel, war eine unverkennbare Aehnlichkeit mit dem jungen Verwandten. Es waren offenbar Familienzüge, die sich bei Beiden wiederholten, aber sie hatten eben nur diese regelmäßigen edlen Linien gemein, während sich in allem Uebrigen die größte Verschiedenheit kundgab.
Bei dem Freiherrn waren Haar und Augen dunkler, und in seinem Antlitze lag jenes Etwas, das man bei Paul vermißte, ein tiefdurchgeistigter Ausdruck. Freilich gruben sich auch scharfe Linien in dieses Antlitz, das in seiner auffallenden, krankhaften Blässe den vollsten Gegensatz zu dem blühend heiteren Gesicht des jungen Mannes bildete. In das dunkelblonde Haar und den vollen Bart mischten sich schon hier und da einzelne Silberfäden, und die Augen waren von jener stahlgrauen Farbe, die bisweilen schwarz erscheint, während sie in anderen Augenblicken einen leuchtend hellen Schimmer zeigt. Es waren seltsame Augen: tief, träumerisch und räthselvoll, schienen sie das Innere eher zu verschleiern, als zu offenbaren. Sie mußten sehr schön gewesen sein, als sie einst in der Schwärmerei der Jugend aufflammten; jetzt lag nur tiefe Ermüdung darin, und wenn der Blick sich für einen Moment belebte, war es nur der Widerschein erloschener Gluthen.
»Ich freue mich, Dich zu sehen, Paul,« sagte der Freiherr, indem er seinem Neffen die Hand reichte. »Sei willkommen!«
Der junge Mann hatte Mühe, seine Betroffenheit zu verbergen; er hatte sich die Persönlichkeit und den Empfang des Onkels so ganz anders gedacht. Diese einfach vornehme Erscheinung mit dem ruhigen Ernste in Haltung und Sprache paßte durchaus nicht zu dem excentrischen Bilde, welches seine Phantasie entworfen hatte Er sprach etwas von seiner Freude, dem Onkel endlich persönlich nahen zu dürfen, und von dem längst gehegten sehnlichen Wunsche, ihm mündlich für all seine Großmuth zu danken, aber Werdenfels schien weder auf diese Freude noch auf die Dankbarkeit besonderes Gewicht zu legen. Er erwiderte keine Silbe darauf, sondern lud den jungen Mann nur mit einer Handbewegung zum Sitzen ein, während er sich gleichfalls niederließ.
»Du bist vermuthlich überrascht, Felseneck in dieser Gestalt wiederzusehen,« begann er die Unterhaltung »Du kennst es ja wohl nur als Ruine?«
»Ich bewundere immer von Neuem, was Du aus diesen alten Steintrümmern geschaffen hast,« entgegnete Paul, diesmal mit voller Aufrichtigkeit »Du hast ja die ehemalige Burg in ihrer ganzen Pracht wieder erstehen lassen.«
»So weit das nach den vorhandenen Plänen und Rissen möglich war, allerdings; der Bau hat freilich jahrelang gedauert; er ist erst im vergangenen Herbste vollendet worden.«
»Und trotzdem wohnst Du hier in dem alten Thurme, der allein noch von den früheren Resten erhalten ist?«
»Ja, und ich denke auch hier zu bleiben.«
»Aber weshalb bautest Du denn das Schloß, wenn weder Du noch Andere es bewohnen?« fragte Paul verwundert.
»Weshalb?« fragte der Freiherr ruhig. »Nun, zur Unterhaltung! Man muß doch irgend etwas zu thun haben. Es ist nur schade, daß mit der Vollendung eines solchen Baues auch das Interesse daran aufhört. Seit Felseneck fertig dasteht, ist es mir sehr gleichgültig geworden.«
Der junge Mann sah in sprachloser Ueberraschung auf seinen Verwandten, der nur »zur Unterhaltung« Hunderttausende an ein derartiges Bauwerk verschwendete und dann jedes Interesse an seiner vollendeten Schöpfung verlor.
»Es ist jedenfalls ein stolzer Wohnsitz, den Du Dir mitten in der Einsamkeit des Hochgebirges geschaffen hast,« sagte er nach einer Pause. »Du bist vermuthlich ein geübter Bergsteiger, Onkel Raimund?«
»Nein, meine Gesundheit verbietet mir gänzlich dergleichen Anstrengungen.«
»Dann treibst Du wohl die Jagd mit Leidenschaft in diesen Bergwäldern?«
»Ich jage nie.«
»Oder Du betreibst in ungestörtester Ruhe Deine wissenschaftlichen Studien? Das ist ja wohl von jeher Deine Lieblingsneigung gewesen?«
Werdenfels schüttelte den Kopf.
»Das war in früheren Jahren: jetzt studire ich sehr wenig. Für den Laien hat das auf die Dauer doch keinen Reiz.«
»Aber mein Gott, was fesselt Dich dann hier oben?« rief Paul, »und was liebst Du eigentlich an diesem Aufenthalte, der Dich so weit von den Menschen entfernt?«
»Die Berge!« sagte der Freiherr langsam. »Und die Einsamkeit!«
Er erhob sich und trat an die weit geöffnete Thür, die auf den Altan hinausführte.
»Willst Du die Aussicht einmal genießen? Deine Zimmer haben den Blick nach der Ebene hinaus; nur von hier aus sieht man das Hochgebirge.«
Paul kam der Aufforderung nach und trat gleichfalls auf den Altan. Es war während der letzten Stunden klarer geworden; die Wolken jagten und zogen noch an den Bergwänden hin, aber der Nebel war gesunken, und die Gipfel zeigten sich unverhüllt. Man blickte von diesem Theile des Schlosses aus unmittelbar hinunter in die schwindelnde Tiefe eines öden Felsenthales, aus dem nur Klippen emporstarrten, während unten in dem nebelumhüllten Grunde der Bergstrom tobte, dessen Brausen bis hier herauf drang. Drüben flatterten die Wolken an den jähen Abstürzen einer Felswand, deren Fuß dunkle Wälder umsäumten, während die Höhe nackt und kahl aufragte, und ringsum lagerten die Häupter des Gebirges, die, zum Theil schon schneebedeckt, in schweigender Majestät niederblickten. Nirgends war eine menschliche Wohnung zu erblicken, nirgends ein milderer Zug in diesem Gemälde wilder Großartigkeit ringsum nur Felsen, Tannen und Schneegefilde!
Dem Schlosse gerade gegenüber stieg ein einzelner, riesiger Gipfel empor, der, fast in Pyramidenform gestaltet, all die andern überragte. Auch er trug das leuchtende Schneegewand, aber er thronte einsam, wie ein Herrscher über der ganzen Bergwelt. Obgleich die Weite des Thales zwischen ihm und dem Schlosse lag, schien er doch in unmittelbarer Nähe zu sein, und es lag beinahe etwas Drohendes in dieser Nähe. Es war, als wolle der Berg mit seinen eisigen Wänden die Menschenwohnung erdrücken, die sich bis in sein Gebiet hinaufgewagt hatte.
»Wir werden Sturm bekommen,« sagte Werdenfels dort hinauf weisend. »Wenn die Geisterspitze sich so nahe zeigt, müssen wir ihn stets erwarten.«
»Ist das der Sturmprophet der Gegend?« fragte Paul. »Er hat allerdings etwas Geisterhaftes. Mir wäre es unheimlich, wenn ich immer diese starre weiße Wand vor Augen hätte.«
»Mir ist sie vertraut, schon seit Jahren! Ich und die Geisterspitze, wir kennen einander nur zu gut!«
Die Worte wollten anscheinend gar nichts Besonderes sagen; dennoch fiel ihr Klang dein jungen Manne auf, ebenso wie der Ausdruck in dem Gesicht seines Onkels. Er hatte die Regungslosigkeit dieser Züge anfangs für ruhigen Ernst gehalten, aber es war etwas Anderes. Allmählich trat immer deutlicher eine Starrheit und Leblosigkeit hervor, die etwas Unheimliches hatte. Jede leidenschaftliche Empfindung, jede warme menschliche Regung schien darin begraben zu sein, und der Blick, welcher unverwandt an jenem Schneegipfel hing, war wohl träumerisch, aber auch in ihm lag dieselbe todte Ruhe.
Der Freiherr schien den beobachtenden Blick zu spüren; denn er wandte sich plötzlich um und fragte:
»Wie gefällt Dir die Aussicht?«
Paul zögerte mit der Antwort.
»Du vermagst ihr wohl keinen Geschmack abzugewinnen?«
»Wenn ich offen sein soll nein!« entgegnete der junge Mann. »Sie ist ja unendlich großartig und mag auch einen mächtigen Reiz ausüben auf Stunden. Wenn ich aber verurtheilt wäre, Tag für Tag immer nur in diese Felsenöde zu schauen, so würde ich schon in der ersten Woche Selbstmordgedanken hegen und in der zweiten hinunterstürzen in das erste beste Dorf, um nur wieder Menschen zu sehen und zu fühlen, daß ich nicht allein auf der Welt bin.«
»Das wäre allerdings das Schwerste für Dich!« sagte der Freiherr mit leisem Spott. »Ich würde es ertragen.«
Er trat wieder in das Zimmer zurück und gab Paul einen Wink ihm zu folgen.
»Vermuthest Du nicht, weshalb ich Dich nach Deutschland zurück rief?« fragte er, seinen früheren Platz wieder einnehmend.
»Nein, aber ich gestehe offen, daß es mich überraschte. Da hattest bisher nie den Wunsch. mich zu sehen.«
»Ich hatte ihn auch jetzt nicht, aber es war doch wohl nothwendig, daß Dein Aufenthalt in Italien ein Ende nahm. Vielleicht fühlst Du das selbst.«
Paul sah betreten auf.
Der Onkel konnte doch unmöglich etwas Anderes von diesem italienischen Aufenthalt wissen, als was die Briefe des jungen Mannes ihm davon berichteten.
»Ich?« fragte er ungewiß, »wie meinst Du das?«
»Du weißt, ich habe die Vormundschaft über Dich stets nur dem Namen nach geführt,« sagte Werdenfels ruhig. »Du bist Dir seit dem Tode Deiner Mutter gänzlich allein überlassen gewesen. Ich liebe es nicht, den Mentor zu spielen, und ich greife auch jetzt nur sehr ungern ein, aber Du selbst hast meine Einmischung herausgefordert. Du bist mir doch nun einmal von Deinem sterbenden Vater übergeben worden, und ich kann mich der übernommenen Pflicht nicht entziehen. Du hast dafür gesorgt, daß sie unabweisbar an mich heran tritt.«
In dem Antlitz Pauls stieg eine dunkle Röthe auf. Er verstand nur zu gut, wohin diese Worte zielten, wenn es ihm auch unbegreiflich blieb, wie der Onkel in seiner weltverlorenen Einsamkeit zu der Kenntniß jenes Treibens gekommen war. Dennoch versuchte er sich zu vertheidigen.
»Ich weiß nicht, was Du gehört haben magst, Onkel Raimund, aber ich versichere Dir –«
»Ich mache Dir ja keine Vorwürfe,« unterbrach ihn Raimund. »Du bist jung, lebensfroh und fremdem Einfluß sehr zugänglich. Da geräth man leicht in den Strudel, aber nicht Jeder hat die Kraft, sich mit eigener Hand wieder daraus empor zu arbeiten, und Du hast sie vollends nicht, deshalb mußte ich die meinige herleihen. Es wäre doch schade, Paul, wenn Du mit vierundzwanzig Jahren schon in diesem Strudel zu Grunde gingest.«
Der junge Mann sah zu Boden, während die Röthe in seinem Gesicht noch tiefer wurde. Es waren nicht die Worte, welche ihn verletzten; es lag ja kaum ein Vorwurf darin, und er war sich bewußt, noch ganz andere Vorwürfe verdient zu haben, aber die kühle Ruhe und Theilnahmlosigkeit, mit der das alles ausgesprochen wurde, kränkte und reizte ihn zugleich. Er hatte die Empfindung, als ob es dem Onkel in Wirklichkeit ziemlich gleichgültig sei, ob sein junger Verwandter zu Grunde gehe oder nicht. Er erfüllte mit seinem Einschreiten nur eine Pflicht, welche ihm offenbar sehr lästig war; ein Interesse an der Sache selbst nahm er durchaus nicht.
»Du hast Recht,« sagte Paul endlich mit einer Selbstüberwindung, die ihm schwer genug wurde »Ich bin leichtsinnig gewesen und undankbar gegen Dich, dem ich so Vieles danke, aber Du darfst es mir glauben« hier schlug er die blauen Augen voll und offen zu dem Freiherrn auf »ich habe das oft genug selbst gefühlt und mehr als einmal versucht, mich loszureißen, aber –«
»Deine sogenannten Freunde haben das nicht zugegeben,« ergänzte Werdenfels. »Ich weiß es, da war vor Allem ein gewisser Bernardo, der Dich zu all den Thorheiten verleitet hat«
»Also auch das weißt Du?« rief Paul auf's Höchste betroffen. »Ich ahnte nicht, daß Du so genau über meine dortigen Bekanntschaften orientirt bist.«
Der Freiherr ließ die letzte Bemerkung unerörtert; er fuhr mit derselben kühlen Gelassenheit fort:
»Es war nothwendig, Dich aus diesen Umgebungen zu entfernen; deshalb rief ich Dich zurück. Ich hoffe und erwarte, daß jene Beziehungen nicht wieder aufgenommen werden, aber um Dich ganz davon zu lösen, müssen Deine Angelegenheiten vollständig geregelt werden. Du hast dort Verpflichtungen hinterlassen?«
»Ja,« sagte der junge Mann leise.
Jetzt kam die gefürchtete Beichte; er hatte sie sich doch nicht so schwer und peinlich gedacht, und er wußte, daß die Gelassenheit des Onkels nicht Stand halten werde, wenn er die Summe erfuhr, um die es sich handelte. Der Freiherr zeigte jedoch gar keine Neugier in dieser Hinsicht.
»Wende Dich an meinen Rechtsanwalt, den Justizrath Freising, durch den Du bisher Deine Geldsendungen bezogst! Ich werde ihm die Weisung zugehen lassen, die Sache sofort zu erledigen. Er wohnt nur zwei Stunden von hier in M.; Du kannst also alles Nöthige mit ihm persönlich besprechen.«
»Wie Du befiehlst,« sagte Paul zögernd, »aber die Summe ist bedeutend, sehr bedeutend sogar; ich –«
»Nenne sie dem Justizrath!« unterbrach ihn der Freiherr abwehrend. »Zwischen uns Beiden braucht das nicht weiter erörtert zu werden. Ich fordere nur Dein Ehrenwort, daß Du in dieser Beziehung offen bist, damit jene Verpflichtungen ganz und voll gelöst werden Alles Uebrige wird Freising besorgen.«
Paul stand wortlos da und wußte nicht, ob er sich erleichtert oder bedrückt fühlen sollte. Er hatte diese Auseinandersetzung sehr gefürchtet, und nun ging sie ohne jede Scene vorüber. Der Onkel fragte nicht einmal nach dem Betrag jener Summe, die immerhin ein kleines Vermögen repräsentirte; er gewährte, ohne auch nur einen Tadel auszusprechen; aber die kalte, halb verächtliche Art, in der dies geschah, beschämte den jungen Mann auf das Tiefste. Er hätte lieber Tadel und Vorwürfe hingenommen, als eine derartige Verzeihung, und das warme Dankeswort, das er so gern ausgesprochen hätte, wollte nicht über seine Lippen.
»Ich danke Dir,« sagte er endlich etwas gezwungen. »Ich glaubte nicht, daß Du die Sache so aufnehmen würdest, aber ich werde mich bemühen, Deine Güte besser zu verdienen, als bisher.«
Das Auge des Freiherrn ruhte prüfend auf den Zügen seines jungen Verwandten, aber es lag kein Interesse in diesem Blick.
»Das wird mich freuen, um Deinetwillen. Und nun kein Wort mehr von der Angelegenheit! Sie ist besprochen und erledigt; übergeben wir sie der Vergessenheit! Ich hoffe, daß Du mit Deinen Zimmern zufrieden bist. Du hast Deinen eigenen Diener mitgebracht?«
»Ja, den alten Arnold, der mich stets begleitet.«
»Er ist ja wohl schon lange in den Diensten Deiner Familie?«
»Schon seit länger als vierzig Jahren. Ich habe ihn von meinen Eltern übernommen.«
»Und Du bist vermuthlich sehr vertraut mit ihm?«
»Allerdings,« entgegnete Paul mit geheimer Verwunderung, daß der sonst so gleichgültige Onkel sich so eingehend nach einem alten Diener erkundigte, der ihm gänzlich unbekannt war. »Arnold hat mich von meiner frühesten Kindheit an unter seiner ausschließlichen Obhut gehabt und, wie er stets behauptet, ›erzogen‹. Wir sind zwar fortwährend im Kriegszustande; denn er nimmt sich bei jeder Gelegenheit heraus, den Hofmeister zu spielen, aber ich weiß doch, daß er mit Leib und Seele an mir hängt, und ich selbst kann ihn und seine ewigen Predigten gar nicht mehr entbehren.«
»Man muß diesen alten Dienern manche Eingriffe hingehen lassen,« sagte Werdenfels, »Sie betrachten sich als zur Familie gehörig und haben gewissermaßen ein Recht dazu. Behalte immerhin Deinen Arnold!«
»Interessirst Du Dich für ihn?« fragte Paul, dem eine gewisse Beziehung in diesen Worten zu liegen schien. »Er würde sehr glücklich sein, wenn es ihm erlaubt würde, sich Dir vorzustellen, Onkel Raimund.«
Der Freiherr machte eine abwehrende Bewegung.
»Nein, ich sehe nicht gerne fremde Gesichter um mich. Aber noch Eins, Paul! Laß den ›Onkel‹ aus unseren Gesprächen weg! Dein Vater und ich waren allerdings Vettern, der Altersunterschied zwischen Dir und mir ist aber nicht so groß, um diesen Titel zu rechtfertigen. Ich habe nur zehn Jahre vor Dir voraus. Nenne mich einfach Raimund!«
Paul blickte erstaunt auf seinen Onkel, der erst vierunddreißig Jahre alt sein sollte; er hatte ihn mindestens um zehn Jahre älter geschätzt. Die Züge des Freiherrn waren allerdings noch jugendlich, aber die tiefe Blässe dieser Züge und die noch tieferen Linien darin ließen den Irrthum verzeihlich erscheinen.
»Was nun Deinen nächsten Aufenthalt betrifft,« fuhr Raimund fort, »so wirst Du vorläufig hier bleiben. Ich weiß, daß das nicht in Deinen Wünschen liegt, aber ich halte es doch für besser, Dich nicht sofort neuen Versuchungen auszusetzen, indem ich Dich nach der Residenz schicke. Du hast freie Disposition über die Ställe und kannst reiten und fahren, wohin es Dir beliebt; Du findest hier oben ein vorzügliches Terrain für die Jagd, und die Bibliothek des Schlosses steht ebenfalls zu Deiner Verfügung. Im Uebrigen mußt Du Dich mit der Einsamkeit und Langeweile von Felseneck abfinden, so gut Du es vermagst. Ich selbst werde Dich wenig sehen; denn ich liebe es nicht, mich in meinen Gewohnheiten stören zu lassen. Im Laufe des Winters wird sich ja wohl irgend eine Thätigkeit für Dich finden, die Dir in Zukunft einen festeren Halt im Leben giebt. Und nun leb' wohl für heute!«
Im Laufe des Winters! Paul war so entsetzt über die Aussicht, den ganzen Winter hier zuzubringen, daß er zu antworten vergaß. Zwar stand es bei ihm fest, daß er auf keinen Fall in Felseneck bleiben werde, aber für den Augenblick war jede Opposition unmöglich. So ruhig die Worte auch klangen, sie enthielten doch einen ganz bestimmten Befehl, und nach der unbedingten Großmuth, die der Onkel ihm soeben gezeigt, konnte der junge Mann sich füglich nicht offen dessen Willen widersetzen. Er verneigte sich also und ging. Der Freiherr winkte ihm freundlich, gleichgültig mit der Hand und trat dann wieder auf den Altan hinaus, von wo er unverwandt zu der Geisterspitze hinaufblickte, die in ihrem leuchtenden Schneegewande in voller Klarheit dastand.
*
Es war in der That nicht zu viel gesagt, wenn man behauptete, daß der Burgherr von Felseneck das Märchen der ganzen Umgegend geworden. Je weniger er nach der Welt und den Menschen zu fragen schien, desto mehr fragten sie nach ihm, und die vollständige Zurückgezogenheit und Einsamkeit, in der er nun schon seit Jahren lebte, gaben Anlaß zu den seltsamsten Gerüchten.
Diese Gerüchte waren freilich meist so abenteuerlich, daß die Vernünftigen sie ohne Weiteres in das Reich der Fabel verwiesen und sich mit der Annahme begnügten, daß Raimund von Werdenfels ein ausgemachter Menschenfeind sei. Allerdings blieb kaum eine andere Erklärung übrig für die Hartnäckigkeit, mit der er sich jedem Umgange, ja sogar jeder zufälligen Begegnung entzog. Er war und blieb unsichtbar für die ganze Nachbarschaft, unzugänglich für seine Beamten, welche niemals direct mit ihm verkehrten; selbst seine eigene Dienerschaft, den Kammerdiener ausgenommen, bekam ihn nur höchst selten zu Gesicht. Er betrat niemals Werdenfels oder eines seiner anderen Güter und hatte um sein Felseneck einen förmlichen Bannkreis gezogen, der nicht zu durchbrechen war, so mancher Versuch auch in dieser Hinsicht gemacht wurde. Die Dienerschaft hatte strenge Befehle, die ebenso streng befolgt wurden. Das Schloß öffnete sich Keinem, der nicht durch den Schloßherrn selbst gerufen war.
Unter seinen Standesgenossen erregte diese Art zu leben ebenso viel Befremden wie Tadel. Man fand es unerhört, daß ein Mann, der durch seinen Namen und Reichthum, durch die Traditionen seiner Familie berufen war, eine der ersten Stellungen im Lande einzunehmen, auf jede Thätigkeit verzichtete und es sogar verschmähte, unter den Grundbesitzern der Provinz, wo er weitaus der bedeutendste war, eine Rolle zu spielen. Man verzieh ihm nicht seine vollständige Gleichgültigkeit gegen alle Interessen und Vorgänge der Umgegend und empfand sein entschiedenes Abwenden davon als eine Art Beleidigung Die Neugier beschäftigte sich allerdings viel mit ihm, aber er genoß auch nicht die geringste Sympathie in jenen Kreisen.
Noch schlimmer gestaltete sich das Verhältniß des Freiherrn zu dem Landvolk, das ihm geradezu feindselig gegenüberstand, und gerade seine eigenen Güter waren es, wo diese Feindseligkeit am schärfsten und nachdrücklichsten hervortrat. Selbst die zahlreichen Beamten, die auf den ausgedehnten Besitzungen und in den umfangreichen Bergwaldungen angestellt waren, traten selten oder nie für ihren Herrn ein, wenn ihre Stellung es ihnen auch verbot, offen gegen ihn Partei zu nehmen. In diesen Kreisen glaubte man unbedingt all jenen Gerüchten, die über Raimund von Werdenfels im Umlaufe waren, und hielt um so hartnäckiger daran fest, je abenteuerlicher sie lauteten. Es war ein Gemisch von Furcht, Haß und Aberglauben, das schließlich einen förmlichen Sagenkreis um ihn wob.
Paul von Werdenfels war mit all diesen Verhältnissen nur sehr oberflächlich bekannt; er hatte nur durch gelegentliche Berichte und Schilderungen davon erfahren, aber es war genug, um im Verein mit dem, was er hier sah und hörte, ihm den Aufenthalt in Felseneck als unmöglich erscheinen zu lassen Er kannte zwar jetzt den Grund dieser plötzlichen Berufung und mußte auch nothgedrungen die Fürsorge anerkennen, die darin lag, aber seit jener persönlichen Begegnung wußte er auch, daß es dem »gnädigen Herrn Onkel«, wie Arnold ihn nannte, sehr unbequem war, sich so eingehend mit seinem leichtsinnigen Neffen befassen zu müssen. Der Freiherr empfand diese Unterbrechung seiner gewohnten Einsamkeit offenbar als eine lästige Störung, hielt es aber doch für seine Pflicht, den jungen Mann, den er bisher so ganz sich selber überlassen, auf einige Zeit den Versuchungen der großen Welt zu entziehen. Eine derartige Buße aber war durchaus nicht nach Pauls Geschmack, und er trat in sein Zimmer, wo Arnold soeben mit dem Auspacken der Garderobe beschäftigt war, mit einem Gesichte, das die übelste Laune verkündete.
»Du packst nur den kleinen Koffer aus, Arnold!« befahl er. »Nur so viel, wie für etwa acht Tage nöthig ist; wir bleiben auf keinen Fall länger hier.«
»So?« fragte Arnold, indem er in seiner Beschäftigung innehielt und verwundert aufblickte. »Sind der Herr Onkel damit einverstanden?«
»O, der Onkel!« rief Paul mit einem ärgerlichen Lachen. »Der hat die freundliche Absicht, mich den ganzen Winter hier oben zu behalten, damit ich Buße thue für meine Sünden und nebenbei bei ihm einen Cursus in der Menschenfeindlichkeit durchmache. Aber eine derartige Strafe lasse ich mir nicht zudictiren. Wir reisen in der nächsten Woche.«
»Nein, Herr Paul, das thun wir nicht!« erklärte Arnold in voller Gemüthsruhe, während er schleunigst wieder auszupacken begann.
»Ich sage Dir, wir reisen! Soll ich etwa zum Trappisten werden in dieser Einsamkeit? Soll ich den ganzen Tag lang Gemsen schießen oder aus Verzweiflung die gelehrten Werke der Schloßbibliothek durchstudiren, die mir großmüthig zur Verfügung gestellt werden? Ich halte es nicht aus in diesem verwünschten Schlosse mit seiner öden unheimlichen Pracht! Ich komme mir wie verzaubert darin vor, und der Onkel hat auch etwas von einem Hexenmeister an sich, dem nichts verborgen bleibt. Er, der nie sein Schloß verläßt, der mit keinem Menschen Verkehr unterhält, ist trotzdem ganz genau über meinen Aufenthalt in Italien unterrichtet. Er weiß Alles, kennt Alles, sogar den Bernardo.«
»Sogar den Signor Bernardo!« wiederholte Arnold mit einem ganz eigenthümlichen Seitenblicke. »Ja, woher mag er das erfahren haben?«
«Weiß ich es? Vielleicht hat es ihm seine weiße Geisterspitze da oben zugeflüstert. Mit natürlichen Dingen geht es nicht zu.«
»Der Herr Onkel waren wohl sehr wild von wegen unserer Schulden?« fragte der alte Diener mit einer unverkennbaren Genugthuung.
»Nein,« sagte Paul ernster. »Er war im Gegentheile die Güte selbst, aber ich wollte, er hätte mich gescholten. Ich hätte lieber die härtesten Vorwürfe ertragen, als diese eisige Gleichgültigkeit, mit der er alles gewährte und alles verzieh. Da ist auch nicht ein Funke von Wärme, von Interesse mehr vorhanden, weder für mich noch für sonst etwas auf der Welt. Er scheint allen menschlichen Regungen abgestorben zu sein.«