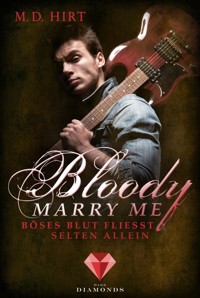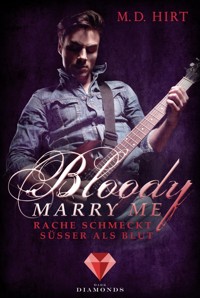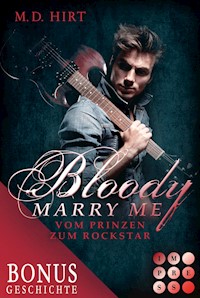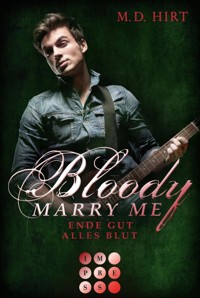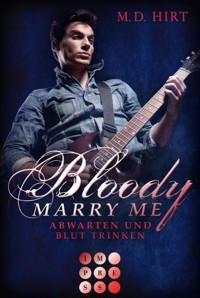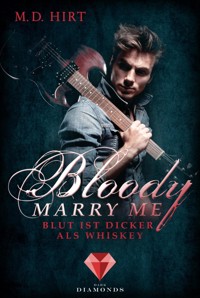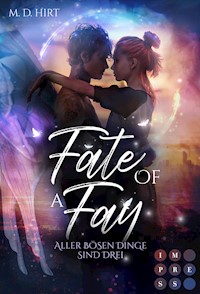
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Verbrenn dir nicht die Flügel …** Peggy ist nur schwer aus der Ruhe zu bringen und hat vor nahezu nichts Angst. Das ist einer der Gründe, warum sie ein altes, verlassenes Krankenhaus ihr Heim nennt und als Trashfilm-Drehbuchautorin nach den skurrilsten Geschichten sucht. Bis sie ein Hilferuf erreicht, der ihr Leben gehörig auf den Kopf stellt. Atris, ein über und über mit geheimnisvollen Tattoos bedeckter Mottenfeenrich, hat versehentlich seine Welt ins Verderben gestürzt. Nun braucht er Peggys Hilfe, um ihre Welt vor dem gleichen Schicksal zu bewahren und einen neuen Platz für sich zu finden … Außergewöhnliches Setting trifft auf ebenso außergewöhnliche Figuren – dieser Fantasy-Liebesroman wird dich umhauen! »Fate of a Fay. Aller bösen Dinge sind drei« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
M. D. Hirt
Fate of a Fay. Aller bösen Dinge sind drei
**Verbrenn dir nicht die Flügel …**Peggy ist nur schwer aus der Ruhe zu bringen und hat vor nahezu nichts Angst. Das ist einer der Gründe, warum sie ein altes, verlassenes Krankenhaus ihr Heim nennt und als Trashfilm-Drehbuchautorin nach den skurrilsten Geschichten sucht. Bis sie ein Hilferuf erreicht, der ihr Leben gehörig auf den Kopf stellt. Atris, ein über und über mit geheimnisvollen Tattoos bedeckter Mottenfeenrich, hat versehentlich seine Welt ins Verderben gestürzt. Nun braucht er Peggys Hilfe, um ihre Welt vor dem gleichen Schicksal zu bewahren und einen neuen Platz für sich zu finden …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© Shattered Light Photography
M. D. Hirt wurde in Barcelona geboren und bereiste mit ihren Eltern die ganze Welt. Heute lebt und studiert sie in Berlin und liebt es, mittlerweile selbst Pläne zu schmieden, um ferne Länder zu erkunden. Ihre Freizeit verbringt sie entweder in ihrer Werkstatt, in der sie an allem herumtüftelt, was ihr in die Finger kommt, oder an ihrem Schreibtisch. Dort ist auch ihr vampirisch-schöner Debütroman entstanden.
Für all diejenigen, die keine Vampirbücher mögen;)
01.
Eine neue Story
»Wie rettet man die Welt ohne Plan? Hm … Nein, auch nicht.« Ich strich eine weitere Titelidee in meinem Notizbuch durch und schob mir das letzte Stück Schokolade aus der XXL-Familienpackung in den Mund, als ich eine neue Nachricht bekam. Nicht die erste und sicherlich auch nicht die letzte in dieser Nacht. Einen kalten Schluck Kaffee später klickte ich auf das kleine Symbol in der Ecke meines PC-Bildschirms, woraufhin sich ein Fenster öffnete. Meine Augen weiteten sich für einen Augenblick voller Erwartung, dann zuckte ich mit den Schultern und schloss das Fenster. Schon wieder die hirnverbrannte Geschichte irgendeines Spinners, der sich meine Aufmerksamkeit erhoffte, indem er mir erzählte, dass die vor ein paar Tagen gesichteten Lichter über Buxtehude definitiv ein mit Mikroplastik betriebenes Raumschiff waren und kein Wetterballon, wie in den Nachrichten berichtet worden war – alles klar! Ich ließ mich gegen die Stuhllehne fallen.
Die Nacht war nicht wirklich ergiebig gewesen und das mit dem Raumschiff war traurigerweise beinahe noch das Beste, was ich heute gefunden hatte. Ein Gähnen entwich mir und ich streckte mich, bevor ich mich von meinem Stuhl erhob. Der Wecker zeigte 3:45 Uhr an – eigentlich noch zu früh, um ins Bett zu gehen, aber ich hatte einen Marathon an Videoschnitt und -bearbeitung hinter mir, weshalb ich beschloss, dass ich mir die paar Extrastunden Schlaf redlich verdient hatte.
Ich schlurfte missmutig ins Bad am Ende des Flurs und putzte mir die Zähne, ehe ich mich noch mal kurz unter die Dusche stellte, um den Schweiß des Tages abzubrausen. Als ich bereits nackig unter dem lauwarmen Wasserstrahl stand, begann das Licht zu flackern. Ich verdrehte die Augen und schlug beherzt gegen die Fliesen oberhalb der Armatur. Welcher Vollidiot war nur auf die Idee gekommen, die Stromleitungen neben den bereits angerosteten Rohren zu verlegen? Offenbar irgendein lebensmüder Handwerker in den 50er-Jahren – und das auch noch ausgerechnet in dem Krankenhaus, in dem ich Dauergast war.
Meine Wohnsituation war in etwa so abgefahren wie mein restliches Leben – zumindest wenn man Steve, meinem besten Freund, Glauben schenken konnte, der sich jedes Mal, wenn er mich besuchen kam, vor Angst beinahe in die Hose machte. Ich persönlich hatte mich dagegen bereits lange daran gewöhnt, als Hauswächterin hier zu leben. Eine kleine Immobilienfirma hatte mich vor ein paar Jahren vermittelt. Sie sorgten mit Leuten wie mir dafür, dass leerstehende Immobilien stinkreicher Investoren, wie das Krankenhaus hier, vor Vandalismus geschützt wurden. Niedrige Mieten gegen Einbrecherschutz durch Bewohnung – eigentlich eine Win-win-Situation. Einziges Manko: Man durfte keine Scheu davor haben, schräg angesehen zu werden, wenn man einen One-Night-Stand in die ungewöhnliche Behausung mitnahm. Generell war eine gewisse Unerschrockenheit Bewerbungsvoraussetzung, die nicht jeder erfüllte – denn von unbekannten Geräuschen bis hin zu flackerndem Licht kam alles regelmäßig vor.
Ein weiterer beherzter Schlag gegen die Wand verwandelte das Flackern wieder in ein gleichmäßiges Leuchten. Na endlich! Ich warf noch einen prüfenden Blick in Richtung Decke, stieg aus der Dusche und rubbelte mir die schulterlangen roten Haare trocken.
Als ich in meinen Pyjama schlüpfte, knurrte wie auf Kommando mein Magen. Offenbar forderte er so langsam seinen Tribut. Meine Diät bestand größtenteils aus Kaffee und Knabberkram. Aber wenn ich jetzt noch etwas Festes zu mir nehmen wollte, dann würde ich den ganzen Gang bis zum Ende laufen und mir noch mal die Zähne putzen müssen … Das war es mir dann doch nicht wert und ich war entschieden zu faul. Noch so ein Nachteil, wenn man in einem verlassenen Krankenhaus wohnte – die Wege waren zu lang für Mitternachtssnacks.
Mit grummelndem Bauch stieg ich schließlich resigniert ins Bett. Auf meinem Handy scrollte ich noch etwas durchs Netz.
Ach, schau an, noch jemand aus meinem Abiturjahrgang, der ein Kind bekommen hat.
Es war mir ein absolutes Rätsel, wie die sich schon in der Lage fühlten, einen kleinen Menschen großzuziehen, während ich nicht mal die Selbstdisziplin aufbrachte, an manchen Tagen was anderes als eine Jogginghose aus dem Schrank zu kramen – wenn überhaupt. Ich seufzte, ehe ich das Smartphone beiseitelegte und zu der Erkenntnis kam, dass sechzehn Stunden auf verschiedene Bildschirme starren dann doch genug waren. Mit einem weiteren wohligen Seufzen schloss ich die Augen, die mir die Ruhepause von den flackernden Pixeln definitiv dankten.
Ich dämmerte in einen traumlosen Schlaf, aber so richtig erholt kam ich mir nicht vor, als mein Telefon klingelte und mich aufweckte. Völlig orientierungslos brauchte ich erst mal einen Moment, um zu begreifen, wo und wer ich war, was das Geräusch verursachte und welchen Wochentag wir überhaupt hatten.
Mit einer Hand tastete ich in dem Vogelnest, wie ich meine Haarmähne liebevoll nannte, herum, mit der anderen griff ich verschlafen nach dem Handy auf meinem Nachtschrank.
»O mein Gott! Peggy, du bist eine Göttin!«
Steves aufgeregte Stimme schallte mir entgegen und ich verzog das Gesicht. Auch wenn er mich schon gefühlt ewig kannte, schien er alles, was er über mich wusste, nach Bedarf geflissentlich zu ignorieren: zum Beispiel, dass man vor dem ersten Kaffee am besten nicht mit mir reden sollte – schon gar nicht so laut.
»Steve, warum zur Hölle rufst du an, es sind noch zwei Stunden, bevor mein Wecker überhaupt nur daran denkt, zu klingeln? Es ist erst kurz vor zwölf!« Ein Stöhnen entfuhr mir. Wenn das irgendjemand anderes als Steve bei mir machen würde, dann hätte ich ihm bereits längst den Kopf abgehackt. Aber da er nicht nur ein Freund, sondern auch ein Kollege von mir war, wäre das ziemlich dämlich. Ich würde mir damit nur mehr Arbeit machen. Unsere Firma, Sharky Industries – eine kleine GmbH, die sich auf Trashfilme spezialisiert hatte –, war so unterbesetzt, dass jeder von uns gleich mehrere Aufgaben übernehmen musste. Das Studio hatte solche Indie-Trashfilm-Hits wie Meteor Sharks und Murder Granny produziert. Nicht wirklich etwas, was in den vorderen Rängen der Online-Streamingdienste rangierte. Wir waren eigentlich nur was für wahre Kenner unterirdisch abstruser Action- und Monsterfilme. Aber es gab noch einen weiteren Grund, von spontanen Köpfungsaktionen abzusehen: Ich hatte mir eine Zeit lang auch mal gewünscht, dass Steve etwas mehr werden könnte als nur ein Kollege, und war gerade erst darüber hinweg.
»Lava Sharks wird der Hit! Das habe ich im Urin«, fuhr er fort.
Aha. Ich zog unweigerlich eine Augenbraue nach oben. Steve hatte doch nichts anderes im Urin als Energydrinks. »Na wenn du meinst …«, murmelte ich genervt und schwang die Füße aus dem Bett. An Schlaf war nicht mehr zu denken.
»Was machst du heute noch?«, fragte Steve weiter und ich verzog das Gesicht nach dem Blick auf den Kalender.
»Bisschen Recherche und dann kommt die Besichtigungsgruppe um 18 Uhr.«
»Versuchen sie wieder das Krankenhaus mit Patienten zu füllen?«
»Jap, zu viele Räume, die ich angeblich nicht allein bewohnen kann«, murrte ich nur. »Vielleicht finden sie diesmal jemanden, der zu mir ziehen will.« Ach, Scheiße, ich musste auch noch lüften und zumindest ein bisschen aufräumen. »Steve, hör zu, ich geh gleich online und melde mich später noch mal bei dir.«
»Alles klar, see you soon, Sailor Moon, Asta la Pasta!«, verabschiedete Steve sich und ich verdrehte die Augen.
Ich legte auf und erhob mich ächzend vom Bett, als sich endlich wieder Stille über mich senkte. Blöderweise war es jedoch vielleicht bald endgültig mit meiner himmlischen Ruhe vorbei.
Eigentlich hatte ich das Krankenhaus am Anfang nicht allein bewohnt, sondern mit zwei Studenten. Doch sobald sie ihren Bachelor in der Tasche hatten, nicht nur im akademischen, sondern auch im beziehungstechnischen Sinne, waren sie erleichtert ausgezogen, während ich hier weiter festhing. Danach hatte ich noch mehrere Mieter kommen und vor allem gehen sehen. Manche schafften es ein paar Wochen, andere immerhin ein ganzes Jahr, ehe sie sich etwas Besseres suchten.
Mit meinem letzten ausgezogenen Mitbewohner hatte ich es dann vor zwei Jahren schließlich auch aufgegeben, mich sonderlich um die festgelegten Regeln zu scheren. Ich nutzte seitdem die weitläufigen Flure des Krankenhauses, um Skateboard zu fahren und gelegentlich für Partys ein Bowlingspiel aus leeren Pfandflaschen zu basteln.
War ja keiner mehr da, der mich verpetzen konnte. Ich hatte dieses kleine Fleckchen aus grauem Beton ganz für mich allein.
Mit einem beherzten Schwung öffnete ich die großen Fenster und ließ frische Luft herein. Dadurch, dass ich die Vorhänge ebenfalls öffnen musste, strömte mit der Luft zusammen allerdings auch jede Menge Licht in mein Gesicht.
»Urgh.« Ich kniff die Augen zusammen und streckte die Hand aus, um mein Gesicht vor der gleißenden Helligkeit abzuschirmen. Die Nacht war mir wesentlich lieber, denn der Mond blendete deutlich weniger auf meinen Computerbildschirmen.
Missmutig schlurfte ich ins Badezimmer.
Nach einer Katzenwäsche zog ich mir eine Jogginghose und ein halbwegs sauberes T-Shirt an, ehe ich mich dem Aufräumen widmete. Seufzend beförderte ich die leere Schokoladenpackung von letzter Nacht in einen Müllsack und warf noch zwei, drei leere Tetrapacks Eistee hinterher. Dann klaubte ich einen BH von meiner Stuhllehne und warf ihn in den Wäschekorb – oder zumindest in dessen grobe Richtung. Das würde an Ordnung ausreichen müssen. Ein Genie beherrschte schließlich das Chaos. Ich war halbwegs präsentierbar, mein Zimmer roch besser und sah einen Hauch weniger nach nerdigem Saustall aus – mehr konnte man nun wirklich nicht von mir verlangen. Meine zukünftigen Mitbewohner sollten schließlich mitbekommen, worauf sie sich einließen.
Zeit für einen Kaffee.
Mit einem vertrauten Schnurren erwachte nicht nur meine Kaffeemaschine, sondern parallel auch mein PC auf einen Knopfdruck hin zum Leben. Das Surren der Lüfter war wie Musik in meinen Ohren und als die drei Bildschirme alle gleichzeitig ansprangen, kam es mir beinahe so vor, als würde mein Herz plötzlich ebenfalls schneller schlagen.
Mein Leben spielte sich nicht nur in diesen ungewöhnlichen vier Wänden ab, sondern eben vor allem in der unbegrenzten Weite des Internets. Sowohl im harmlosen Bereich, in dem die meisten Menschen gerade mal an der Oberfläche kratzten, als auch in zwielichtigen Foren und auf Websites, die man niemals bei Google finden würde. Während andere Leute das Internet für Alltägliches benutzten, bewegte ich mich darin, als wäre es mein zweites Zuhause.
Laut Steve war ich eine Jägerin. Doch statt Wild, Verbrecher, oder verlorene Socken in der Waschmaschine jagte ich Inspirationen und Geschichten. Geschichten wie Urban Legends, die tiefsten Ängste der Menschen, ungewöhnliche Vorkommnisse, gruselige Kriminalfälle und all die anderen Dinge, die kleinen Kindern schlaflose Nächte bereiteten.
Ich sorgte dafür, dass aus ebenjenen Geschichten Filme wurden. Zugegebenermaßen ziemlich schlechte mit einem miesen Budget, aber immerhin kamen sie in einschlägigen Indie-Kinos gern auch mal auf die große Leinwand des Hauptsaales. Lava Sharks würde sich ja nach Steves Einschätzung dort anscheinend zu einem wahren Kassenschlager entwickeln. Ich bezweifelte das noch – immerhin war die Thematik über prähistorische Superhaie schon recht ausgelutscht, auch wenn ich sie neu interpretiert hatte. Es würde ein Film werden, bei dem die Viecher auf der Lava eines Supervulkans schwammen und mit jedem Zentimeter, den der heiße Strom in Richtung Meer floss, immer mehr zu einer globalen Bedrohung wurden. Doch auch wenn ich es selbst geschrieben hatte, war ich nur mäßig von der Story und dem damit verbundenen Blockbuster-Potenzial überzeugt.
Die Vermarktung und die Zuschauerzahlen waren aber auch nicht mein Problem. Das Marketing war einer der wenigen Bereiche, die ich nicht abdeckte, und der ganz Steve vorbehalten war. Ich stellte nur meine Ideen vor und schrieb anschließend Drehbücher dazu – wenn sie denn angenommen wurden. In letzter Zeit war jedoch der Stapel meiner abgelehnten Manuskripte immer größer geworden, weshalb ich zusätzlich noch mehr andere Aufgaben übernahm als ohnehin schon. Schneiden, Bearbeitung des Rohmaterials, Mischen der Tonspur, alles, was ich irgendwie halbwegs hinbekam, wurde mir zugeschustert. Das Einzige, wogegen ich mich konsequent weigerte, war Schauspielern. Wenn ich die blonde und ziemlich hohle Schauspielerin in unserem letzten Streifen so ansah, wurde mir auch wieder klar, warum. Auch wenn ich sie nicht als besonders talentiert empfand – ich würde es kein bisschen besser machen. Jeder beliebige Achtklässler einer Theater-AG hatte mehr schauspielerisches Talent in seinem kleinen Finger als unser durchschnittlicher Cast und ich zusammen. Der zur obligatorischen Liebesgeschichte zugehörige talentbefreite Kerl war ebenfalls eine Vollkatastrophe, der bei jeder Gelegenheit sein Haar nach hinten strich und ein Foto für Instagram schoss, um seine Influencer-Karriere voranzutreiben. Vermutlich wäre ich nicht mal annähernd in der Lage, irgendwelche Chemie zwischen uns vorzutäuschen. Dabei war ich im Vortäuschen eigentlich ziemlich geübt, wenn man meinen Ex-Freunden Glauben schenken wollte.
Ich rollte mit den Augen und meine Gedanken fokussierten sich wieder auf die Tastatur vor mir. Ich streckte und dehnte mich noch einmal. Fast jedes meiner Gelenke knackte fürchterlich und mit geübten Fingerbewegungen gab ich die Adresse des Forenkollektivs ein, in dem ich am meisten aktiv war. Hier tummelten sich Hunderte von Menschen und manche von ihnen hatten vielleicht eine interessante Geschichte zu erzählen.
Zeit, sie zu suchen.
Doch noch ehe ich in den Posts von Verschwörungstheoretikern und Aluhut-Spinnern wühlen konnte, tauchte erneut das kleine Nachrichtenfenster in einer Ecke auf.
Einen Klick später wusste ich, warum. Mein Postfach war vollgestopft mit Nachrichten von irgendeinem unbekannten User. Da hatte wohl jemand ziemlich viel Langeweile gehabt.
Ich schnaubte genervt. Um damit umzugehen, brauchte ich noch einen Kaffee und Nervennahrung … vielleicht auch noch einen Apfel oder so was Gesundes.
Mit einem Snickers bewaffnet ließ ich mich wieder in meinen durchgesessenen Stuhl fallen. Etwas Gesundes hatte ich nicht finden können. Die Obstschale hatte ich vergessen bei meinem letzten Einkauf aufzufüllen.
Dann mal los.
Ich klickte auf das kleine Glocken-Icon und die Flut von Nachrichten sprang mir regelrecht entgegen. Viele von dem seltsamen Typen, aber auch eine Menge Fanpost. Durch meine Arbeit war ich vor allem unter meinem Spitznamen Peggy P. relativ bekannt – die legendäre Heldin der Trashfans. Noch ein Grund mehr, warum ich immer wieder Internetstalker und schräge Vögel anzog. Ich öffnete die erste Nachricht. Der Text war simpel.
Hilfe. Hilf mir!
Das war das, was ich schon gestern Nacht gelesen hatte. Meistens wurden diese Hilfegesuche dann konkretisiert mit einem Hilf mir, du bist das rettende Medikament für meinen schmerzenden Körper! Wenn ich Pech hatte, gab’s dann auch noch gleich ein Foto vom Gemächt des Senders gratis und unerwünscht dazu, weshalb ich den Vordruck für eine entsprechende Anzeige bereits auf meinem Desktop gespeichert hatte. Aber diesmal schien es doch etwas anders zu sein.
Als ich die nächste Nachricht öffnete, war da ebenfalls nur ein kurzer Satz: Ich bin gefangen.
Oh, wow, wenn die Person wirklich pro Halbsatz eine ganze Nachricht brauchte, dann war es ja kein Wunder, dass mein Postfach geflutet war.
Aber vielleicht lohnte sich die Puzzlearbeit ja? Immerhin gab es noch kein Schwengelbild. Nachricht für Nachricht, Minute für Minute setzte ich die Bruchstücke schließlich zu einem richtigen Text zusammen. Ich hatte ja zugegebenermaßen sonst nichts Besseres zu tun.
Hilfe. Hilf mir. Ich bin gefangen. Mein Name ist Nina, ich komme aus Berlin. Ich habe im Internet dieses Spiel gefunden. Es heißt »Elevator Game«, ich habe es gespielt und jetzt bin ich gefangen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin allein hier – vermutlich in einer Spiegel- oder Parallelwelt. Alles ist düster und zwielichtig – das einzige richtige Licht stammt von dem brennenden scharlachroten Kreuz am Himmel. Du musst mir helfen.
So weit, so gut. Ein Lächeln stahl sich auf meine Lippen. Vielleicht war der User doch kreativer als zuerst angenommen. Der Ton der Nachricht passte zu einer Mittelstufenschülerin – abgesehen von der verdächtigen Abwesenheit von Smileys.
Eigentlich war so etwas jedoch genau das, was ich suchte. Ich spürte, wie es mir in den Fingern juckte. Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass ich noch gut eineinviertel Stunden Zeit hatte, um ein bisschen Recherche zu betreiben. Ich dehnte nochmals meine Finger, bis sie ein weiteres leises Knacken von sich gaben, und machte mich ans Werk.
Meine erste Station führte mich, so wie vermutlich jeden klar denkenden Menschen, zu Google. Mit flinken Fingern gab ich Elevator Game in die Suchleiste ein und wurde nicht enttäuscht: 138.000.000 Ergebnisse – damit konnte man doch arbeiten!
Einige Minuten später war ich dann schon schlauer. Bei dem sogenannten Elevator Game handelte es sich um eine koreanische urbane Legende, bei der man mithilfe eines zehnstöckigen Gebäudes und eines Fahrstuhls in eine andere Dimension reisen konnte.
Die neun Regeln zu dem Spiel lauteten wie folgt:
1.Betrete den Fahrstuhl im ersten Stock. Du musst es allein tun, wenn irgendjemand zwischendurch einsteigt, musst du von vorn beginnen, deswegen ist es sinnvoll, das Spiel bei Nacht zu spielen.
2.Im nächsten Schritt musst du den Knopf zum vierten Stock drücken, dort steigst du aber nicht aus, sondern drückst stattdessen den Knopf für den zweiten Stock.
3.Sobald du im zweiten Stock angekommen bist, steige nicht aus, sondern drücke den Knopf für den sechsten Stock.
4.Im sechsten Stock angekommen bleibst du ebenfalls im Fahrstuhl und drückst erneut den Knopf für den zweiten Stock.
5.Wieder im zweiten Stock angekommen kann es sein, dass du eine Stimme hörst, die versucht dich aus dem Fahrstuhl zu locken. Auf keinen Fall solltest du dieser Stimme folgen, sondern stattdessen den Knopf für den zehnten Stock drücken.
6.Im zehnten Stock angekommen bleibst du ebenfalls im Fahrstuhl und fährst als Nächstes in den fünften Stock.
7.Im fünften Stock kann es sein, dass eine fremde Frau zusteigt, sie kann allerdings auch die Gestalt einer Person annehmen, die du kennst. Egal was passiert, du darfst sie weder ansehen noch mit ihr reden. Du solltest stattdessen nur auf die Knöpfe des Fahrstuhls gucken.
8.Drücke den Knopf für den ersten Stock. Der Fahrstuhl sollte jetzt jedoch statt nach unten nach oben, in den zehnten Stock, fahren. Auf dem Weg dorthin könnte die Frau versuchen, ein Gespräch mit dir anzufangen. Sprich auf keinen Fall mit ihr! Sieh sie nicht an!
9.Sobald du im zehnten Stock angekommen bist, hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du bleibt im Fahrstuhl, drückst den Knopf für den ersten Stock und landest wieder in deiner eigenen Dimension. Oder du verlässt den Fahrstuhl und erkundest die Anderswelt – auf eigene Gefahr.
Dort war man offensichtlich mutterseelenallein. Die Parallelwelt war nicht von Menschen bevölkert. Es gab also auch keine Ärzte oder die Feuerwehr, die einen retteten, sollte man sich in einer brenzligen Situation wiederfinden. Das Einzige, was sonst noch – abgesehen von dem Mangel an Menschen – verriet, dass man nicht in der hiesigen Dimension war, war anscheinend die Tatsache, dass ein brennendes rotes Kreuz am immer dunklen Himmel prangte – genau wie in der Puzzlenachricht von Nina beschrieben.
Wofür sie meine Hilfe brauchte, war mir allerdings schleierhaft, denn der Rückweg war denkbar einfach: Um zurück in seine Heimatdimension zu gelangen, musste man nur dieselben Schritte in derselben Reihenfolge mit demselben Fahrstuhl wiederholen. So weit, so gut – eigentlich ganz einfach, aber dennoch irgendwie ein reizvolles Thema für ein Drehbuch.
Was meine kleine Recherche allerdings noch zutage förderte, war die Tatsache, dass der Mythos Elevator Game jetzt schon ziemlich ausgeschlachtet war. Es gab Kurzfilme, Geschichten und sogar ein Videospiel. Seufzend wägte ich ab, ob es sich trotzdem lohnen würde, diese Spur weiter zu verfolgen, oder ob es klüger wäre, sich weiter in den Foren umzusehen, in der Hoffnung auf etwas Besseres.
Hmm …
Nach einem kurzen Scan durch die heutigen Trendthemen der paranormalen Nachrichten entschied ich mich recht schnell dafür, Nina noch eine weitere Chance zu geben. Es klang auf jeden Fall interessanter als die zweihundertunddrölfigste Ufo-Sichtung über Arizona.
Deswegen suchte ich als Nächstes nach dem Namen, der ganz oben als Absender der Nachricht prangte: Nina Leier.
Auch hier wurde ich nicht enttäuscht. Nina Leier war offenbar Berliner Studentin und seit etwas mehr als einem Monat als vermisst gemeldet. Die Polizei suchte nach Hinweisen und ihre Familie und Freunde schienen verzweifelt zu sein. Ich fand sogar ihre Facebook-Seite, auf der sich jede Menge Nachrichten sammelten, in der Hoffnung, sie würde sich melden.
Eine Gänsehaut lief mir den Nacken herunter. Ich war mir sicher, dass es nicht Nina war, die mich kontaktiert hatte – die hätte es garantiert zuerst bei ihren Verwandten versucht. Außerdem waren im Internet die Dinge oft nicht so, wie sie auf den ersten Blick schienen. Jeder konnte jede Identität annehmen, aber es war schon ziemlich makaber, die Identität einer Vermissten zu wählen. Andererseits war ein solcher Gänsehautmoment auch genau das, was wir unseren Zuschauern bescheren wollten. Die Sache war auf jeden Fall einen zweiten Blick wert, wenn auch vielleicht moralisch etwas verwerflich. Ich griff nach meinem Handy und wählte Steves Kontakt aus, um die letzten paar Minuten vor der Besichtigung der potenziellen neuen Hauswächter sinnvoll zu nutzen, und schickte ihm eine Nachricht.
Ich: Hey, Steve, ich bin gerade an einer neuen Sache dran.
Steve: Schon wieder? Du stehst ja wirklich nicht still. Wird es so gut wie Lava Sharks?
Ich schmunzelte.
Ich: Besser. Du musst für mich alles zum Thema »Elevator Game« recherchieren.
Steve: Wird gemacht, Boss!
Jetzt war es Zeit, noch mal mit dieser Person zu reden, die sich für eine verschwundene Studentin ausgab, und das Spiel mitzuspielen.
Hi Nina, schrieb ich, Peggy hier, wie soll ich dir denn helfen?
Ein Klingeln drang aus dem Flur. Jetzt musste ich wohl vorerst mal gute Miene zum bösen Spiel machen und schauen, ob sich noch jemand außer mir vorstellen konnte, in einem alten, verlassenen Krankenhaus zu wohnen. »Willkommen in der Klinik«, murmelte ich, während ich den Türöffner betätigte.
02.
Das Ritual
Als ich motivierte Schritte die Treppe hochstapfen hörte, konzentrierte ich mich darauf, ein Lächeln zustande zu bringen, meinen unordentlichen Pferdeschwanz zu richten und die etwas zu langen Ponysträhnen, die in alle Richtungen abstanden, zu bändigen.
»Daach, Pemela!«
Der Erste, der durch die Flurtür kam, war Matthias, der Hauswächtervermittler. Er war etwas dicklich und sächselte stark, weshalb ich ein paar Treffen gebraucht hatte, um ihn zu verstehen. Mittlerweile kannten wir uns jedoch gut, immerhin kam er alle paar Wochen mal mit einer Gruppe Menschen vorbei und lief mit ihnen durchs Krankenhaus – das schweißte auf einer sehr seltsamen Ebene zusammen. Doch egal wie oft ich ihm sagte, er solle mich Peggy nennen, zog er es weiterhin vor, mich bei meinem richtigen Namen zu rufen, weil er ihn so schön fand. Ich fand den Namen entsetzlich. Meine Mutter war ein riesiger Pamela-Anderson-Fan. Die richtige englische Schreibweise war ihr dann aber doch zu exotisch gewesen und sie hatte das A einfach zu einem E gemacht – deswegen ließ ich mich statt Pemela dann doch lieber Peggy nennen, um mir die Peinlichkeit zu ersparen. Denn im Gegensatz zu meiner Mutter war ich weder ein übermäßiger Fan der blonden 90er-Jahre-Ikone noch von falsch geschriebenen Namen.
Unwillkürlich vergrub ich allein bei dem Gedanken erneut mein Gesicht in meiner Hand, ehe ich wieder hochsah. Mein Lächeln tröpfelte jedoch noch etwas weiter aus meinem Gesicht, als ich die Neuankömmlinge, die langsam hinter Matthias hereinströmten, näher betrachtete.
So wie fast immer waren ein paar Fans durchgerutscht. Matthias gab sich jedes Mal Mühe sie auszusortieren, aber er scheiterte kläglich dabei. Ich nahm ihn zur Seite.
»Matthias, die zwei da vorn mit den Murder-Granny-Shirts. Ich glaube …«
»Oah nee! Ne schon wiedor. Nu hab isch aber langsam die Faxen digge! Isch hab das wegen de Jaggen näh gesähen«, fluchte Matthias entschuldigend.
»Tja … Sie zücken bereits ihre Autogrammhefte.«
»Isch such ma de Schweigebabbiere«, murmelte der Hauswächtervermittler und wühlte in seiner Mappe nach den NDAs, die solche ungebetenen Gäste vorgesetzt bekamen, damit meine Adresse sich nicht noch weiter verbreitete als ohnehin schon.
Mit einem gequälten Lächeln trat ich nach vorn und unterschrieb die verdammten Autogrammhefte, ehe Matthias seinerseits Unterschriften von ihnen einforderte und sie anschließend rauswarf. Danach führte er die Verbliebenen, die hoffentlich mehr am Wohnraum als an mir interessiert waren, durch die Zimmer des Krankenhauses. Schweigend folgte ich ihnen und beobachtete das Geschehen.
Mit der Zeit hatte ich ein Gefühl dafür entwickelt und konnte schon jetzt mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Matthias auch diesmal kein Glück haben würde. Das blonde Mädchen, das vermutlich erst vor ein paar Monaten ihr Abi gemacht hatte und sich jetzt mit dem katastrophalen Berliner Wohnungsmarkt konfrontiert sah, zuckte bei jedem noch so normalen Geräusch zusammen. Das junge Paar dahinter wirkte zwar interessiert, aber das Flüstern hinter Matthias’ Rücken verriet mir, dass sie es nicht ernsthaft in Erwägung zogen, tatsächlich hier einzuziehen. Sie fanden es einfach nur cool, eine geführte Tour durch einen so gruseligen Ort zu bekommen. Bei dem Rest sah es ähnlich aus, und als der Hauswächtervermittler die magische Frage stellte: »Na, wie isses, wer möschte?«, erntete er nur kollektives Kopfschütteln. Verzweifelt verwies er noch mal auf den niedrigen Mietpreis, doch auch das schien niemanden aus der Reserve zu locken, obwohl der Mietspiegel in Berlin in den letzten Jahren in ungeahnte Höhen geschossen war.
Ich brachte die Gruppe noch zur Tür und tätschelte Matthias, der den Kopf hängen ließ, ermutigend auf den Rücken. »Beim nächsten Mal klappt es bestimmt.«
»Joa, mir guggn morgen nochemal, da is de näschsde Besischtschung«, erklärte Matthias mit zweifelhaftem Optimismus.
»Jap, 12:00 Uhr, hab’s mir aufgeschrieben.«
Ich brachte es nicht über mich, ihm zu sagen, dass ich das alles für eine riesige Zeitverschwendung hielt. Eine gute Stunde meines Lebens, die ich nicht zurückbekommen würde, und dann gab’s dasselbe Spiel auch noch mal morgen in aller Herrgottsfrühe.
»Dschissi!«
Ein letztes Winken von mir und … Knall! Die Tür fiel ins Schloss und ich war endlich wieder allein.
Mit langen Schritten lief ich den Flur entlang und schwang mich in meinen Sessel. Ein Grinsen spielte um meine Lippen. Mehrere neue Nachrichten.
Ich öffnete zuerst die von Steve, aber da sie länger als fünf Absätze lang war, seufzte ich nur und drückte auf das Icon mit dem Telefonhörer neben seinem Namen. Glaubte er wirklich, ich würde all das lesen, wenn er es mir auch einfach in fünf Minuten mündlich erklären konnte? Außerdem genoss ich es, seiner tiefen Stimme zu lauschen. Einige Sekunden später erschien sein Video auf meinem Bildschirm und mein Puls beschleunigte sich etwas. Steve war eigentlich recht attraktiv, wenn auch nicht im konventionellen Sinne. Er hatte etwas längere schwarze Haare, ein kantiges Gesicht mit Bartschatten und war genau wie seine Nachricht sehr lang – so lang, dass er sich andauernd an Türen den Kopf stieß. Außerdem war er furchtbar dünn, seine Unterschenkel hatten in etwa die Dimension meiner Unterarme. Ich hätte nicht mal ein Bein in seine Skinny Jeans bekommen. Wobei ich sie ihm wohl lieber ausgezogen hätte. Zumindest war das früher mal so gewesen, heute wusste ich, dass wir aus diversen Gründen besser nur Freunde blieben, auch wenn mein Herz das noch nicht so hundertprozentig verstehen wollte.
»Steve, deine Nachricht war viel zu lang, gib mir die Kurzfassung.«
Er seufzte genervt. Er hasste es, dass ich nicht die Geduld aufbrachte, seine ausgiebige Recherche zu lesen. Noch ein Grund mehr, warum wir besser nur Freunde waren – wir würden uns andauernd über solche Kleinigkeiten streiten.
»Peggy, Peggy, Peggy …« Steve wackelte mit seinem Finger und sah in die Kamera. »Sei doch einmal ein braves Mädchen.«
Sein schiefes Lächeln ließ mein Herz flattern. Verdammt.
»Braves Mädchen kann ich nicht«, erwiderte ich trocken und mein Puls beruhigte sich wieder. Bleib cool!
»Das habe ich gesehen, als du das eine Mal vergessen hast, die Kamera auszumachen, während du dich umgezogen hast. Schwarze Spitze? Für wen hast du dich denn so chic gemacht?«, fragte Steve und wackelte anzüglich mit den Augenbrauen. »Nachdem ich das gesehen hab, habe ich mich echt gefragt, wo du die ganze Schokolade unterbringst.«
Er übertrieb maßlos. Der Vorfall war Monate her und er ritt immer noch darauf herum. Möglicherweise hatte ich ganz versehentlich vergessen meine Kamera auszumachen. Vielleicht war die schwarze Spitze auch kein Zufall gewesen. Eventuell hatte Steve den Wink mit dem Zaunpfahl allerdings trotzdem nicht verstanden. Ich war anscheinend nicht gerade die geborene Verführerin. Meine Wangen brannten allein beim Gedanken daran. Als ich nichts erwiderte, räusperte er sich und kam endlich zum Punkt.
»Ich habe für dich recherchiert. Elevator Game. Es ist eine urbane Legende aus Korea, es geht darum, in eine andere Welt zu gelangen …«
Ich unterbrach ihn. »Ja, das weiß ich alles schon, die Regeln auch. Gibt’s noch was anderes Interessantes?«
Ich hörte Steve genervt seufzen, ehe er fortfuhr. »Angeblich gab es im Zusammenhang damit einen Mord. Eine junge Studentin in Vegas. Das Letzte, was man von ihr gesehen hat, bevor sie tot im Wassertank eines Hotels gefunden wurde, waren die Videobänder des Fahrstuhls, in dem sie sich sehr, sehr seltsam verhalten hat. Ich schick dir den Link.«
Steves Nachrichtenfenster ploppte auf. Ich klickte das Video an und wurde nicht enttäuscht.
Man sah einen Fahrstuhl mit einer jungen Frau in einem roten Hoodie, die wild Knöpfe drückte und so aussah, als wäre sie zu Tode verängstigt. Der Fahrstuhl verhielt sich seltsam, da er die Türen teilweise nicht schloss und die Knöpfe teilweise nicht von der Frau, sondern wie von Geisterhand betätigt wurden – alles hatte eine düstere Grundstimmung. Zwischendurch sah die junge Frau, die sich den Großteil der Aufnahme in die Ecke des Fahrstuhls presste, in den Flur und bewegte ihre Finger in unmöglichen Mustern, die man nicht anders als unnatürlich bezeichnen konnte. Als ob ihre Hände flexibler wären als die von normalen Menschen. Ein bisschen seltsam war es schon. Ich nickte zufrieden und öffnete Steves Videofenster erneut.
»Und, was glaubst du, ist es eine Geschichte wert? Ich habe Nachrichten von jemandem bekommen, der behauptet, das Spiel gespielt zu haben und jetzt in einer anderen Dimension festzustecken.«
»Klingt doch eigentlich erst mal ganz geil! Ich meine, das wäre doch die perfekte Gelegenheit … Du könntest …«
Ich fiel ihm ins Wort, da ich genau wusste, worauf er hinauswollte. »Nein!«
»Och, komm schon, die Idee ist genial!«
»Ich bin Drehbuchschreiberin, und meinetwegen noch Editor und Cutterin, aber keine Schauspielerin!«
»Du weißt, wie gut diese Fake-Dokus seit Mermaid: The Bodys’ Found ankommen!«
Ich verdrehte die Augen. Seit dieser einen Dokumentation, bei der Animal Planet so getan hatte, als seien Meerjungfrauen real, war der Markt um Fake-Dokumentationen, sogenannte Mockumentarys im Found-Footage-Stil, geradezu explodiert. Hauptsache, es sah so aus, als wäre es von irgendeinem Vollidioten gefilmt, der nicht mal wusste, wie man eine Kamera gerade hielt. Nun nervte mich Steve regelmäßig damit, dass ich perfekt wäre für das Format. Wenn ich meine Geschichten recherchierte, wäre es doch ein Klacks, mich dabei aufzunehmen, das Ganze anschließend mit B-Roll-Material, welches wir irgendwie nebenbei aufnahmen, zu überblenden und – Zack! – einen neuen Low-budget-Film zu produzieren, den wir einfach mal zwischendurch veröffentlichen könnten.
»Du weißt, Joseph wäre begeistert!«, versuchte Steve mich weiter zu überzeugen.
Joseph war unser größter Investor und genau wie Steve schon seit einer ganzen Weile Feuer und Flamme für die Idee, mich als Laiendarstellerin einzusetzen. Das hieß allerdings nicht viel.
Denn Joseph war von jeder Idee, die mit mir zu tun hatte, überschwänglich begeistert. Er überinterpretierte jedes Wort aus meinem Mund und jede Geste, die ich machte, maßlos. Den Grund dafür kannte ich: Er hatte Gefühle für mich, aus denen er keinen Hehl machte, und finanzierte deshalb maßgeblich alle Projekte, an denen ich beteiligt war. Ich hatte ihm bereits mehrfach gesagt, dass da nie was zwischen uns laufen würde, aber das schien ihn nicht zu stören oder davon abzuhalten, unsere Firma mit Geld zu bewerfen. In seinen Augen, die von einer rosaroten Brille verschleiert wurden, war ich einfach nur perfekt. Die Traumfrau mit ebenmäßiger Kellerbräune, einem schokoladenverschmierten roten Mund und Haaren, die ihn an seinen liebsten Videospielcharakter erinnerten. Mir sollte es recht sein. Ein Seufzen entfuhr mir. Wenn Steve nur ein bisschen mehr wie Joseph gewesen wäre …
Ich schüttelte den Kopf, um den Gedanken zu vertreiben.
Doch es half nicht wirklich, dass Steve mit seinem Dackelblick gerade direkt in die Kamera sah. Mein Magen zog sich zusammen und die Hand, die die Maus umklammert hielt, wurde etwas rutschig. Wie konnte ich da nur Nein sagen? Ich seufzte aus tiefster Seele.
»Na gut, ich nehme mich und meinen Bildschirm auf, aber ich kann nicht versprechen, dass irgendetwas Sinnvolles dabei rauskommt!«
»Oh, Peggy, du bist die Beste!«
Scheiße. Vielleicht war es doch nicht so effektiv gewesen, sich einzureden, dass meine Gefühle für Steve komplett verebbt waren. Wenn er lächelte, dann konnte ich nicht anders, als es ihm gleichzutun – auch wenn ich es mir nicht eingestehen wollte. Mit ein paar geschickten Klicks öffnete ich das Aufnahmeprogramm und die Kamera. Ich war knallpink im Gesicht, was sich fürchterlich mit meinen kupferroten Haaren biss. O Mann, so würde das nie was werden. Vor allem, da ich mich nicht konzentrieren konnte, wenn Steve mich die ganze Zeit beobachtete.
»Na gut, dann muss ich jetzt aber auflegen, um vernünftig arbeiten zu können«, murmelte ich ausweichend und kratzte mich am Kinn. Wenn ich alles Wichtige aufzeichnen wollte, dann musste ich die Fenster auf meinen Bildschirm definitiv anders anordnen … Ich verschob das Kamerafenster und änderte ein paar der Einstellungen. Mein eigenes Antlitz sah mich leicht verpixelt aus dem Bildschirm heraus an. Mittellange Haare, der widerspenstige Pony, tiefblaue Augen und ein einzelnes Tattoo in Runenschrift an der rechten Seite meines Kieferknochens knapp unter meinem Ohr: Wer das liest, ist doof! Ich hatte es mir stechen lassen müssen, nachdem ich eine Wette verloren hatte. Für einen Augenblick überlegte ich es zu überschminken, entschied mich dann jedoch dagegen. Bei meinem Talent würde es danach vermutlich aussehen wie ein blauer Fleck. Doch trotz meiner sonst eher mangelhaften Make-up-Künste war ich in der Lage, den Eyeliner perfekt aufzutragen – auch wenn es auf diesem Gebiet eben zu sonst nicht viel reichte.
Ich atmete tief durch, vergewisserte mich noch mal, dass die Aufnahme wirklich lief, und öffnete wieder das Chatfenster des Forums.
So, dann wollten wir der Nina doch mal auf den Zahn fühlen. »Und Action!«, flüsterte ich zu mir selbst.
Ich: Hi, Peggy hier, wie soll ich dir denn helfen?
Unter meiner alten Nachricht war eine neue erschienen und zu meinem Glück war sie erst vor ein paar Minuten gesendet worden – vielleicht würde ich eine richtige Konversation aufbauen können.
Nina: Hilf mir hier raus, ich will wieder zurück!
Ich rollte mit den Augen, das war nicht besonders hilfreich und meine Hoffnung schwand wieder etwas.
Ich: In den Regeln steht, dass du einfach nur dieselben Schritte noch mal von vorn machen musst, so gelangst du zurück in unsere Dimension.
Nina: Das geht nicht.
Ich: Wieso nicht?
Nina: Es gibt den Fahrstuhl, den ich benutzt habe, nicht mehr.
Ich sog scharf die Luft zwischen den Zähnen ein. Das war tatsächlich ein Problem. So langsam wurde die Sache spannend.
Ich: Was soll ich dann machen?
Nina: Vielleicht kannst du mich mit zurücknehmen.
Also wollte Nina, dass ich in ihre Dimension kam? Das klang nach einer Menge Arbeit, um einer urbanen Legende nachzugehen. Im Krankenhaus gab es zwar schon mal einen Fahrstuhl, der über zehn Stockwerke ging, und Angst hatte ich keine. Aber sollte ich mich wirklich darauf einlassen, das Spiel selbst auszuprobieren? Dafür müsste ich schließlich die bequeme Wärme meines Zimmers verlassen. Außerdem … was, wenn wirklich etwas Wahres an der Geschichte dran war? Frustriert über mich selbst verwarf ich den Gedanken. Ich glaubte nicht an irgendwelche Geistergeschichten aus dem Internet. Reflexartig kniff ich mich noch mal in den Arm. Ich tat das gern, um mich zu erden und für mich selbst zu prüfen, was real war und was nicht. Wie erwartet durchzuckte mich der gewohnte kurze Schmerz, der für mich nur eines bedeutete: alles okay! Erneut tippte ich auf meiner Tastatur.
Ich: Wo genau bist du denn, Nina?
Nina: Ich bin in der Gegend um Adlershof.
Nun, das war ja nun wirklich nicht um die Ecke. Genauer gesagt befand Nina sich wohl am anderen Ende von Berlin.
Ich: Du musst in den Bezirk Steglitz-Zehlendorf kommen, wenn ich dich von hier aus mitnehmen soll.
Ich würde die Adresse nicht konkretisieren. So weit kam es noch, dass ich irgendjemandem im Internet die Lagebeschreibung meines Wohnortes gab. Es reichte schon, dass hier bei jeder Wohnungsbesichtigung Spinner auftauchten, da würde ich nicht auch noch welche direkt zu mir nach Hause einladen.
Nina: Okay, ich werde dich auf dem Laufenden halten.
Damit ging sie … oder er, ganz ausschließen wollte ich das noch nicht, offline und machte sich anscheinend sofort auf den Weg. Da ich keine Ahnung hatte, ob in der anderen Dimension irgendwelche Busse oder Straßenbahnen fuhren, hatte ich zumindest etwa eine Stunde, ehe sie überhaupt auch nur in meine Nähe kommen würde. Plötzlich leuchtete der kleine Kreis neben Ninas Namen doch wieder grün auf und mein Nachrichtenfenster blinkte erneut.
Nina: Du wirst mir deine Adresse nicht geben, oder?
Ich seufzte. Hatte ich es nicht vorhergesagt? Innerlich gab ich mir selbst ein von der Menschheit enttäuschtes High-Five.
Ich: Gut erkannt, Sportsfreund.
Nina: Okay, dann machen wir das anders, male mit Salz einen Kreis auf den Boden und stelle vier Kerzen, ausgerichtet nach Süden, Westen, Osten und Norden an den Rand, dann werde ich zu dir finden können.
Ich: Kann ich auch vier IKEA-Teelichter nehmen?
Nina: Du könntest auch vier Geburtstagskerzen oder Räuchermännchen hinstellen, Hauptsache, sie stehen richtig und brennen. Das Feuer ist das Wichtigste. Von mir aus kannst du auch vier Scheiterhaufen errichten.
Ich grinste über die schnippische Antwort. Wenigstens hatte mein Gegenüber mehr Humor als zunächst angenommen. Die Frage war nur, wie weit ich bereit war, mich zum Affen zu machen. Mit einem weiteren Augenrollen dachte ich an das Videomaterial, das dabei entstehen würde. Vermutlich machte ein Salzkreis mit Kerzen zumindest etwas mehr her als unendlich lange Chatverläufe. Allerdings würde ich diese ganze Krümelkacke auch wieder aufräumen müssen.
Unschlüssig haderte ich noch ein paar Minuten mit mir, ehe ich mich seufzend erhob. Na gut. Salz, Kerzen und den Staubsauger.
Ich schob meinen Stuhl zurück, trat aus meinem Zimmer und schlurfte den Flur entlang bis zur Küche.
Salz … Salz … Da ich so gut wie nie kochte, war ich mir nicht sicher, wo und wie viel Salz ich überhaupt hatte. Nacheinander öffnete ich suchend die Schränke, bis mir eine volle Dose in die Hände fiel. Ich konnte mich nicht im Entferntesten daran erinnern, überhaupt jemals Salz gekauft zu haben. Offenbar hatte es einer meiner ehemaligen Mitbewohner zurückgelassen.
Als Nächstes kramte ich in einer der Schubladen – die Teelichter fand ich auf Anhieb. Die schlechten Leitungen im Krankenhaus machten es mehr als notwendig, immer eine Taschenlampe oder Kerze parat zu haben, denn der Strom war hier schon öfter ausgefallen. Ebenfalls ein Grund, warum ich meinen PC so eingestellt hatte, dass er regelmäßige Back-ups auch ohne mein Zutun an den Cloudserver unserer Firma sendete. Ein kompletter Datenverlust hatte mir gereicht und damals dafür gesorgt, dass das ganze Drehbuch zu Oh Deer 2 – Die Killerhirsche kehren zurück in die ewigen Jagdgründe eingegangen war. Ich verzog das Gesicht allein bei dem Gedanken daran. Monatelange Arbeit hatte sich einfach in Luft aufgelöst und ich hatte alles neu schreiben müssen.
Mit den Kerzen in der einen und dem Salz in der anderen Hand machte ich mich wieder auf den Weg in mein Zimmer.
Ich zog meinen abgenutzten Flohmarkt-Perserteppich beherzt zur Seite und entblößte so den hässlichen türkisfarbenen Linoleumboden, ehe ich die Salzdose öffnete.
Ob es wohl einen Unterschied machte, ob man Meer- oder Mineralsalz verwendete? Ich schüttelte den Kopf und musste grinsen, als ich mich dabei ertappte, mir ernsthaft darüber Gedanken zu machen, wie man ein abstruses Ritual von irgendeinem anonymen Internetuser korrekt ausführte. Behutsam bückte und drehte ich mich, während ich versuchte einen halbwegs runden Salzkreis um mich herumzuziehen.
Als ich zurücktrat und mein Werk betrachtete, stellte ich fest, dass es mehr einer unförmigen Pflaume glich. Irgendwie sah das in den ganzen Horrorfilmen immer einfacher aus.
Aber es würde wohl genügen müssen, da ich absolut keinen Bock hatte, alles noch mal wegzusaugen und einen zweiten Versuch zu starten. Prüfend schüttelte ich die Salzpackung – es würde ohnehin nicht für einen weiteren Kreis reichen.
Okay … Schritt zwei. Ich zog mein Handy aus der Tasche und wählte die Kompass-App aus. Zwar hatte ich keine Ahnung, wie zuverlässig die wirklich war, aber zusammen mit dem Wissen darüber, von welchem Fenster aus mich die aufgehende Sonne üblicherweise blendete, konnte ich die Kerzen hoffentlich korrekt ausrichten. Ziellos tastete ich auf meinem Schreibtisch herum, bis ich das Feuerzeug fand, das Steve mal bei mir vergessen hatte. Ich hatte es immer in meiner Nähe, obwohl ich Nichtraucherin war – falls das Licht mal wieder ausfiel oder Steve mich je fragen würde, ob ich mal Feuer für ihn hatte. Doch bisher war mein großer Moment noch nicht gekommen.
Es klickte und ein daumennagelgroßes Flämmchen erschien. Schnell machte ich mich ans Werk, bevor mich das Feuerzeug, genau wie meine Kreis-Zeichenkünste, im Stich lassen konnten.
Die Kerzen erwachten nach und nach zum Leben und warfen lange Schatten an die getünchten Wände. Es sah fast schon ein bisschen mystisch aus. Vielleicht würde ich nachträglich in der Bearbeitung noch einen Farbfilter drüberlegen, aber insgesamt würde das Video sicherlich was hermachen. So weit, so gut. Ich prüfte noch mal, ob die Kamera perfekt ausgerichtet und mein Salz-Ei gut zu sehen war, ehe ich erneut das Chatfenster öffnete.
Ich: Kerzen stehen. Was soll ich jetzt machen? »Abrakadabra« sagen und dreimal drumherum rennen?
Nina: Differt lux tenebras mundi.
Ich: Bitte was?
Nina: Das sollst du sagen. Nix mit Rumrennen. Stell dich in den Kreis. Bleib da, bis das Licht wieder angeht.
Ich: Bis das Licht wieder angeht?
Nina: Du wirst schon sehen.
Da wusste jemand ganz genau, wie man sich irgendwelche okkulten Rituale ausdachte. Nina erschien mir langsam sehr viel selbstbewusster als noch vor ein paar Nachrichten – vielleicht war sie doch nicht nur ein Opfer, so wie sie es zunächst vorgegeben hatte. Das würde sich für einen guten Plot Twist eignen. Ich machte mir eine mentale Notiz, trat vom Computer zurück und sah die Kerzen an. Ich kam mir zwar unendlich lächerlich dabei vor, aber ich stellte mich in die fragwürdige Mitte des Gebildes und sagte mit lauter, klarer Stimme, damit sie mein Mikrofon auch ja aufzeichnete: »Differt lux tenebras mundi.«
Augenblicklich begannen die Kerzen zu flackern, aber das beunruhigte mich zunächst nicht. Vermutlich war es nur der Wind, der durch das schlecht abgedichtete Gebäude strich. Ich hatte irgendwann aufgehört dem Hausmeister Bescheid zu sagen, wenn ich mal wieder bemerkte, dass es an irgendeiner Ecke meines Zimmers zog – ansonsten wäre er bis zum Nimmerleinstag mit Abdichten beschäftigt gewesen. Es war eben ein altes Gebäude.
Das leise »Klick«, das als Nächstes ertönte, war mir genauso vertraut, aber dennoch war mir noch nie eine Gänsehaut über den Rücken gehuscht, als ich es gehört hatte. Es war das Geräusch meines Lichtschalters gewesen. Irgendwie hatte er sich von selbst betätigt und ich stand nun im Stockfinsteren – das war im Gegensatz zu dem Luftzug noch nie passiert. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit. Beleuchtet wurde ich nur noch von den Computerbildschirmen und den immer noch flackernden Kerzen. Hatte Nina das gemeint, als sie geschrieben hatte: Bis das Licht wieder angeht?
Gerade wollte ich mich umdrehen, um das Deckenlicht wieder einzuschalten, da ertönte das »Pling« einer neuen Nachricht. Ich hatte das Chatfenster offen gelassen und konnte deshalb selbst vom Kreis aus die geraden, schmucklosen Lettern sehen.
Nina: Bleib im Kreis!
Mich überkam eine weitere Gänsehaut. Das war jetzt doch ein wenig gruselig. Woher sollte Nina wissen, dass ich kurz davor gewesen war, aus dem Kreis zu treten? War meine Webcam etwa gehackt worden?
Kaum hatte ich den Gedanken zu Ende gebracht, passierte etwas, was mich an dieser Schlussfolgerung zweifeln ließ. Die schnöden weißen IKEA-Teelichter, deren Flammen ein warm-gelbes Licht verbreiteten, wechselten ihre Beleuchtung in ein sattes Rot. Ein Rot, das eigentlich viel zu hell war, um von irgendwelchen Teelichtern stammen zu können.
Es war fast wie Magie. Aber eben nur fast. Ich glaubte nicht an Magie. Wenn man einmal damit anfing, dann war es nicht mehr weit bis zu dem Zeitpunkt, an dem man seinem Verstand Lebewohl sagen konnte – und das würde ich nicht zulassen. Es musste also eine andere logische Erklärung her. Ich kniff mich in den Arm, während ich nachdachte.
»Steve?«, rief ich in die Dunkelheit. »Komm schon, das ist nicht witzig. Ich weiß, das Material würde sicherlich mehr hergeben, wenn ich mich richtig erschrecke, aber das ist echt ein bisschen kindisch. Die Versteckte Kamera ist schon seit 2001 nicht mehr lustig!«
Ich sah mich um, doch niemand antwortete mir oder sprang aus meinem Kleiderschrank. Stattdessen begannen meine Bildschirme zu flackern. Das war kein gutes Zeichen und absolut nicht mehr witzig. Mein Magen vollführte einen Salto und ich spürte, wie Wut und eine leichte Panik in mir aufflammte.
»Steve!«, rief ich aufgebracht und diesmal ignorierte ich Ninas letzte Nachricht geflissentlich. Wenn jemand mit meinem Computer, meinem Baby, Schabernack trieb, dann konnte sich derjenige auf was gefasst machen. Nina, oder wer auch immer sonst hinter diesem Möchtegern-Spuk steckte, würde mich kennenlernen. Beherzt trat ich aus dem Kreis und musste blinzeln, als ich schlagartig in gleißendes Licht gehüllt wurde. Sobald mein Fuß über die Salzlinie getreten war, war das Deckenlicht wieder angesprungen. Was zur Hölle? Ich kniff die Augen zusammen und senkte den Kopf, um dem hellen Licht noch weiter zu entgehen, welches sich in meine Netzhaut brannte. Die Kerzen am Kreisrand waren erloschen und feine Rauchfäden schlängelten sich empor. Sie sahen wieder wie ganz normale Teelichter aus – keine Spur von roter Farbe oder irgendwelchen Brandverstärkern, die die Helligkeit beeinflusst hätten. Nervös riss ich den Kopf hoch, doch auch mein PC schien wieder in den Normalzustand übergegangen zu sein. Statt des Flackerns leuchtete dort eine neue Nachricht von Nina auf, die ich frühestens in einer Dreiviertelstunde erwartet hatte.
Nina: Komm zum Fahrstuhl. Ich bin da.
03.
Du bist nicht allein
»Steve, im Ernst?«, faltete ich ihn zusammen, nachdem ich ihm die Aufnahme geschickt hatte.
»Peggy, ich schwöre, ich war das nicht!« Seine Stimme klang so, als ob er erschauerte. »Das ist wirklich gruselig. Läuft die Kamera noch und zeichnet unser Gespräch auf?«
»Ja«, knurrte ich als Antwort. »Im Ernst, Steve? Ich hab mich volles Brett erschrocken, als meine Bildschirme angefangen haben zu flackern. Hör auf mit dem Scheiß!«
»Warte, das mit dem Licht und den Kerzen hat dich nicht gestört, sondern nur, dass deine Bildschirme geflackert haben?«
»Ich setz halt Prioritäten«, erwiderte ich und Steve pfiff anerkennend zwischen den Zähnen.
»Ich hätte mir in die Hosen gemacht«, kommentierte er, ehe unser Gespräch kurz ins Stocken geriet. »Was hat Nina gesagt?«
»Nur dass sie oder er jetzt da wäre … wo auch immer dieses da ist. Ist nicht so, als ob hier jemand geklingelt hätte. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob Nina tatsächlich so ein unschuldiges Opfer ist.«
»Wieso?«, fragte mein Arbeitskollege und runzelte die Stirn.
»Na ja, der Vorschlag, dieses seltsame Salzkreis-Ritual zu machen, kam ja von ihr. Wer weiß, ob sie wirklich ist, wer sie vorgibt zu sein«, gab ich zu bedenken. Immerhin sprachen wir hier immer noch von einer wildfremden Person aus dem Internet.
Steve atmete tief ein. »Was wirst du jetzt machen? Zum Fahrstuhl gehen?«, fragte er hoffnungsvoll. »Vielleicht steckt diese Nina ja wirklich irgendwie in Schwierigkeiten, denk nur mal an die Vermisstenanzeige.«
»Zum hundertsten Mal, Steve, selbst wenn, dann wird sie sicherlich nicht in einer Parallelwelt hocken. So etwas gibt es nicht! Ich weiß nicht, was du dir davon erhoffst.«
»Okay«, sagte er langsam. »Aber was ist mit dem Film? Wenn jetzt schon das Licht geflackert hat, vielleicht schaffst du es noch, besseres Material zu kriegen. Im Fahrstuhl sind deine heiß geliebten Bildschirme und der zugehörige Computer ja nicht. Oder hast du doch Angst?«, fragte er.
Einen Augenblick lang überlegte ich, ob ich mich nur einmal in die Rolle der Jungfrau in Nöten begeben sollte, in der vagen Hoffnung, dass er sich in die U-Bahn schwang, um mir zur Hilfe zu eilen, verwarf den Gedanken aber schnell wieder. Ich war eine halbwegs unabhängige und vor allem unerschrockene Frau. Steve dagegen … Vermutlich würde es so enden, dass ich ihn tröstete und vor potenziellen Monstern beschützte statt andersherum.
»Nein, ich hab keine Angst, nur keine Lust aufzustehen, die Sicherungen anzustellen, um dann völlig sinnlos eine Runde Fahrstuhl zu fahren«, murmelte ich und verdrehte die Augen.
»Aber schau doch mal, wie erklärst du dir das mit dem Lichtschalter?«
»Hier ist alles alt, Steve. Vermutlich hat er sich einfach von selbst betätigt.«
»Und was ist mit den Kerzen?«
»Vielleicht hab ich aus Versehen irgendwelchen farbwechselnden Mist gekauft. Wer weiß, was es mittlerweile alles bei IKEA gibt. Ich glaube nicht an Geister, deswegen denke ich, dass wir so einfach nicht weiterkommen und die Sache verwerfen sollten.«
»Alles klar, ich glaube, ich kann schon zwischen den Zeilen lesen. Du kannst ruhig offen zugeben, dass du Angst hast, ich würde das verstehen«, sagte Steve, doch der gespielt einfühlsame Ton in seiner Stimme verriet mir bereits, dass er mächtig enttäuscht wäre, wenn ich ablehnen würde.
»Zum hundertsten Mal: Ich habe keine Angst!«, grummelte ich, diesmal sehr laut.
»Dann kannst du ja Fahrstuhl fahren.«
Es war der älteste Trick der Welt und er kannte mich gut genug, um zu wissen, dass er funktionieren würde. Ich glaubte nicht an Übernatürliches. Während er panisch auf den Stuhl sprang, weil er meinte, ein Geist hätte ihm in den Nacken geatmet, war ich diejenige, die ihn darauf hinwies, dass das Fenster hinter ihm offen war. Aber trotzdem wusste er genau, wie er meine Unerschrockenheit zu seinem Vorteil ausspielen und genau das von mir bekommen konnte, was er wollte. Tja, und groß rumtönen klappte natürlich trotzdem noch.
Ein Seufzen aus tiefster Seele entfuhr mir. »Wenn ich es mache, dann bleibst du dran und bist telefonisch die ganze Zeit dabei, damit ich mich nicht auch noch zu Tode langweile«, gab ich nach. Außerdem hätte ich so Gesellschaft, falls der Retro-Fahrstuhl stecken bleiben sollte.
»Besser noch, wir wechseln in einen Videocall. Du speicherst das Video direkt und ich kann simultan mitgucken. Dann haben wir die Aufnahme und trotzdem bin ich dabei und kann sogar alles sehen«, schlug Steve vor und ich nickte. »Aber ich habe gelesen, dass es sein kann, dass es keinen Strom oder kein Handynetz in der anderen Dimension gibt, die Berichte sind da mal so, mal so«, fügte er noch hinzu und ich lachte auf.
»Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich tatsächlich in einer anderen Dimension landen werde?«, sagte ich zwischen zwei Lachern.
Ich durchsuchte meine Aktenschränke, die neben meinem Schreibtisch standen, und kramte ein altes mobiles Stativ für mein Handy sowie ein batteriebetriebenes Ringlicht hervor. Relikte von vor sieben Jahren, als ich nach der Schule ein Work-and-Travel-Jahr gemacht und dabei einen Instagram-Account gepflegt hatte. Irgendwann war mir das allerdings zu anstrengend und vor allem zu teuer geworden – seitdem verstaubte das verbliebene Equipment, das ich nicht bei eBay hatte verkaufen können.
Ich schraubte alles zusammen und tippte probehalber auf der Kamerafunktion meines Smartphones herum. Der kleine rote Punkt und die hochzählende Zeitanzeige zeigten mir, dass alles zu funktionieren schien. Anschließend kappte ich die Verbindung zu Steve an meinem Computer und lud ihn zu dem Videocall auf dem Handy ein.
»Sieht gut aus, fast schon ein wenig zu professionell für einen Trashfilm«, kommentierte Steve mit vor Ironie triefender Stimme.
Ich zeigte ihm als Antwort den Mittelfinger. »Ich hab nix Besseres da! Wenn mein Gehalt höher wäre, hätte ich vielleicht ein neueres Telefon mit besserer Kameraauflösung … Bist du bereit?«, fragte ich und wandte mich bereits zur Tür.
»Warte!«, rief Steve und seine Stimme klang blechern durch den winzigen Smartphone-Lautsprecher. »Willst du nichts mitnehmen? Verpflegung? Eine Jacke?«
»Wozu?« Ich verdrehte die Augen. »Ich fahr nur Fahrstuhl und mache keine Reise zur Antarktis?«, entgegnete ich. »Selbst wenn ich in einer anderen Dimension landen sollte, wäre ich nur ein paar Minuten dort.«
»Nimm wenigstens eine Taschenlampe mit«, schlug Steve vor und ich nickte ergeben.
»Okay, ist gut, aber nur, weil das Licht hier im Krankenhaus dauernd flackert.« Ich durchwühlte die Schubladen meines Schreibtisches, bis ich das gesuchte Objekt ertastet hatte. Mit der Taschenlampe bewaffnet machte ich mich nun erneut auf den Weg zum Fahrstuhl.
Schon als ich den Flur betrat, wurde Steve extrem still. »Dein Krankenhaus … also deine Wohnung ist ja eigentlich schon gruselig genug für einen Film. Wenn wir da vorn in Post-Produktion einen Geist ans andere Ende basteln, dann haben wir hier schon einen perfekten Schocker-Streifen … Weißt du noch die Szene aus Insidious? Aber kannst du vielleicht etwas ängstlicher wirken?« Steve verzog die Stirn, als er mich kritisch musterte.
»Dafür müsste ich an den ganzen Schwachsinn glauben und das würde bedeuten, ich werde langsam so irr…«
»So irre … wie dein Vater. Jaja, ich weiß schon«, unterbrach er mich.
Ich biss mir auf die Lippen, um zu überspielen, wie sehr mir dieser Kommentar wehtat. Es war eine Sache, wenn ich es selbst aussprach, aber eine andere, wenn Steve es sagte.
»Können wir das Thema einfach sein lassen, Steve? Kein schlechtes Schauspiel meinerseits. Ich bin so kurz davor, diese ganze Aktion abzubrechen, und jedes Gemeckere von dir macht diesen Gedanken umso verlockender«, knurrte ich zurück.
Steve zog den Kürzeren. Er wusste, dass er verloren hatte. »Okay, okay, gut, ich sag gar nichts mehr.«
Zufrieden nickte ich und steuerte zielstrebig den Sicherungskasten am Ende des Flurs an. Spätestens jetzt war ich froh, dass Steve mir geraten hatte, die Taschenlampe mitzunehmen, denn der blöde Kasten wurde nicht direkt von einer der Deckenlampen angestrahlt und die kleinen Beschriftungen waren im Dämmerlicht des langen Gangs extrem schwer zu lesen. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich trotz Taschenlampe Hauptflur Licht, Strom und Fahrstuhl alle Etagen auf einem der inaktiven Schalter entziffert hatte. Was für eine Sauklaue. Mit einem geschickten Hebeln meines Fingers und einem leisen Geräusch sprang der Schalter in die aktive Position. Und nur einige Meter vor mir, hinter der Glastür zum Hauptflur, erwachten die Neonröhren mit einem Flackern zum Leben.
»Bingo«, murmelte ich und setzte meinen Weg fort. Der Hauptflur war staubig und ich betrat ihn so gut wie nie, da es einen viel bequemeren Nebeneingang gab, der direkt in meinen Flügel führte. Den Fahrstuhl hatte ich das letzte Mal zu meinem Einzug benutzt, um mein Bett und die anderen Möbel von der Tiefgarage bis in den ersten Stock zu befördern. Während ich mein Handy auf dem Stativ noch mal so ausrichtete, dass es alles einfing, was ich tat, drückte ich auf den Fahrstuhl-Schalter. Momentan hing das Ding aus unerfindlichen Gründen im dritten Stock herum, mir blieben also ein paar Minuten, um mir noch mal die Reihenfolge der Knöpfe, die ich gleich drücken musste, in Erinnerung zu rufen.
»4,2,6,2,10,5 und 1«, zählte ich auf.
»Was?«, plärrte es aus dem Lautsprecher meines Telefons.
»Ich hab nur mit mir selbst gesprochen … Das waren die Knöpfe für das Elevator Game.«
Was auch immer Steve daraufhin sagte, ich hörte es nicht, da zeitgleich das »Pling« des Fahrstuhls ertönte. Die Stahltüren öffneten sich und ich blickte in die gähnende Leere der Fahrstuhlkabine. Eine der vier Lampen war ausgebrannt und mir schlug der Geruch stickiger Luft entgegen. Ansonsten wirkte der Edelstahl allerdings gut gepflegt – er war ja schließlich auch seit einer ganzen Weile komplett ungenutzt. Während ich einstieg, warf ich noch einen Blick auf die TÜV-Plakette, die war glücklicherweise auch noch nicht abgelaufen. Ich wusste nur nicht, ob das bedeutete, dass der Hausmeister das Teil auch regelmäßig wartete; immerhin kannte ich seine Einstellung zu sonstigen Reparaturen im Krankenhaus.
Doch die Türen hinter mir schlossen sich bereits wieder und der Fahrstuhl wartete darauf, dass ich ihm ein Kommando via Ziffernfeld gab, was mir die Entscheidung, jetzt dann doch umzukehren, irgendwie albern vorkommen ließ.
Geschickt platzierte ich mein Handy mit dem Stativ in der Ecke des Fahrstuhls – direkt neben dem Schaltpult, damit die gesamte Kabine aufgenommen werden konnte. Falls etwas passierte, konnte ich so direkt danach greifen, aber es stand mir dennoch nicht im Weg herum.
»Passt das so?«, fragte ich an Steve gewandt.
»Ja, prima, ich sehe jede Ecke. Vor allem die Lady hinter dir.« Das Grinsen in seiner Stimme war nicht zu überhören. Ich verdrehte erneut die Augen und wandte mich nicht einmal um.
»Sehr witzig«, murmelte ich und seufzte.
Ohne noch weiter zu zögern, drückte ich den Knopf zum vierten Stock und der Fahrstuhl setzte sich ruckartig in Bewegung. Plötzlich änderte sich etwas: Aus den Lautsprechern ertönte die nervigste Fahrstuhlmusik aller Zeiten.
»Oha, der Film hat soeben eine Hintergrundmusik bekommen«, verkündete Steve amüsiert.
»Als wäre die ganze Geschichte und deine Kommentare, die die Zuschauer sich dann irgendwann mal zu Gemüte führen müssen, nicht schon bekloppt genug.«
»Sieh es mal so, die Musik ist superalt, das Copyright ist dafür vielleicht schon abgelaufen und wir müssen sie nicht rauseditieren. Ich werde das recherchieren«, versuchte er mich aufzumuntern, während ich die Tastatur klackern hörte, als er sich eine Notiz machte.
Die Absurdität der Situation ließ mich ebenfalls kurz lächeln. »Dudududududu«, machte die Musik unbeirrt weiter und gab der ganzen Szene etwas Albernes, aber keinesfalls die düstere Wirkung, die wir erzielen wollten.
Seufzend drückte ich den Knopf zum zweiten Stock, nachdem ich mit einem Quietschen im vierten angekommen war. Anschließend drückte ich den Knopf zum sechsten Stock und kurz darauf erneut den zweiten. Es war eine ganz normale, wenn auch ziellose Fahrstuhlfahrt. Jedes Mal, wenn sich die Türen öffneten, lag der hell erleuchtete Hauptflur des jeweiligen Stockwerks vor mir, aber sonst geschah absolut gar nichts.
»Du bist jetzt im zweiten Stock, hörst du eine Stimme?«, fragte Steve und seine Worte waren nur noch ein nervöses Flüstern. Ich lauschte, doch alles war still – mit Ausnahme der verdammten Fahrstuhlmusik.
»Nein, ich höre nichts«, antwortete ich, keineswegs flüsternd – warum auch?
Die Türen schlossen sich erneut, als ich gelassen den Knopf für die zehnte Etage drückte. Es würde das langweiligste Video der Welt werden, bei dem man mir zusah, wie ich mit einem genervten Gesichtsausdruck sinnlos mit einem Fahrstuhl auf und ab fuhr. Plötzlich ertönte ein Knacken aus dem Lautsprecher meines Telefons.