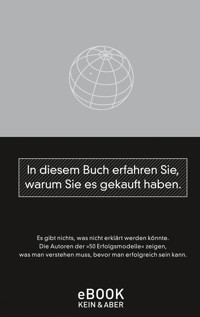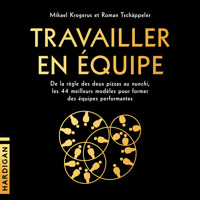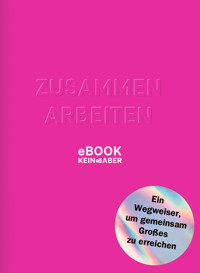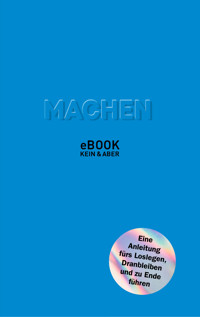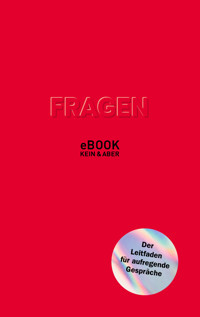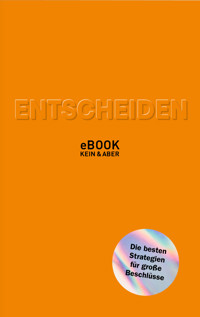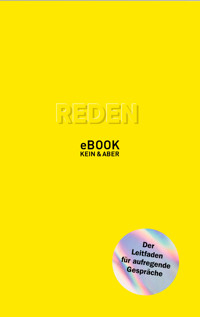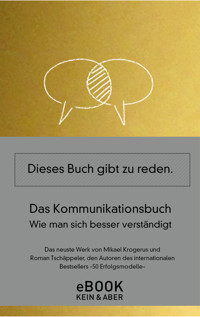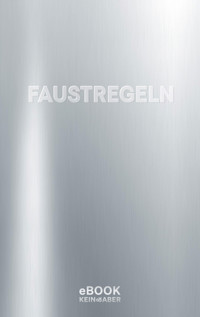
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Lange hatten die Naturwissenschaften das Monopol auf »Gesetzmäßigkeiten«, »Lehrsätze« und »Prinzipien«. Schwerkraft zum Beispiel, Thermodynamik, Ohmsches Gesetz. Aber während Newtons Gravitationstheorie uns unmissverständlich erklären kann, warum das Ketchup aus dem Hamburger tropft, erklärt sie leider nicht, warum das immer uns passiert. Das hingegen macht Murphys Gesetz: »Alles, was schiefgehen kann, geht schief«. Murphys Gesetz ist das, was man ein »ungeschriebenes Gesetz« nennt. Es steht in keinem Regelwerk, lässt sich nicht wissenschaftlich belegen – und ist doch wahr. Genauso wie das Peter-Prinzip, das erklärt, warum unsere Vorgesetzten Idioten sind oder Parkinson’s Law, das postuliert, dass Sitzungen immer so lange dauern, wie man dafür Zeit veranschlagt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
» Über die Autoren
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTOREN
Mikael Krogerus ist Finne. Er ist in Stockholm geboren und schloss 2003 sein Studium an der Kaospilot School in Dänemark ab. Ab 2005 arbeitete er bei NZZ Folio, dem Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Seit 2015 ist er Redakteur bei Das Magazin in Zürich.
Roman Tschäppeler, Schweizer, in Bern geboren, schloss 2003 sein Studium an der Kaospilot School in Dänemark ab und absolvierte zudem die Zürcher Hochschule der Künste. Er berät Stiftungen, Unternehmen und Teams in strategischen Belangen und entwickelt mit ihnen Ideen zu allerlei.
Über das Buch
Das Autorenduo Krogerus & Tschäppeler versammelt 44 zeitlose Faustregeln für Beruf, Beziehung und andere Baustellen. Das Ketchup-Gesetz etwa – »Erst kommt lange nichts, dann plötzlich zu viel«. Oder das Peter-Prinzip, das belegt, warum unsere Vorgesetzten unfähig sind oder Parkinson’s Law, das erklärt, warum Sitzungen immer so lange dauern.
Solche Gesetze wirken witzig, sind aber tatsächlich nützliche Faustregeln, die uns helfen, Situationen schneller zu erfassen und Entscheidungen leichter zu fällen.
Bei den 44 Lektionen geht es nie um kurzlebige Trends oder aktuelle Technologien, es geht um ewige Fragen des Entscheidens, Kommunizierens und Zusammenarbeitens. Das Buch bietet praktische Lösungen für alle Lebenslagen.
Inhalt
Faustregeln, um Sitzungen, Deadlines und andere Abenteuer des Arbeitslebens zu überstehen
Der Ketchup-Effekt
Stuergon’s Law
Parkinson’s Law
Die 3-3-3-Methode
Hofstadter’s Law
Plotz’s Law
Das Paretoprinzip
Parkinsons Gesetz der Trivialität
Brook’s Law
Goodhart’s Law
Das Locksmith-Paradox
Murphy’s Law
Faustregeln für Momente, in denen wir glauben, alles anders machen zu müssen
Chesterton’s Fence
Amara’s Law
KISS-Principle
Sutton’s Law
Strummer’s Law
Canada Principle
Das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen
Der Ikea-Effekt
Das MAYA-Prinzip
Lindy’s Law
Faustregeln, um sich selbst und andere besser zu verstehen
Wiio’s Law
Das Peter-Prinzip
Jaspers’ Gesetz
Brach’s Law
Das Komfortzonen-Gesetz
Das Region-Beta-Paradox
Goldilock’s Principle
Der Fischteicheffekt
Die Broken-Windows-Theorie
Faustregeln für die ganz großen Fragen des Lebens
Morrison’s Law
Pari de Pascal
Ockham’s Razor
Das Agnes-Allen-Gesetz
Korzybskis Gesetz
Das Gesetz der zwei Seiten
Die Ein-Prozent-Regel
Laver’s Law of Fashion
Popsicle Test
Das Tocqueville-Paradox
Das Bild des Näherrückens
10-10-10-Methode
Epilog
Box’s Law
Rest of Faustregeln
Anhang
Quellen
Die Autoren
Dank
Faustregeln – Kurze Rede, langer Sinn
Lange Zeit waren es nur die Naturwissenschaften, die Gesetzmäßigkeiten feststellten. Schwerkraft zum Beispiel, Thermodynamik, Punkt-vor-Strich-Regel. Aber während Newtons Gravitationsgesetz uns unmissverständlich erklären kann, warum das Ketchup aus dem Hamburger tropft, erklärt es leider nicht, warum das immer dann passiert, wenn wir ein weißes Hemd tragen. Das hingegen macht Murphy’s Law: Alles, was schiefgehen kann, geht schief.
Murphys Gesetz ist ein ungeschriebenes Gesetz. Es steht in keinem ernsthaften Lehrbuch – und trifft doch zu. Ungeschriebene Gesetze sind nicht nachweislich wahr, sie sind gefühlt wahr. Weil sie etwas auf den Punkt bringen, was wir alle kennen. Weil sie nicht der Lehrtheorie, aber unserer Lebenspraxis entsprechen. Weil sie die inneren Logiken des modernen (Arbeits-)Lebens besser beschreiben als acht Semester Psychologiestudium.
Das Ketchup-Gesetz etwa – Erst kommt lange nichts, dann plötzlich zu viel – ist natürlich kein Naturgesetz, und doch hat jeder und jede das schon so erlebt. Oder nehmen wir das Agnes-Allen-Gesetz: Es ist leichter, irgendwie reinzukommen, als rauszukommen. Stimmt das wirklich immer? Nein. Natürlich nicht! Aber wer schon einmal versucht hat, sein Mobilabo zu kündigen oder eine komplizierte Beziehung zu beenden, ahnt, warum Agnes Allen mit ihrem Gesetz etwas Grundlegendes, Universales ausgesprochen hat.
Manche dieser Gesetze sind jahrhundertealt, die meisten aber wurden in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst. In jener Zeit also, in der die Arbeitswelt überflutet wurde mit Managementmethoden, die ein effektiveres Arbeiten versprechen. Diese Managementmethoden erklären, wie man Unternehmen gründet, führt, umstrukturiert, wie man Prozesse optimiert und Mitarbeitende motiviert, aber sie beschreiben nicht, wie all das wirklich ist. Das hingegen machen die ungeschriebenen Gesetze. Sie sind zu einer Art Anthologie des Büroalltags geworden; kein Prophet, eher ein guter Freund. Und so kursierten die kleinen Lebensweisheiten in Großraumbüros, wurden fotokopiert, herumgereicht und mit den Jahren umgeschrieben, ergänzt – und oft vergessen.
Dieses Buch versammelt nun die unserer Meinung nach wichtigsten Lehrsätze für Beruf, Beziehung und andere Baustellen. Einige sind mit einem Augenzwinkern geschrieben, während andere fast schon eine Art Zen-Weisheit ausstrahlen, doch allen sind zwei Sachen gemein: Sie sind kurz. Und sie sind mehr als bloße Beobachtungen. Die Gesetze sind im engeren Sinne Faustregeln, die uns helfen, die Absurditäten des Alltags besser zu verstehen und einen Umgang mit ihnen zu finden. Es geht dabei immer wieder um die drei großen Fragen des Arbeitens:
Habe ich die Situation, die Person, das Problem richtig verstanden? Wie soll ich mich entscheiden? Bin ich auf dem richtigen Weg?
Wenn man Ruhe, Zeit und guten Rat hat, sind die Fragen beantwortbar. Aber wenn wir uns in einer unsicheren, sich ständig verändernden Situation befinden, wenn wir uns rasch einen Überblick verschaffen wollen oder schnell entscheiden müssen, schlägt die Stunde der Faustregeln, denn sie fokussieren auf das Wesentliche.
Natürlich sollten nicht alle Situationen Pi mal Daumen gelöst werden. Und außerdem gilt: Was mir hilft, muss nicht zwangsläufig für andere gelten. Das heißt, Sie sollten nicht blind alle Faustregeln in diesem Buch befolgen, sondern sie neugierig in die Hand nehmen, um herauszufinden, ob sie Ihrer Arbeitsweise, Ihrer Situation, Ihrem Ziel entsprechen.
PS: Uns ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nicht die Urheber dieser Gesetze sind. Wir haben sie bloß gesammelt, erklärt, eingeordnet, visualisiert (und hoffentlich nicht falsch verstanden). Wir müssen Sie also darauf aufmerksam machen, dass alles, was Sie in diesem Buch für schlau halten, nicht von uns stammt, sondern von jemand anderem. Und auch dazu gibt es übrigens eine Faustregel:
Wenn Sie glauben, eine neue Idee zu haben, liegen Sie falsch. Wahrscheinlich hatte sie jemand anderes schon vor Ihnen. (Sutton's Law, S. 70)
Faustregeln, um Sitzungen, Deadlines und andere Abenteuer des Arbeitslebens zu überstehen
Wenn erst lange nichts kommt und dann zu viel
Es ist vielleicht die beste Metapher für unser Leben: Das Ketchup will nicht aus der Flasche. (Wir reden hier von Glasflaschen, nicht diesen seelenlosen Plastikflaschen, mit denen man schummeln kann, indem man sie zusammendrückt.) Meistens läuft es so ab: Man öffnet die Flasche und hält sie in einem 45-Grad-Winkel. Man wartet. Man geht auf 90 Grad. Und wartet. Dann verliert man die Geduld. Schlägt mit der flachen Hand auf den Flaschenboden. Schüttelt die Flasche, aber es geschieht … nichts. Und plötzlich kommt das Ketchup. Aber nicht in der gewünschten Portion, nein, es überwältigt förmlich die Fritten.
Es gibt für alles einen Namen. Das hier nennt man den Ketchup-Effekt.
Erst kommt lange nichts, und dann zu viel.
Man findet den Ketchup-Effekt überall im Leben. Der Typ, der jahrelang vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung sucht – plötzlich hat er vier Zusagen, und kann sich nicht entscheiden. Die Freelancerin, die während einer Durststrecke händeringend jeden Auftrag annimmt – bloß, um sich dann zu verzetteln.
Der Ketchup-Effekt: Erst kommt lange nichts, dann zu viel.
Es gibt aber auch einen positiven Ketchup-Effekt, wir verbinden ihn häufig mit dem Moment, in dem das Blatt sich plötzlich zu unseren Gunsten wendet. Der Augenblick zum Beispiel, wenn wir nicht mehr alleine sind, unsere Idee nicht mehr belächelt oder bekämpft, sondern begrüßt wird. (Immer auf die Gefahr hin, dass uns dann die Kontrolle entgleitet, dass zu viel Ketchup kommt.) Aber was löst den Ketchup-Effekt aus?
Auf den ersten Blick könnte man meinen, es ist die Person, die den Mut hat, den ersten Schritt zu machen und etwas Neues vorzuschlagen. Diese Person ist wichtig. Sie öffnet, um im Bild zu bleiben, die Ketchupflasche – aber löst das den Effekt aus? Nein. Derek Sivers machte vor Jahren in seinem großartigen Ted-Talk folgende Beobachtung: Es braucht auch eine erste Person, die zu dem Vorschlag Ja sagt. Und wenn eine Person mitmacht, kommt vielleicht noch jemand dazu, aus Einzelkämpfer:innen wird eine Gruppe. Und dann kommt der tipping point, dann kommt das Ketchup. Die Bedeutung dieser ersten Unterstützer:innen wird oft unterschätzt.
Ein Beispiel: Emmeline Pankhurst war die Gründerin der Suffragettenbewegung in England, die dort für das Frauenwahlrecht kämpfte. Man kennt ihren Namen, sie schraubte den Deckel von der Flasche. Aber wer kennt ihre Unterstützerinnen? Es waren unter anderem ihre Töchter, mit denen sie Gleichgesinnte um sich sammelte. Mit der Zeit gewannen sie immer mehr Unterstützung, der Druck wuchs, bis schließlich die Regierung nachgeben musste.
Der Ketchup-Effekt erinnert uns daran, dass es nicht nur um die Führung geht. Es geht auch um die Anhängerschaft. Ohne Follower keine Leader. Wenn Sie also in einer Situation sind, in der das Ketchup nicht aus der Flasche will, fragen Sie sich, ob Sie nicht vielleicht die Person sein wollen, die den Raum drehen kann, indem sie Ja sagt.
Warum 90 Prozent von allem Mist ist
An einer Vorlesung an der New York University soll der Schriftsteller Theodore Sturgeon (1918–1985) seinem Ärger darüber Luft gemacht haben, dass Science-Fiction das einzige literarische Genre sei, das anhand seiner schlechtesten Beispiele bewertet werde und nicht anhand seiner besten: »Sie sagen, ›neunzig Prozent von Science-Fiction ist Mist‹, nun, Sie haben recht. Neunzig Prozent von Science-Fiction ist Mist. Aber neunzig Prozent von allem ist Mist. Alle Dinge – Autos, Bücher, Käse, Frisuren, Leute – sind Mist, bis auf das Zehntel, das uns zufälligerweise gefällt.« Daraus wurde »Sturgeon’s Law«:
Neunzig Prozent von allem ist Mist.
Die neunzig Prozent sind natürlich eine Überzeichnung, Sturgeon ging es um die Feststellung, die wohl alle von uns bestätigen können: Das meiste ist Mist. Die meisten Meetings, an denen wir teilnehmen, die meisten Dinge, die wir kaufen, das meiste, was wir auf Instagram sehen (ganz sicher das meiste, was wir selber posten), sind Mist. Auch die meisten Sorgen, die wir uns machen, und die meisten Hoffnungen, die wir hegen – Mist.
Aber Achtung: Machen Sie es sich nicht zu gemütlich, denn wenn neunzig Prozent von allem Mist ist, dann ist auch die Haltung, dass neunzig Prozent von allem Mist ist, Mist. Verstehen Sie? Sturgeon kritisierte die Kritiker. Fehler finden und besser wissen kann jeder. Es ist ein Leichtes zu sagen: Die Geschäftsleitung macht zu neunzig Prozent Mist. Aber gemäß Sturgeon sind neunzig Prozent solcher Meinungen eben auch Mist.
Die Faustformel können wir in zweifacher Hinsicht für uns nutzen: Auf Konsumentenseite erinnert sie uns daran, dass wir nicht alles, was gesagt, geschrieben oder versprochen wird, glauben müssen. Es lohnt sich, genauer hinzusehen, nachzufragen, mitzudenken. Es lohnt sich umgekehrt aber auch, großzügiger zu sein mit neunzig Prozent von allem Gesagten, Geschriebenen, Versprochenen – es ist in der Regel nicht absichtlich schlecht gemacht, es ist einfach nicht so gut geworden wie die herausragende Minderheit. Auf Produzentenseite erinnert uns das Gesetz daran, dass nur ganz wenig wirklich gut ist und dass man viel machen, ausprobieren, verwerfen muss, um hin und wieder die zehn Prozent zu erreichen.
Sturgeons Gesetz ist somit eine Art Kontrollmechanismus für uns selbst: Ist das, was ich hier mache, relevant, sinnstiftend, gut? Falls nein: Ist es wenigstens gut genug? Falls nein: Dann muss ich noch einmal von vorne anfangen.
Sturgeon’s Law: Neunzig Prozent von allem ist Mist.