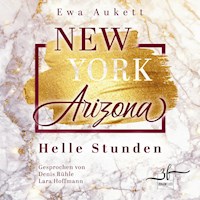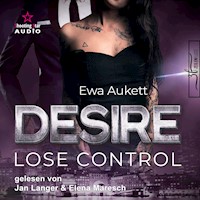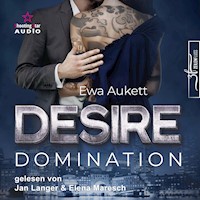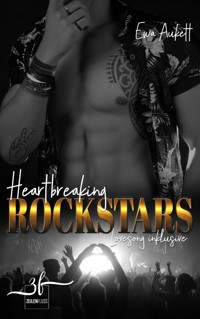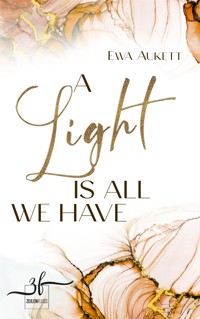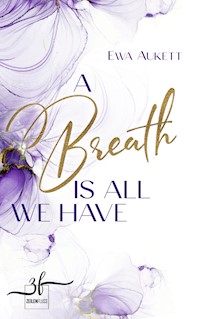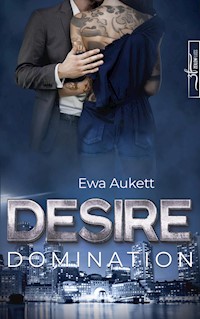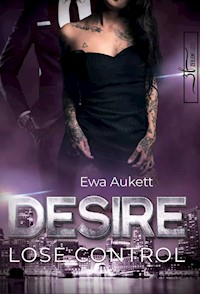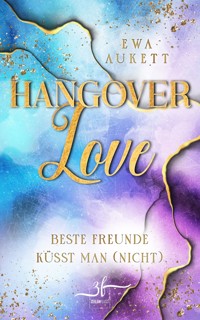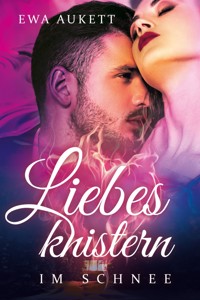4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fear and Desire
- Sprache: Deutsch
"Das ist nicht dein Kampf, Sarah."
Ihre freie Hand legte sich auf meine Brust, und ihre Finger begannen, kleine Kreise auf meine Haut zu zeichnen.
"Ist es doch. Es wurde zu meinem Kampf, als sie auf mich geschossen haben."
Ihr Finger verharrte über der Stelle, wo sich mein Herz befand. "Ich weiß, was ich tue, Brandon. Du bist es, den ich will, und ich will dich in einem Stück."
Sarah bleibt mitten in der kanadischen Einöde mit ihrem Wagen liegen. Brandon findet sie, der dort in einer Waldhütte lebt. Gegen ihren Willen erliegt sie seiner Anziehungskraft. Doch Brandon hat ein Geheimnis, und dieses holt ihn plötzlich und mit unbarmherziger Härte wieder ein. Gejagt von gnadenlosen Killern beginnt eine halsbrecherische Flucht weit über die Grenzen der kanadischen Wildnis hinaus ...
Der neue Band der Romantic-Suspense-Reihe "Fear and Desire" bei beHEARTBEAT.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressum1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. KapitelEpilogÜber dieses Buch
Sarah bleibt mitten in der kanadischen Einöde mit ihrem Wagen liegen. Brandon findet sie, der dort in einer Waldhütte lebt. Gegen ihren Willen erliegt sie seiner Anziehungskraft. Doch Brandon hat ein Geheimnis, und dieses holt ihn plötzlich und mit unbarmherziger Härte wieder ein. Gejagt von gnadenlosen Killern beginnt eine halsbrecherische Flucht weit über die Grenzen der kanadischen Wildnis hinaus …
Über die Autorin
Ewa Aukett wurde im Jahr 1974 als Jüngste von sechs Geschwistern an einem schönen Mittwochnachmittag pünktlich zu Kaffee & Kuchen geboren. Früh hat sie die Leidenschaft zu Büchern für sich entdeckt – und zu Keksen! Bereits in jungen Jahren begann sie die Geschichten in ihrem Kopf zu Papier zu bringen. Dennoch lernte sie erst einmal einen »richtigen« Beruf und das Schreiben blieb ein Hobby. Nachdem ihr Freunde und Familie lange Zeit in den Ohren gelegen hatten, wagte sie sich schließlich im Jahr 2013 mit ihrem Erstlingswerk an die Öffentlichkeit.
EWA AUKETT
Gefährliche Lüge
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Petra Förster
Lektorat/Projektmanagement: Anna-Lena Meyhöfer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer untere Verwendung von Motiven © shutterstock: arek_malang | Elovich; © iStock: andipantz
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-1791-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. Kapitel
Kanada, British Columbia
Sarah
Samstag, 04:13 p.m.
Bryan Adams’ Summer of 69 dröhnte aus dem Radio, während sich vor mir eine endlose, baumbestandene Landschaft ausbreitete und die Straße sich schnurgerade durch diese eintönige, weiße Welt zog.
Ich trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad.
Seit Stunden schon schien es um mich herum nichts anderes zu geben als Schnee und Wälder, Wälder und Schnee. Keine Häuser, keine Autos, keine Menschen. Doch im Radio sang der gute Brian von seiner ersten Gitarre und dem besten Sommer seines Lebens.
Nicht mal ein blöder Elch war irgendwo zu sehen.
Als ich das Seitenfenster einen Spaltbreit öffnete, strömte eisige Luft ins Wageninnere und trieb die Müdigkeit fort. Ich zog fröstelnd die Schultern hoch.
Sommerliche Temperaturen wären jetzt schön gewesen … und dazu ein süßer, leckerer Fruchtcocktail, inklusive Schirmchen natürlich!
Ich grinste.
Als ich zwölf Stunden zuvor in Fort Nelson aufgebrochen war, hatte ich gehofft, den Nahanni Nationalpark vor dem Abend zu erreichen. Mittlerweile war es schon vier Uhr nachmittags, und ich war nicht einmal sicher, ob ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg war. Schon seit mehr als einer Stunde war mir kein anderes Fahrzeug mehr begegnet, und ich fühlte mich irgendwie ziemlich allein auf diesem eisigen Planeten.
Stirnrunzelnd tippte ich auf das Display des betagten Navis, das an der Windschutzscheibe klebte. Nicht zum ersten Mal sprang der Positionspfeil vom Highway 97 mitten in die weiße Fläche von British Columbia, ehe er wieder zurück zum Highway schnellte.
»Oh, oh.« Das dumpfe Gefühl in meinem Bauch verstärkte sich. »Sag, dass das nicht wahr ist.«
Ich nahm den Fuß vom Gas, richtete mich in meinem Sitz etwas auf und angelte blind nach der Handtasche auf der Rückbank. Endlich bekam ich den Schulterriemen zu fassen und holte die Tasche auf den Beifahrersitz. Mit einer Hand versuchte ich, den Reißverschluss aufzufummeln.
»Ach, komm schon.« Vorsichtig gab ich wieder Gas und hielt den Blick auf die Straße gerichtet. Die Gefahr, hier in den Gegenverkehr zu geraten, war zwar gleich null. Aber ich wollte trotzdem nicht riskieren, irgendwo im Graben zu landen.
Endlich hatte ich es geschafft. Ungeduldig schob ich meine Hand in die Tasche und wühlte zwischen Geldbörse, Kamera und Wasserflasche herum. Von Taschentüchern über Lippenpflegestift und Deo bis hin zu Haarbürste und einer kleinen Dose Pfefferspray bekam ich alles in die Finger. Als meine Nägel fast den Boden erreicht hatten, wollte sich schon ein Anflug von Panik in mir breitmachen, dann ertastete ich mein Smartphone.
Erleichtert zog ich es heraus und drückte den Knopf, um den Sperrbildschirm zu aktivieren.
Mein Daumen strich über das Display.
Maylins und mein eigenes Gesicht grinsten mir entgegen. Ich versuchte, den Stich in meiner Brust zu ignorieren, den das Foto immer noch in mir hervorrief. Es war keine drei Monate her, dass Maylin gestorben war.
Natürlich hätte ich mir ein anderes Bild als Hintergrund wählen können, doch irgendwie hätte es sich falsch angefühlt – als würde ich meine beste Freundin vollends aus meinem Leben tilgen.
»Du fehlst mir«, flüsterte ich.
Ich berührte das Symbol für den Internetbrowser und richtete den Blick wieder auf die Straße.
»Okay, Google. Wie weit ist es noch bis Tungsten?«
Nichts.
Das Handy blieb stumm.
Mein Blick flog über das Display.
Der Browser arbeitete und arbeitete.
Nach weiteren fünf Sekunden tat sich immer noch nichts.
Ich nahm den Fuß vom Gas und betrachtete das Display genauer.
Kein Netz.
»Na toll.« Genervt warf ich das Smartphone auf den Beifahrersitz. »Oh Mann, Scheißtechnik! Wenn’s drauf ankommt, funktioniert natürlich nix.«
Nach einer letzten Sekunde des Zögerns lenkte ich den Wagen an den Straßenrand, schaltete in den Leerlauf und wandte mich dem Navi zu.
Vielleicht würde es etwas bringen, wenn ich dieses Ding neu startete. Irgendwo musste doch die Zivilisation wieder in Sicht kommen. Ich war diese Einöde wirklich leid.
Im dem Moment, als ich auf den Einschaltknopf des Navis drückte, erstarb der Motor meines Wagens. Verblüfft starrte ich auf das Armaturenbrett.
»Hallo? Was zum Teufel …«
Alles aus. Der Tank zeigte zwar noch eine halb volle Füllung, aber sämtliche Lichter waren zusammen mit dem Motor erloschen. Ungläubig sackte ich zurück in den Sitz, drehte den Schlüssel und wartete fünf Sekunden.
Okay. Nicht nervös werden.
Mein Auto war schließlich nicht mehr das jüngste.
Ich pustete mir eine Locke aus der Stirn und ignorierte die Kälte, die durch den Fensterspalt ins Innere drang.
Automatikwagen.
Schaltknüppel in P-Stellung.
Fußbremse treten.
Schlüssel drehen.
Ich wartete.
Nichts.
Nicht einmal ein Husten. Die Leuchten im Armaturenbrett blinzelten mich lediglich hektisch an, aber das war auch schon alles.
Kopfschüttelnd versuchte ich es erneut.
Ein zweites Mal.
Ein drittes.
Nichts.
Nicht mal im Leerlauf.
»Scheiße!«
Für einen Moment starrte ich entgeistert auf das Lenkrad. Ich presste mich in den Sitz, fuhr mir mit beiden Händen durch das Haar und stierte die dunkle Instrumententafel an.
»Oh, Scheiße!«
Vor der Abfahrt in Fort Nelson hatte ich das Kühlwasser und den Ölstand kontrolliert.
Dad hätte mir den Marsch geblasen, wenn ich mich nicht penibel für diese Reise vorbereitet hätte. Alles war im Normbereich gewesen, und für den Fall der Fälle hatte ich jeweils einen Liter Öl und Wasser zum Nachfüllen mitgenommen. Man konnte ja nie wissen.
Allerdings befürchtete ich, dass es nicht daran lag.
Ich löste den Gurt.
Was konnte es sein?
Keilriemen?
Wasserpumpe?
Okay, der Wagen war alt, locker zwanzig Jahre.
Maylin hatte ihn damals von ihrem ersten selbst verdienten Geld gekauft. Wir hatten in all den Jahren mehr als zweihunderttausend Meilen mit dem froschgrünen und mittlerweile ziemlich rostzerfressenen SUV abgerissen.
Wir hatten diesem hässlichen Ungetüm sogar einen Namen gegeben, weil es in der Anfangszeit ständig bockte und Öl verlor – wie ein fieser, alter Cowboy, der seinen Kautabak überall hinrotzte. Trotzdem hatte der Wagen uns an jeden Ort gebracht, immer und zu jeder Zeit.
Ich hatte geheult, als Maylin mir ihren Ol’Mackenzie vererbt hatte. Er konnte mich doch jetzt nicht einfach so im Stich lassen. Nicht hier draußen!
War es die Batterie?
Oder der Anlasser?
Verfluchter Mist!
Ich ließ meinen Blick über die Umgebung schweifen.
Im Grunde war egal, was es war. Ich saß hier fest. Die Karre war mir verreckt, und es gab in dieser verdammten Pampa keinen Handyempfang. Seit über einer Stunde war mir kein einziges Auto mehr begegnet, und ich bezweifelte, dass in ein paar Hundert Metern eine Notrufsäule zu finden wäre – von einer Werkstatt ganz zu schweigen.
»Okay, Sarah! Denk nach, denk nach!«
Angesichts der Kälte, die sich rasend schnell im Inneren des Wagens ausbreitete, fischte ich meine Jacke vom Beifahrersitz, zwängte mich hinein und zog den Reißverschluss zu.
Hier drin sitzen zu bleiben war jedenfalls keine Option.
Ich musste nachschauen, selbst wenn ich mit meinem laienhaften Wissen überhaupt keine Ahnung hatte, woran ich erkennen sollte, ob der Anlasser hinüber war.
Entschlossen öffnete ich die Tür, stieg aus und wurde von eisiger Kälte empfangen. Obwohl dieser Februar für kanadische Verhältnisse relativ mild war, waren Temperaturen um die minus zwanzig Grad nicht dafür geeignet, nur in einem dünnen Pullover durch die Gegend zu laufen. Hastig zog ich meinen Schal aus der Jackentasche und wickelte ihn mir um den Hals.
Mein Atem bildete kleine, nebelige Wölkchen vor dem Gesicht, als ich mich erneut ins Auto beugte, um an dem Hebel für die Motorhaubenentriegelung zu ziehen. Ich schlug die Tür zu und lief durch den Schnee zur Vorderseite des Wagens.
Es war mühsam, die schwere Klappe nach oben zu drücken.
Ol’Mackenzie war weder besonders klein, noch war ich mit meinen eins siebenundfünfzig besonders groß. Es war ein ziemlich unfaires Kräftemessen, und die Motorabdeckung leistete entschiedenen Widerstand, ehe sie schließlich in halb geöffneter Position verharrte.
Ich seufzte.
Das waren die Momente, in denen ich es verfluchte, keine Modelmaße wie meine kleine Schwester Hannah zu haben, die mich um fast zwanzig Zentimeter überragte. Ich hätte schon eine Trittleiter gebraucht, um überhaupt den ganzen Motorraum überblicken zu können.
Nichtsdestotrotz wusste ich, es konnte weder am Öl noch am Kühler liegen. Dafür sah die Batterie ziemlich übel aus. So übel, dass mein eigentliches Problem klar auf der Hand lag.
Ein dicker Riss zog sich durch den Kunststoff von einem Pol zum anderen, das Plastik war verschmort, und es stank fürchterlich.
Ich biss mir auf die Unterlippe.
Damit hatte ich nicht gerechnet.
Und das Schlimmste war, dass Dad mich noch gewarnt hatte: »… blabla … der Winter in Kanada ist hart … blabla … die Batterie ist alt, wenn die sich entleert und womöglich platzt … bla-blabla-bla …«
Ich hatte ihm nur mit halbem Ohr zugehört. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass genau das passieren würde. Natürlich hatte ich keine Ersatzbatterie eingepackt, obwohl Dad es mir geraten hatte.
Das würde er mir ewig unter die Nase reiben.
Genau wie meine Brüder.
Im Geiste sah ich schon Gerrys genervtes Augenrollen und Pauls hämisches Grinsen. Sie würden mir bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit reindrücken, wie dämlich ich mich angestellt hatte.
Frotzelnde Brüder waren die Pest.
Ich trat einen halben Schritt zurück und zog die Haube wieder herunter. Knirschend rastete das Schloss ein.
Was nun?
Die Hände in den Jackentaschen vergraben blickte ich mich um.
Hinter mir lag nichts als eine endlos lange Straße, die sich durch die hohen, verschneiten Tannen schlängelte. Der Weg vor mir sah nicht viel besser aus. Da ich allerdings nicht sicher sein konnte, ob es dort nicht doch irgendwo Leben gab, wäre es wohl sinnvoller, sich weiterhin geradeaus zu bewegen – wenigstens für eine Weile. Zurücklaufen konnte ich immer noch.
Beim Auto auszuharren war definitiv nicht drin.
Durch den Fensterschlitz drang die Kälte in den Wagen. Selbst wenn ich mich in meinen Schlafsack hüllte, würde ich irgendwann erfrieren.
Wenn ich etwas tun wollte, dann musste ich es jetzt tun.
Es wäre Irrsinn gewesen, darauf zu warten, dass mir in dieser einsamen Gegend ein anderer Wagen begegnete oder der Pannendienst zu Hilfe eilte.
Irgendwo musste diese verdammte Straße schließlich hinführen. Dann würde ich den Weg eben zu Fuß entlanglaufen … oder wenigstens eine Anhöhe erreichen, wo ich Empfang hatte und einen Notruf absetzen konnte.
Entschlossen kehrte ich zurück zur Fahrertür und krabbelte ins Auto. Für meinen Aufbruch musste ich mich vorbereiten.
Ich war kein verwöhntes Stadtkind. Mit meinem Dad hatte ich früher genug Touren durch die endlosen Weiten Colorados unternommen. Ich musste akzeptieren, dass mein Abenteuer heute mit einem kalten Spaziergang begann … und es keine weitere Nacht in einem mollig warmen Motelzimmer geben würde.
Ich war doch schließlich losgezogen, um die Wildnis von Kanada mit der Kamera einzufangen. Nun bekam ich meine Chance und würde sie nutzen. Und meinem Optimismus sei Dank, würde ich gewiss auch irgendwo auf Zivilisation stoßen und irgendwen kontaktieren können, der mir dabei half, Ol’Mackenzie wieder zum Laufen zu bekommen.
Das wäre doch gelacht!
***
Mir war kalt.
Richtig kalt.
Wieso musste es in dieser Schneewüste so eisig sein?
Wenn das ein milder Winter war, was verstanden die Kanadier dann unter kalt?
Leider fühlte sich der Teil meines Gesichts, der nicht mit Schal und Mütze bedeckt war, mittlerweile an, als hätte er sich oberhalb meiner Nasenflügel in gefrorenes Hackfleisch verwandelt.
Sollte das jemals wieder auftauen, würde mir vermutlich die halbe Nase abfallen.
Ich zog den Schal noch ein Stück höher und stapfte mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken weiter. Die Straße war mittlerweile unter der Schneedecke nur noch zu erahnen.
Eine Viertelstunde zuvor hatte es angefangen zu schneien.
Keine Flocken, wie ich sie aus Colorado kannte – und die Winter dort waren kein Zuckerschlecken. Nein, Flocken so groß wie Tante Carols West-Highland-Terrier.
In dieser Eispampa war alles nur kalt, weiß und viel zu nass.
Ich blieb stehen, bewegte meine Finger in den Fäustlingen und warf einen Blick über die Schulter zurück. Ich war nun seit einer guten halben Stunde unterwegs, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, nicht wirklich voranzukommen.
Wenn ich mich umdrehte, sah ich den grünen SUV immer noch am Straßenrand stehen, obgleich das Schneegestöber es mir langsam schwer machte, ihn zu erkennen.
Ich seufzte. Meine Laune verfinsterte sich. Ich wollte irgendwo ins Warme, vorzugsweise nach Hause – und außerdem musste ich mal!
Ich zog den Schal über das Kinn hinab, nahm die kleine isolierte Trinkflasche aus der Tasche meiner Jacke und gönnte mir einen Schluck lauwarmen Tee. Ärgerlich runzelte ich die Stirn. Mann, dieses verdammte Teil hielt nicht ansatzweise das, was der Verkäufer mir versprochen hatte. Dem würde ich was erzählen, wenn er mir wieder unter die Augen kam.
Ich schüttelte den Kopf.
Ganz ruhig, Sarah. Tief durchatmen.
Ich verschloss die Flasche und lief weiter. Wenn ich meine Energie damit verschwendete, mich über diesen pickeligen Verkäufer zu ärgern, änderte sich nichts.
Überrascht hob ich den Kopf und blieb stehen.
Was war das für ein Geruch?
War das Rauch?
Tatsächlich! Ich bildete mir das nicht ein – das war tatsächlich Rauch.
Planlos sah ich mich um.
Woher kam das?
Wo etwas brannte, mussten auch Menschen sein, und wenn ich es roch, dann konnte die Entfernung zur Brandquelle nicht allzu groß sein, oder?
Ich ließ meinen Blick über die Baumwipfel schweifen.
Es war schwierig, etwas zu erkennen. Auf der Straße befand ich mich in einer denkbar ungünstigen Position, zudem behinderte das Schneetreiben zusätzlich die Sicht. Trotzdem konnte ich die schmale, dunkle Rauchsäule erahnen, die nordöstlich von mir aufstieg.
Mitten im Wald.
War das wirklich möglich?
Aufgeregt verharrte ich einen Moment auf der Stelle.
Lebte jemand hier draußen in dieser Einöde?
Freiwillig?
Meine Euphorie erhielt im gleichen Moment einen Dämpfer.
Ich zögerte.
Wer wohnte dort und warum?
Handelte es sich um einen Einsiedler?
Einen Aussteiger?
Vielleicht lebte hier ein wahnsinniger Wissenschaftler, der mit verrückten Ideen experimentierte und unglückselige, einsame Wanderer mit Teilen von toten Tieren zusammennähte.
Vielleicht ein Serienmörder, der mich umbringen und in kleine Stücke zerhacken würde, weil ich ihn gestört hatte.
Vielleicht ein psychopathischer Sadist, der mich in seinen Keller sperren und mit einer Kette an ein Heizungsrohr fesseln würde … in greifbarer Nähe nichts weiter als eine Handsäge, mit der ich entweder die Kette oder irgendein Körperteil durchtrennen müsste.
Kopfschüttelnd stopfte ich die Flasche, die ich immer noch in der Hand hielt, zurück in meine Jacke und zog mir wieder den Schal vors Gesicht.
Egal wer es war, ich brauchte Hilfe – und vielleicht sollte ich damit aufhören, mir zu Hause ständig diese Zombieserien und Horrorfilme reinzuziehen.
Immerhin hatte ich schon einige Semester gepflegten Journalismus studiert – da sollte ein wenig sachliche Objektivität doch gegeben sein. Gut, ich pausierte mit dem Studium, weil ich ein paar Monate Auszeit brauchte. Dennoch sollte mir eigentlich klar sein, wie gering die Wahrscheinlichkeit war, ausgerechnet in dieser Einöde einem irren Biologen oder einem minderbemittelten Killer zu begegnen.
Meine Fantasie ging mal wieder mit mir durch, das war alles.
Die Bewohner hatten sicherlich ein Telefon, und dann könnte ich einen Pannendienst kontaktieren. Vielleicht gab’s dort auch einen heißen Kaffee und eine Toilette.
Ich musste das Risiko eingehen und versuchen, die Quelle des Rauches ausfindig zu machen. Es war Zeit für ein bisschen Glück.
***
Meine Laune hatte sich den eisigen Temperaturen, die hier herrschten, schon längst angepasst. Zunehmend gereizter quälte ich mich durch den kniehohen Schnee und starrte zu der Blockhütte hinüber, die auf einmal wie hingezaubert vor mir zwischen den Bäumen erschien.
Wie romantisch!
Rauch stieg aus dem Schornstein. Inmitten der umherwirbelnden Schneeflocken strahlte dieser Anblick eine heimelige, angenehme Wärme aus.
Schnaufend blieb ich stehen.
Wie konnte man hier in der Pampa wohnen und nicht dafür sorgen, dass der Weg zum Haus einigermaßen begehbar war?
Bekam dieser Mensch nie Post?
Ernährte er sich von Baumrinde und Tannennadeln, sodass er seine Hütte nie verlassen musste, um Vorräte einzukaufen?
Ich hätte mein Ziel schon längst erreicht, wenn ich nicht immer wieder im Tiefschnee stecken geblieben wäre … und inzwischen konnte ich auch erkennen, dass um die Hütte herum durchaus Schnee geschaufelt worden war.
Welchen Sinn ergab es, sein Haus freizuschaufeln, aber keinen Weg zur Straße zu schaffen?
Wie weit noch?
Fünfzehn Meter? Zwanzig?
Ich ging weiter.
Eigentlich ein Katzensprung, doch ich fühlte mich, als hätte ich den Mount Everest bestiegen und vor mir läge nun die letzte, aber schier unüberwindbare Etappe.
Meine Lungenflügel brannten, meine Beine waren bleischwer, und der Stoff meiner Jeans klebte mir nass und kalt an den Schenkeln. Dass meine Füße mittlerweile völlig taub und ohne Gefühl waren, versuchte ich geflissentlich zu ignorieren. Genau wie den Schnee, der mir mit jedem weiteren Schritt in die Stiefel rieselte.
Ich würde diese letzten Meter schaffen.
Wenn ich endlich den Tiefschnee hinter mir gelassen und das flachere Stück erreicht hätte, würde es besser gehen. Mein Blick huschte zur Hütte hinüber.
Ob man mich schon bemerkt hatte und beobachtete? Die verdreckte Fensterscheibe und die dämmrigen Lichtverhältnisse des späten Nachmittages machten es mir unmöglich, etwas im Inneren zu erkennen. Das einzige Lebenszeichen war der Rauch, der aus dem Schornstein stieg.
Was, wenn man mich nicht hineinließ?
Ich ballte die Hände zu Fäusten. Umkehren war unmöglich. Ich war unterkühlt und brauchte einen Ort, um mich aufzuwärmen. Ich würde so lange randalieren, bis man mir die Tür öffnete.
Was, wenn niemand da war?
Vielleicht wohnte hier so ein alter Schrat, der gerade irgendwo auf der Jagd im Wald unterwegs war. Er würde mich vermutlich tiefgefroren unter dem kleinen Vordach finden, wenn er zurückkäme. Blau und bleich auf diesem hässlichen, weißen Plastikstuhl sitzend, der zwischen Fenster und Türe stand.
Erleichtert brachte ich den letzten Schritt hinter mich und blieb einen Moment völlig außer Atem auf der freigeräumten, festgetrampelten Fläche stehen, die die Blockhütte in einem Radius von etwa fünfzig Yards umgab.
Endlich!
Nach vorn gebeugt stützte ich mich mit den Händen auf den Knien ab und versuchte, wieder zu Kräften zu kommen. Als ich über die Schulter zurückblickte, konnte ich nur schwer glauben, dass die Straße lediglich eine gute halbe Meile entfernt war. Selbst der giftgrüne Lack von Ol’Mackenzie war durch die Bäume hindurch noch zu erkennen.
Ich fühlte mich, als wäre ich Stunden unterwegs gewesen und hätte mich durch den Wald gekämpft. Stattdessen war ich nur ein paar Hundert Meter weit gekommen.
Ich ignorierte die Frustration, die nach mir griff.
Die Hände zu Fäusten geballt, richtete ich mich auf und sah zu dem Haus hinüber. Davon würde ich mich nicht entmutigen lassen.
Abgesehen vom Wind, der zunehmend lauter durch die Baumkronen pfiff, war es hier draußen fast schon unnatürlich still, und in meine vorgeschobene Unerschrockenheit mischte sich eine seltsame Mischung aus Beklemmung und Faszination.
Ich zog mein Handy aus der Hosentasche und aktivierte die Kamera. So merkwürdig dieser Ort auch war, irgendwie hatte es auch etwas Wildes und Schönes, wie diese Blockhütte inmitten des verschneiten Waldes stand. Ich schoss ein Foto, ehe ich das Handy wieder wegsteckte.
»Hoffentlich war das keine deiner Schnapsideen, Sarah«, murmelte ich vor mich hin.
Wenn ich über die Situation nachdachte, war es natürlich die einzig vernünftige Entscheidung gewesen, diese Hütte aufzusuchen. Ich hatte keine Ahnung, wo die nächste Ortschaft lag und wie lang ich gebraucht hätte, um sie zu erreichen. Es war richtig gewesen, sich durch den Schnee hierherzukämpfen.
Dennoch konnte ich das mulmige Gefühl nicht ignorieren, das sich in mir breitmachte, während ich mich nun langsam der Hütte näherte.
Hätte sich da drin nicht schon irgendetwas rühren müssen?
Mein Blick huschte zum Fenster. Ich konnte einen schwachen Lichtschein erkennen.
Sollte ich mich erst anschleichen und einen Blick riskieren?
Falls es sich doch um einen Serienmörder handelte, könnte ich wenigstens reagieren und sehen, dass ich von hier wegkäme.
Aber was, wenn er mir folgen und mich einholen würde, noch bevor ich die Straße erreicht hätte?
Ich blieb stehen, presste die Finger gegen die Schläfen und kniff die Augen zusammen.
»Hör auf! Reiß dich zusammen!«
Vielleicht hätte ich auf Dad hören sollen, als der scherzhaft gemeint hatte, ich solle doch lieber Literatur studieren als Journalismus. Breit grinsend hatte er geflachst, bei meinem Talent für Übertreibungen müsse ich eigentlich einen anderen Weg einschlagen als den einer nüchternen Berichterstatterin.
Im Grunde hatte er recht.
In meinem Kopf hatte schon immer ein heilloses Chaos geherrscht. Kleinigkeiten sorgten dafür, dass sich in meinem Gehirn verrückte Ideen und mögliche Szenarien formten, die völlig an den Haaren herbeigezogen waren.
Aber mir lag das Formulieren von unterhaltsamen Sätzen leider gar nicht. Ich war mehr so der anpackende, burschikose Typ … »Herz auf der Zunge und mit dem Kopf durch die Wand«. Emotionen und Bilder mithilfe von Worten zu erzeugen lag eher meiner kleinen, introvertierten Schwester.
Ich gab mir einen Ruck, lief die letzten Meter durch den festgetrampelten Schnee und blieb schließlich mit wild hämmerndem Puls vor der Tür stehen.
Ich schob mir den Schal vom Gesicht, zog mir einen Handschuh aus und klopfte. Das Geräusch erschien mir unnatürlich laut hier draußen.
In der Hütte bewegte sich etwas, und ich konnte hören, wie Stuhlbeine über Holz geschoben wurden. Der Klang einer dunklen Stimme drang an mein Ohr, und es näherten sich Schritte.
»Alles wird gut«, wisperte ich vor mich hin und trat einen Schritt zurück. Als sich die Tür öffnete, konnte ich zuerst nur einen großen Schatten erkennen, dann trat ein Mann in das geöffnete Rechteck.
Oh. Mein. Gott.
Ich erstarrte.
Die Kälte war plötzlich nebensächlich, und ich konnte nicht umhin, ihn anzuglotzen. Er war ungefähr so groß wie Dad, und ich schätzte ihn auf höchstens Mitte dreißig. Dunkelbraunes Haar, das ein bisschen zu lang war und sich über dem Kragen seines karierten Hemdes lockte.
Er trug einen Bart, was ich eigentlich nicht mochte. Doch darunter erkannte ich ein wirklich attraktives Gesicht mit einladenden Lippen und unfassbar klaren, blauen Augen, die von dichten, dunklen Wimpern umrahmt wurden.
Heiß.
Mir war heiß.
Wen interessierte schon der kälteste Winter des Jahres, wenn einem so ein Kerl gegenüberstand?
Ohne auf seine finstere Miene zu achten, ließ ich meinen Blick über seine Gestalt huschen. Breite Schultern, schmale Hüften. Er trug Jeans zu einem offenen Flanellhemd, unter einem eng anliegenden, weißen T-Shirt konnte ich eine ausgesprochen wohlgeformte Männerbrust erkennen und ein … Sixpack? Hatte er wirklich einen Waschbrettbauch?
Mein Atem ging schneller.
Er war barfuß.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Blinzelnd versuchte ich mich daran zu erinnern, warum ich eigentlich hier war. Meine Knie wurden weich.
Diese tiefe Stimme fühlte sich wie Samt auf meiner Haut an und hinterließ ein vibrierendes Echo in mir. Die Härchen auf meinen Armen stellten sich auf – und zwar nicht weil mir so kalt war.
In meinem Bauch war plötzlich ein ganzer Schwarm Schmetterlinge.
Ich hob den Kopf und sah ihn an.
Diese Augen. So blau.
Scheiße, Sarah, reiß dich zusammen!
Das Blut schoss mir in die Wangen, als mir bewusst wurde, dass ich ihn anstarrte wie einen Weihnachtsbraten. Mit hochrotem Gesicht räusperte ich mich.
»Entschuldigung … ich …« Ich deutete hinter mich und vage in die Richtung, wo ich die Straße vermutete. »Mein Wagen ist liegen geblieben, nicht ganz eine Meile die Straße runter.«
Er runzelte immer noch die Stirn.
Ich bemerkte, wie er mich musterte. Mir wurde noch wärmer in der Winterjacke, und ich konnte spüren, wie es an meinem ganzen Körper zu kribbeln begann.
Was ist los mit dir?
Verflucht, ja, dieser Typ war heißer als heiß – und ich sah vermutlich aus wie eine Dreizehnjährige im Schneeanzug. Trotzdem war das kein Grund, hier zu stehen wie eine läufige Hündin und ihn mit heraushängender Zunge anzuglotzen.
Gottverdammt, wer konnte ahnen, dass sich hier draußen so ein Prachtexemplar verkroch?
Ich versuchte, unauffällig einen Blick in die Hütte zu erhaschen.
Hatte er eine Frau bei sich im Haus? Oder einen anderen Kerl?
Dieser Typ konnte unmöglich real sein. Er sah aus, als wäre er einem Frauenmagazin entsprungen … Die Wahl zum heißesten Holzfäller des Jahres – und hier ist unser Favorit, mit neunzig Prozent der Stimmen gewählt.
Verdammt, verdammt, verdammt.
»Und?«
Ich schüttelte den Kopf. Und?
Hatte er das gerade wirklich gesagt? »Wie und?«
Er zuckte mit den Schultern. »Was habe ich damit zu tun? Rufen Sie den Pannendienst, ich kann Ihnen nicht helfen.«
Als er im Begriff stand, die Tür zu schließen, machte ich instinktiv einen Schritt nach vorn und stellte einen Fuß in den Türrahmen.
»Sie können mich doch hier nicht stehen lassen.«
Ich warf ihm einen entgeisterten Blick zu.
Gutes Aussehen war ganz offensichtlich keine Garantie für gutes Benehmen. Irgendwie fühlte ich mich gerade ziemlich vor den Kopf gestoßen.
»Nehmen Sie den Fuß aus der Tür«, sagte er in harschem Tonfall.
Ärger wallte in mir auf.
»Ich brauche aber Hilfe.«
»Das ist nicht mein Problem.«
Er sah aus, als würde er überlegen, mich in den Schnee zu schubsen, wenn ich nicht freiwillig Platz machte – und dass er mir körperlich überlegen war, daran zweifelte ich nicht eine Sekunde.
»Gehen Sie«, verlangte er. »Sie können hier nicht bleiben.«
Vollidiot.
War das sein Ernst?
Meine nackte Hand ballte sich zur Faust, ehe ich mit dem Zeigefinger vor dem Gesicht des Typen herumfuchtelte und ihn mit meinem unerwarteten Angriff ein Stück zurück in die Hütte zwang.
»Hören Sie mir jetzt mal zu, Mann! Mein Scheißauto ist liegen geblieben, und ich habe in dieser gottverdammten Einöde keinen Handyempfang. Meine Füße sind dank dieser Dreckskälte fast abgefroren, und ich muss dringend pinkeln. Sie können meinetwegen so unhöflich sein, wie sie wollen, aber ich lasse mich nicht von Ihnen wie ein dummes Gör abfertigen. Ich verlange weder, dass Sie mein Auto reparieren, noch, dass Sie mir Unterschlupf gewähren. Aber es wäre das Mindeste, mich wenigstens telefonieren zu lassen, damit ich mir Hilfe von jemandem holen kann, der keinen Stock im Arsch hat.«
Mit zusammengezogenen Augenbrauen warf er mir einen verblüfften Blick zu. Ich war mir sicher, er würde mir nun doch die Tür vor der Nase zuschlagen. Mit dieser Ansage hatte ich es vermutlich endgültig vermasselt.
Scheiße, Sarah, Scheiße! Du und deine vorlaute Klappe.
»Ich habe kein Telefon«, erwiderte er in ruhigem Ton.
Mir klappte die Kinnlade herunter.
»Was?« Selbst in meinen Ohren klang ich irgendwie hysterisch.
»Ich habe kein Telefon«, wiederholte er.
Fassungslos schüttelte ich den Kopf. »Welcher Mensch hat denn bitte kein Telefon?«
»Einer, der hier draußen seine Ruhe haben will«, murmelte er. Ich bemerkte, dass er kurz zögerte, ehe er einen Schritt beiseite machte und mir damit Zugang zu seiner Hütte gewährte.
»Sie können meine Toilette benutzen und sich hier aufwärmen. Danach schaue ich mir Ihren Wagen an.«
Wie bitte? Ich glaubte, mich verhört zu haben.
Eben hatte er mich noch loswerden wollen und nun das?
Von einer Sekunde auf die andere hatte sich ein Scheißkerl in jemanden mit einem Mindestmaß an Anstand verwandelt. Ich konnte nicht leugnen, dass ich eine gewisse Genugtuung verspürte.
Was so eine Standpauke doch alles bewirken konnte! Seltsam, dass man Männern immer erst in den Arsch treten musste.
Andererseits bereute ich meinen Ton, der alles andere als höflich gewesen war, fast ein bisschen.
Ich runzelte die Stirn.
»Danke«, murmelte ich kleinlaut. Einen kurzen Moment überlegte ich, mich zu entschuldigen, entschied mich dann aber dagegen.
Die Standpauke hatte er sich verdient.
Er musterte mich abermals mit diesem finsteren Blick, blieb jedoch stumm. Als ich in die Hütte treten wollte, deutete er auf meine Stiefel.
»Ziehen Sie die aus«, verlangte er. »Ich mache Ihnen einen Tee.« Ohne ein weiteres Wort verschwand er ins Innere und ließ mich vor der geöffneten Tür stehen.
Hastig schlüpfte ich aus den Boots und verzog die Lippen, als mir bewusst wurde, wie nass und kalt die Socken waren. Ich schüttelte den restlichen Schnee von meinen Hosenbeinen, zog mir die Socken aus und trat barfuß ins Haus.
Leise schloss ich die Tür hinter mir.
Wärme empfing mich, und in mir machte sich ein fast behagliches Gefühl breit. Die Hütte war nicht groß und bestand im Grunde aus einem einzigen Raum.
Ich sah einen Kamin, der zur Hälfte von einem alten Sofa verdeckt wurde, das mit braunem Cordstoff bezogen war. Direkt gegenüber dem einzigen Fenster stand ein Schreibtisch, auf dem ein heilloses Durcheinander aus Fotos und Papieren herrschte. Breite Regale voller Bücher waren an den Wänden festgeschraubt.
Vielleicht hatte ich meinen unhöflichen Gastgeber bei seiner Arbeit gestört. Wer wusste schon, was dieser Kerl hier draußen trieb.
Okay, er sah eher aus wie ein Holzfäller.
Das Haar war zu lang, dazu der Bart. Vermutlich war er so ein Ökofritze auf Weltenrettermission. Jemand, der eins mit der Natur werden wollte oder so.
Ich ließ meinen Blick weiter zu einer kleinen Küchenzeile mit altertümlichem Ofen wandern. Direkt davor stand der Fremde und stellte einen Wasserkessel auf die Herdplatte. Selbst von hinten hatte der Typ diese hypnotische Wirkung … und einen wirklich geilen Arsch!
Reiß dich zusammen!
Ich zwang mich, seine ansehnliche Kehrseite nicht länger anzuglotzen, und schaute mich weiter in der Hütte um. Halb hinter einem zerschlissenen Vorhang verborgen erkannte ich rechts von mir ein Bett mit zerwühlten Kissen. Ich ignorierte das nervöse Herzklopfen, das der Anblick in mir auslöste. Die Erleichterung darüber, dass ich hier keine Anzeichen für die Anwesenheit eines anderen Menschen fand, versuchte ich zu ignorieren.
Zu meiner Linken bemerkte ich eine nachträglich eingezogene Wand mit Tür … Gab es hier doch einen zweiten Raum?
»Dort ist die Toilette«, verkündete der Fremde.
Er sah mich nicht einmal an, stand nur da und deutete mit dem Daumen über seine Schulter hinweg. Vermutlich befürchtete er, ich würde ihm auf seine blank gebohnerten Dielen pinkeln. Ich verdrehte die Augen.
Hör auf, ihm irgendwelche Dinge zu unterstellen. Du kennst diesen Typ gar nicht. Er wird dir helfen, und sobald das Auto wieder läuft, verschwindest du.
Dankbar, der merkwürdigen Wirkung, die er auf mich hatte, entkommen zu können, verschwand ich im Bad.
***
»Ich bin Sarah.« Ich schenkte ihm ein offenes Lächeln und hielt ihm die Hand hin. Während ich in dem winzigen Bad gewesen war, hatte ich ein wenig meiner Souveränität zurückgewinnen können und war nun bemüht, diese beizubehalten.
Er reichte mir die Tasse und ergriff schließlich mit deutlichem Zögern meine Hand. Dort, wo seine Finger meine Haut berührten, spürte ich ein sanftes Prickeln.
In meinem Bauch war wieder ein Schwarm Schmetterlinge.
Verflucht!
»Brandon«, erwiderte er leise. Unsicherheit flackerte in seinem Blick auf. Spürte er das Knistern zwischen uns auch, oder bildete ich mir das nur ein?
»Ich muss mich entschuldigen«, murmelte ich. »Ich hätte das vorhin nicht sagen sollen … Mir sind die Nerven durchgegangen.«
Er starrte mich an. Ich fragte mich, ob er mir überhaupt zuhörte. Die Hitze in meinen Wangen steigerte sich noch. Ich war sicher, wenn wir noch länger hier stünden und uns an den Händen hielten, würde ich irgendetwas fürchterlich Dummes sagen oder tun.
Schließlich blinzelte er, ließ meine Hand los und trat einen Schritt zurück.
»Vermutlich habe ich das verdient«, bemerkte er schulterzuckend. »Ich war auch nicht gerade die Höflichkeit in Person.« Er wandte sich ab, um sich ebenfalls eine Tasse Tee zu nehmen. »Wahrscheinlich bin ich schon zu lang allein hier draußen.«
Selbst wenn ich nicht so neugierig gewesen wäre, hätte mich spätestens jetzt mein journalistischer Spürsinn zu der nächsten Frage veranlasst.
»Lebst du hier das ganze Jahr?«
Vielleicht war die Frage ein wenig forsch. Aber er konnte nicht so viel älter als ich selbst sein. Manchmal war Angriff einfach die bessere Taktik.
Zerstreut wärmte ich meine Finger an der mit heißem Tee gefüllten Tasse und führte sie an die Lippen. Der Geruch ließ mich innehalten.
Oh, bitte nicht.
Ich konnte gerade noch verhindern, eine Grimasse zu ziehen.
Pfefferminze!
Ich hasste Pfefferminztee, das war fast so schlimm wie der Kamillentee, den Mum uns immer eingeflößt hatte, wenn meine Geschwister oder ich krank gewesen waren.
Kurz überlegte ich, Brandon um ein Glas Wasser zu bitten. Allerdings wäre es nach unserem ohnehin schon unglücklichen Kennenlernen zu unhöflich gewesen, ihm zu sagen, wie ekelhaft ich dieses Gesöff fand.
Nein, ich würde das durchstehen.
Der Tee half dabei, mich wieder aufzuwärmen. Nur das zählte. Ich zwang mich, einen winzigen Schluck zu nehmen, und musste ein Würgen unterdrücken.
Gott, war das widerlich!
Als ich Brandon ansah, bemerkte ich seinen abwesenden Gesichtsausdruck. Offenbar überlegte er immer noch, was er auf meine Frage antworten sollte. Ich runzelte die Stirn.
Wieso musste er darüber überhaupt nachdenken?
Hatte er etwas zu verbergen?
»Mal so, mal so«, erwiderte er plötzlich ausweichend. Ich war überrascht. Ehrlich gesagt hatte ich schon gar nicht mehr damit gerechnet, irgendeine Antwort von ihm zu bekommen. »Hattest du kein Benzin mehr?«
Seine Reaktion wertete ich als positives Zeichen.
Wir kannten einander zwar nicht, aber ein bisschen Small Talk hatte noch niemandem geschadet. Ich war doch bloß auf der Durchreise. Er brach sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er ein wenig höfliche Konversation betrieb.
Allerdings wollte er offenbar partout nichts über sich preisgeben. Somit musste ich es wohl hinnehmen, dass er gleich wieder abzulenken versuchte.
»Doch, der Tank ist noch halb voll«, erwiderte ich. »Ich schätze, es ist die Batterie; das Plastik ist gerissen.«
Sein zweifelnder Blick machte mir ziemlich deutlich, was er von Frauen hielt, die meinten, sich mit Autos auszukennen.
Macho.
Er nickte nachsichtig und deutete auf meine Tasse.
»Wenn du fertig bist, werfe ich einen Blick auf das Auto.«
Ich zuckte mit den Achseln, versuchte, den ekelerregenden Geruch zu ignorieren, und nippte erneut an dem Heißgetränk. Angespanntes Schweigen erfüllte den Raum, bis ich die Stille nicht mehr aushielt. »Und, was tust du hier draußen so ganz allein?«
Interessiert schlenderte ich durch den Raum und blieb hinter dem Sofa stehen. Zu meiner Überraschung sah ich einen wuscheligen, mittelgroßen Hund vor dem Kamin auf einem Teppich liegen. Er öffnete ein Auge und wedelte kurz mit dem Schwanz, als er mich sah.
»Oh, entschuldige, so allein bist du gar nicht«, bemerkte ich mit einem Lächeln. Wer einen Hund hatte, konnte nicht so übel sein, oder? Vielleicht hatte er einfach einen schlechten Tag.
»Nein, bin ich nicht.«
Mit einem Mal stand er direkt hinter mir.
Das Herz hämmerte mir bis in die Kehle und machte das Atmen fast unmöglich. Ich spürte die Welle der Erregung, die in meinem Körper aufbrandete.
Verdammt, ich hatte noch nie derart intensiv auf einen Kerl reagiert. War das noch normal?
Nervös wandte ich mich ihm zu.
Ernüchterung machte sich in mir breit. Er sah mich nicht einmal an.
Stattdessen trank er einen großen Schluck von seinem grauenhaften Tee und starrte zum Schreibtisch hinüber. Noch deutlicher hätte er mir nicht zu verstehen geben können, dass ich unerwünscht war.
An seinen Gastgeberqualitäten musste er echt noch feilen!
Trotzig ging ich um das Sofa herum und nahm ungefragt darauf Platz. Ich hielt dem dunklen Hund eine Hand hin, damit er an ihr schnüffeln konnte. Fast gelangweilt hob er seinen Kopf, berührte mit der grauen Schnauze kurz meine Finger und machte es sich wieder gemütlich.
»Ist mit ihm alles in Ordnung?«, wollte ich wissen.
»Ja, er ist einfach nur alt und bequem geworden.«
Brandon klang zunehmend gereizter. Mir war klar, dass mein dreistes Verhalten ihm zu schaffen machte und er mich so schnell wie möglich wieder loswerden wollte. Zu seinem Pech fühlte ich mich von seiner Unhöflichkeit und der abweisenden Art provoziert.
Ich liebte Herausforderungen, und sein sprödes Verhalten machte ihn nur noch interessanter.
Was verschlug einen Kerl wie ihn hierher in die Einsamkeit?
Die Spekulationen in meinem Kopf reichten bereits vom Ökoterroristen auf Selbstfindungstrip bis zum gefeierten Superstar, der vor einer durchgedrehten Stalkerin floh.
Vermutlich war er aber nur ein durch und durch langweiliger Typ, der zufällig aussah wie ein Hollywoodstar, der sich seit Wochen nicht rasiert hatte … und ein Sixpack besaß.
Leider hatte er in der Zwischenzeit sein Hemd geschlossen, und mir blieb ein prüfender Blick auf das enge T-Shirt verwehrt.
Ich zuckte mit den Schultern.
Er räusperte sich. »Ich würde mir jetzt gern dein Auto anschauen.«
Wortlos nickte ich und erhob mich.
Der Macho hatte gesprochen. Aber vielleicht hatte ich Glück und er besaß eine Autobatterie, die er entbehren konnte. Außerdem entkam ich damit der Verpflichtung, mir weiterhin diesen Ekeltee reinzwingen zu müssen.
So attraktiv dieser Kerl auch war, so überflüssig fühlte ich mich in seiner Nähe. Je eher ich von hier verschwinden konnte, desto besser.
***
Das Schneegestöber war deutlich schlimmer geworden.
Unschlüssig trat ich neben Brandon, der mit dem halben Oberkörper im Motorraum des SUV hing.
»Scheint die Batterie zu sein«, hörte ich seine gedämpfte Stimme. Ich verdrehte die Augen und schnitt eine Grimasse hinter seinem Rücken.
»Hab ich doch gesagt.«
Er murmelte etwas Unverständliches vor sich hin.
Natürlich war es die Batterie! Ich war schließlich kein hohles Dummchen, das kaum wusste, wie man den Zündschlüssel im Schloss herumdrehte.
»Tja, da kann ich auch nicht helfen.«
Brandon wischte sich die schmutzigen Hände an den Hosenbeinen ab und zuckte mit den Schultern. Gleichzeitig vollbrachte er das Kunststück dreinzublicken, als hätte er in eine rohe Zwiebel gebissen.
Sein Blick streifte mich kurz und wanderte dann einmal die Straße hinauf und wieder hinunter. Ich ahnte, was ihm durch den Kopf ging.
Außer meinen Fußspuren, die gerade noch erkennbar waren, war die stetig höher werdende Schneedecke so gut wie unberührt. Hier war schon seit Stunden niemand mehr mit dem Auto vorbeigefahren … und vermutlich würde das auch nicht passieren, bis das aufkommende Unwetter vorüber war.
Ich hatte eine vage Ahnung, was da auf mich zukam.
Bei meinen Reisevorbereitungen hatte ich mehrfach von den üblen Unwettern gelesen, die im Norden Kanadas herrschen konnten. Daher wusste ich nur allzu gut, dass es nicht ratsam war, sich in einem solchen Fall draußen aufzuhalten. Ich war auch fest entschlossen gewesen, mich dem nicht unnötigerweise auszusetzen.
»Wir müssen zurück«, stellte Brandon fest.
Ihm war anzusehen, wie wenig ihm der Gedanke behagte. Ich stopfte die Hände in die Taschen meiner Jacke.
Wir hatten den Weg zum Auto bereits in unangenehmem Schweigen verbracht. Nun erneut mit ihm zu seiner Hütte zurückzulaufen und dort mit diesem miesepetrigen Menschen die nächsten Stunden eingesperrt zu sein löste auch in mir keine Begeisterung aus.
Alternativen gab es jedoch nicht, entweder ich blieb hier und verbarrikadierte mich im Auto, oder ich lief durch einen Schneesturm. In beiden Fällen waren die Chancen ausgesprochen gering, es unbeschadet zu überstehen.
»Wenn du mir sagst, wo ich die nächste Stadt finde, dann laufe ich«, bemerkte ich. »Du brauchst mich nicht länger als nötig ertragen.«
»Ein Blizzard zieht auf«, erwiderte er. »Sogar wenn ich es verantworten könnte, dich gehen zu lassen, sind es fünf Meilen bis zum nächsten Ort. Das schaffst du niemals. Nicht einmal ein Ortskundiger würde den Weg inmitten des Schneegestöbers noch finden … Man sieht die Straße ja schon jetzt kaum mehr.«
Er schüttelte so vehement den Kopf, dass ich den Eindruck bekam, er könne selbst nicht glauben, was er da von sich gab. »Du kannst bleiben, bis das Schlimmste vorüber ist.«
Im Grunde war ich erleichtert. Ich war nicht scharf darauf, mich bei Minusgraden und Schnee, der mir waagerecht ins Gesicht schlug, durch diese Einsamkeit zu schlagen. Trotzdem blieb ein sturer, trotziger Rest in mir, der auf Konfrontation aus war.
»Sicher, dass du das aushältst?«, wollte ich wissen.
Er warf mir einen seltsamen Blick zu, ehe er die Motorhaube des SUV zudrückte und loslief.
»Komm einfach!«, rief er.
Ich zögerte gerade so lang, dass ihm klar werden musste, dass ich seiner seltsamen Einladung nur widerwillig folgte.
Ich verkniff mir einen tiefen Seufzer und schulterte den schweren Rucksack.
Sich wie ein bockiges Kind zu benehmen machte die Sache auch nicht besser. Kein Wunder, dass er mich nicht ernst nahm.
Das Beste war, sich mit der Situation abzufinden und nicht den Kopf in den Sand zu stecken … oder in den Schnee. Ich musste das Ganze als Herausforderung sehen – außerdem hatte ich nun Zeit herauszufinden, wer er eigentlich war und was er hier draußen so ganz allein trieb.
Er konnte mir ja nicht ständig aus dem Weg gehen.
Abgeschnitten von der Außenwelt und in der Gesellschaft dieses unglaublich unterhaltsamen, charmanten Mannes, der zwar gut aussah, aber wenig Wert auf soziale Interaktionen mit anderen Menschen zu legen schien … Da freute sich das Journalistenherz. Das war eine tolle Trockenübung, um mit unwilligen Interviewpartnern ins Gespräch zu kommen.
Nur ein Geburtstag bei Großtante Maude mit ihrer Bridgerunde wäre ein noch zweifelhafteres Vergnügen gewesen. Ich lächelte grimmig und stapfte hinter Brandon her. Die nächsten Stunden würden bestimmt sehr amüsant … besonders für meinen Gastgeber.
»Könntest du vielleicht schneller laufen?«
Ärgerlich schüttelte ich den Kopf.
So ein Arsch.
Mir hing fast die Zunge aus dem Hals, und er rannte einfach weiter. Rücksichtnahme war ebenfalls keine seiner herausragenden Eigenschaften.
»Meine Beine sind nicht lang genug. Ich kann mich nicht so locker durch den Schnee schwingen wie du.«
»Das hat nichts mit der Länge der Beine zu tun. Es ist der Rhythmus, in dem du dich bewegst.«
Klugscheißer.
Ärgerlich starrte ich ihm ein Loch in den Rücken.
»Gibt’s dich eigentlich auch in nett?«, fragte ich.
Brandon warf mir einen deutlich angesäuerten Blick über die Schulter hinweg zu.
»Das frage ich mich in deinem Fall auch schon die ganze Zeit.« Ohne mich noch einmal anzuschauen, bog er von der Straße ab und trat zwischen den Bäumen hindurch in den Wald.
Ich fluchte still. Zugegeben, meine Laune war nicht unbedingt die beste, aber dieser Kerl machte es mir auch nicht gerade leicht.
»Warte!«, rief ich.
Mit den Händen gestikulierte er wild in die Richtung, in der die Straße im Gewirr des Schneegestöbers verschwand.
»Mach, was du willst. Entweder du hältst mit meinem Tempo mit und kommst jetzt, oder du suchst dir deinen eigenen Weg, wo auch immer der hinführen mag. Ich bin nicht verantwortlich für dich.«
Hätte ich nicht befürchtet, in dem zunehmenden Gewirr aus weißen Flocken die Orientierung zu verlieren, wäre ich vermutlich schmollend stehen geblieben und hätte ihn beschimpft. Doch mein Überlebensinstinkt veranlasste mich dazu, all meine Kräfte ein letztes Mal zu mobilisieren, die Träger meines schweren Rucksacks zu umfassen und ihm so schnell wie möglich hinterherzurennen.
***
Die Stimmung zwischen uns blieb frostig.
Seit wir eine Viertelstunde zuvor in der Hütte angekommen waren, hatten wir kein Wort miteinander gewechselt.
Nun, da ich nicht länger Gefahr lief, draußen vom Weg abzukommen und irgendwo tiefgefroren als Bärenfutter zu enden, beruhigte sich mein erhitztes Gemüt langsam wieder.
Fast fühlte ich mich ein bisschen schuldig, als ich Brandon dabei zusah, wie er unruhig in der Hütte auf und ab lief und alles Mögliche hin und her räumte. Er sah nicht glücklich aus.
Vermutlich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, sich bei ihm für mein zickiges Verhalten zu entschuldigen. Allerdings benahm er sich keinen Deut besser als ich. Warum also sollte ich den Anfang machen?
Du bist hier Gast. Er hätte dich genauso gut dort draußen deinem Schicksal überlassen können.
Ich schloss für einen Moment die Augen und unterdrückte einen Seufzer. Merkwürdigerweise klang mein nörgelndes, schlechtes Gewissen immer wie meine kleine Schwester. Hannah hätte kein Problem damit gehabt, die Wogen zu glätten.
Sie war ein ausgesprochen ruhiger und mitfühlender Mensch und hätte mit Sicherheit sofort die richtigen Worte gefunden. Wo ich mit dem Kopf durch die Wand und meinen Willen durchsetzen wollte, war Hannah der stille Fels in der Brandung.
Kein Wunder, dass ständig alle in ihrer Nähe verzaubert waren.
Ihr engelhaftes Äußeres, ihr zartes Wesen – ich fühlte mich manchmal wie das schwarze Schaf der Familie, obwohl Dad immer betonte, dass er seinen »temperamentvollen Rotschopf« gegen nichts auf der Welt eintauschen wolle.
»Brandon?«
Mein Gastgeber hielt kurz in der Bewegung inne, ehe er weiterräumte. Er sah mich nicht an. Stattdessen deutete er auf das Bett in der Ecke.
»Du kannst dort schlafen. Ich übernachte auf dem Sofa.«
»Übernachten?«, wiederholte ich irritiert.
Sein kühler Blick streifte mich.
»Der Sturm wird die nächsten Stunden andauern. Wir müssen das aussitzen – ob wir wollen oder nicht.«
Den zweiten Teil des Satzes hatte er nur leise vor sich hin gemurmelt. Dennoch hatte ich ihn verstanden.
Für einen Moment war mir, als würde Hannah mir eine Hand auf die Schulter legen, um mich zu beruhigen.
Tief durchatmen. Scheiße, nett sein ist blöd.
»Es tut mir leid.« Die Hände in den Hosentaschen vergraben, krümmte ich die nackten Zehen auf den Holzdielen und starrte zu Boden. »Mir sind da draußen die Gäule durchgegangen. Diese ganze Situation überfordert mich gerade irgendwie. Ich gebe zu, ich bin nicht unbedingt für meine Sensibilität berühmt. Aber sogar ich merke, dass du mich im Grunde nicht hier haben möchtest … und ich will dir mit meiner Anwesenheit eigentlich auch gar nicht auf den Keks gehen. Ich weiß nur leider nicht, wohin ich sonst soll.«
Ich hörte ihn scharf einatmen.
Als ich das Kinn hob, stand er da und starrte mich an, auf eine sehr merkwürdige Weise, die ich nicht einzuordnen wusste.
»Schon gut«, erwiderte er leise. »Dies ist für uns beide eine unangenehme Situation. Wir sollten versuchen, das Beste daraus zu machen.«
Ich nickte still.
»Sobald der Sturm vorbei ist, versuche ich, meinen Kontakt in Netla zu erreichen und Hilfe zu besorgen«, fügte er hinzu.
Mit einem Blinzeln legte ich den Kopf schief.
»Deinen Kontakt in Netla erreichen? Wie meinst du das?«
Brandon zuckte mit den Schultern, ergriff eine Wolldecke und warf sie auf das Sofa.
»Per CB-Funk.«
Verblüfft sah ich dabei zu, wie er sich auf das Sofa setzte und die Füße auf dem Couchtisch ablegte. Ich versuchte zu ignorieren, dass der Anblick seiner nackten Zehen erneut seltsame Gelüste in mir heraufbeschwor.
Was zur Hölle war los mit mir? Ich hatte noch nie auf Füße gestanden. Füße waren ekelhaft.
Ich floh mich in den neu aufkeimenden Ärger.
»CB-Funk?«, wiederholte ich vorwurfsvoll.
Er warf mir einen irritierten Blick über die Schulter zu.
»Was ist daran so verwunderlich?«
»Was …«
Ich schnappte nach Luft, ballte die Hände zu Fäusten und stapfte um das Sofa herum. Sein Hund lag immer noch vor dem Kamin und sah aus, als hätte er sich in den anderthalb Stunden, seit wir zum Wagen gegangen waren, nicht von der Stelle gerührt. Hätten seine Augen sich nicht zwischendurch bewegt, hätte ich geglaubt, der Köter wäre ausgestopft.
»Du hast ein Funkgerät«, stellte ich fest.
Brandon zuckte mit den Schultern.
»Ja, ich weiß. Das sagte ich gerade«, erwiderte er.
War er wirklich so schwer von Begriff, oder machte er das extra?
»Du hast gemeint, du hättest keine Möglichkeit, jemanden anzurufen, als ich dich danach gefragt habe.«
Er zog die Augenbrauen hoch.
»Du hast nach einem Telefon gefragt … und das habe ich nicht«, gab er zurück. »Du hast nicht um mein Funkgerät gebeten.«
Kopfschüttelnd warf ich die Hände in die Luft.
»Männer! Ich hätte Hilfe gebraucht. Da ist es mir doch egal, ob per Telefon, Funk oder Rauchzeichen.«
Er sah mich nur an und schwieg.
»Willst du nichts dazu sagen?«
Fast wirkte er schon gelangweilt, als er tief einatmete.
»Bist du überhaupt an meiner Meinung interessiert?«
Seine Gegenfrage nahm mir so plötzlich den Wind aus den Segeln, dass ich ihn eine gefühlte Ewigkeit mit offenem Mund anstarrte.
Erweckte ich diesen Eindruck?
Ja, verdammt.
Ich verschränkte die Arme vor der Brust und zwang mich zur Ruhe. Ich benahm mich schon genauso hysterisch und überdreht wie Großtante Maude, wenn diese sich mal wieder mit Dad in die Wolle bekam.
»Okay, ja, entschuldige … Warum hast du mir nicht gesagt, dass du ein Funkgerät hast?«
»Du hast nicht danach gefragt.«
Ich ließ das Kinn auf die Brust sinken und bedeckte mit einer Hand mein Gesicht. Diese Antwort hätte jetzt auch von einem meiner Brüder kommen können.
Männliche Logik.
»Aber dir war schon klar, dass ich einfach nur Hilfe gebraucht hätte«, warf ich ein.
»Ein Sturm zog auf«, gab Brandon zurück. »Ich hätte nichts erreicht. Um den Funk nutzen zu können, muss das Wetter klar sein … Davon abgesehen kenne ich dich nicht gut genug.«
Verwirrt runzelte ich die Stirn und hob beide Hände.
»Was hast du erwartet? Eine Spionin der CIA?«
Er zuckte mit den Schultern, doch auf seinem Gesicht zeigte sich für den Bruchteil einer Sekunde ein seltsamer Ausdruck, der mich dazu veranlasste, ihn genauer anzusehen.
»Nein, das nicht«, bemerkte er, »aber hier draußen begegnen einem manchmal die seltsamsten Menschen.«
Ich gab ein humorloses Lachen von mir.
»Wem sagst du das?«
Es zuckte um seine Mundwinkel.
Oh, ein Anflug von Humor.
Gut, ich musste das anders angehen.
Ich nahm neben ihm auf dem Sofa Platz und wickelte mir nachdenklich eine Locke um den Finger.
Was schadete es schon, wenn ich ihm ein wenig entgegenkam und ihm erst einmal erklärte, wer ich war?
»Eine Spionin wäre sicher auf alle Eventualitäten hier draußen vorbereitet gewesen – ich war’s nicht. Ich wollte nach Tungsten, als mein Wagen liegen geblieben ist.«
Ich musste irgendetwas sagen, die Stimmung auflockern und ihm klarmachen, dass ich harmlos war … eigentlich … okay, meistens jedenfalls.
»Du weißt schon, dass diese Straße nicht nach Tungsten führt?«
Ich öffnete den Mund und warf ihm einen kurzen ungläubigen Blick zu, ehe meine Schultern nach unten sackten.
»Ernsthaft?«
»Du warst in genau der entgegengesetzten Richtung unterwegs.«
»Nein.«
»Doch.«
»Oh, Scheiße!«
Zerknirscht biss ich mir auf Unterlippe.
»Entschuldige … ich meine, das ist so dämlich.« Seufzend fuhr ich mir mit einer Hand durchs Haar. »Mein Navi hat verrückt gespielt und mir angezeigt, ich wäre auf dem richtigen Weg. Aber dann – am Auto ist alles ausgefallen und ich wusste nicht, wo ich war – und mein Handy konnte ich hier draußen auch nicht gebrauchen –, und vorher ist mir schon stundenlang kein einziges Auto mehr begegnet.«
Brandon nickte.
»Hier draußen ist das Nirgendwo«, stellte er achselzuckend fest. »Kein Handyempfang, kein GPS, kein gar nichts. Mit viel Glück und bei gutem Wetter kann man jemanden per Funk erreichen, doch selbst das ist schwierig.«
Ich musterte ihn.
»Aber du lebst hier!«
»Ja, weil ich genau diese Abgeschiedenheit mag. Was treibt dich nach Kanada? Du klingst eher nach mittlerem Westen.«
Ich registrierte sehr wohl, dass er von sich abzulenken versuchte. Aber ich tat ihm den Gefallen und beantwortete seine Frage.
»Ja, ich komme eigentlich aus Colorado. Ich mache hier Urlaub. Oder … so was in der Art.«
Ich verstummte. Die Erinnerung an das erste Weihnachtsfest ohne Maylin und daran, wie ich dem grauer werdenden Alltag entflohen war, hielt mich sekundenlang gefangen. Wir hatten diese Tour gemeinsam machen wollen, wir hatten monatelang alles geplant.
Doch dann war alles sehr schnell gegangen – zu schnell –, und Maylin war fort.
»So was in der Art?«, wiederholte er.
Ich räusperte mich.
»Na ja, ich hatte eine Fototour geplant, wollte alle kanadischen Nationalparks abfahren und Bilder für ein Buch machen. Der Schneesturm wirft mich jetzt ein bisschen in meinem Zeitplan zurück.«
Seine Stirn legte sich in Falten. »Ein Buch?«
»Ja, einen Fotoband. Eigentlich war das ein Gemeinschaftsprojekt, aber …« Ich räusperte mich erneut. Der Kloß in meinem Hals war hartnäckig. »Meine Freundin ist verhindert.«
Er nickte, und ich war froh, dass er desinteressiert über meinen letzten Satz hinwegging. Ich hatte Maylin gar nicht erwähnen wollen, es war mir einfach herausgerutscht.
»Wie lang bist du schon unterwegs?«
»Nicht ganz zwei Wochen«, erwiderte ich bereitwillig. »Ich bin in Calgary gestartet, habe den Banff National Park besucht und war anschließend in Jasper. Danach bin ich dann nach Fort Nelson weitergereist.«
Ich seufzte.
»Nun wollte ich eigentlich einen Zwischenstopp in Tungsten einlegen, um den Nahanni und den Naats’ihch’oh-Nationalpark zu besuchen.« Ich hob resigniert die Hände. »Das kann ich mir nun wohl abschminken.«
»Das würde ich so nicht sagen«, erwiderte er. »Du befindest dich im Außengebiet des Nahanni. Normalerweise ist das keine Straße, auf der sich irgendein Tourist bewegt – sie ist nicht mal in den Karten eingezeichnet.«
Verblüfft starrte ich ihn an.
»Aber du wohnst hier.«
»Ja, und?«
»Du kannst in keinem Nationalpark wohnen.«
»Wer sagt das?«
Ich schüttelte entrüstet den Kopf. Dieser Kerl machte mich wahnsinnig.
»Du kannst hier doch nicht einfach eine Hütte bauen.«
»Wer sagt, dass ich das getan habe?«, fragte er.
Ich rollte mit den Augen.
»Wir sitzen gerade drin«, blaffte ich ihn an.
Er nickte, und ein schwaches Lächeln umspielte seine Lippen.
»Weißt du …« Er klang plötzlich sehr oberlehrerhaft. »Der Nahanni ist genau genommen gar kein Nationalpark, sondern ein staatliches Schutzgebiet und hat seit den späten Siebzigern den Nationalpark-Reserve-Status. Glücklicherweise ist er noch nicht den strömenden Menschenmassen ausgeliefert wie manch anderer Park. Diese Hütte steht hier übrigens schon seit den Zwanzigerjahren und wird nie von jemandem aufgesucht, außer von mir.«
Ich presste die Lippen aufeinander. So viel zu dem Vorhaben, keine voreiligen Rückschlüsse zu ziehen.
»Also lebst du hier nicht das ganze Jahr?«
»Ich nutze sie, um meine Feldforschung zu betreiben«, entgegnete er lapidar.
»Feldforschung?«, wiederholte ich.
Für einen kleinen Moment wirkte er ertappt. Es war offensichtlich, dass er mir davon nichts hatte erzählen wollen.
»Oh, du bist ein Umweltaktivist«, stellte ich fest. »Greenpeace?«
»Mal so, mal so«, murmelte er ausweichend und erhob sich vom Sofa. »Hör zu, bleib doch einfach hier sitzen und trink noch einen Tee. Ich muss ein bisschen Feuerholz holen.«
Ohne mir einen weiteren Blick zu gönnen, zog er seine Jacke an. An der Tür schlüpfte er in seine Stiefel.
»Clyde!«
Der Rüde erhob sich schwerfällig.
Man sah ihm an, dass die Jahre ihm zu schaffen machten, und das kühle Wetter hier tat vermutlich ein Übriges. Er warf mir im Vorbeischlendern einen mäßig interessierten Blick zu, wedelte kurz mit dem Schwanz und schlurfte dann zu Brandon hinüber. Die beiden verschwanden nach draußen, und ich blieb allein zurück.
Nervös erhob ich mich vom Sofa und trat ans Fenster. In der fortschreitenden Dunkelheit sah ich ihnen nach, bis sie aus meinem Blickfeld verschwanden.
Von einem Moment auf den anderen fühlte ich mich allein gelassen. Diese Abgeschiedenheit war nichts für mich.
Vielleicht hätte ich mitgehen sollen.
Allerdings entsprach die Aussicht auf wiederholt nasse Socken und eiskalte Füße auch nicht meinen Wunschvorstellungen.
Unruhig wandte ich mich vom Fenster ab und starrte unschlüssig vor mich hin. Wenn es hier wenigstens ein Radio oder einen Fernseher gegeben hätte!
»Wie hält man so viel Stille bloß aus?«, murmelte ich vor mich hin. Während ich durch das Zimmer wanderte, sah ich mich aufmerksam um.
Keine Bilder an den Wänden, keine Fotos, die irgendwo herumstanden. Es war gemütlich, aber ebenso unpersönlich und zweckmäßig. Hier hätte jeder wohnen können.
Es gab nichts, was auch nur ansatzweise darauf hindeutete, wer Brandon war. Ich wusste rein gar nichts über meinen Gastgeber … und meine Vermutung, dass er sich für irgendeine Organisation einsetzte, hatte er auch nicht wirklich bestätigt.
Neben der Küchenzeile blieb ich stehen und öffnete neugierig den Kühlschrank. Der Inhalt war ernüchternd. Salami, Käse, Brot, Butter und ein wenig Gemüse im untersten Fach.
Oh, und eine angebrochene Dose Hundefutter, die mit Alufolie abgedeckt war. In der Türablage entdeckte ich noch Eier und eine ungeöffnete Flasche Ketchup.
Es gab nicht mal Getränke.
Welcher Kerl hatte kein Bier im Kühlschrank?
Ich schloss die Tür und trat an die Anrichte.
Irgendetwas war sehr seltsam an Brandon. Er lebte hier draußen, doch seine Vorräte sprachen nicht dafür, dass er wirklich auf einen langen Aufenthalt vorbereitet war.
Ich öffnete einen der oberen Schränke und verzog das Gesicht.
Okay, vielleicht war »nicht vorbereitet« nicht der richtige Ausdruck. Er hatte offenbar eine Vorliebe für Konserven und Beef Jerky. Ich betrachtete die säuberlich sortierten Reihen aus Dosen und Tüten.
Die nächsten zwei Schränke waren ähnlich bestückt.
Zudem gab es einen Riesenvorrat an Tee und Wasser. Allerdings entdeckte ich nirgends auch nur den Hauch eines anderen Getränks.
Ich hätte gemordet, um jetzt einen guten Kaffee mit viel Milch zu bekommen oder auch nur ein profanes Bier, um mich ein bisschen zu benebeln. Die nächsten vierundzwanzig Stunden würden verdammt lang werden.
Inständig hoffte ich, dass der Schneesturm rasch vorbeizöge und Brandon bald Hilfe anfordern könnte. So gut mein griesgrämiger Gastgeber auch aussehen mochte, seine Gesellschaft war weder besonders unterhaltsam, noch steigerte sie das Wohlbefinden.
Ich schlenderte weiter und trat neben den chaotischen Schreibtisch. Blätter stapelten sich darauf. Ich sah Fotos und eine Landkarte, auf der unterschiedliche Markierungen eingezeichnet waren.
Neugierig beugte ich mich darüber.
Wenn mich nicht alles täuschte, war das eine Karte von dem Gebiet, in dem auch der Nahanni Nationalpark lag. Außerdem eine vom Banff National Park, darauf ein dickes, rotes X.
Woran forschte er hier draußen? An der Population der Schwarzbären?
Als ich mich abwenden wollte, bemerkte ich mehrere Blätter mit Diagrammen und darüber zwei Namen: Craven & Abbott.
War das die Organisation, für die er tätig war?
Ich kannte mich nicht aus auf dem Gebiet. Geläufig waren mir nur Namen wie Greenpeace oder der WWF. Allerdings gab es zahllose kleine und national tätige Umweltschutzorganisationen – vielleicht war das eine davon.
Ich zog mein Handy aus der Hosentasche und entsperrte das Display.
Immer noch kein Empfang. Verdammt.
Kein Internet zu haben bereitete mir langsam, aber sicher körperliches Unbehagen.
Wie ertrug Brandon diesen Zustand hier draußen nur? Das war ja fast wie im Mittelalter.
Seufzend schob ich das unnütze Telefon zurück in meine Jeans und betrachtete abermals die Papiere, die vor mir ausgebreitet waren. Irritiert runzelte ich die Stirn, als mir etwas auf einem der unteren Blätter auffiel.
Es war der Briefkopf des ECCC, des Environment and Climate Change Canada. Was hatte Brandon mit dem kanadischen Umweltministerium zu schaffen? Als ich es ein Stück herauszog, sah ich einen Haufen Zahlen und einige verwirrende Sätze von Wasser- und Bodenwerten, darunter eine Unterschrift von jemandem namens Prankett oder Pratchett. Unmöglich zu entziffern.
Plötzlich traf mich ein kalter Windstoß und riss mich aus meinen Gedanken.
»Was machst du da?«
Der harsche Ton ließ mich zusammenzucken. Ich drehte mich um. Brandon stand in der offenen Tür. Er war eindeutig wütend.
»Gott. Du hast mich erschreckt.«
Während Clyde zurück zum Kamin trottete, warf Brandon geräuschvoll die Tür hinter sich ins Schloss, und der Stapel Holzscheite landete auf dem Boden.
Mit langen Schritten durchquerte er den Raum, trat zwischen mich und den Schreibtisch und maß mich mit zornigem Blick.
Ich schluckte.
Was war los mit ihm? Gut, er hatte mich beim Schnüffeln erwischt und sicher das Recht, ärgerlich zu sein. Aber die kalte Wut in seinem Gesicht war übertrieben. Ich hatte mich doch nur ein bisschen umgesehen.
»Entschuldige, ich …«
Der Zeigefinger, der mir fast ins Gesicht stach, unterbrach mein hilfloses Gestammel abrupt.
»Solange du mein Gast bist, halt dich fern von meiner Arbeit.«
Brandons Kiefer mahlte.
Ich fühlte mich genötigt, mich zu verteidigen.
»Wow, krieg dich mal wieder ein. Ich habe mich nur ein bisschen umgesehen, weil du mich neugierig machst – ich will dir nichts wegnehmen.«
Er überwand die letzte Distanz zwischen uns, und sein Kopf ruckte nach vorn. Brandons Nasenspitze berührte fast meine eigene. Ich konnte seinen Atem auf meinen Lippen spüren. Für einen winzigen Moment wollte ich in seinen blauen Augen versinken und mich in seine Arme werfen.
Küss mich.
»Wenn ich dir nichts erzähle, dann tue ich das, weil dich das nichts angeht«, entgegnete er zornig. »Halt dich von mir und meinem Zeug fern. Sobald der Sturm vorbei ist, verschwindest du von hier.«
Ein Eimer kaltes Wasser hätte keine weniger abschreckende Wirkung gehabt.
»Was hast du für ein Problem?«
»Du hast an meinem Zeug nichts zu suchen.«
Ich hob abwehrend die Hände. »Okay, okay, passiert nicht wieder. Es tut mir leid.«
Er drängte mich beiseite, griff nach der Decke, die über dem Sofa lag und warf sie auf seinen Schreibtisch. Papiere und Fotos verschwanden unter einem Haufen karierter Wolle.
Das war echt albern. Ich konnte seinen Ärger ja verstehen, trotzdem brauchte ich mich nicht so von ihm anranzen lassen.
»Vielleicht bist du einfach schon zu lang allein hier draußen«, murmelte ich. »Oder du hattest nie eine gute Kinderstube.«
Als er mich ansah, wusste ich, dass ich zu weit gegangen war.