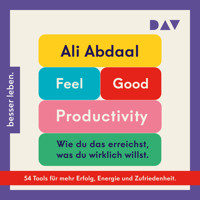10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Entscheide dich dafür, dein Leben zu genießen Die Feel-Good-Methode für ein unbeschwertes, glückliches Leben Du versinkst in Arbeit, trotzdem ist Prokrastination dein ständiger Begleiter? Du fühlst dich ausgelaugt und ohne Fokus? Du möchtest dein Stresslevel senken, mehr Zeit für Freunde und Familie haben und trotzdem erfolgreich sein? Dann wird Ali Abdaals Feel-Good-Methode dein Leben verändern. Der Experte für Produktivität zeigt eindrucksvoll und wissenschaftlich fundiert, dass der Erfolg sich vor allem dann einstellt, wenn wir uns gut fühlen und das Beste daran ist: Plötzlich haben wir mehr Zeit und Energie für die Dinge, die uns wirklich erfüllen, anstatt gehetzt ins Burnout zu rennen. Feel-Good-Produktivität ist eine einfache Methode, doch sie verändert alles. Sie zeigt: Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, müssen wir uns nicht darauf beschränken, uns mühsam an der Oberfläche zu halten. Wir können schwimmen lernen. - 54 praktische Strategien für ein erfülltes, glückliches Leben - Ali Abdaal enthüllt das Geheimnis der Produktivität "Ali ist ein Meister der Produktivität, ohne dabei sein Lebensglück zu opfern. Dies ist das Buch, auf das wir alle gewartet haben." Dr. Julia Smith, Bestseller-Autorin von "Aufstehen oder Liegenbleiben" "Alis Auffassung von Produktivität ist außergewöhnlich und lebensverändernd. Eine Pflichtlektüre, wenn man die Kraft der Produktivität vollkommen neu erleben möchte." Professor Will Macaskill, University of Oxford
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Ali Abdaal schafft es in »Feel-Good Productivity«, Produktivität in ein völlig neues Licht zu rücken. Abseits von Disziplin und harter Arbeit, gibt es Strategien, die unsere versteckten Energiereserven aktivieren und uns helfen diese Energie sinnvoll zu nutzen, ohne auszubrennen. Das Geheimnis ist eine simple Frage: Was muss ich verändern, um Spaß an meinen täglichen Aufgaben zu haben? Dazu gehören eine positive Grundeinstellung, ein gestärktes Selbstbewusstsein, aber auch erfüllende sozialen Beziehungen und die Erkenntnis, welche Werte uns antreiben. Nutzen wir dieses Wissen geschickt, wird ein positiver Kreislauf in Gang gesetzt: Wenn wir uns gut fühlen, erzeugen wir Energie, die unsere Produktivität steigert. Und diese Produktivität führt zu Erfolgserlebnissen, die uns wiederum ein gutes Gefühl geben.
Ali Abdaal
Feel-Good Productivity
Wie du das erreichst, was du wirklich willst
Aus dem Englischen von Annika Tschöpe
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Einleitung
Die erstaunlichen Geheimnisse der Feel-Good-Produktivität
Deshalb ist Feel-Good-Produktivität so wirkungsvoll
Das erwartet dich in diesem Buch
Teil Eins Energie schöpfen
Kapitel 1 Spiel
Für Abenteuer sorgen
Den Spaß entdecken
Das Risiko senken
Kurz zusammengefasst
Kapitel 2 Macht
Das Selbstvertrauen stärken
Kompetenzen weiterentwickeln
Verantwortung für deine Arbeit übernehmen
Kurz zusammengefasst
Kapitel 3 Menschen
Die richtige Szene finden
Das Helfer-High
Overcommunication
Kurz zusammengefasst
Teil Zwei Energieblockaden lösen
Kapitel 4 Klarheit schaffen
Der Nebel der Unsicherheit
Frage »Warum?«
Frage »Was?«
Frage »Wann?«
Kurz zusammengefasst
Kapitel 5 Mut finden
Kenne deine Angst
Ängste abbauen
Deine Angst überwinden
Kurz Zusammengefasst
Kapitel 6 Loslegen
Aufwand reduzieren
Aktiv werden
Unterstütze dich selbst
Kurz zusammengefasst
Teil Drei Energie erhalten
Kapitel 7 Bewahren
Überanstrengungs-Burnouts und wie sie sich vermeiden lassen
Weniger tun
Ablenkungen widerstehen
Mehr Pausen einlegen
Kurz zusammengefasst
Kapitel 8 Auftanken
Kreativ aufladen
In der Natur auftanken
Ziellos auftanken
Kurz zusammengefasst
Kapitel 9 Harmonie schaffen
Der langfristige Horizont
Der mittelfristige Horizont
Der kurzfristige Horizont
Kurz zusammengefasst
SchlusswortDenken wie ein Produktivitäts-Profi
Dank
Sachregister
Für Mimi und Nani – für eure Liebe, eure Unterstützung und eure Aufopferung.
Einleitung
»Frohe Weihnachten, Ali. Versuch bitte, niemanden umzubringen.«
Mit diesen Worten legte mein Oberarzt schnell auf und ließ mich mit einer voll belegten Station allein. Als frischgebackener Assistenzarzt hatte ich vor drei Wochen einen schweren Anfängerfehler gemacht: Ich hatte vergessen, über die Feiertage Urlaub zu beantragen. Jetzt musste ich am ersten Weihnachtstag ganz allein die gesamte Station betreuen.
Was übel angefangen hatte, wurde schnell noch schlimmer. Als ich in die Klinik kam, empfing mich eine Lawine an Krankengeschichten, Diagnoseberichten und kryptischen Untersuchungsanweisungen, die versierte Archäologen sicherlich leichter entschlüsselt hätten als unser Bereitschaftsradiologe. Schon nach wenigen Minuten gab es den ersten Notfall: Ein Mann Mitte fünfzig war mit einem plötzlichen Herzstillstand zusammengebrochen. Kurz darauf teilte mir eine Pflegekraft mit, dass jemand dringend eine manuelle Ausräumung brauchte (und wer das schon einmal machen musste, weiß, wie fürchterlich das ist …).
Um 10.30 Uhr bot sich auf der Station folgendes Bild: Pflegerin Janice raste mit Infusionen und Medikamentenblättern beladen panisch auf Flur A hin und her. Auf Flur B verlangte ein hartnäckiger älterer Patient lautstark nach seinem verlegten Gebiss. In Flur C war ein Betrunkener aus der Notaufnahme eingedrungen, der ziellos durch die Gegend lief und »Olive! Olive!« brüllte (bis heute weiß ich nicht, wer diese Olive war). Und im Minutentakt kamen neue Anliegen: »Dr. Ali, könnten Sie bei Mrs Johnson nach dem Fieber sehen?«, »Dr. Ali, was machen wir gegen Mr Singhs hohen Kaliumspiegel?«
Ich merkte, wie ich allmählich in Panik geriet. Auf so etwas hatte mich das Medizinstudium nicht vorbereitet. Als Student war ich immer ziemlich effizient gewesen. In schwierigen Phasen hatte ich eine simple Strategie: fleißiger arbeiten. Mit dieser Methode hatte ich sieben Jahre zuvor einen Studienplatz für Medizin ergattert, mit ihr war es mir gelungen, mehrere Artikel in akademischen Fachzeitschriften zu veröffentlichen, und so hatte ich es geschafft, parallel zum Studium eine Firma zu gründen. Disziplin war die einzige Produktivitätstechnik, die ich kannte. Und sie hatte immer funktioniert.
Jetzt jedoch funktionierte sie nicht mehr. Seit ich vor ein paar Monaten als Arzt angefangen hatte, drohte ich ständig in Arbeit zu ertrinken. Selbst wenn ich bis spät in die Nacht schuftete, konnte ich nicht so viele Leute behandeln oder so viele Formalitäten erledigen, wie nötig war. Darunter litt auch meine Laune. Die medizinische Ausbildung hatte mir Freude gemacht, aber die eigentliche Arbeit empfand ich als äußerst deprimierend. Dazu kam die ständige Angst, einen Fehler zu machen, der einen Menschen das Leben kosten könnte. Ich schlief nicht mehr, Freundschaften dünnten aus, meine Familie hörte kaum noch von mir. Und ich arbeitete mehr als je zuvor.
Und jetzt das. Am ersten Weihnachtstag, allein auf einer Krankenhausstation, wuchs mir alles über den Kopf.
Der Tiefpunkt war erreicht, als ich ein Tablett mit medizinischen Gerätschaften fallen ließ und die Spritzen in hohem Bogen auf dem Linoleumboden landeten. Als ich hilflos meinen feuchten Kittel betrachtete, wurde mir klar, dass sich etwas ändern musste – sonst würde mein Traum, Chirurg zu werden, niemals wahr werden.
An diesem Abend hängte ich das Stethoskop weg, nahm mir ein Mince Pie und klappte den Laptop auf. Früher war ich doch immer so produktiv, dachte ich. Hatte ich das verlernt? In meinem ersten Jahr an der medizinischen Fakultät hatte ich mich intensiv mit den Geheimnissen der Produktivität beschäftigt. Abend für Abend hatte ich mir Notizen zu Hunderten von Artikeln, Blogbeiträgen und Videos gemacht, die angeblich den Schlüssel zu optimaler Leistung lieferten. Sämtliche Gurus betonten, wie wichtig Fleiß sei. Immer wieder wurde Muhammad Ali zitiert: »Ich hasste jede Minute des Trainings, aber ich sagte mir: ›Gib nicht auf. Leide jetzt und sei den Rest deines Lebens ein Champion.‹«
Der zweite Weihnachtsfeiertag brach an, und ich saß noch immer über meinen alten Notizen und überlegte, ob dort mein Fehler liegen mochte. Musste ich meine alte Arbeitsmoral wieder aufleben lassen? Aber als ich am nächsten Tag mit dem festen Vorsatz zur Arbeit ging, einfach mehr zu leisten, änderte sich nichts. Obwohl ich bis Mitternacht auf der Station blieb – und obwohl ich mir in allen Pinkelpausen den Spruch von Muhammad Ali einbläute –, wurde ich mit dem Papierkram trotzdem nicht schneller fertig. Meine Patienten hatten es immer noch mit einem schlappen, ineffizienten Ali zu tun, und dass bei mir keine Weihnachtsstimmung aufkommen wollte, war immer noch allzu offensichtlich.
Als mein bislang härtester Tag endlich überstanden war, fühlte ich mich restlos ausgelaugt. Und dann fielen mir wie aus dem Nichts die weisen Worte meines ehemaligen Tutors Dr. Barclay ein: »Wenn die Behandlung nicht anschlägt, solltest du die Diagnose hinterfragen.«
Auf einmal regten sich erst sehr leise und bald darauf ganz entschiedene Zweifel an sämtlichen Produktivitätsratschlägen, die ich verinnerlicht hatte. War Leiden wirklich der einzige Weg zum Erfolg? Was war überhaupt »Erfolg«? War Leiden eigentlich nachhaltig? War es nicht unlogisch, dass man sich restlos überfordert fühlen musste, um etwas zu schaffen? Musste ich tatsächlich auf Gesundheit und Glück verzichten, um irgendetwas zu erreichen?
Es sollte noch ein paar Monate dauern, doch ich war auf den Weg zur Offenbarung gestoßen: Alles, was ich über Erfolg gehört hatte, war falsch. Hektische Betriebsamkeit würde mich nicht zu einem guten Arzt machen. Wenn ich noch mehr arbeitete, würde ich nicht glücklich werden. Vielmehr gab es einen anderen Weg zur Erfüllung, einen Weg, der nicht mit ständiger Angst, schlaflosen Nächten und einer besorgniserregenden Abhängigkeit von Koffein einherging.
Ich kannte nicht alle Antworten, im Gegenteil. Aber zum ersten Mal konnte ich einen alternativen Ansatz erahnen. Einen Ansatz, bei dem man nicht bis zum Umfallen arbeiten musste, sondern bei dem es darum ging, die Arbeit angenehmer zu gestalten. Einen Ansatz, bei dem mein eigenes Wohlbefinden im Vordergrund stand und dieses Wohlbefinden dazu diente, meine Konzentration und Motivation zu steigern. Einen Ansatz, den ich später als Feel-Good-Produktivität bezeichnen sollte.
Die erstaunlichen Geheimnisse der Feel-Good-Produktivität
Während meines Medizinstudiums hatte mich das Thema Produktivität so fasziniert, dass ich noch ein zusätzliches Studienjahr investierte, um einen Abschluss in Psychologie zu erwerben. Als ich dann die Feel-Good-Produktivität zusammenbastelte, fiel mir eine Studie ein, die in einer Prüfung vorgekommen war – und die mit einer Kerze, einem Streichholzheftchen und einer Schachtel Heftzwecken zu tun hatte.
Stell dir vor, du bekommst diese drei Dinge und dazu die Anweisung, die Kerze so an einer Korkplatte an der Wand zu befestigen, dass kein Wachs auf den Tisch tropft, wenn sie angezündet wird. Du rätselst herum und begutachtest die Gegenstände. Kommst du auf die Lösung?
Die meisten Leute denken bei dieser Aufgabe nur an die Kerze, die Streichhölzer und die Heftzwecken. Innovativere Geister erkennen jedoch, welche Möglichkeit die Heftzweckenschachtel bietet. Die optimale Lösung besteht darin, die Schachtel nicht nur als Behälter, sondern auch als Kerzenhalter zu sehen.
Dieses »Kerzenproblem« ist ein klassischer Test für kreatives Denken. Es wurde von Karl Duncker entwickelt, 1945 posthum veröffentlicht und seither in zahllosen Studien verwendet, um die verschiedensten Dinge zu testen, von kognitiver Flexibilität bis hin zu den psychologischen Auswirkungen von Stress. Ende der 1970er Jahre benutzte die Psychologin Alice Isen diese Aufgabe für ein einflussreiches Experiment, mit dem sie untersuchte, wie sich die Stimmung auf die Kreativität auswirkt.[1]
Isen teilte ihre Freiwilligen zunächst in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe bekam ein kleines Geschenk – einen Beutel Süßigkeiten –, ehe sie sich dem Kerzenproblem widmete, die andere Gruppe bearbeitete die Aufgabe ohne einen solchen Anreiz. Die Theorie lautete, dass die Personen, die Süßigkeiten bekommen hatten, in positiverer Stimmung an die Aufgabe herangehen würden. Isen machte eine interessante Beobachtung: Diejenigen, deren Stimmung sich durch das Geschenk leicht verbessert hatte, konnten das Kerzenproblem deutlich erfolgreicher lösen.
Als ich im Psychologiestudium erstmals von Isens Experiment las, fand ich es zwar interessant, aber nicht gerade weltbewegend. Ich persönlich hatte nie den starken Drang verspürt, eine Kerze an der Wand zu befestigen. Doch als ich mich nun als Assistenzarzt wieder damit befasste, erkannte ich die weitreichende Bedeutung von Isens Erkenntnis. Sie weist nämlich darauf hin, dass positive Stimmung nicht nur bedeutet, dass man sich gut fühlt, sondern auch unsere Denk- und Handlungsmuster beeinflusst.
Nun erfuhr ich, dass die Studie einen Grundpfeiler zahlreicher Forschungsarbeiten bildete, die den Einfluss positiver Emotionen auf verschiedene kognitive Prozesse des Menschen untersuchten. Dabei wurde festgestellt, dass wir bei positiver Stimmung meist ein breiteres Spektrum an Handlungsmöglichkeiten in Betracht ziehen, offener für neue Erfahrungen sind und Informationen besser aufnehmen können. Mit anderen Worten: Wenn wir uns gut fühlen, steigt unsere Kreativität – und unsere Produktivität.
Eine der Ersten, die erforschte, was genau dahintersteckt, war Barbara Fredrickson. Die Professorin von der University of North Carolina at Chapel Hill zählt zu den führenden Persönlichkeiten der positiven Psychologie, einem relativ neuen Zweig der Psychologie, der sich mit dem Glücklichsein befasst. Ende der 1990er Jahre beschrieb Fredrickson die sogenannte Broaden-and-Build-Theorie der positiven Emotionen.[2]
Nach dieser Theorie können positive Emotionen unser Bewusstsein »erweitern« (broaden) und unsere kognitiven und sozialen Ressourcen »aufbauen« (build). Das Erweitern bezieht sich dabei auf die unmittelbare Wirkung positiver Emotionen: Wenn wir uns gut fühlen, öffnet sich unser Geist, wir nehmen mehr Informationen auf und erkennen mehr Möglichkeiten in unserem Umfeld. Das zeigt das Kerzenproblem: Positiv gestimmte Testpersonen nehmen ein breiteres Spektrum an möglichen Lösungen wahr.
Build, also aufbauen, bezieht sich auf die langfristigen Auswirkungen positiver Emotionen. Wenn wir positive Gefühle verspüren, legen wir einen Vorrat an geistigen und emotionalen Ressourcen an, die uns in Zukunft helfen können – Ressourcen wie Resilienz, Kreativität, Problemlösungskompetenz, soziale Beziehungen und körperliche Gesundheit. Im Laufe der Zeit verstärken sich diese beiden Prozesse gegenseitig, sodass eine Aufwärtsspirale aus Positivität, Wachstum und Erfolg entsteht.
Positive Emotionen sind der Treibstoff für den Motor, der die Entfaltung des Menschen antreibt.
Diese Theorie eröffnet eine völlig neue Sicht auf die Rolle, die positive Emotionen in unserem Leben spielen. Sie sind nicht nur flüchtige Gefühle, die ohne jede Folge kommen und gehen, sondern ein wesentlicher Bestandteil unserer kognitiven Funktionen, unserer sozialen Beziehungen und unseres allgemeinen Wohlergehens. Positive Emotionen sind der Treibstoff für den Motor, der die Entfaltung des Menschen antreibt.
Deshalb ist Feel-Good-Produktivität so wirkungsvoll
Die Broaden-and-Build-Theorie brachte mich erstmals auf die Idee, dass auch eine andere Sicht auf das Leben möglich sein könnte. Jahrelang hatte ich geglaubt, dass ich das, was ich wollte, dadurch erreichen würde, dass ich mich einfach mehr anstrengte. Wenn ich ein guter Arzt werden wollte, würde mein Leben von harter, unerbittlicher Arbeit geprägt sein.
Jetzt jedoch erkannte ich einen anderen Weg. Nach Fredricksons Theorie ändern positive Emotionen die Abläufe in unserem Gehirn. Der erste Schritt besteht darin, dass wir uns besser fühlen. Im zweiten Schritt tun wir häufiger das, was uns wichtig ist.
Aber warum?, fragte ich mich. Je mehr ich las, desto deutlicher wurde mir, dass es unterschiedliche Erklärungen gibt und manches auch unklar bleibt. Wissenschaftliche Erkenntnisse liefern jedoch einige Antworten.
Zuallererst gilt, dass wir mehr Energie haben, wenn wir uns wohlfühlen. Vermutlich haben die meisten von uns schon einmal eine Energie erlebt, die keinen rein körperlichen oder biologischen Ursprung hatte und nicht durch Zucker oder Kohlenhydrate zustande kam, sondern durch eine Mischung aus Motivation, Konzentration und Inspiration. Das ist die Energie, die man spürt, wenn man mit einer besonders fesselnden Tätigkeit beschäftigt ist oder mit inspirierenden Menschen zu tun hat. Für diese Energie gibt es viele verschiedene Namen. In der Psychologie bezeichnet man sie als »emotionale«, »spirituelle«, »mentale« oder »motivierende« Energie, in der Neurowissenschaft spricht man von »Tatendrang«, »Vitalität« oder »energetischer Erregung«. Doch auch wenn sich die Forschung nicht auf einen Namen festlegen kann, so ist man sich doch einig, dass diese Energie dafür sorgt, dass wir uns konzentrieren, inspiriert sind und motiviert auf unsere Ziele hinarbeiten.
Wie also entsteht diese geheimnisvolle Energie? Die kurze Antwort lautet: durch gute Gefühle. Positive Emotionen sind mit insgesamt vier Hormonen verknüpft – Endorphine, Serotonin, Dopamin und Oxytocin –, die oft als »Wohlfühlhormone« bezeichnet werden.[3] Sie alle steigern unser Leistungsvermögen. Endorphine werden häufig bei körperlicher Aktivität, gegen Stress oder Schmerzen ausgeschüttet, steigern das Glücksgefühl und mindern Unbehagen – ein Mehr an Endorphinen bedeutet in der Regel mehr Energie und mehr Motivation. Serotonin wirkt sich auf Stimmungsregulierung, Schlaf, Appetit und das allgemeine Wohlbefinden aus; es sorgt dafür, dass wir zufriedener sind, und gibt uns die Energie, Aufgaben effizient zu erledigen. Dopamin, das sogenannte Belohnungshormon, hängt mit Motivation und Genuss zusammen, und wenn es ausgeschüttet wird, empfinden wir Befriedigung, sodass wir uns länger konzentrieren können. Und Oxytocin, das sogenannte Liebeshormon, ist bei sozialen Bindungen, Vertrauen und dem Aufbau von Beziehungen im Spiel; es trägt dazu bei, dass wir leichter Kontakt zu anderen aufnehmen, und verbessert unsere Stimmung, was sich wiederum auf die Produktivität auswirkt.
Damit setzen diese Wohlfühlhormone also einen positiven Kreislauf in Gang. Wenn wir uns gut fühlen, erzeugen wir Energie, die unsere Produktivität steigert. Und diese Produktivität führt zu Erfolgserlebnissen, die uns wiederum ein gutes Gefühl geben.
Zweitens reduzieren gute Gefühle unseren Stress. Neben der Broaden-and-Build-Theorie entwickelte Barbara Fredrickson auch die sogenannte Undoing-Hypothese. Gemeinsam mit Kollegen untersuchte sie Forschungen aus mehreren Jahrzenten, die ergaben, dass bei negativen Emotionen Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet werden.[4] Kurzfristig ist dies kein Problem, denn dieser Mechanismus bewirkt, dass wir bei Gefahren die Flucht ergreifen. Aber wenn diese negativen Empfindungen zu häufig auftreten, werden wir von Ängsten geplagt und unsere körperliche Gesundheit leidet. Die ständige Aktivierung dieser Hormone kann sogar das Risiko für Herzkrankheiten und Bluthochdruck erhöhen. Nicht gerade ideal.
Fredrickson fragte sich, ob auch das Gegenteil gilt: Wenn negative Emotionen so schädliche physiologische Auswirkungen haben, dann könnten positive Emotionen diese vielleicht ausgleichen. Wäre es möglich, das Nervensystem mit guten Gefühlen »zurückzusetzen« und zu erreichen, dass sich der Körper entspannt?
Um das herauszufinden, überlegte sich Fredrickson eine ziemlich fiese Studie. Eine Gruppe von Testpersonen bekam die Anweisung, sich eine Minute lang auf eine Rede vorzubereiten, die gefilmt und von anderen beurteilt werden würde. Fredrickson wusste, dass fast jeder Mensch Angst davor hat, sich öffentlich zu äußern, und rechnete deshalb damit, dass sich das Angst- und Stressniveau der Probanden erhöhen würde. So war es auch: Die Testpersonen waren nach eigenen Angaben nervös, Herzfrequenz und Blutdruck stiegen an. Nun ließ das Forschungsteam die Probanden nach dem Zufallsprinzip einen von vier Filmen anschauen – zwei weckten leicht positive, der dritte neutrale und der vierte traurige Gefühle. Anschließend wurde gemessen, wie lange die Testpersonen brauchten, um sich von dem Stress zu erholen.
Die Ergebnisse waren verblüffend. Bei denjenigen, die Filme mit positiven Emotionen gesehen hatten, erreichten Herzfrequenz und Blutdruck deutlich schneller wieder den Ausgangszustand, und nach einem traurigen Film dauerte das am längsten.
Das ist der Undoing-Effekt: Positive Emotionen können die Auswirkungen von Stress und anderen negativen Emotionen rückgängig machen (englisch undo). Wenn Stress das Problem ist, dann könnten gute Gefühle die Lösung sein.
Die dritte und vielleicht bedeutendste Wirkung der Feel-Good-Produktivität geht weit über eine einzelne Aufgabe oder ein Projekt hinaus: Denn das ganze Leben wird generell schöner, wenn man sich gut fühlt. Im Jahr 2005 wertete ein Psychologenteam sämtliche vorhandenen Studien zur komplexen Beziehung zwischen Glück und Erfolg aus – 225 veröffentlichte Arbeiten mit Daten von mehr als 275000 Personen.[5] Die Fragestellung lautete: Macht Erfolg, wie es so oft heißt, glücklich – oder ist es vielleicht umgekehrt?
Die Studie lieferte stichhaltige Beweise dafür, dass wir Glück oft falsch verstehen. Wer häufig positive Gefühle erlebt, ist nicht nur geselliger, optimistischer und kreativer, sondern auch leistungsfähiger. Diese Menschen verbreiten in ihrem Umfeld ansteckende Energie, haben häufiger erfüllende Beziehungen, verdienen mehr Geld und leisten im Beruf Großes. Wer bei der Arbeit positive Gefühle pflegt, kann Probleme besser lösen, besser planen, besser kreativ denken und ist belastbarer und aktiver. Diese Leute empfinden weniger Stress, werden von ihren Vorgesetzten besser beurteilt und zeigen ein höheres Maß an Loyalität gegenüber ihrer Firma.
Gute Gefühle entstehen nicht durch Erfolg. Erfolg entsteht, wenn man sich gut fühlt.
Einfach ausgedrückt: Gute Gefühle entstehen nicht durch Erfolg. Erfolg entsteht, wenn man sich gut fühlt.
Das erwartet dich in diesem Buch
Damals, in meinem ersten haarsträubenden Jahr als Arzt, waren die meisten dieser Erkenntnisse für mich noch Lichtjahre entfernt. Ich schob endlose Schichten und versuchte, meine Forschungen zum Thema Produktivität irgendwie in die knappen Pausen zwischen den Patientenbesuchen zu quetschen.
Aber schon durch die simplen Schlüsse, die ich dabei zog, änderte sich meine Beziehung zur Arbeit drastisch. Je besser es mir gelang, meine Disziplinversessenheit abzustellen und mich stattdessen auf das zu konzentrieren, was meine Arbeit angenehm machte, desto leichter fielen mir die schlimmen Schichten. Bald besserte sich auch meine Laune. Ich erinnere mich noch an einen Termin mit einer älteren Patientin, mit der ich sprach, als ich mich schon ein paar Monate mit der Feel-Good-Produktivität befasst hatte. »Wissen Sie, Herr Doktor«, sagte sie, »Sie sind seit einer Woche der erste Mensch, den ich hier lächeln sehe.«
Diese neue Perspektive sollte nicht nur meine Herangehensweise an den Arztberuf verändern, sondern mein gesamtes Leben. Zum ersten Mal seit Jahren sah ich Möglichkeiten, die über meine Arbeit hinausgingen: meinen Freundeskreis, meine Familie und die anderen Interessen, die ich bisher vernachlässigt hatte. Und schon bald merkte ich, dass ich meine Entdeckung mit anderen teilen wollte. Ich hatte bereits seit ein paar Jahren einen YouTube-Kanal, auf dem ich Lerntipps und Bewertungen zu technischen Geräten veröffentlichte. Jetzt fing ich an, dort praktische Erkenntnisse aus Psychologie und Neurowissenschaften zu teilen. Dabei war ich mein eigenes Versuchskaninchen und experimentierte mit dem, was ich gelernt hatte, sowie den Strategien, die meiner Ansicht nach funktionieren könnten.
Mein radikaler Gedanke, dass Erfolg nicht mit Leiden verbunden sein muss, fand allmählich Anklang, und ich erhielt immer mehr E-Mails von meinem Publikum. Schüler meisterten ihre Prüfungen mit Bravour, Firmen verdoppelten ihr Einkommen, Eltern gelang es, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen – und all das mit den Strategien, die ich ihnen vermittelte. Sogar alte Hasen, die der lange, harte Berufsalltag geradezu ausgelaugt hatte, entdeckten neue Energie, Motivation und neue Ziele.
Mir selbst ging es genauso. Je mehr ich las, desto weiter entwickelte sich meine Philosophie. Schließlich kam ich mit diesen Prinzipien und Strategien zu dem Schluss, dass ich die Medizin auf Eis legen wollte, um etwas Neues zu machen.
So entstand der Wunsch, dieses Buch zu schreiben. Was auf diesen Seiten steht, ist kein Produktivitätssystem wie viele andere, das dir helfen soll, um jeden Preis mehr zu leisten. Es geht darum, häufiger das zu tun, was dir wichtig ist. Du wirst mehr über dich erfahren, darüber, was du liebst und was dich wirklich motiviert.
Meine Methode besteht aus drei Teilen, die jeweils einen anderen Aspekt der Feel-Good-Produktivität behandeln. Teil Eins erklärt, wie du die Wissenschaft der Feel-Good-Produktivität nutzen kannst, um dich mit Energie zu versorgen. Er stellt die drei »Energiequellen« vor, die die Grundlage für positive Gefühle bilden – Spiel, Macht und Menschen –, und erklärt, wie du diese in deinen Alltag einbauen kannst.
In Teil Zwei geht es darum, wie wir mit Feel-Good-Produktivität die Prokrastination besiegen können. Du erfährst mehr über die drei Ursachen von Blockaden, die bewirken, dass es uns schlecht geht – Unsicherheit, Angst und Trägheit –, und auch, wie man sie überwindet. Wenn du diese Blockaden löst, nimmt nicht nur die Prokrastination ein Ende, sondern du wirst dich auch besser fühlen.
In Teil Drei schließlich werden wir erkunden, wie uns die Feel-Good-Produktivität langfristig Kraft geben kann. Wir werden uns mit den drei Arten des Burnout befassen – Überanstrengungs-Burnout, Erschöpfungs-Burnout und Disharmonie-Burnout. Und wir erklären, wie wir mit drei einfachen Strategien – bewahren, auftanken und Harmonie schaffen – erreichen, dass wir uns gut fühlen, und zwar nicht nur für ein paar Tage und Wochen, sondern über Monate und Jahre.
Jedes Kapitel enthält eine ganze Reihe an praktischen Tipps, aber dieses Buch ist nicht als umfassende To-do-Liste gedacht. Es geht mir darum, dir eine Philosophie zu vermitteln: eine neue Sicht auf Produktivität, die du auf deine ganz eigene Art und Weise auf dein Leben anwenden kannst. Ich habe die Hoffnung, dass dieses Buch dich dazu bewegt, dich näher mit Produktivität zu befassen: dass du einige Methoden entdeckst, die funktionieren, andere über Bord wirfst und letztendlich ermittelst, was dir dabei hilft, dich gut zu fühlen und mehr zu erreichen. Deshalb findest du in jedem Kapitel nicht nur drei einfache, wissenschaftlich fundierte Ideen, die Produktivität in ein neues Licht rücken, sondern auch sechs »Experimente«, die du selbst ausprobieren kannst. Wenn ein Experiment bei dir funktioniert, ist das toll – wenn nicht, ist auch das eine wertvolle Erkenntnis. Insgesamt sollte dir dieses Buch jedoch genug Werkzeuge an die Hand geben, um die Feel-Good-Produktivität auf deine Arbeit, deine Beziehungen und dein Leben anwenden zu können.
Ich hoffe, das wird dir genauso gut helfen, wie es mir geholfen hat. Denn wenn ich bei meiner Beschäftigung mit diesem Thema eines gelernt habe, dann ist es, dass sich die Feel-Good-Produktivität in allen Bereichen umsetzen lässt. Sie macht aus beängstigenden Aufgaben spannende Herausforderungen. Sie lässt innigere Verbindungen zu Gleichgesinnten entstehen. Sie sorgt bei allem, was du tust, für bedeutungsvolle Interaktionen, jeden Tag.
Wenn du weißt, wie du erreichst, dass du dich gut fühlst, und dieses Wissen anwendest, wird sich nicht nur deine Arbeit verändern, sondern dein ganzes Leben.
Feel-Good-Produktivität ist eine einfache Methode, doch sie verändert alles. Sie zeigt: Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, müssen wir uns nicht darauf beschränken, uns mühsam an der Oberfläche zu halten. Wir können schwimmen lernen.
Legen wir los.
Teil Eins Energie schöpfen
Kapitel 1Spiel
Von außen betrachtet wirkte die Karriere von Professor Richard Feynman geradezu perfekt. Mit nur 27 Jahren galt er bereits als einer der größten Physiker seiner Generation – man ging davon aus, dass er herausfinden würde, wie sich das Potenzial der Kernenergie optimal nutzen ließ. Gerade hatte er eine Stelle an der renommierten Cornell University im Bundesstaat New York angetreten, als einer der jüngsten Professoren überhaupt.[6]
Doch es gab ein Problem. Die Physik langweilte ihn.
Wenn er sich mit einem Thema befassen wollte, empfand er einfach nur Müdigkeit. Alles hatte damit angefangen, dass Feynmans Frau Arline im Juni 1945 an Tuberkulose starb, wenige Monate, ehe der Zweite Weltkrieg für die USA zu Ende ging. Mit ihrem Tod erstarb alle Musik im Leben des jungen Professors. Die Ideen, die ihn als Doktoranden so begeistert hatten, erschienen ihm nun stumpf und fade. Obwohl er gut unterrichten konnte, war ihm das langweilig und lästig. »Ich war einfach ausgebrannt«, erinnerte er sich später.
»Oft ging ich in die Bibliothek und las in Tausendundeine Nacht. Aber wenn es dann Zeit war, mich mit Forschungsarbeit zu befassen, konnte ich mich dazu nicht aufraffen. Es interessierte mich nicht.«
Feynman stellte fest, dass das Nichtstun ziemlich einfach war. Es machte ihm immer noch Freude, in der Bibliothek zu lesen und über den Campus zu schlendern. Nur die Arbeit mochte er nicht. Und so kam es, dass Feynman sich Ende der 1940er Jahre ohne größere Probleme mit seiner neuen Identität abgefunden hatte: ein Physikprofessor, der sich nicht mit Physik beschäftigte.
Doch eines Tages sollte sich das ändern. Feynman pflegte schon einige Jahre sein neues Dasein, als er in der Mensa der Universität zufällig einer Gruppe von Studenten gegenübersaß. Einer von ihnen warf immer wieder einen Teller in die Luft. Feynman bemerkte etwas Merkwürdiges: Der Teller eierte, während er durch die Luft flog, aber das Universitäts-Logo, das darauf prangte, schien schneller zu eiern als der Teller selbst.
Seltsam, dachte Feynman. Aber nicht gerade nobelpreisverdächtig. Er, der einst mit anderen den Code für die Kernspaltung geknackt hatte, sollte sich nicht den Kopf über fliegendes Geschirr zerbrechen. Doch dieser Moment der Neugier bewirkte eine kleine Offenbarung. Feynman überlegte, wie er überhaupt zu seinem Fachgebiet gekommen war. »Früher hatte mir die Physik Spaß gemacht«, erinnerte er sich später.
»Und warum hat sie mir Spaß gemacht? Ich hatte damit gespielt. Ich habe gemacht, wozu ich Lust hatte – mir ging es nicht darum, ob es die Entwicklung der Kernphysik voranbrachte, sondern ob ich es interessant und unterhaltsam fand, damit zu spielen.«
Nachdem er die Mensa verlassen hatte, dachte er daran zurück, wie er die Welt als Teenager gesehen hatte.
In der Highschool hatten andere das, was ihn an der Welt am meisten faszinierte, oft langweilig gefunden. So hatte er beispielsweise bemerkt, dass der Wasserfluss immer schmaler wird, je weiter er sich vom Wasserhahn entfernt, und überlegt, was diesen Verlauf bestimmen mochte. »Ich hätte mich nicht damit beschäftigen müssen, für die Zukunft der Wissenschaft spielte es keine Rolle; jemand anders hatte es bereits herausgefunden«, sagte Feynman. »Aber das war mir egal: Ich erfand Dinge und spielte mit Dingen, weil ich Freude daran hatte.«
Konnte es sein, dass er wieder Freude an der Physik finden würde, wenn er diese Sicht auf die Welt zurückgewann? Wenn er die Physik nicht als Beruf, sondern als Spiel betrachtete, mit dem er sich zum Spaß beschäftigte? »Das wird meine neue Einstellung«, nahm er sich vor. »So wie ich zum Spaß Tausendundeine Nacht lese, werde ich mit der Physik spielen, wann immer ich Lust dazu habe, ohne mir Gedanken über die Bedeutung zu machen.«
Mit dem eiernden Teller fing es an. In der Folgezeit widmete Feynman mehrere Wochen der Modellierung von Gleichungen, die erklärten, wie sich der Teller durch die Luft bewegte. Seine Kollegen erkundigten sich verwundert, wozu das gut sein sollte. »Es ist überhaupt nicht wichtig«, erwiderte Feynman vergnügt. »Ich mache das nur aus Spaß an der Sache.«
Aber je mehr Feynman sich mit den rotierenden Tellern beschäftigte, desto mehr faszinierten sie ihn. Bald überlegte er, ob sich ein Teller in der Luft möglicherweise genauso bewegte wie die Elektronen in einem Atom. Oder ob die Bewegung vielleicht der Funktionsweise der Quantenelektrodynamik entsprach. »Ehe ich mich’s versah (es dauerte nicht sehr lange), ›spielte‹ – beziehungsweise arbeitete – ich mit genau dem Thema, das ich immer so geliebt hatte.« Mit dem Unterschied, dass ihn die »Arbeit« an der Physik jetzt nicht ausbrannte.
Das Interesse für die wirbelnden Teller sollte Professor Feynman letztendlich den Nobelpreis für Physik einbringen. Sein Modell für die eiernde Bewegung hatte Anteil an der Entschlüsselung der Quantenelektrodynamik, die beschreibt, wie Licht und winzige Teilchen auf Quantenebene interagieren. Das lässt sich veranschaulichen, so Feynman, wenn man sich rotierende Teller vorstellt.
Feynman ist nicht der Einzige, dem es so erging. Meines Wissens führen mindestens sechs Nobelpreisträger und -trägerinnen ihren Erfolg auf das Spielen zurück. James Watson und Francis Crick, die in den 1950er Jahren den Aufbau der DNA entschlüsselten[7], erklärten, dass sie dazu »eine Reihe von Molekülmodellen konstruierten, mit denen wir dann spielten«. Alexander Fleming, der Entdecker des Antibiotikums Penicillin, bezeichnete seine Arbeit einmal als »Spiel mit Mikroben«.[8] Donna Strickland, die 2018 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde, beschrieb ihren Beruf als »Spiel mit Hochleistungslasern«, und Konstantin Novoselov, der für seinen Beitrag zur Entdeckung des Materials Graphen 2010 den Nobelpreis für Physik erhielt, brachte es ganz schlicht auf den Punkt: »Wenn man versucht, den Nobelpreis zu gewinnen, wird man es nicht schaffen«, meinte er. »Wir sind wirklich ziemlich spielerisch vorgegangen.«[9]
Dieser Ansatz wird durch eine wachsende Anzahl an Forschungsarbeiten gestützt. In der Psychologie setzt sich immer mehr die Ansicht durch, dass Spielen der Schlüssel zu echter Produktivität ist, zum Teil deshalb, weil es für psychologische Entlastung sorgt. Eine neuere Studie formuliert das so: »In psychologischer Hinsicht dient das Spiel dazu, körperlich und geistig erschöpften Menschen durch eine Aktivität, die Spaß macht und entspannt, Erholung zu verschaffen.«[10]
Das Leben ist stressig. Spielen macht es angenehmer.
Spielen ist unsere erste Energiequelle. Das Leben ist stressig. Spielen macht es angenehmer. Wenn es uns gelingt, den Geist des Spielens in unser Leben einzubauen, werden wir uns besser fühlen – und auch mehr schaffen.
Für Abenteuer sorgen
Es ist gar nicht so leicht, das Leben spielerischer zu gestalten, könntest du einwenden. Für viele Erwachsene ist Spielen nicht mehr selbstverständlich.
Im Kindesalter steckt jeder Tag voller Abenteuer. Wir erkunden jeden Zentimeter des Gartens, wir rasen durch Einkaufszentren, klettern auf Bäume und schaukeln an Ästen. Wir arbeiten nicht auf Ziele hin und sind auch nicht bemüht, unseren Lebenslauf zu optimieren. Wir lassen uns von Neugier leiten und genießen, was wir tun, ohne uns um Ergebnisse zu scheren.
Doch je älter wir werden, desto mehr wird uns diese Abenteuerlust ausgetrieben. Deine Eltern haben dir vermutlich vermittelt, dass der erste große Schritt zum Erwachsenwerden darin besteht, dass man nicht mehr spielt, sondern das Leben ernst nimmt – es sei denn, sie waren außerordentlich progressiv. Irgendwann ist das Leben dann nicht mehr voller Abenteuer, sondern öder, vorhersehbarer Alltagstrott.
Das ist ein Fehler, denn das Abenteuer ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels – und vielleicht auch des Glücks.
Im Jahr 2020 wollte ein Forschungsteam der New York University und der University of Miami mit einem Experiment ermitteln, welche Auswirkungen eine abenteuerlustige Einstellung zum Leben hat.[11] Dazu wurden über 130 Testpersonen rekrutiert, die bereit waren, ihren Standort mit dem GPS ihrer Handys nachverfolgen zu lassen. Im Laufe der nächsten Monate erkundigte sich das Forschungsteam per Textnachricht nach den Gefühlen der Testpersonen: Wie glücklich, aufgeregt oder entspannt waren sie?
Die Ergebnisse waren äußerst aufschlussreich. Aus den GPS-Daten und den Antworten auf die Textnachrichten ließ sich ermitteln, dass diejenigen, die mehr abenteuerliche Erfahrungen gemacht hatten – die zum Beispiel mehr unterschiedliche Orte aufsuchten, eine andere Route zur Arbeit nahmen oder statt des Stammcafés ein neues Lokal ausprobierten –, glücklicher, angeregter und entspannter waren. Die Schlussfolgerung: Ein abenteuerliches Leben ist der Schlüssel zu positiven Gefühlen.
Das Potenzial des Spiels können wir also nutzen, indem wir unser Leben abenteuerlicher gestalten. Aber wie? Nun, mit den richtigen Hilfsmitteln lässt sich immer noch die Begeisterung wecken, die wir einst verspürten, wenn wir durch Einkaufszentren sausten und an Ästen schaukelten. Schritt Nummer eins: Such dir einen Charakter aus.
EXPERIMENT 1:Einen Charakter aussuchen
Ich muss gestehen, ich war einst süchtig nach World of Warcraft.
Dieses Online-Rollenspiel, kurz WoW, ist bekannt dafür, dass es absolute Nerds anspricht. Zu Beginn wählt man einen Charakter – das kann ein Hexenmeister sein, ein Krieger, ein Paladin oder vieles andere mehr – und erkundet dann die Fantasiewelt Azeroth. Man tut sich mit anderen Spielern zusammen, um durch die Welt zu fliegen, Dämonen zu töten, die eigenen Waffen zu verbessern und eine Menge Spaß zu haben.
Allerdings ist das Spiel auch für seinen hohen Suchtfaktor bekannt. Ich entdeckte es mit 14 und brachte in den drei darauffolgenden Jahren zusammengerechnet 184 Tage damit zu. 4416 Stunden. Drei Stunden pro Tag, also 25 Prozent meiner wachen Zeit. Eine ganze Menge.
Warum war ich so süchtig nach World of Warcraft? Für einen 14-Jährigen gibt es nichts Aufregenderes, als Monster zu töten und auf Quests zu gehen (eigentlich klingt das auch jetzt noch ziemlich verlockend). Diese einfache Tatsache erklärt zwar, warum die ersten paar Stunden des Spiels Spaß machen, doch die nächsten paar 1000 erklärt sie eher nicht. Um ehrlich zu sein, ist die Spielmechanik nach einer Weile gar nicht mehr so unterhaltsam. Man kann sich nicht unbegrenzt dafür begeistern, Missionen zu erledigen oder die Katze einer Dorfbewohnerin zu retten.
Meiner Vermutung nach ist es weniger der grundlegende Mechanismus, der WoW so attraktiv macht, sondern der Eskapismus. WoW bietet eine lebendige, alternative Welt, in der man mit einem Zauberspruch eine Armee von Zombies vernichten oder einen Drachen zähmen und auf seinem Rücken durch die Gegend fliegen kann. Und was noch wichtiger ist: In dieser Welt nimmt man einen anderen Charakter an. In WoW war ich nie Ali Abdaal, der etwas streberhafte, ziemlich schüchterne und leider vollkommen unsportliche Schuljunge, sondern immer Sepharoth, der große, gut aussehende Blutelfen-Zauberer in wallenden violetten Gewändern, der eine Armee von Dämonen befehligte.
Spielen gibt uns die Möglichkeit, in verschiedene Rollen oder Persönlichkeiten zu schlüpfen, ob wir nun einen Charakter in WoW verkörpern oder mit Freunden auf dem Spielplatz etwas nachspielen. Mit diesen Rollen können wir verschiedene Facetten unseres Selbst ausdrücken und unsere Erfahrungen in etwas verwandeln, das mehr Freude bereitet. Wenn man in eine andere Rolle schlüpft, erlebt man Abenteuer.
Das ist gar nicht so abwegig, wie es klingen mag. Mit »Charakter aussuchen« ist nicht gemeint, dass du über Nacht deine Persönlichkeit änderst (und auch nicht, dass du dich im Büro als Goblin ausgibst). Vielmehr geht es darum, dass du herausfindest, welche Art von Spiel am besten zu dir passt, und einen Spielertypus auswählst, den du verkörpern willst.
Dr. Stuart Brown hat den Großteil seiner Karriere der Psychologie des Spiels gewidmet.[12] Der klinische Psychologe befasste sich genauer mit den Vorzügen des Spiels, nachdem er beobachtet hatte, welche transformative Wirkung es auf seine Patienten hatte. Später gründete er das National Institute for Play und wurde klinischer Professor für Psychiatrie an der University of California in San Diego. Damals sprach er mit über 5000 Menschen aus allen Lebensbereichen – von Kunstschaffenden über Lkw-Fahrer bis hin zu Nobelpreisträgern – über die Bedeutung, die das Spiel für sie hat.
Bei diesen Gesprächen stellte sich heraus, dass uns meist nur ein oder zwei bestimmte Spielcharaktere ansprechen. Wenn wir wissen, was uns am meisten liegt, können wir eine »Spielpersönlichkeit« annehmen, die unseren Sinn für Abenteuer weckt.[13] Im Rahmen seiner Forschung ermittelte Dr. Brown die folgenden acht Spielschwerpunkte.
Sammeln bedeutet, dass man gerne Dinge zusammenträgt und organisiert, zum Beispiel seltene Pflanzen sucht und in Archiven oder auf Flohmärkten herumstöbert.
Wettkampf bedeutet, dass man Spiele und Sport liebt und Freude daran hat, sich anzustrengen und zu gewinnen.
Entdecken heißt, dass man gerne herumstreift, um neue Orte und unbekannte Dinge zu erkunden, sei es bei einer Wanderung, auf Reisen oder bei anderen Abenteuern.
Erschaffen bedeutet, dass man gerne etwas herstellt und viele Stunden mit Zeichnen, Malen, Musizieren, Gartenarbeit und ähnlichen Dingen verbringen kann.
Erzählen heißt, dass man eine lebhafte Fantasie hat und diese nutzt, um andere zu unterhalten. Wer gerne erzählt, mag Aktivitäten wie Schreiben, Tanzen, Theater und Rollenspiele.
Humor bedeutet, dass man gerne andere zum Lachen bringt, sich vielleicht bei Stand-up-Auftritten oder im Impro-Theater auslebt oder anderen mit lustigen Streichen ein Schmunzeln entlockt.
Regie führen heißt, dass man gerne plant, organisiert und andere anleitet. Das ist in vielen unterschiedlichen Rollen und Tätigkeiten möglich, von der Regie bei Bühnenaufführungen über die Leitung eines Unternehmens bis hin zu politischer Arbeit oder sozialem Engagement.
Bewegung bedeutet, dass man körperliche Aktivitäten wie Akrobatik, Gymnastik und Freerunning liebt.
Wenn du die Arbeit – und das Leben – mit einem Sinn für spielerisches Abenteuer angehen willst, liegt hier der erste Schritt. Überlege dir, welcher dieser Schwerpunkte am besten zu dir passt, und versuche dann, diesen Schwerpunkt auf deine Arbeit zu übertragen. »Erzählen« könnte beispielsweise bedeuten, dass du eine langweilige Aufgabe (du musst eine trockene, organisatorische E-Mail verfassen) so veränderst, dass sie deinen Sinn fürs Spielerische anspricht (etwa, indem du sie als Geschichte mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Schluss gestaltest und vielleicht noch eine unerwartete Wendung hinzufügst). Wenn dich »Erschaffen« anspricht, könntest du eine banale Tätigkeit (du musst eine langweilige Tabelle ausfüllen) als Möglichkeit zum kreativen Ausdruck nutzen (und eine optisch ansprechende, leicht verständliche Infografik erstellen).
Indem wir unsere Spielpersönlichkeiten ermitteln und erkunden, können wir etwas von dem Abenteuerdrang zurückgewinnen, der unsere Kindheit geprägt hat – eine Zeit, in der es der Normalfall und nicht die Ausnahme war, dass wir uns gut fühlten. Dieser Geist steckt immer noch in uns. Auch Stuart Brown sagt: »Dass wir uns daran erinnern, worum es beim Spielen geht, und dass wir es zum Teil des Alltags machen, sind vermutlich die wichtigsten Faktoren für ein erfülltes Leben.«
EXPERIMENT 2:Neugier nutzen
Was bedeutet eigentlich »Dinosaurier«?
Welcher Beatles-Song hielt sich am längsten in den US-Single-Charts?
Wer war Präsident der Vereinigten Staaten, als Uncle Sam erstmals einen Bart bekam?
Diese Fragen stammen nicht aus einem besonders kniffligen Fernsehquiz, sondern sind drei von insgesamt 19, die ein Forschungsteam am Davis Center for Neuroscience der University of California in einem bahnbrechenden Experiment verwendete.[14]24 Freiwillige bekamen diese Fragen und sollten dann angeben, wie neugierig sie auf die jeweilige Antwort waren, von »wenig neugierig« bis »sehr neugierig«. Dann ließ man die Testpersonen eine Weile über den Fragen brüten. (Die richtigen Lösungen lauten übrigens »gefährliche Echse«, »Hey Jude« und »Abraham Lincoln«.)
So wollte man herausfinden, ob sich die Neugier auf das menschliche Gedächtnis auswirkt. Zum einen vermutete das Forschungsteam, dass sich Menschen Einzelheiten besser merken können, wenn sie darauf neugierig sind. Und so war es auch, denn die Studie ergab, dass sich die Testpersonen an Fakten, die sie interessant fanden, stolze 30 Prozent besser erinnerten als an Fakten, die sie langweilten.
Noch überraschender war aber vielleicht, was in den Gehirnen vor sich ging, wenn sich die Probanden an diese Fakten erinnerten. Ein Hirnscan ergab, dass die neurologische Aktivität bei Fragen, die Neugier weckten, ganz anders ausfiel: Offenbar gab es einen Dopaminschub. Dopamin zählt zu unseren Wohlfühlhormonen und aktiviert auch den Teil des Gehirns, der für das Lernen und die Entstehung von Erinnerungen zuständig ist. Die Testpersonen fühlten sich also gut, wenn sie ihrer Neugier nachgaben – und konnten sich damit Informationen besser merken.
Die zweite Methode, um Abenteuer in dein Leben zu bringen, besteht deshalb darin, dass du dir deine Neugier zunutze machst. Neugier macht nicht nur das Leben schöner, sondern trägt auch dazu bei, dass wir uns länger konzentrieren. Der Schriftsteller Walter Isaacson kam nach einer ausführlichen Analyse der Biografien einiger bedeutender Pioniere der Geschichte, von Leonardo da Vinci bis Steve Jobs, zu dem Schluss: »Wenn man in jeder Hinsicht neugierig ist, wird man nicht nur kreativer. Es bereichert das Leben.«[15]
Neugier macht nicht nur das Leben schöner, sondern trägt auch dazu bei, dass wir uns länger konzentrieren.
Wie also können wir einen Sinn für Neugier in unser Leben einbauen? Eine Methode wäre, dass wir nach dem Ausschau halten, was ich als »Nebenquest« bezeichne. In Videospielen wie Zelda, The Witcher und Elden Ring gibt es Dutzende von Nebenquests, denen man sich widmen kann. Diese Nebenquests haben keinen Einfluss auf die Haupthandlung des Spiels, sondern ergeben sich, wenn man neugierig ist: Was passiert, wenn ich diese Höhle betrete, wenn ich versuche, den höchsten Punkt in dieser Region zu erklimmen, oder wenn ich tief in diesen See eintauche? Oft sind die besten Geheimnisse des Spiels in Höhlen, Wäldern und Dörfern versteckt, auf die man nicht stößt, wenn man sich auf die Haupthandlung beschränkt.
Ich stelle mir oft vor, dass mein Leben eine Reihe von Nebenquests enthält. Wenn ich mich morgens an meinen Arbeitsplatz setze, schaue ich immer in den Kalender und auf meine To-do-Liste und frage mich: »Was wird heute die Nebenquest?« Diese Frage hilft mir, neben den offensichtlichen Aufgaben, die ich zu erledigen habe, auch mögliche Alternativrouten zu erkennen. Das könnte dazu führen, dass ich statt im Büro ein paar Stunden in einem Café in der Nähe arbeite. Oder ich finde den Mut, eine neue Software auszuprobieren, die mir bei dem Problem helfen könnte, an dem ich gerade arbeite.
Wenn du deinen Tag um eine Nebenquest bereicherst, schaffst du Raum für Neugier, Erkundung und eine spielerische Einstellung – und vielleicht entdeckst du auf diese Weise etwas Erstaunliches und völlig Unerwartetes.
Den Spaß entdecken
Es war ein sternenklarer Abend Ende der 1990er Jahre an einer kleinen Universität in Ohio. Ein junger Forschungsassistent stand mit einer Ratte in der Hand im Labor. Mit einem trockenen Pinsel strich er dem Tier vorsichtig über den weißen Bauch und hoffte, dass etwas Interessantes passieren würde.
Erst war nichts zu hören, doch dann stieß die Ratte plötzlich einen Schrei aus. Allerdings klang der nicht verzweifelt – die Ratte schien zu lachen.
In diesem Labor wurden die Ratten nicht nur zum Spaß gekitzelt, sondern man erforschte, welche biologischen Folgen das Spiel für das menschliche Gehirn hat – der wissenschaftliche Leiter Jaak Panksepp bezeichnete das als »Biologie der Freude«.[16] Damals herrschte in der Wissenschaft die Überzeugung, dass nur Menschen Gefühle empfinden. Man ging davon aus, dass Emotionen von einem hochkomplexen Teil des Gehirns ausgehen, den nur wir haben: die Großhirnrinde. Doch als Panksepp entdeckte, dass Nagetiere lachen können, drängte sich eine andere Ansicht auf, nämlich dass Emotionen aus viel primitiveren Bereichen des Gehirns wie Amygdala und Hypothalamus stammen müssen. Freude, so zeigte Panksepp, ist eine grundlegende Urerfahrung.
Zu Panksepps wichtigsten Erkenntnissen gehörte, dass Ratten gerne spielen. Ein Großteil seines Experiments bestand darin, dass er die Geräusche aufzeichnete, die die Ratten beim Spielen machten. Diese klangen fröhlich, wie er später sagte: »Es hörte sich an wie auf einem Spielplatz«. Und warum? Spielen setzt Dopamin frei. Die Ratten fühlten sich gut.
Von diesen Nagern können wir das eine oder andere lernen. Panksepps Ratten haben gezeigt, dass wir, wenn wir an unserem Tun Freude haben wollen, nicht nur die höheren und komplizierteren Teile des Gehirns brauchen, also die mit der Großhirnrinde verbundenen. Auch ältere, primitivere Teile unserer Neurologie sind involviert – nämlich die Wohlfühlhormone, die bei den Ratten aktiviert wurden. Wir können für kleine Dopaminschübe sorgen, die uns glücklich machen und bei der Stange halten.
Aber wie? Die Antwort findet man, wenn man untersucht, wann genau Dopamin ausgeschüttet wird. In einem von der Harvard Medical School publizierten Artikel heißt es, das Hormon werde durch »Sex, Shopping [und] den Duft von Keksen im Backofen«[17] aktiviert – also durch Dinge, die uns Freude machen.
Wenn wir die revolutionäre Wirkung des Spiels für unsere Zwecke nutzen wollen, besteht der zweite Schritt demnach darin, nach Freude zu suchen, wo wir gehen und stehen. Den Anfang macht dabei ein Besuch in einer Disney-Version des edwardianischen London.
EXPERIMENT 3:Das magische Post-it
In einer besonders anstrengenden Phase meiner Tätigkeit als Assistenzarzt schaute ich eines Abends mit meiner Mitbewohnerin Molly einen Filmklassiker, den wir beide als Kinder sehr geliebt hatten: Mary Poppins. Die Fantasiewelt mit animierten Vögeln, extrem schlechtem Cockney-Akzent und Musicalhits über Suffragetten würde uns, so hofften wir zumindest, ein paar Stunden Ablenkung verschaffen.
Damals fiel es mir schwer, die nötige Motivation aufzubringen, um für meine Medizinprüfungen zu lernen. Die bevorstehenden Fristen und der komplexe Stoff, den ich neben meiner Arbeit im Krankenhaus zu bewältigen hatte, wirkten wie unüberwindliche Hindernisse. Es war für mich der reinste Albtraum, mich nach der täglichen Schicht in die Lehrbücher zu vertiefen.
Aber als ich dann noch einmal Mary Poppins sah, geschah etwas Unerwartetes. Der Film war nicht nur eine heitere Geschichte über ein schrulliges Kindermädchen mit magischen Kräften, sondern barg eine tiefe Wahrheit. Zu den berühmtesten Liedern im Film gehört »Ein Löffelchen voll Zucker«, das Mary den Kindern vorsingt, als sie über die Hausarbeit jammern. Aus meiner Kindheit hatte ich nur den Refrain in Erinnerung: »Wenn ein Löffelchen voll Zucker bittre Medizin versüßt … rutscht sie gleich noch mal so gut.«
Als ich diese bekannte und doch vergessene Szene 20 Jahre später noch einmal sah, hörte ich auch den Anfang des Songs.
In jeder Arbeit, merkt euch das,
Steckt auch ein kleines bisschen Spaß.
Versteh den Spaß
Und schnapp, die Arbeit klappt.
Der Rest des Liedes beschreibt, wie Vögelchen und Bienen sich ihre mühsame Arbeit angenehmer machen, indem sie dabei singen. (Die Vögel singen angeblich »froh und selbstbewusst«, um »ein Frohgemüt« zu schaffen; später musste ich leider feststellen, dass diese Analyse ornithologisch nicht korrekt ist).
Ich nahm mir vor, dieses Konzept auf mein eigenes Leben zu übertragen, schnappte mir in einem nächtlichen Anfall von Inspiration einen Filzstift und einen Post-it-Zettel und schrieb neun einfache Worte: Wie würde es aussehen, wenn es Spaß machen würde?
Diesen Zettel klebte ich an meinen Computermonitor und ging dann schlafen.
Als ich den Zettel am nächsten Tag am Monitor entdeckte, hatte ich ihn schon wieder vergessen. Ich war gerade von der Arbeit zurückgekommen und wollte mich mit den biochemischen Pfaden befassen, die ich für das medizinische Examen beherrschen musste. Also setzte ich mich an den Schreibtisch, um wie üblich die Zähne zusammenzubeißen – doch als ich den Zettel sah, musste ich stutzen. Wie würde es aussehen, wenn es Spaß machen würde?
Die erste Antwort hatte ich sofort: Wenn es Spaß machen würde, wäre Musik im Spiel. Mir wurde klar, dass ich mich deutlich mehr für biochemische Pfade interessieren würde, wenn dabei über Kopfhörer der Soundtrack von Herr der Ringe liefe. So wurde Musik für mich eines der wichtigsten Mittel, um meine Arbeit spielerischer zu gestalten.
Schon bald setzte ich diese Methode auch an meiner Arbeitsstelle ein. Damals war ich auf der Geriatrie-Station tätig und hatte als Arztzimmer einen kleinen, spärlich eingerichteten Raum in einer entlegenen Ecke. An einem besonders zermürbenden Nachmittag, als ich mit einer schier endlosen Liste von Aufgaben im Büro saß, beschloss ich, auch hier auf »musikalischen Spaß« zu setzen. Da ich keine Boxen dabeihatte, besorgte ich mir aus der Küche eine Schüssel, in die ich mein Handy legte, um einen Lautsprecher zu improvisieren. Dann öffnete ich Spotify und ließ für den Rest des Tages leise den Soundtrack von Fluch der Karibik laufen, während ich meine Aufgaben abarbeitete. Die Wirkung war gewaltig; ich fühlte mich einfach viel besser.