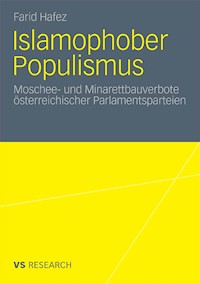Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Verlag Wien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Islamfeindlichkeit ist in Mode gekommen. Aber woher kommt sie und wie drückt sie sich im Alltag aus? Welche politischen und akademischen Debatten stehen mit ihr in Verbindung? Welche Grenzen lassen sich zwischen einer sachlichen Debatte über 'Islam' und 'MuslimInnen' und einer in Rassismus verfallenden Generalisierung ziehen? Dieses Einführungsbuch beleuchtet institutionelle Formen des anti-muslimischen Rassismus und zeigt den Stand der Debatten zum Verhältnis von Antisemitismus und Islamophobie auf. Zum Schluss diskutiert der Autor Gegenstrategien für eine Gesellschaft mit weniger Ungleichheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Farid Hafez
FEINDBILD ISLAM
Über die Salonfähigkeit von Rassismus
BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2019 by Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co. KG, Wien, Kölblgasse 8–10, A-1030 WienAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Lektorat: Jessica Paesch, JenaKorrektorat: Rainer Landvogt, HanauEinbandgestaltung: Michael Haderer, WienSatz: Michael Rauscher, WienEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlagewww.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-205-20923-2
Inhalt
Vorwort
Prolog: Worüber wir (nicht) sprechen
Worüber wir nicht sprechen
Worüber wir sprechen
Islamophobie: Herkunft eines Begriffs und Popularisierung eines Konzeptes
Ein Wort, viele Geschichten
Politische Debatten: Kampfbegriff oder legitime Benennung?
Ursprünge des antimuslimischen Rassismus
Religiöse Stereotypisierung
1492 – Der Beginn einer neuen Welt
Orientalismus
Das Ende des Kalten Krieges und die neue Welt(un)ordnung
Das postfaschistische Europa und die Islamophobie in (West-)Europa
Islamophober Diskurs und Praxis
Islamophobe Diskurse und Stereotype: Die Medien
Die Einschränkung religiöser Praxis
Ausdehnung sicherheitspolitischer Maßnahmen
Legitimation von Gewalt und Krieg
Mord und Genozide
Zentrale Funktionen des antimuslimischen Rassismus
Macht, Identitätspolititk und Ablenkung von sozioökonomischen Bedürfnissen
Fallbeispiel islamische Kindergärten
Die Normalisierung von Rassismus: Thilo Sarrazin
Antisemitismus und Islamophobie
Der Vergleich
Ähnliche Rhetorik
Das jüdische und muslimische ›andere‹ Paar heute
Entmenschlichung
Die Rechten und die Täter-Opfer-Umkehr
Gegenstrategien
Änderung der Rahmung von Konflikten
Islamophobie sichtbar machen
Empowerment
Gegenerzählungen
Allianzen
Anmerkungen
Vorwort
Der Beginn meiner Beschäftigung mit dem ›Feindbild Islam‹ geht auf die Endphase meiner formalen akademischen Ausbildung zurück. Als ich mich im Kontext der Antisemitismusforschung und der Diskursanalyse mit den ersten Wahlkampfkampagnen der rechten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) ab dem Wiener Landtagswahlkampf im Jahr 2004 auseinandersetzte, konnte ich nicht ahnen, wie sehr die Dynamik der Islamfeindlichkeit bzw. des antimuslimischen Rassismus noch an Kraft gewinnen würde. Zeitgleich zu meiner Beschäftigung mit diesem Phänomen kam es auch auf globaler Ebene in akademischen Kreisen zu einer stärkeren Auseinandersetzung damit. Insbesondere im englischsprachigen Raum lief und läuft diese größtenteils unter dem Begriff ›Islamophobie‹. Als ich hierzu 2009 gemeinsam mit John Bunzl den ersten Sammelband für Österreich herausgab, begannen auch in Deutschland immer mehr Personen umfassendere Werke zu dieser Thematik zu publizieren. Das gestiegene akademische Interesse mündete auch in dem von mir erstmals 2010 veröffentlichten Jahrbuch für Islamophobieforschung. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Problematisierung von Musliminnen und Muslimen im öffentlichen Diskurs schien ein Projekt der systematischen Behandlung dieses Themas von zentraler Bedeutung für eine grundlegende kritische Auseinandersetzung damit. 2012 folgte unabhängig davon die Gründung des Islamophobia Studies Journal an der University of California, Berkeley. Die akademischen Konferenzen, Beiträge in Fachzeitschriften und Publikationen zu diesem Themenkomplex sind zwischenzeitlich so zahlreich, dass für einen besseren Überblick kommentierte Bibliografien veröffentlicht werden.1 Die stärkere akademische Beschäftigung damit hat jedoch nicht dazu geführt, dass das Phänomen an Relevanz verloren hätte. Im Gegenteil, selbst der weniger subtile, offensichtliche antimuslimische Rassismus ist immer salonfähiger geworden. Heute haben wir den Präsidenten der letzten verbliebenen Supermacht, der im Fernsehen unverblümt und unmissverständlich meint: »Der Islam hasst uns.«2 Dass eine solche Aussage möglich ist, hat nicht nur mit Donald Trump und seinem neuen politischen Stil zu tun. Es ist vielmehr Abbild einer Entwicklung, die global, in einer langen Geschichte des Weltsystems verankert ist und die man gegenwärtig auch in den deutschsprachigen Ländern beobachten kann. Wenn der Geschäftsführer einer – nominell nicht rechtspopulistischen – Regierungspartei wie der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) vorschlägt, dass das Fasten im Monat Ramadan für SchülerInnen zu verbieten sei,3 ohne dass es hörbaren Aufschrei dagegen gibt, sollten die Alarmglocken läuten. Derartige Regulationen erinnern am ehesten noch an die Volksrepublik China, die für die Behandlung ihrer religiösen Minderheiten mehr Kritik als Ruhm erntet. Dass abseits der großen Aufmärsche – wie jenen von Pegida (den Patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes) oder den jährlichen zum Unabhängigkeitstag in Warschau – hetzerische Schriften wie die von Thilo Sarrazin in den Jahren 2010 und 2011 21 Wochen lang auf dem Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste waren und von weiten Teilen der Bevölkerung gelesen werden, spricht ebenfalls Bände hinsichtlich der Salonfähigkeit eines Rassismus, der oftmals nicht einmal als solcher erkannt und anerkannt wird. Es scheint, als gäbe es heute eine tatsächliche ›muslimische Frage‹.
Und auch an folgendes Muster rassistischen Denkens sollte erinnert werden: Was seinerzeit als ›jüdische Frage‹ bezeichnet wurde, war weniger eine ›jüdische‹ als eine ›antisemitische Frage‹, wie AntisemitismusforscherInnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und noch mehr in der Zeit unmittelbar nach dem Holocaust festgestellt haben.4 Zur der Zeit, als das ›Jüdische‹ in den europäischen Gesellschaften vielfach thematisiert wurde, schien die Formulierung dieser Frage vielen jedoch legitim. Ebenso verhielt es sich mit der sogenannten ›Rassenfrage‹ in den USA. James Baldwin meinte hierzu treffend, dass nicht der Schwarze das Problem sei, sondern der Weiße, der die Figur des Schwarzen erfunden habe und der sich die Frage stellen müsse, warum er diese Figur so sehr brauche.5 Aber die ›Rassenfrage‹ wurde in einer von Weißen dominierten Gesellschaft als wichtige Frage angesehen. Und heute wird die ›muslimische Frage‹ zu einer wichtigen gesellschaftlichen Frage erhoben.6
Dieses Buch will einer breiten Leserschaft Ansätze präsentieren, die diese Fragestellung kritisch betrachten und auch Antworten auf die Frage geben, woher dieses Feindbild ›Islam‹ stammt. Anders gesagt: Was sind die Ursachen für antimuslimischen Rassismus? Welche Diskurse gibt es dazu? Wie äußert sich Islamophobie konkret in unserer Welt? Was sind zentrale Funktionen von Islamfeindlichkeit? Da sich dieses Einführungswerk an eine deutschsprachige Leserschaft richtet, diskutiere ich auch das Verhältnis von Antisemitismus und Islamophobie. Schließlich ist der antijüdische Rassismus im deutschsprachigen Raum umfassender untersucht worden als jede andere Form von Rassismus. Im letzten Kapitel werden überblicksmäßig mögliche Gegenstrategien aufgezeigt, um antimuslimischen Rassismus zu überwinden.
Wien, im Januar 2019
Prolog: Worüber wir (nicht) sprechen
Islamophobie, Islamfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus – drei Begriffe, die oftmals synonym verwendet werden, um ein Phänomen zu benennen, dessen rasante Verbreitung wir in den letzten Jahrzehnten beobachten konnten. Sosehr diese Termini auch Eingang in unseren Sprachgebrauch gefunden haben – Islamophobie im angloamerikanischen, Islamfeindlichkeit im deutschsprachigen Raum und antimuslimischer Rassismus in akademischen Debatten –, gilt gleichzeitig aber auch, dass sie oft unterschiedlich verwendet werden.7 Im Folgenden werde ich diese Begriffe synonym verstehen. Aus diesem Grund wird einführend vorausgeschickt, worum es hier nicht gehen soll.
Terminologien, und damit die Bezeichnung von Phänomenen, erschließen sich nicht allein dadurch, dass man erklärt, was sie bedeuten. Die Begriffsbedeutung erschließt sich vielmehr auch durch das, was die Begriffe nicht bezeichnen, d.h. durch die Bestimmung ihrer Grenzen. Ich beginne deswegen damit zu zeigen, was ich nicht meine, wenn ich über Islamfeindlichkeit, Islamophobie oder antimuslimischen Rassismus spreche, um genau herauszuarbeiten, von welcher Bedeutung ich ausgehe. Diesem Anliegen folge ich ohnehin über weite Strecken des Buches.
Worüber wir nicht sprechen
Eine wichtige Vorbemerkung gilt der Bedeutung der Begriffe Islam und MuslimInnen im Zusammenhang mit dem Phänomen der Islamophobie. Vergegenwärtigen wir uns viele der Debatten, die heute in der Öffentlichkeit geführt werden, so werden wir immer wieder feststellen, dass im Zusammenhang mit dem sogenannten ›Islam‹ und den sogenannten ›MuslimInnen‹ nur über scheinbar reale ›Probleme‹ gesprochen wird. Die Debatten reichen von der behaupteten Unverträglichkeit des Islams mit der Demokratie bis hin zur Gewaltaffinität des Islams. Gibt es eine Diskussion über Islamophobie, so wird schnell von den ›realen‹ Gefahren, die angeblich von dieser Religion bzw. ihren AnhängerInnen ausgehen, gesprochen. An dieser Stelle ist eine erste Zäsur angebracht, mit der ich zurück in die Geschichte des letzten Jahrhunderts gehe.
Im Jahre 1946 antwortete der afroamerikanische Autor Richard Wright (1908–1960) auf die Frage eines Journalisten, was er über das ›Problem der Schwarzen‹ (negro problem) in den Vereinigten Staaten von Amerika denke, mit den Worten: »Es gibt kein schwarzes Problem in den USA, es gibt nur ein weißes Problem.«8 Damit dreht Wright den Spieß um und verortet das ›Problem‹ nicht aufseiten der vordergründigen Opfer dieses rassistischen Verhältnisses, sondern auf der Seite der TäterInnen. Dies hatten vor dem Literaten schon andere getan. So meinte der Historiker Werner Jochmann, dass die seinerzeit diskutierte sogenannte ›jüdische Frage‹ in Wirklichkeit in Beziehung zu einer größeren Frage, nämlich der ›deutschen Frage‹, stehe.9 Noch deutlicher machte dies davor schon der bekannte Philosoph und Vertreter des Existenzialismus, Jean-Paul Sartre, der in seinem 1948 erschienenen Werk Betrachtungen zur Judenfrage. Psychoanalyse des Antisemitismus treffend konstatierte: »Wenn es keinen Juden gäbe, der Antisemit würde ihn erfinden.«10 Seiner Meinung nach schafft »nicht die Erfahrung den Begriff des Juden, sondern das Vorurteil fälscht die Erfahrung«.11 Für Sartre ist also das, was die Vorstellung vom Judentum und von ›Jüdinnen und Juden‹ ausmacht, nicht an deren Sein abzulesen. Vielmehr bestimme die Vorstellung – in diesem Fall die Imagination der AntisemitInnen –, wie über das Jüdische gedacht werde. Das Bild vom Jüdischen sagt somit viel eher etwas über die AntisemitInnen aus, als dass es etwas über das Judentum und/oder die Jüdinnen und Juden aussagen würde. Die Umdeutung der ›antisemitischen Frage‹ in eine ›jüdische Frage‹ ist damit als eine Strategie der AntisemitInnen zu entlarven. In diesem Sinne meinte der schwedische Antisemitismusforscher Hugo L. Valentin:
Die in jüdischen und nichtjüdischen Kreisen weit verbreitete Ansicht, dass Juden auf die eine oder andere Weise handeln hätten können oder dass die Juden den Antisemitismus möglicherweise hätten abwenden können, basiert auf einer Illusion. Denn nicht die Juden werden gehasst, sondern ein imaginäres Bild von ihnen, das mit der Realität verwechselt wird, und die tatsächlichen ›Fehler‹ der Juden spielen in der Sache eine sehr unwichtige Rolle. […] Es ist keineswegs sicher, dass der Antisemitismus geschwächt würde, wenn die Juden ausschließlich aus Engeln in menschlicher Form bestehen würden.12
Auf die Islamophobie übertragen bedeutet dies, dass das reale Verhalten von MuslimInnen das Bild der Islamophoben nicht zu ändern vermag. Vielmehr müsste dieses Bild geändert werden, das aber von den Islamophoben selbst geschaffen wurde, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Auf diese Zweckmäßigkeit wird im vierten Kapitel noch genauer eingegangen werden. Die zentrale Bedeutung, die damit aber jenen zukommt, die diese Bilder schaffen, soll noch einmal mit einem Zitat des afroamerikanischen Schriftstellers und kritischen Geistes James Baldwin hervorgehoben werden. Er meinte in einer Diskussion mit zwei führenden Kämpfern für die Gleichberechtigung von Schwarzen in den 1960er Jahren:
Aber der Schwarze in diesem Land […] die Zukunft des Schwarzen in diesem Land ist exakt so hell beziehungsweise so dunkel wie die Zukunft dieses Landes […] Was weiße Menschen in diesem Land tun müssen, ist, in ihren eigenen Herzen herauszufinden, warum sie einen ›Nigger‹ brauchten. Denn ich bin kein Nigger. Ich bin ein Mensch. Aber wenn Sie denken, ich sei ein Nigger, dann bedeutet dies, dass Sie ihn brauchen […] Ich bin hier nicht der Nigger, und Sie haben ihn erfunden. Sie, die weißen Leute, haben ihn erfunden und müssen deswegen herausfinden, warum dem so ist. Und die Zukunft dieses Landes hängt davon ab, ob sie dazu imstande sind, diese Frage zu stellen oder eben auch nicht.13
So wie gegenüber dem imaginierten Juden und der imaginierten Jüdin Vorurteile geschaffen wurden, um ihre Diskriminierung bis hin zur Vernichtung zu legitimieren, wurden auch Bilder, Imaginationen, über Schwarze erzeugt, um diese zu unterwerfen, sich ihrer zu bemächtigen, sie von Afrika in die Neue Welt zu verschiffen und dort bis zur Vernichtung auszubeuten, um aus ihrer Arbeitskraft Reichtum zu generieren. Die Figur des Juden und der Jüdin wie die Figur des/der Schwarzen gehören dabei genauso wie die Figur des/der MuslimIn in die Kategorie des Erfundenen.
Deswegen handelt dieses Buch auch nicht von ›dem Islam‹ oder ›den MuslimInnen‹, und es geht auch nicht darum, wie MuslimInnen ihre Religion leben oder eben nicht leben und warum sie das tun oder eben auch nicht. Es geht nicht um Kriege auf der internationalen Bühne und nicht darum, inwiefern das Diskursfeld Islam zu Zwecken der Mobilisierung genutzt wird. Das Buch sagt auch nicht, welche Interpretationen des Islams die besten wären. Es geht hier um etwas anderes. Es geht um den Rassismus, der die Figur des Muslims in den Blick genommen hat und sich an dieser in mannigfaltiger Art abarbeitet.
Worüber wir sprechen
Zu behaupten, dass die erwähnten Figuren – Juden/Jüdinnen, Schwarze, Muslime/Musliminnen – imaginierte Figuren sind, bedeutet jedoch nicht, dass die entsprechenden Imaginationen nicht gleichzeitig auch an Fakten anknüpften. Wären die Figuren völlig frei erfunden, würde es schwerer fallen, sie als glaubhaft darzustellen. Deswegen sind die Stereotype, die diesen Figuren angeheftet werden, tragfähiger, wenn sie partiell an die Realität anknüpfen. So knüpft etwa das antisemitische Stereotyp, Juden würden über das Bankwesen die Welt regieren, an existierende Familien mit jüdischem Hintergrund wie die Rothschilds oder die Rockefellers an, die im Bankwesen tätig waren. Dies bedeutet aber weder, dass das Gros der Jüdinnen und Juden an diesem Reichtum Teil hätte, noch ist es ein Beweis für eine ›Geheimregierung‹, wie sie von AntisemitInnen behauptet wird. Zudem muss die Frage aufgeworfen werden, welche Bedeutung das ›Jüdische‹ überhaupt für die ökonomische Position der entsprechenden Familien hat.
Das Gleiche gilt für jede andere Form des Rassismus, ob sie sich nun gegen Schwarze, MuslimInnen oder andere Gruppen wie die der Sinti und Roma richtet. All diesen Formen des Rassismus ist gemein, dass sie an reale Gegebenheiten anknüpfen, diese aber auf die gesamte Gruppe beziehen und zu einer charakteristischen Eigenschaft aller Angehörigen dieser Gruppe umdeuten. Nicht mehr das Individuum, sondern eine Gemeinschaftsidentität steht im Mittelpunkt der Imagination. Rassismus markiert Gruppen von Menschen und entindividualisiert sie. Auf diese Weise wird der oder die Einzelne auf eine aus mehreren allgemeinen Identitätsbausteinen bestehende Person reduziert. Politische Orientierungen, ökonomische Zwänge oder die psychische Verfasstheit werden außer Acht gelassen. Der Mensch wird auf seine Hautfarbe oder Religion reduziert und damit zu der von RassistInnen erschaffenen Figur. Die Religion wird zu dem Moment, dass das Handeln aller dieser Gruppe vermeintlich zugehörigen Personen erklären soll. Im Umkehrschluss wird jede Abweichung vom Vorurteil als Ausnahme gedeutet und bedeutet nichts anderes als eine Bestätigung und weitere Stabilisierung des Vorurteils.
Zur Verdeutlichung seien ein historisches und ein aktuelles Beispiel erwähnt. Adolf Hitler hat über den Hausarzt seiner Mutter, Eduard Bloch, einmal gesagt: »Ja der ist eine Ausnahme, das ist ein Edeljude; wenn alle Juden so wären, würde es keine Judenfrage geben.«14 Bloch war Jude, aber für Hitler war er nicht primär Jude. Vordergründig war Bloch für Hitler Arzt, der Arzt seiner Mutter. Weil er aber doch zugleich auch Jude war und seine Qualitäten den rassistischen Theorien Hitlers widersprachen, stellte er für Hitler eine Ausnahme vom Stereotyp der Figur des Jüdischen dar. Diese reale Erfahrung mit einem Juden brachte Hitler nicht dazu, sein Bild zu korrigieren, denn sein Vorurteil stabilisierte sich mithilfe dieser ›Ausnahmen‹ nur weiter. MuslimInnen kennen diesen Vorgang. Wenn ich heute in einer Veranstaltung einem mehrheitlich muslimischen Publikum die Frage stelle, wer schon einmal Sätze gehört hat wie »Wenn alle MuslimInnen so wären wie du …« oder »Du bist anders als alle anderen MuslimInnen«, dann melden sich durchschnittlich 90 % der Zuhörenden. Oft begreifen jene, die solche Sätze äußern, nicht einmal, dass sie eine vorurteilsbeladene verallgemeinernde Aussage treffen, die – obwohl gut gemeint – nichts anderes offenbart als ihr Vorurteil.
Des Weiteren zeigen empirische Befunde, dass die Ablehnung von MuslimInnen in jenen Regionen am höchsten ist, in denen die wenigsten von ihnen leben. Das ist auch das Ergebnis von europäischen Vergleichen, wie z.B. der Studie von Chatham House oder der des Pew Research Center. Erstere zeigt, dass in den Ländern mit den wenigsten MuslimInnen die Ablehnung vom MigrantInnen aus muslimischen Ländern am höchsten ist. 71 % der Befragten in Polen und 62 % der Befragten in Ungarn folgen dieser Einstellung.15
Wenn wir über Islamfeindlichkeit sprechen, dann sprechen wir also nicht über ›den Islam‹ oder ›die MuslimInnen‹. Wir sprechen in erster Linie über die Bilder der Islamophoben von ›MuslimInnen‹. Wir sprechen über die Markierung einer Gruppe von Menschen, ihre Reduktion auf ein einziges scheinbares ›Merkmal‹, nämlich das MuslimInsein. Dieses ›Muslimische‹ wiederum wird auf bestimmte negative Stereotype reduziert und einem Prozess der Generalisierung unterzogen.
Wichtiger noch: Wie jede andere Form des Rassismus dient auch dies dem Erlangen, der Stabilisierung sowie der Ausweitung von Macht im weitesten Sinne. Macht ist ein zentraler Faktor in der Erklärung islamophober Diskurse und Politiken. In Europa verfolgen viele Oppositionsparteien – insbesondere im rechten Lager – Wahlkampfstrategien, die auf Islamophobie setzen, um an die Macht zu kommen. Gleichzeitig sind es auch Regierungsparteien – insbesondere nominell im Mitte-rechts-Spektrum angesiedelte –, die sich islamophober Diskurse bedienen, um ihre Machtposition zu stabilisieren. Zudem hilft die Umsetzung islamophober Politiken der Ausweitung von Macht. So ist die Regulierung der privaten Lebensführung, wie etwa im Falle des Kopftuchverbotes, ein erster Schritt, mit dem der Staat in den privaten Bereich eindringt. Ein solches Eindringen eröffnet immer auch die Möglichkeit, Politiken mit ähnlicher Logik auf andere Bevölkerungsgruppen auszuweiten, und ermöglicht den AkteurInnen in den Machtpositionen, ihren Einfluss zu erweitern. Insofern ist islamophobe Politik nicht als eine Politik gegen MuslimInnen allein zu sehen. Sie richtet sich in ihrer zugrunde liegenden Logik gegen die gesamte Gesellschaft, weil sie überhaupt erst Eingriffe vonseiten staatlicher Behörden ermöglicht.
Die mit Machtressourcen ausgestatteten Personen werden im Gegensatz zu den als Sündenböcken markierten MuslimInnen oftmals weniger benannt. Diese Position wird in der Forschung zur Critical Whiteness (oft als Kritische Weißseinsforschung übersetzt) »Weiße Position« genannt. Damit werden AkteurInnen verortet, die keiner weiteren Benennung unterzogen werden, weil sie diejenigen sind, die andere benennen, die aber in bestimmten Kontexten Dominanz ausüben. Da sie eine unmarkierte Position innehaben, gelten sie als privilegiert.16 Weiße Positionen zu benennen soll die Unsichtbarkeit der Machtpositionen beenden und den Fokus weg von den marginalisierten ›Anderen‹, Schwarzen oder MuslimInnen, hin zu den zentralen Akteuren lenken. Weiß-, Schwarz- und Muslimsein werden in diesem Zusammenhang nicht als biologische oder kulturelle Kategorien verstanden, sondern als konstruierte Kategorien, mit deren Hilfe der Blick auf Machtverhältnisse geschärft werden soll. Es geht um die ideologische Konstruktion von ›Hautfarben‹,17 Religion oder Kultur, die der Stabilisierung von Machtverhältnissen dient.
Diese Vorbemerkung ist wichtig, bevor dem Ursprung und der Popularisierung des Begriffs, der kritischen Debatte über sowie den AkteurInnen von Islamophobie auf den Grund gegangen wird. Später wird auch auf problematische Punkte dieser Debatte, etwa die Frage nach dem Verhältnis von Islamophobie und Kritik am Islam bzw. MuslimInnen, eingegangen werden.
Islamophobie: Herkunft eines Begriffs und Popularisierung eines Konzeptes
Ein Wort, viele Geschichten
Tatsächlich ist der Begriff Islamophobie älter, als allgemein angenommen wird. Eine der frühesten Verwendungen geht auf den französischsprachigen Raum zurück, wo der Begriff 1910 im Zusammenhang mit der französischen Kolonisierung zur Beschreibung der vorurteilsbeladenen Einstellung der Kolonisatoren gegenüber der algerischen Bevölkerung und ihrer Religion verwendet wurde.18 ›Islamophobie‹ wurde somit sehr früh von verschiedenen französischen Schriftstellern und Denkern verwendet. So benutzten beispielsweise der französische Maler Étienne Dinet und sein algerischer Ko-Autor Sliman Ben Ibrahim den Begriff in ihrer Muhammad-Biografie zur Bezeichnung der absichtlichen Falschdarstellung des Islams durch Orientalisten, die darauf abzielte, der islamischen Religion Schaden zuzufügen.19
Im englischsprachigen Raum, so das Oxford English Dictionary, wurde der Begriff erstmals im Jahre 1923 in der Zeitschrift The Journal of Theological Studies verwendet.20 Der Kulturwissenschaftler und Autor des berühmten Werkes Orientalismus, Edward Said, benutzte den Begriff im Jahre 1985 zum ersten Mal in der akademischen Zeitschrift Race and Class.21 Der Boston Globe verwendete als erste US-amerikanische Zeitung den Begriff im Jahre 1995. Dort findet sich ein Artikel von Elizabeth Neuffer mit der Überschrift: »Islamophobia in Europe Fuels Tensions, Isolation«.22
Diesen vereinzelten und seltenen Verwendungen folgte eine Phase der Popularisierung. Weite Verbreitung erhielt der Begriff im Zuge eines Berichts der antirassistischen britischen Denkfabrik Runnymede Trust. 1997 wurde von einer Kommission, bestehend aus AkademikerInnen und VertreterInnen der muslimischen Zivilgesellschaft, der Bericht Islamophobia – A Challenge for us all herausgegeben. Die Wahl des Begriffs begründeten die Autoren damit, dass sich MuslimInnen in Großbritannien mit einem besonders gegen sie gerichteten Rassismus konfrontiert sähen. Um diesem Umstand gesellschaftlich Rechnung zu tragen, solle mit dem Begriff Islamophobie die besondere antimuslimische Dimension von Rassismus benannt werden.23 Gleichzeitig ist für Großbritannien zu beachten, dass hier die Kategorie Rasse, die im deutschsprachigen Raum nicht als eigenständige Kategorie zur Erfassung von Menschengruppen verwendet wird, nicht auch die Religion umfasste. Der damals in Kraft befindliche Race Relations Act von 1976, ein Antidiskriminierungsgesetz, erstreckte sich auf ethnische Diskriminierung, nicht aber auf Diskriminierung aufgrund der Religion. Politisch war es daher ein Ausdruck des gewachsenen Problembewusstseins aufseiten der MuslimInnen, mit dem Begriff der Islamophobie einem bisher nicht ausreichend wahrgenommenen Phänomen sprachlich Ausdruck zu verleihen. Die breite Rezeption des Berichts führte im Weiteren zu einer Popularisierung des Begriffs Islamophobie. 20 Jahre nach der Einführung des Islamophobiebegriffs durch den Runnymede Trust im akademischen Raum wurde ein Folgebericht erstellt: Islamophobia: Still a challenge for us all titelte die Denkfabrik nun24 und revidierte das von ihr eingeführte Islamophobie-Konzept, welches in der akademischen Landschaft einige Debatten ausgelöst hatte. Islamophobie sei, so der Bericht nun, eine Form von Rassismus.25 Auch hierauf gab es Reaktionen wie etwa von Salman Sayyid und AbdoolKarim Vakil, die diese Stoßrichtung zwar begrüßten, gleichzeitig aber auch kritisch im Forum des Islamophobia Research and Documentation Project (IRDP) der University of California, Berkeley weiterdiskutierten.26
Zunehmend fand der Begriff auch in internationalen Organisationen Akzeptanz. Das European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), welches heute als FRA (Fundamental Rights Agency) bekannt ist und die wichtigste Stelle der EU für die Thematisierung von Menschenrechtsverletzungen darstellt, veröffentlichte 2002 den Bericht Summary Report on Islamophobia in the EU after 11 September 2001.27 Im Jahr 2004 folgte eine Konferenz der Vereinten Nationen mit dem Titel Confronting Islamophobia, in deren Rahmen Generalsekretär Kofi Annan davon sprach, dass der zunehmenden fanatischen Abneigung gegenüber dem Islam entgegenzutreten sei.28 Ein 2006 herausgegebener Bericht der EUMC trug den Titel MuslimInnen in der Europäischen Union. Diskriminierung und Islamophobie29. Seit 2007 gibt auch die Organisation of Islamic Cooperation, die 57 Mitgliedstaaten umfasst, einen jährlichen Islamophobiebeobachtungsbericht30 heraus. Seit dem Jahr 2016 publizieren der Politikwissenschaftler Enes Bayrakli und ich jährlich einen Europäischen Islamophobiebericht, den European Islamophobia Report31, in dem zuletzt mehr als 40 AutorInnen insgesamt 33 europäische Länder untersucht haben. Zudem ist auf EU-Ebene der 21. September der offizielle European Day Against Islamophobia.
Die zunehmende Akzeptanz des Begriffes aufgrund der Publikationen von anerkannten Einrichtungen führte auch zu seiner Popularisierung im öffentlichen Sprachgebrauch. 2010 titelte das Magazin Time »Is America Islamophobic?«32. In der Titelgeschichte ging es um den Widerstand bzw. die Proteste gegen die Planung von Moscheebauten, die der Kontroverse um das Projekt Park51 Islamic Cultural Center in Manhattan folgten, das unter dem Namen ›Ground Zero Mosque‹ bekannt wurde.33 In den USA fand der Begriff zunehmend durch PolitikerInnen und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Verwendung. Außenminister John Kerry meinte 2015 nach den terroristischen Übergriffen auf Charlie Hebdo auf dem World Economic Forum: »Es gibt keinen Platz für sektiererische Entzweiung. Es gibt keinen Platz für Antisemitismus oder Islamophobie.”34 2017 sprach der Bundespräsident der Republik Österreich im Zusammenhang mit der Diskriminierung von Frauen in der Öffentlichkeit ebenfalls von zunehmender Islamophobie.35 Dennoch gilt, dass die Verwendung im deutschsprachigen Raum eher die Ausnahme als die Regel darstellt, denn hier wird häufiger der Begriff