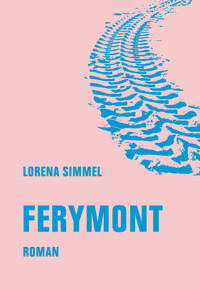
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als ihr in Berlin das Geld für ihr Studium ausgeht, reist die junge Ich-Erzählerin in ihr Heimatdorf Ferymont in der Schweiz, um dort für eine Saison als landwirtschaftliche Hilfskraft zu arbeiten. Beim Einsatz auf den Feldern freundet sie sich mit Daria an, die mit ihrer Familie jährlich aus der Republik Moldau anreist, um in den Betrieben des Schweizer Seelands Geld als Saisonkraft zu verdienen. Durch die entstandene Nähe zwischen den beiden jungen Frauen rückt auch das Ungleichgewicht zwischen den west- und osteuropäischen Regionen in den Fokus. »Ferymont« ist ein literarisches Porträt einer Region im Herzen Europas, das eine oft unsichtbare Realität thematisiert. Ein leiser Roman, der sprachlich virtuos kapitalistische Arbeitsbedingungen hinterfragt und sensibel die Geschichten von Saisonarbeiter*innen in den Mittelpunkt stellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage
Verbrecher Verlag Berlin 2024
www.verbrecherei.de
© Verbrecher Verlag GmbH 2024
Satz: Christian Walter
Druck und Bindung: CPI Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-95732-580-8
eISBN 978-3-95732-591-4
Printed in Germany
Der Verlag dankt Felix Bauer, Charlotte Kuschka und Greta Schlusche.
Lorena Simmel
FERYMONT
Roman
VERBRECHER VERLAG
Für M.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Dank
Prolog
In Terespol regnete es. Der Bahnhof war ein großer Neubau aus Beton und Glas. Seine Empfangshalle war um diese Uhrzeit fast leer, durch eine automatische Schiebetür sah man auf einem Gleis weit hinten eine alte Lokomotive. Sie passte zum Regen, der ein aus der Mode gekommenes Wetter zu sein schien.
Gegen sieben Uhr füllte sich die Halle mit Ankommenden. Ihre Stimmen und Schritte hallten von der hohen Decke wider, von Zeit zu Zeit bewegte sich ein Schwall Reisender zu den Ausgängen. Eine ältere Frau trug einen Trauerkranz aus Blumen vor sich her, andere waren mit Gepäcktaschen, Regenschirmen, Einkaufstüten oder Laptoptaschen unterwegs. Ein paar schauten auf ihr Handy oder hörten Musik.
Auch vom Bahnhofsvorplatz aus betraten jetzt Leute die Halle. Sie blieben meist einen Moment vor der großen Anzeigetafel über der Schiebetür stehen und gingen dann weiter, hinaus zu den Gleisen oder zur »Bar« im hinteren Bereich der Halle.
Ich saß auf einer der Bänke beim Eingang. Mein Zug war für 7 Uhr 15 mit zwanzig Minuten Verspätung angekündigt.
In diesem Moment, der sich durch die Wartezeit ergab, hatte ich das angenehme Gefühl, in den Geräuschen, dem Gemurmel und der Geschäftigkeit der Ankommenden und Abreisenden unterzugehen.
Jede und jeder von ihnen hätte, so dachte ich, jemand sein können, mit dem ich im Jahr zuvor auf dem Feld gearbeitet hatte. Ich suchte nach Darias oder Konrads Gesicht, und tatsächlich hoben sich für Augenblicke einzelne Gesichter aus der Menge hervor, die aber sogleich wieder zwischen den Reisenden verschwanden. In der Menge, die mich umgab, ohne von mir Kenntnis zu nehmen, fühlte ich mich geborgen und geschützt, aber auch hellwach. Es beachtete mich niemand, gleichzeitig konnte ich alles ungestört beobachten.
In diesem Moment war ich sicher, den Herzschlag der Stadt und der umliegenden Siedlungen und Dörfer an der belarussischen Grenze zu hören, und ich zögerte noch einen Moment mit dem Aufstehen, um noch kurz unter den Reisenden zu bleiben und mit ihnen diesen Wintermorgen zu erleben.
Ich arbeitete damals auf einem Tabakfeld in der Schweiz. Wegen der nassen Böden hatte sich das Setzen der Jungpflanzen um mehrere Wochen verzögert. Im April und Anfang Mai war es kalt gewesen, danach ungewöhnlich warm. Im Juni regnete es fast die ganze Zeit. Jeden Morgen, wenn wir aufs Feld fuhren, hingen dicke Regenwolken bis tief über den Jura. Von den Pappeln flogen die Samen wie Watte über die Kanäle und blieben auf dem Wasser und den Wegen liegen. Die ockerfarbenen Rinder der Strafanstalt Bellechasse standen reglos auf der vom Torf schwarzen Erde. Die Weizen- und Rapsfelder glänzten im Dunst, der nach dem Regen über der Ebene lag. Die Pflanzen ließen unter dem Gewicht des Wassers ihre Köpfe hängen. Das »Wetterloch«, der Eingang des Tals hinter dem Neuenburger See, war von Nebel verhangen.
Es war März, als ich ankam. Meine Tante holte mich am späten Nachmittag am Bahnhof in Ferymont ab. Sie wartete am oberen Ende der Treppe und lachte, während sie anscheinend fror. Ihre Arme hielt sie über ihrem Strickmantel verschränkt. Mir war warm von der Reise und dem beunruhigenden Gefühl, das mich jedes Mal überfiel, wenn ich in Ferymont ankam.
Hinter meiner Tante erhob sich das »Drogenwäldchen« in den Himmel, eine Gruppe kahler Pappeln, unter denen früher im Dorf für zwielichtig gehaltene Gestalten mit Bier und Zigaretten gesessen hatten.
Heute sah das Wäldchen ordentlich gestutzt aus. Die Bänke unter den Pappeln waren leer, in den Baumkronen rauschte der Wind.
Meine Tante drückte mich an sich. Sie roch nach Kafffee und Parfüm, ihre Haare waren diesmal braun gefärbt. Seit meinem letzten Besuch vor ein paar Monaten schien sie kleiner geworden, wie eingegangen zu sein.
»Endlich«, sagte sie und lächelte.
In ihrem tannenbaumgrünen Golf fuhren wir die Bahnhofstraße ins Dorf hinauf. Das Fitnesszentrum war wie immer mit Neonlicht ausgeleuchtet, ein paar Leute trainierten an den wie ungelenke Vögel aussehenden Geräten. Vor dem Blumengeschäft standen Stiefmütterchen und Thujastecklinge in Reih und Glied auf bewässerbaren Tischen. Im Café Münz saßen ein paar ältere Menschen vor Eisbechern oder Bier.
Seit dem Umzug meiner Eltern lebte meine Tante allein in einem großen Haus am Ortsrand von Ferymont. Das Haus war von einem Wäldchen umgeben, davor erstreckte sich über einen Teil des Grundstücks eine große Einfahrt. Eine Außentreppe aus Stein mit einem schönen, nur etwas angerosteten Geländer führte zur Eingangstür hinauf. Auf beiden Seiten des Gebäudes gelangte man über Kieswege in den großen Garten. Es war ein altes Haus, in dem meine Tante früher mit ihrem Bruder, meinem Vater, gewohnt hatte. Die Geschwister waren, wie auch meine Mutter, in den 1980er Jahren aus Deutschland zum Studieren in die Schweiz gekommen.
Ich bezog das Zimmer im Obergeschoss, eine Art Büro meiner Tante mit Bett am Fenster, einem Schreibtisch, auf dem ein alter Flachbildschirm stand, und einem Schrank mit Glastüren und Spitzenvorhängen. Meine Tante hatte es extra für mich hergerichtet. Sie hatte meinen alten, silbernen CD-Player, den meine Eltern nebst ein paar anderen Sachen von mir im Keller meiner Tante untergerbacht hatten, auf die Fensterbank gestellt. Er glänzte matt futuristisch. Meine alte Schreibtischlampe, auf die ich als Jugendliche mit schwarzem Marker Did your shadow ever speak to you? geschrieben hatte, klemmte am Schreibtisch. Aus dem Fenster sah man auf Bäume, ein Stück Einfahrt und auf den Himmel über dem Wald.
Da ich anfangs, wahrscheinlich, weil das die weniger anstrengende sowie unkompliziertere Arbeit war, mit den Männern in der Spargelernte eingesetzt wurde, fuhr ich am Morgen nach meiner Ankunft im Auto mit einem älteren Ehepaar, Zef und Drita, zum Nusshof, einer Unterkunft der landwirtschaftlichen Hilfskräfte, die im Großen Moos in der Nähe einer Ausfahrt der Umfahrungsstraße »T10« gelegen war, und stieg dort in einen Kleinbus, der uns zum Feld fuhr.
Vor dem Einsteigen in die Feldbusse schüttelten sich die Männer die Hände, die Frauen nickten einander und den Männern zu, einige rauchten, man stand etwas herum und scharrte mit den Arbeitsschuhen in der Erde.
Den Nusshof kannte ich vom Vorbeifahren. Ein altes, sandfarbenes Haus mit roten Fensterläden, das wie ein Verwaltungsgebäude aussah. Eigentlich handelte es sich um einen alten Gasthof, der schon lange nicht mehr in Betrieb war.
Obwohl es gerade erst dämmerte, schienen die meisten Hilfskräfte hellwach, als hätten sie schlecht oder gar nicht geschlafen. Auch ich hatte in der ersten Nacht kaum Schlaf gefunden. Mehrere Male war ich mit einem komischen Gefühl aufgewacht, ohne mich orientieren zu können, bis sich in der Dunkelheit neben dem Bett das Bürofenster meiner Tante abzuzeichnen begonnen hatte und mir bewusst wurde, dass ich in Ferymont in ihrem Haus im Bett lag, und nicht in meiner Wohnung in Berlin.
Nach dem Rumstehen und Rauchen ging alles sehr schnell. Ein Gruppenleiter wies die Saisonarbeitenden in unterschiedliche Autos, man sprang rein, die Türen gingen zu. Ich quetschte mich auf die Rückbank zwischen andere Erntehelfer, es roch nach Gummi und Autositzen und nach der Erde, die von den Schuhsohlen gefallen und in den Fußräumen getrocknet war.
Der Fahrer des Kleinbusses drehte sich zu den Sitzreihen um.
»Auf eine gute Zusammenarbeit«, sagte er an mich gewandt und grinste. Er hatte ein freundliches Gesicht mit ruhigen Augen. »Woher kommst du?«
»Berlin«, sagte ich.
»Alles klar«, sagte er. »Willkommen.«
Ich war etwas aufgeregt und konzentrierte mich auf das Geräusch der aneinanderreibenden Regenschutzkleidung und auf die Musik, die vorne aus dem Busradio kam.
Draußen vor dem Fenster zog eine Landschaft vorbei, die ich kannte und die mir vertraut war, mir an diesem Morgen aber wie aus einer Welt stammend erschien, die ich noch nie richtig gesehen hatte: die Felder mit dem Gemüse, die Kanäle, die Dörfer mit den im hier typischen Stil gebauten alten Bauernhäusern, die neuen Siedlungen aus weißen, kubusförmigen Gebäuden, vor denen die Firmenautos kleiner Sanitär- oder Heizungsinstallationsunternehmen standen, und dahinter die Hügel des Ferymonter Umlandes, der Jura mit dem Sendeturm auf dem Chasseral, die Hänge mit gründunkelblau schimmerndem Wald, das Wetterloch.
Um die Häuser in den Dörfern wirkte alles aufgeräumt, die Gärten waren winterlich kahl. Um manche Büsche war beiges Vlies gewickelt.
In der Nähe einer Tankstelle fuhren wir an einem Parkplatz vorbei, auf dem Autos, Wohnwagen und Wohnmobile standen. An einer zwischen zwei Rückspiegeln gespannten Wäscheleine hingen Geschirrtücher, zwei Personen luden Werkzeug in einen Koffferraum. Diese Menschen machten in der Region Halt, so lange ich denken konnte, und waren früher in die Dörfer gekommen, um von Tür zu Tür zu gehen und Körbe zu verkaufen oder den Bewohnern verschiedene Dienste wie das Schleifen von Messern oder Fensterputzen anzubieten, die meine Eltern manchmal in Anspruch genommen hatten.
Jetzt schaute ich auf die Autos, Stühle und einen auf dem Asphalt liegenden Ball wie eine Touristin auf eine Attraktion.
Das Große Moos, die Ebene zwischen den Seen um Ferymont, war spärlich besiedelt. Nebst den Aussiedlerhöfen, die weit weg von den Straßen zu sehen waren, standen an den Bahnhöfen der Strecke, die auf einem Damm durch das Flachland führte, kleine Siedlungen mit drei- oder vierstöckigen Wohnblocks. Auch am Bahnhof in Ferymont gab es eine solche Siedlung, eine Ansammlung von Blöcken mit je acht bis zwölf Wohnungen.
Die Dörfer lagen auf den Anhöhen über dem Großen Moos oder an den Ufern der Seen. Sie zogen sich über mehrere Kilometer an den durch das Dorf führenden Hauptstraßen entlang und zersiedelten die Gegend bis in die Ebene, und wenn auch keines der Dörfer ein richtiges Zentrum hatte, so hatte doch das Seeland, wie die Region genannt wurde, eines, nämlich Ferymont, das genau in der Mitte von drei Seen auf einem Hügel lag.
In Ferymont gab es ein Kino, die Bäckereien Wäch und Ritter, zwei Kioske, den Kücheneinrichtungsladen Rieder, zwei Sportartikelgeschäfte, eine Käserei, eine Metzgerei und eine Bibliothek, in der meine Mutter gearbeitet hatte. Außerdem gab es eine Drogerie und eine Apotheke, zwei Supermärkte, eine Papierwarenhandlung, mehrere Friseurläden, eine Schule sowie einen Schachverein, der sich, in Anlehnung an die englische Bezeichnung für die Problemschach-Art Fairy chess, Fairymont nannte und dessen Vereinsräume sich direkt neben der einzigen Tankstelle im Dorf befanden.
Die meisten Leute im Seeland wohnten, wie meine Tante, in Einfamilienhäusern, die so gebaut waren, dass man seine Nachbarn möglichst selten sah und aus den Zimmerfenstern eher auf die Zäune, Hecken oder Mauern blickte, die die Grundstücke voneinander trennten.
In Ferymont kreuzten sich drei Bahnlinien, die die größeren Städte im Umland miteinander verbanden. Außerdem fuhren Postbusse in die kleineren umliegenden Ortschaften.
Nebst den Bahnstrecken durchzog ein Netz aus Landstraßen und Feldwegen die Ebene, sowie die vor etwa zwanzig Jahren fertiggebaute Umfahrungsstraße T10, an deren Ausfahrten in den letzten Jahren Tankstellen, Kleinindustrie, ein paar Discounter und, in der Agglomeration der nächsten größeren Stadt, zwei Einkaufszentren entstanden waren. Drei Strafvollzugsanstalten grenzten an das Große Moos. Ansonsten bestand die Gegend aus den drei Seen, die nach den Überschwemmungen, Versumpfungen und darauffolgenden Entwässerungen übriggeblieben waren, sowie aus Feldern, auf denen intensiv Gemüse angebaut wurde. Vier Hauptkanäle verliefen durch die Ebene und verbanden die Seen, die zulaufenden Flüsse und die kleineren Wasserläufe miteinander.
Der landwirtschaftliche Betrieb, der mich als Saisonarbeiterin eingestellt hatte, war ein mittelgroßes Unternehmen mit dem Namen Bescheder Beeren, das sich auf den Anbau von Spargel und Beerenkulturen spezialisiert hatte. Seine Wohn- und Wirtschaftsgebäude lagen in einem Nachbarort von Ferymont, seine Felder in der Umgebung in der Ebene, an einem der Kanäle und auf der Nordseite eines circa sechshundert Meter hohen Molassehügels mit dem Namen Jolimont, der während der Abtragung des Jura-Faltengebirges entstanden war und in dessen Sandsteinschichten man versteinerte Muscheln und Haizähne finden konnte. Geführt wurde der Betrieb von einem älteren Ehepaar, Herr und Frau Bescheder, die ich von früher von Dorfffesten und anderen Veranstaltungen in der Gegend vom Sehen kannte.
Mit Plastikeinkaufskörben stellten wir uns an einem Ende des Feldes in einer Reihe auf und begannen, die Fläche nach Spargel abzugehen. Die Gruppe bestand aus sieben oder acht älteren Männern, darunter Zef, mit dem ich am Morgen aus Ferymont zum Nusshof gefahren war und der gerne las und felsenfest behauptete, es gäbe nichts, was besser schmeckte als frisch geschnittener grüner Spargel bei Sonnenaufgang.
Seine Frau und er wohnten seit Anfang der 1990er Jahre in Ferymont. Sie lebten in zwei separaten Wohnungen, was beiden, wie Zef erklärte, die nötige Leichtigkeit für ein gelungenes Zusammenleben verleihe. Sie hatten eine Tochter, Meret, die in der Schweiz geboren und vor ein paar Jahren »zurück« nach Pristina gezogen war.
An einem der ersten Vormittage auf dem Spargelfeld fragte mich Zef, ob ich, da ich erzählt hatte, dass ich in Berlin Literaturwissenschaft studierte, den Lyriker Ali Podrimja kennen würde, dessen Gedichtband mit dem Titel Ich sattle das Ross den Tod die erste deutschsprachige Buchveröfffentlichung eines zeitgenössischen albanischen Lyrikers überhaupt gewesen sei. Die Sonne ging hinter der Anhöhe, auf der Ferymont lag, auf, Zef kaute auf einem Spargel und zitierte aus einem Gedicht:
»Der Tod singt weiter / in Sarajevo / und abgerissene Menschenköpfe / kommen weiter als Geschenk / für das schlafende Europa.«
Er intonierte die Zeilen, indem er eine Art Tremolo in seine Stimme legte. Zef war mager und großgewachsen. Er bückte sich und schnitt in einer Bewegung mit seinem Messer einen Spargel genau zwei Zentimeter über der Erdoberfläche ab. Als er sich aufrichtete, sagte er: »Beim Anblick der Berge hier fällt mir immer Podrimja ein.« Er legte den Spargel in den an seinem Arm baumelnden Plastikkorb. »Er hat in seinen Gedichten oft die karge Berglandschaft Gjakovas beschrieben, des Städtchens, in dem er geboren wurde. Wenn ich über die Gegend hier schreiben würde, dann wohl eher ein einfaches, kurzes Gedicht.«
Er bückte sich wieder. Als er sich aufgerichtet hatte, sagte er: »Bei Ferotex werden Zäune hergestellt, / Metallverstrebungen und große Nieten. / Sie werden auf Lastwagen verladen / und bis über die Landesgrenzen hinaus / verfrachtet. – So zum Beispiel. Wie findest du das?«
»Gut!«, sagte ich. »Echt!«
Zef lachte.
Wir stachen drei bis vier Stunden Spargel, dann wechselten die Männer in den Warentransport, die Werkstatt, die Reinigung von Maschinen oder auf ein anderes Feld mit Spargel. Ich wechselte in die Warenaufbereitung, in der die Spargel abgewogen und gebündelt wurden.
Danach fuhr ich, während die anderen Angestellten gemeinsam im Nusshof zu Mittag aßen, nach Hause zu meiner Tante.
An meinem ersten Arbeitstag hatte sie gekocht und war in bester Stimmung. Ich hatte vom Spargelschneiden Rückenschmerzen, ein Ziehen in den Knien und verkrampfte Handgelenke. Ich zog in der Waschküche die Gummistiefel und die Regenhose aus und ging rüber ins Esszimmer.
Meine Tante war eine Dame, aber auch ein – wie sie selber sagte – gefallener Engel. Sie war gutgläubig und schien sich immer wieder Mühe zu geben, die Bildung, die sie erhalten hatte, nicht erkennen zu lassen. Wenn man sich mit ihr unterhielt, spielte sie gerne eine Art Verwirrspiel und relativierte ständig, was sie sagte, oder schmückte ein für das Gespräch nebensächlich erscheinendes Detail aus, sodass ihre Sätze oft unendlich lang und unübersichtlich wurden. Dann war sie plötzlich wieder klar und direkt und gab einsilbige Antworten. Mit dem Alter schien sie es ähnlich zu halten. Sie war Mitte fünfzig, verhielt sich aber wie eine ältere Dame, die eine Jüngere mimte. Wenn es ihr passte, klagte sie über Hüftschmerzen, dann ging sie jeden Tag joggen oder verbrachte ganze Wochenenden mit ihren Freundinnen im Curlingverein in der nächsten größeren Stadt, Neuchâtel, in der sie in einem Lehrmittelverlag als Grafikerin arbeitete. Manchmal tat sie mir leid, da sie in Ferymont nie richtig Anschluss gefunden zu haben schien. Wahrscheinlich fühlte sie sich von meinem Vater und meiner Mutter im Stich gelassen, denn wenn ich erzählte, dass sie angerufen und sich nach ihr erkundigt hätten, betonte sie, wie sehr sie das überraschte und äußerte in sarkastischem Ton, dass sie die Fürsorge meiner Eltern rührend fände.
Es gab Bratkartofffeln mit Speck und Spiegelei und grünen Salat, den meine Tante extra für mich zubereitet hatte, denn normalerweise »glaubte« sie, wie sie sagte, nicht an »grüne Blätter mit dem Vitamingehalt eines Tempo-Taschentuchs«.
Der Salat war eine Art Spezialität der Region und wurde in den Gewächshäusern in der Ebene den ganzen Winter über angepflanzt.
Wir saßen am Esstisch im Wohnzimmer, dessen Fenster den Blick auf den großen Garten freigab.
»Erntet ihr in eurem Betrieb auch Salat?«, fragte meine Tante.
Sie stand immer wieder auf und schob mit einem Pfannenwender mehr Blätter aus der Salatschüssel auf meinen Teller.
»Bis jetzt nicht«, sagte ich. »Danke.«
Ich schirmte meinen Teller mit der Hand ab.
»Wächst dort denn Salat?«, fragte sie.
»Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe noch keinen gesehen«, antwortete ich kauend.
»Ich habe gehört, dass er durch Löcher in einer über der Erde gespannten Plastikfolie wächst«, sagte meine Tante.
»Kann sein«, sagte ich.
»Wächst der Spargel, den ihr erntet, so?«, fragte meine Tante.
»Auf manchen Feldern schon. Die Spargelspitzen durchstoßen dort das Plastik.«
»Unglaublich.«
Ich wehrte einen weiteren Salatangrifff ab. »Zu viel sollte man davon auch nicht essen«, sagte ich.
Meine Tante lachte. »Zu viel Chlorophyll gibt dem Menschen das Gefühl, er sei ein grünes Krokodühl«, flötete sie.
Nach dem Essen setzten wir uns in Liegestühle auf die Veranda, von der eine breite Freitreppe in den Garten hinunterführte. Von hier blickte man über eine große, ungemähte Wiese zu den Bäumen, die das Grundstück von den dahinterliegenden Feldern abtrennten.
Ich hatte eine Stunde Mittagspause und musste bald wieder los.
Meine Tante trank ein Glas Rosé, den sie »Dessert« nannte. Gewöhnlich ging sie gerne in einer Prozedur vom Dessert nach dem Mittagessen zum Aperitif vor der nächsten Mahlzeit am Abend über.
Es war kurz nach ein Uhr und kühl draußen, und wegen der Mittagspause, die zu dieser Zeit überall in Ferymont eingehalten wurde, still über der Ebene. Meine Tante steckte sich eine Zigarette an, es roch nach Wald und kalter Gülle und Rauch.
Sie zog an der Zigarette und blies, den Kopf etwas in den Nacken gelegt, den Rauch in die Luft. »Ich freue mich, dass du hier bist«, sagte sie.
Sie hielt mir die Schachtel entgegen.
Ich schüttelte den Kopf.
»Bist du sicher, dass du die Arbeit auf dem Feld machen willst?«, fragte sie.
Zwar hatte ich überall Muskelkater, aber im Grunde fühlte ich mich ganz gut. Ich war froh, hier und nicht in Berlin zu sein.
»Ich will die Arbeit machen«, sagte ich.
Wir schwiegen eine Weile, während über uns ein Segelflugzeug seine Kreise zog. Es war wahrscheinlich auf dem Flugplatz in Bellechasse gestartet.
Für die Zeit, bis ich wieder losmusste, zog ich mich in das Büro meiner Tante zurück. Ich legte mich auf das Bett, auf dem eine alte Steppdecke von meinen Eltern mit einem Muster aus senfgelben, grünen und weißen Trapezen lag. Kurz verlor sich mein Blick in den scheinbaren Tiefen des Musters und ich erinnerte mich, dass ich es schon als Kind betrachtet hatte. Jetzt schien es mir, als würde ich es zum ersten Mal sehen.
Der vor mir liegende Nachmittag, die Stunden, die ich noch einmal auf dem Feld oder in der Aufbereitung am Band stehend verbringen sollte, kamen mir unendlich lang vor. Ich musste an meine Eltern denken, die vor ein paar Jahren in eine Wohnung im Engadin gezogen waren. Mein Vater schaute wahrscheinlich gerade Nachrichten oder Sport oder arbeitete im Garten, während meine Mutter das Mittagessen zubereitete oder in ihrem Sessel saß und las oder strickte oder auf ihrem Tablet im Internet etwas nachschaute.
Im April erntete ich mit den Frauen die ersten Erdbeeren, die in den hunderte Meter langen Gewächshäusern in der Zihlebene wuchsen. In den Tunneln gab es nur die angestaute Wärme, die fast alle Geräusche schluckte, und das Rascheln des Strohs, wenn man seinen Wagen in der Reihe ein paar Zentimeter weiterschob. Innerhalb weniger Minuten schmerzten die Glieder und Gelenke. Die warmen Temperaturen weichten die Haut auf und der Geruch, den die Erdbeeren ausströmten, drang in die Haut ein und setzte sich in den Schleimhäuten fest. In den Gewächshäusern konnte man nur schlecht atmen, jedes Mal, wenn man den Mund öfffnete, hatte man das Gefühl, in warme Watte zu beißen. Morgens, wenn es kühler war, redeten die Frauen miteinander, aber schon um neun waren die Wärme und die Feuchtigkeit in den Tunneln unerträglich, die Sonne schien auf die Gewächshäuser herunter wie ein Feind, die Stunden zerschmolzen zu einer Unendlichkeit, die Frauen verstummten.
Unsere Gruppenleiterin war eine ältere Frau namens Walentyna. Sie hatte ein freundliches Gesicht und grüne Augen, war groß und drahtig und pflückte schnell und genau. Sie war die Mutter dreier Töchter, die ebenfalls in dem Betrieb arbeiteten und ungefähr in meinem Alter waren.
Zum ersten Mal sah ich die Schwestern, als sie zu dritt in einem der Betriebsautos, einem alten schwarzen Dacia Logan, vor der Aufbereitungsscheune vorfuhren. Es war die Pause am Nachmittag, ich war gerade in die Abläufe in der Erdbeeraufbereitung eingewiesen worden. Aus dem Dacia stiegen Daria, die gefahren war, Aleksandra, die mittlere Schwester, und Ljuba, die jüngste. Dahinter stiegen aus einem schwarzen Passat Darias Mann, der auf dem Hof als Mechaniker arbeitete, Aleksandras Mann, einer der höheren Gruppenleiter und Personalchefs, und Ljubas Verlobter, den ich schon vom Spargelschneiden kannte. Meine Aufmerksamkeit galt aber den Schwestern. Alle drei wirkten respekteinflößend, besonders Daria, die einen offfenen Blick hatte und schwarze, kinnlange Haare. Sie lächelte nicht, alle drei schauten ernst und konzentriert zum Eingang der Aufbereitungsscheune, auf die sie sich zubewegten. Sie trugen die Arbeitskleidung, die wir in der Aufbereitung anzulegen hatten und für die ich mich immer etwas schämte, dicke Winterjacken und -hosen, gefütterte Stiefel und Schals und Mützen, da es in der Nähe des Kühlhauses auch im Sommer sehr kalt sein konnte. Den Schwestern aber verlieh die Kleidung etwas Besonderes. Sie betonte ihre Schönheit.
In der Scheune wirkten die Schwestern wie ausgewechselt. Sie begannen ausgelassen zu reden und scherzten miteinander. Daria schob die Schiebetür zu und schaltete das Licht ein. Über uns öfffnete sich eine hohe Decke. Auf einer Empore lagen Strohballen zu einer Wand aufgestapelt, darunter stand das Kühlhaus, ein grauer Container, der wie ein Ufo aussah und dort fast den ganzen Raum einnahm.
Daria kam auf mich zu und hielt mir ihre Hand entgegen. Sie lächelte. »Ich bin Daria«, sagte sie. Ihre Stimme war klar und bestimmt. Sie sprach, als folgte hinter jedem Wort ein Punkt. »Das sind meine Angestellten.« Sie zeigte auf ihre Schwestern, die angefangen hatten, verschiedene mit Plastikfolie ausgelegte Kisten an die beiden Enden der Spargelsortiermaschine zu stellen.





























