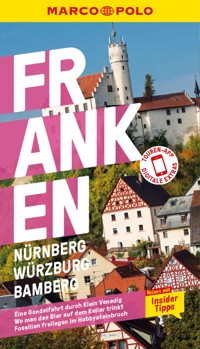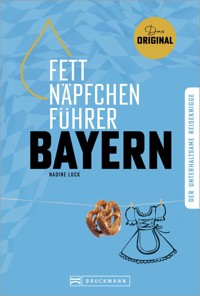
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bruckmann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Jochen aus Wuppertal verliebt sich in Magdalena aus Bayern. Doch als er ihre Heimat besucht, geht es drunter und drüber: Sprachpannen, unerwartete Reaktionen und ein mysteriöses Tier im Wirtshaus – Bayern zeigt sich ihm von seiner kuriosesten Seite. Doch mit jedem Fettnäpfchen wächst sein Verständnis für die bayerische Lebensart. Humorvoll, überraschend und voller Charme!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
FettnäpfchenführerBayern
Nadine Luck
Der Unterhaltsame Reiseknigge
Impressum
© 2025 Bruckmann Verlag GmbH
Infanteriestraße 11a
80797 München
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-7343-3272-2
eISBN: 978-3-7343-3458-0
Autorin: Nadine Luck
Verantwortlich: Susanne Kaufmann
Lektorat und Korrektorat: Charlotte von Schelling
Umschlaggestaltung: derUHLIG Büro für Gestaltung unter Verwendung von Motiven von adobestock (Hintergrundmotiv, Freisteller und Illustration)
Satz: Röser MEDIA, Karlsruhe
Druck und Verarbeitung: Printed in Poland by CGS Printing
Sind Sie mit dem Titel zufrieden? Dann würden wir uns über Ihre Weiterempfehlung freuen.
Erzählen Sie es im Freundeskreis, berichten Sie Ihrem Buchhändler oder bewerten Sie bei Onlinekauf. Und wenn Sie Kritik, Korrekturen, Aktualisierungen haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht an [email protected].
Unser komplettes Programm finden Sie unter
Alle Angaben dieses Werkes wurden von der Autorin sorgfältig recherchiert und auf den neuesten Stand gebracht sowie vom Verlag geprüft. Für die Richtigkeit der Angaben kann jedoch keine Haftung erfolgen. Sollte dieses Werk Links auf Webseiten Dritter enthalten, so machen wir uns diese Inhalte nicht zu eigen und übernehmen für die Inhalte keine Haftung.
Nadine Luck wuchs im niederbayerischen Eggenfelden auf, zog für Studium und Arbeit nach München und lebt heute im fränkischen Bamberg. Dort feiert sie mit ihrem Mann aus Nordrhein-Westfalen täglich den Culture Clash. Als Redakteurin und Buchautorin schreibt sie mit Leidenschaft übers Reisen. Mit ihrer vierköpfigen Familie erkundet sie die Welt – innerhalb und außerhalb der weiß-blauen Grenzpfähle.
www.instagram.com/luck.nadine
Inhalt
Die Protagonisten
Anreise
Ab in den Süden
1
Bayerns Uhren Ticken Anders
Von dreiviertel sieben bis viertel acht
2
Das Maß Aller Dinge
Biertrinken wie ein Bayer
3
Alles Im Butter?
Grammatikalische Schwankungen
4
Sag Niemals Nie Nicht!
Das Ja-Wort und die doppelte Verneinung
5
Wau, Der Waldi
Das Zamperl als heilige Kuh
6
Geografisch Unlogisch
Das alles ist Bayern
7
Habedere
Grüßen auf Bairisch
8
Kruzifix
Bayern, ein Kirchenstaat?
9
Weil’S Nicht Wurscht Is‘
Der Weißwurst-Knigge
10
Hase Küsst Reh
Die aufregende Jagd nach dem
Wolpertinger
11
Ich Wär’ So Weit
Der bairische Konjunktiv
12
Die Domstadt, Die Alle Register Zieht
Politik, Pointen – Passau!
13
Bayern, Die Bellen, Beissen Nicht
Tierische Grüße aus der Oberpfalz
14
Fussballer Und Andere (Anti-)Helden
Die Ruhmeshalle und der Rekordmeister
15
Von Europäischer Relevanz Und Bayerischem Kokain
Rallye durch Regensburg
16
Der Berg Ruft
Bis Haxen, Füße und Beine schmerzen
17
Und Ob Ich Des So Mein’
Der bayerische Grantler
18
Businessmachen In Bayern
Mit Laptop und Lederhose und mit Tiktok und Tracht
19
Beziehungsstatus: Schleife Rechts
Die Macht der Tracht
20
Auf Der
Wiesn
Von Zelten, Mindestverzehr und hendlfettigen Händen
21
Wir Sind Csu
Die Erfinder des weiß-blauen Himmels, einer Foodblog-Reihe und von Recht und Ordnung
22
Zwei Fränkische Lkw
Oder:
Mia san mia san
die anderen
23
Keller Mit Aussicht
Bambergs beste Lage
24
Flaschen Zum Kugeln
Wein(-Franken) auf Bier, das rat ich dir
25
Wo Bayern Schwäbisch Schwätzt
Von schönen Kühen und Frauen
26
Pkw-Maut Auf Dem
Highway To Hell?
Der Bayer, ein Rache suchender Hinterwäldler?
27
Honeymoon, The Bavarian Way
Vom bayerischen Meer bis China
28
Es War Einmal … Ein Märchen
Der ewige Bayernkönig
Anhang
10 Dinge, mit denen Sie sich garantiert blamieren
Glossar
Danksagung
Grüß Gott – besonders herzlich Valentin und Antonia!
Die Protagonisten
Jochen
Der junge Mann aus Wuppertal betritt zum ersten Mal im Leben bayerischen Boden, als er seine Freundin Magdalena in München besucht. Neugierig stürzt er sich ins Abenteuer, doch oft ahnungslos, was die bayerische Kultur betrifft. Sein erstes »Grüß Gott« klingt verdächtig norddeutsch, und beim Versuch, ein Bier zu bestellen, erntet er ein freches Grinsen. Zwischen Brezn, Bierzelt und der Erkenntnis, dass eine doppelte Verneinung anders funktioniert als »Minus mal Minus gibt Plus«, beginnt er zu begreifen, dass Bayern mehr ist als Lederhosen und Alpenpanorama.
Magdalena
Sie stammt eigentlich aus einer Kleinstadt in Niederbayern, zog aber zum Studieren, Leben und Arbeiten in die Großstadt München. Sozialisiert wurde sie durch die Dreifaltigkeit aus Kirche, CSU und Sonntagsbraten, den es bei ihrer Oma nur nach einem anständigen Tischgebet gab. Die Wirtshauskultur hat sie genauso geprägt wie der bayerische Grant. Was sie an Jochen so mag? Nun ja: Für eine waschechte Bayerin ist so ein Kerl aus Wuppertal schon ziemlich exotisch …
Anreise
Ab in den Süden
Im ICE 727 aus Köln, kurz nach Nürnberg, in Richtung München
Der ICE rauscht gleichmäßig durch die flachen Landschaften des nördlichen Bayerns. Die Sonne schimmert durch die großen Zugfenster, Felder und Wiesen ziehen vorbei. Auf einem der Zweierplätze sitzt Jochen, ein Rucksack vor den Füßen, und drückt seine Stirn gegen das Fenster.
»Ehrlich gesagt habe ich mir das anders vorgestellt«, sagt er zu seinem Sitznachbarn, der sich ihm als Max aus München vorgestellt hat und es sehr kurios findet, dass Jochen nie zuvor bayerischen Boden betreten hat und es nun der Liebe wegen tun wird.
»Was meinst du damit?«, fragt Max. »Eine Zugfahrt ist eine Zugfahrt, auch in Bayern!«
»Na ja …« Jochen lässt seinen Blick über die flache Landschaft schweifen. »Wo sind denn die Berge? Ich dachte, Bayern wäre voller Berge. Aber hier – nur Felder, Bäume und, na ja, wieder Felder.«
Max kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Du weißt schon, dass München nicht auf der Zugspitze liegt? Die Alpen findest du erst südlich davon.«
Jochen dreht sich zu ihm, eine Mischung aus Enttäuschung und Verlegenheit auf dem Gesicht. »Ach so? Ich hatte mich innerlich schon darauf vorbereitet, über die Fahrt hinweg Gipfel zu zählen.«
Max schüttelt den Kopf. »Du warst ja wirklich noch nie diesseits des Weißwurstäquators! Man könnte denken, du weißt nichts über Bayern.«
2Das Maß aller Dinge
Biertrinken wie ein Bayer
Münchner Innenstadt, zur Rush Hour in der Schwemme des Hofbräuhauses
»Ein Candle-Light-Dinner wird das nicht«, sagt Jochen mit Blick auf die Tische für jeweils mehrere Personen, an denen in der weltberühmten Schwemme des Hofbräuhauses zahllose Menschen aus der ganzen Welt sitzen. Es ist voll und laut – und es riecht nach Bier. »Wir müssen uns irgendwo dazusetzen.« Magdalena nickt und geht zu einem Tisch, an dem nicht alle Plätze besetzt sind. »Ist hier noch frei?«, fragt sie.
»Haut’s eich hera, na samma mehra«, antwortet ein freundlich aussehender Mann. »Setzt euch hin, dann sind wir mehr«, flüstert Magdalena in Jochens Ohr und sagt laut zu den Herren am Tisch: »Danke schön!«
Das verliebte Paar nimmt bei den Bayern Platz und Jochen schaut sich erst mal um: Ein prächtig bemaltes Kreuzgewölbe mit lukullischen Motiven wie servierfertigen Schweinsköpfen und gegrillten Hühnchen prangt über ihnen. »Durst ist schlimmer als Heimweh« steht über einem Rundbogen, durch den es in andere Teile des Wirtshauses geht. Musiker in Tracht sitzen auf einem Podium im Zentrum des Saales und geben laute, volkstümliche Musik zum Besten. Einige Gäste schunkeln. Eine Kellnerin im Dirndl schiebt sich durch die Reihen, um Riesenbrezn zu verkaufen. »Jetzt ist doch kein Karneval«, denkt Jochen mit Blick auf ihr Outfit und eigentlich mit Blick auf die gesamte Szenerie – und muss schmunzeln. Zünftig ist das, würden die Bayern wohl dazu sagen. Die Stimmung in einem Bierzelt auf dem Oktoberfest dürfte sich von der im Hofbräuhaus nicht wesentlich unterscheiden. Jochen sieht zwei Menschen unschlüssig herumstehen. Aufgrund ihrer lässigen Sweatshirts vermutet er, dass es Amerikaner sind. Sie trauen sich offenbar niemanden zu fragen, ob sie sich dazusetzen dürfen. Verständlich. Es muss seltsam sein für Menschen aus einem Land, in dem die Plätze im Restaurant vom Kellner zugewiesen werden, sich zu fremden Leuten zu quetschen. In ihrer Heimat würde niemand auf die Idee kommen, Gästen dieses Gedränge zuzumuten. Da würde eher in einer langen Schlange am Eingang gewartet, bis großzügig Plätze frei geworden sind. Jochens Gedanken werden unterbrochen, denn eine Kellnerin im Dirndl kommt an den Tisch und fragt: »Was darf’s sein?«
»Ein Maß, bitte«, sagt Jochen.
»A Preiß«, meint der Bayer grinsend, der Magdalena und Jochen gerade an den Tisch gebeten hat – und den Jochen sofort deutlich weniger freundlich findet.
Bevor er etwas erwidern kann, sagt die Kellnerin zu dem Bayern: »Das macht nichts, ich hab’ ihn schon verstanden. Wir haben ja öfter welche hier.«
»Ich dachte, hier bestellt man Maß«, wendet sich Jochen an Magdalena. »Ich hätte ja auch ein Kölsch getrunken, aber ich vermute mal, das gibt es hier nicht. Ihr macht euch ja immer über unsere Getränke in den kleinen Reagenzgläsern lustig …«
»Passt schon«, flüstert seine Liebste ihm zu. »Ich erklär dir später, was der Mann gemeint hat.«
Wenig später ist die Kellnerin mit schweren Maßkrügen für die ganze Runde zurück. Durstig nimmt Jochen sein Bier in die Hand und setzt an.
Doch: »Nur ein Schwein trinkt allein«, sagt der Herr von gerade eben und lacht.
»Jochen, lass uns anstoßen«, sagt Magdalena und zischt ihm zu: »Nimm es nicht persönlich, das ist nur so ein Spruch.«
Jochen ist zwar genervt von »nur so ein Spruch«, aber er stößt an und trinkt. Aus den Augenwinkeln heraus sieht er, dass die Bayern den Krug nochmals auf dem Tisch absetzen, bevor sie trinken.
»Ist ihnen der Krug zu schwer, um ihn sofort zum Mund zu führen?«, flüstert er in Magdalenas Ohr und nimmt gleich noch einen Schluck aus dem schweren Gefäß.
Obacht, neidabbd!
Das Bier ist in Bayern ein Heiligtum, über das die Bewohner gerne und ständig philosophieren. Wer braut das beste, welcher Wirt schenkt welches aus? Oft wird dem Bier aus der örtlichen Brauerei gehuldigt – und meistens zu Recht. Denn Bierbrauen, das können die Bayern. Sie schenken ihr flüssiges Gold auch gerne an Fremde aus. Wenn ein Gast allerdings nicht weiß, wie er die Maß korrekterweise bestellt, dann macht er sich zum Gespött. Und wer sie zwar richtig bestellt, aber falsch ausspricht, taugt ebenfalls zur Lachnummer. Touristen und Zugereiste sollten also besser lernen, wie das gewünschte Bier in lupenreinem Bairisch geordert wird – auch wenn die Bayern es ansonsten nicht ausstehen können, wenn Preußen ihren Dialekt nachahmen.
Einfach ist das nicht. Manche halten ja schon 0,4 Liter für viel Bier – und im Norden der Republik ist es das auch, verglichen mit dem ansonsten ausgeschenkten 0,2-Liter-Kölsch. Die Bayern aber verspotten das »große« 0,4er als Preißn-Halbe. In Bayern entspricht ein kleines Bier 0,5 Litern. Wer dies trinken will, bestellt »eine Halbe« und meint damit 0,5 Liter helles Bier. Das »Helle«, wie es kurz genannt wird, ist eine höchst süffige, helle bis goldgelbe Biersorte mit einer moderaten Hopfennote. Erfunden wurde es als Antwort auf das böhmische Pilsener. In Franken wird der halbe Liter Bier auch gern als Seidla bezeichnet und ebenso bestellt. »Ein Seidla, bitte.« Der Liter Bier heißt in Bayern hingegen »Maß« – eine Bezeichnung, die es außerhalb der bairischen Sprache nicht gibt und die Menschen, die des Bairischen nicht mächtig sind, Probleme bereitet. Denn woher sollen sie wissen, ob es die oder das Maß heißt? Wer sich im Wirtshaus, im Biergarten und auf dem Oktoberfest nicht blamieren will, bestellt jedoch EINE Maß. Und spricht sie aus, als würde in der Getränkekarte »Mass« stehen, mit kurzem »a«, wie in »nass« oder – was im Kontext mindestens genauso gut passt – wie in »Fass«. Wie wir an dieser Stelle lesen können, war der Maß die Rechtschreibreform herzlich Wurst. Wer mag, darf allerdings auch »Mass« schreiben. Der Duden erlaubt es, den Bayern aber gefällt diese Schreibweise eher nicht.
Wenn die Halbe oder die Maß schließlich serviert sind, stoßen alle, die gemeinsam am Tisch sitzen, mindestens vor dem ersten Schluck mit einem herzlichen »Prost!« an. Hierfür fassen sie den Bierkrug am Henkel, denn würden sie den Krug direkt umfassen, könnten sie sich beim Anstoßen die Finger quetschen. Nach dem Anstoßen dürfen die Trinker die Krüge gerne nochmals absetzen. Warum das viele Bayern tun, weiß jedoch niemand so recht. Möglicherweise rührt dieser Brauch daher, dass früher aus Krügen aus Steingut mit Zinndeckeln getrunken wurde. Beim Absetzen stießen die Biertrinker den Deckel mit dem Daumen der Hand, die den Krug hielt, auf, um trinken zu können. Eine andere Erklärung ist, dass durch das Berühren des Tisches symbolisch mit dem Erdboden angestoßen und somit der Verstorbenen gedacht wird. Auch wird das Absetzen mit einem kurzen Innehalten begründet, um Gott für den Genuss dieses wunderbaren Getränks zu danken. Daneben gibt es vermutlich aber auch eine rein praktische Ursache: Beim Anstoßen umfasst man aus oben angeführtem Grund den Krug am Henkel. Das Bier wiegt rund zweieinhalb Kilo, wenn der Krug voll ist – also ziemlich viel. Es ist daher sinnig, abzusetzen und umzugreifen, um den Krug nicht mehr am Henkel, sondern direkt zu umfassen. So hält man ihn stabiler in der Hand. Einheimische greifen automatisiert um und haben diese Trinkweise perfektioniert. Ach ja, wer aus Weizenbiergläsern Weißbier trinkt, stößt mit Gleichgesinnten über die untere Kante des Glases an. Und ein Tipp noch für Jochen, der mit dem Spruch »Nur ein Schwein trinkt allein« konfrontiert wurde: Er könnte antworten: »Nur a Sau nimmt’s genau.«
Bayern Tragen Die Meisterkrone Im Biertrinken
Was den Bierkonsum betrifft, verteidigen die Bayern ihren Titel jedes Jahr aufs Neue. Während deutschlandweit die Trinkerei seit einigen Jahren eine Durststrecke erlebt, wird in Bayern noch vergleichsweise häufig zum Gerstensaft gegriffen: Im Bundesdurchschnitt trinkt statistisch jeder Mensch, vom Baby bis zum Greis, pro Jahr rund 90 Liter Bier; der Durchschnittsbayer genehmigt sich 105 bis 110 Liter. Noch mehr Bier würde im Freistaat Weggehen, wenn es – wie früher – selbstverständlich wäre, dass auch in den Firmenkantinen Bier ausgeschenkt würde. Kein Wunder jedenfalls, dass Bayern auch den höchsten Pro-Kopf-Brauereien-Anteil der Republik hat. Mit gut 600 bayerischen Brauereibetrieben gibt es im Freistaat fast genau so viele wie im Rest des Landes zusammen. Zu den 600 Brauereien gehören freilich nicht nur die großen Münchner Bier-Global-Player, sondern auch viele kleine und mittelständische Betriebe.
Seit 2001 ist die Herkunftsangabe »Bayerisches Bier« EU-weit geschützt und gilt nur für »flüssiges Brot«, wenn es aus bayerischen Sudkesseln stammt und nach dem Bayerischen Reinheitsgebot von 1516 gebraut wurde. Dieses fordert, dass Bier nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser bestehen darf. Beim Brauen gelten verschiedene, zum Teil jahrhundertealte Vorschriften. Trotz dieser Regelwut ist Bayerns Bier nicht gleich Bier. Rund 40 Biersorten und 4.000 verschiedene Biere gibt es im Freistaat. Am beliebtesten sind das Helle und das Weißbier – pur oder als Mischgetränk. Mit Zitronenlimonade wird das Helle zum »Radler« und das Weißbier zum »Russ«. Beide Mischgetränke gelten in Bayern als Biergartenklassiker.
Weissbier-Metropole Bayern
Bayern ist unbestrittener Nabel der Weißbierwelt, obwohl diese spezielle Biersorte ursprünglich aus dem Orient zu stammen scheint, was Abbildungen auf uralten Tongefäßen nahelegen. Der heutige Weißbier-Weltmarktführer – Erdinger Weißbräu – aus Erding in Oberbayern liefert das flüssige Gold in mehr als 100 Länder. Doch praktisch jede der 600 bayerischen Brauereien hat Weißbier, das außerhalb Bayerns als Weizenbier firmiert, im Sortiment. Aber was genau ist ein Weißbier überhaupt? Es ist ein obergäriges Bier mit einem eher geringen Hopfenanteil, wodurch es weniger bitter ist als andere Sorten. Um zum Weißbier zu werden, muss das Getränk zudem mindestens zur Hälfte aus Weizenmalz hergestellt werden. Seine Farbe ist mal naturtrüb, mal kristallklar, mal hell, mal dunkel. Die Trübung ergibt sich durch die beim Brauvorgang eingesetzte Hefe. Was alle Weißbiere auszeichnet: der hohe Kohlensäuregehalt.
Beim Genuss eines Weißbieres ist es am wichtigsten, Zeit mitzubringen. Es lässt sich nicht eben mal aus der Flasche kippen. Weißbier wird seit jeher aus einem hohen, geschwungenen Glas getrunken, das in der Regel einen halben Liter des Getränks fasst. Das hat zwei Gründe. Zum einen schäumt das Weißbier sehr stark und sollte vor dem Trinken im Glas erst einmal zur Ruhe kommen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein Großteil des Bieres statt im Mund auf Kleidung, Tisch oder Boden landet. Zum anderen setzt sich die Hefe des Weißbieres am Flaschenboden ab. Würde man es direkt aus der Flasche trinken, hätte man anfangs keine Hefe im Bier – und gegen Ende zu viel. Darunter würde der Geschmack des Bieres leiden.
Vorsicht: Weißbier einzuschenken, ist eine Herausforderung! Wer einfach loslegt und es wie beispielsweise Wasser ins Glas fließen lässt, scheitert am überschäumenden Temperament des Bieres. Zu starkes Aufschäumen vermeidet, wer das längliche Weißbierglas vor dem Einschenken mit klarem, kaltem Wasser ausspült und es hinterher nicht abtrocknet. Ein leichter Wasserfilm sollte im Glas bleiben. Jetzt gilt es, das Glas leicht schräg zu halten – mindestens im 30-Grad-Winkel. Denn je flacher es beim Einschenken steht, desto weniger Schaum bildet sich. Dreiviertel des Glases dürfen so gefüllt werden. Um auch die Hefe vom Flaschenboden zu lösen, wird die Flasche geschwenkt. Fertig? Jetzt wird der Rest des Bieres mit der gelösten Hefe steil von oben ins Glas geschenkt. Auf diese Weise sollte sich auf dem Weißbier eine prächtige Schaumkrone bilden. Prost!
Die schlechte Nachricht lautet: Ein halber Liter Weißbier hat rund 250 Kalorien. Die gute Nachricht: Wissenschaftler der TU München bescheinigen dem Gerstensaft positive Auswirkungen auf die Gesundheit von Sportlern. Läufer, die sich nach dem Training eine Halbe gönnen, sind um ein Drittel weniger anfällig für Infekte als die Vergleichsgruppe. Wenn sie doch eine Erkältung bekommen, verläuft sie milder oder kürzer. Der Haken an der Geschichte: Der Effekt tritt nur bei der alkoholfreien Variante ein. Doch dies empfiehlt sich sowieso: Wer statt zu normalem Weißbier zu alkoholfreiem greift, spart rund 40 Prozent Kalorien.
3Alles Im Butter?
Grammatikalische Schwankungen
10 Uhr vormittags in einer Wohnung im Münchner Stadtteil Thalkirchen
Am Morgen nach dem Hofbräuhaus-Erlebnis können Magdalena und Jochen ausschlafen. Endlich Wochenende! Endlich gemeinsam frühstücken! Darauf freuen sie sich seit Tagen. Außerdem hat Jochen eine Überraschung für seine Liebste. Doch dafür braucht er Ruhe und Zeit mit ihr allein.
Sie sitzen in der kleinen Küche in Magdalenas Wohnung in Thalkirchen und türmen alles voreinander auf, was sie fürs Frühstück brauchen: Semmeln, wie die Brötchen in Bayern heißen, Croissants, Butter, Schinken und Käse, Marmelade und Ei – und natürlich frisch gebrühten Cappuccino! Allerdings fehlt Magdalena noch etwas.
»Ist es okay, wenn ich den Radio einschalte?«, fragt sie. »Oder stört er dich? Ich bin es gewohnt, morgens immer etwas Musik und die Nachrichten zu hören. Dann ist es nicht so leise in der Wohnung. Wobei, wenn du wirklich irgendwann hierherziehen solltest, brauche ich das vielleicht gar nicht mehr …«
»Nein, nein«, sagt Jochen. »Ich drehe es morgens auch immer an.« Es irritiert ihn jedoch etwas, dass Magdalena »der Radio« gesagt hat. Aber egal, jetzt hat er endlich einmal Gelegenheit, Bayern 3 zu hören, den Sender, bei dem TV-Entertainer Thomas Gottschalk angefangen hat. Als Magdalena etwas später allerdings fragt: »Kannst du mir bitte den Butter reichen?«, kann Jochen sich das Lachen nicht mehr verkneifen.
»Schatz, warum machst du die Butter männlich?« Jochen findet es wirklich witzig. »Sagst du ›der Butter‹, weil du mit mir Butter bei die Fische machen magst?«, scherzt er.
»Was soll das denn jetzt?«, entgegnet sie etwas beleidigt.
»Nicht böse sein«, bittet Jochen. »Denn gerade heute will ich mich besonders gut mit dir vertragen.« Er zieht eine kleine Dose aus seiner Hosentasche, öffnet sie, räuspert sich und fragt: »Willst du meine Frau werden, Magdalena?« Dann deutet er auf die kleine Schatulle. »Der, die, das Ring hier drinnen ist für dich, mein Schatz.«
Obacht, neidabbd!
Von »dem Butter« zu reden, ist kein Magdalen’scher Spezialausdruck. Viele Bayern sagen es. Aber warum tun sie das? Aus bayerischer Sicht war das gerade die falsche Frage an dieser Stelle. Korrekterweise müsste die Frage lauten: Warum heißt es in der Hochsprache »die Butter«? Und noch mehr: Warum heißt es nicht »das Teller« und »der Radio«? Die bairische Version des grammatikalischen Geschlechts dieser Begriffe ist nämlich sprachgeschichtlich betrachtet die logischere oder zumindest die genauso offensichtliche – und somit kein bayerischer Sonderweg. Was die Bayern zu ahnen scheinen, ist Folgendes: Das unscheinbare Wörtchen Butter hat sich aus dem altgriechischen Wort für Kuhquark – boútyron – und schließlich aus dem Lateinischen butyrum entwickelt. Den Endungen zufolge war die-der Butter damals noch ein Neutrum. In den romanischen Sprachen, die aus dem Lateinischen entstanden sind, wurde das sachliche Substantiv männlich. Butter wurde im Französischen und Italienischen zu le beurre und il burro und im verwandten Bairischen eben zu »der Butter«.
Dass sich anderswo »die« Butter herauskristallisiert hat, liegt daran, dass das lateinische butyrum in der Mehrzahlform als butira auf den Tisch gekommen ist und aufgrund der Endung als weiblich missverstanden wurde.
Auch zum bairisch-maskulinen Artikel des Begriffs Radio servieren uns Sprachforscher eine logische Geschichte. Weil es früher der Radio-Apparat hieß, sagen die Bayern häufig »der Radio« und beziehen sich dabei auf den ursprünglich angehängten männlichen Begriff Apparat. Aus dem Radio-Gerät dürfte sich hingegen in der Schriftsprache »das Radio« entwickelt haben.
Ähnlich verhält es sich beim Begriff Teller, der vom altfranzösischen tailleoir abstammt. Hiermit war das Brett gemeint, auf dem Obst, Gemüse und Fleisch klein geschnitten wurden. Damit hierzulande auch dem letzten Küchenjungen klar war, welchem Zweck diese Platte diente, hängte man im Deutschen früher das Wort Brett an. Speisen gab es folglich auf dem tailleoir-brett. Von diesem tailleoir-brett