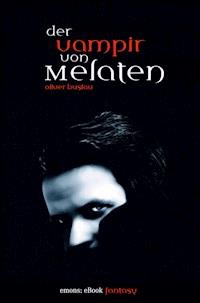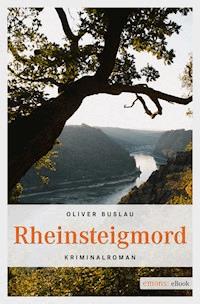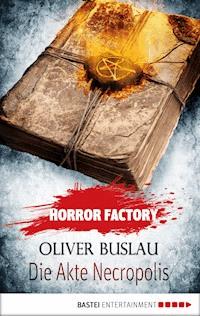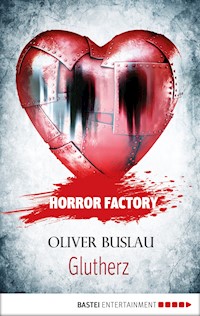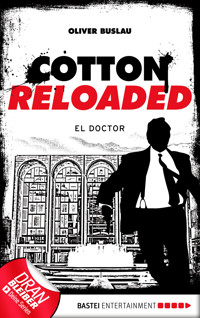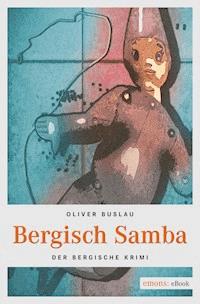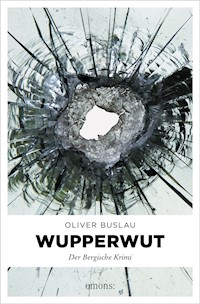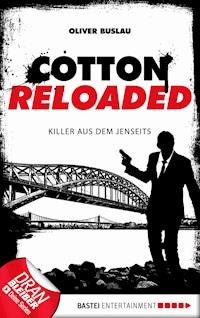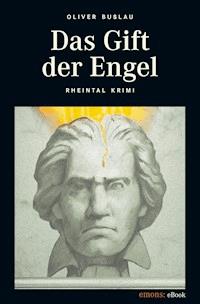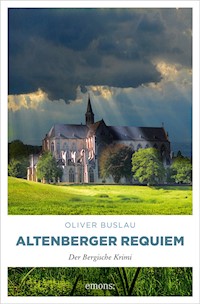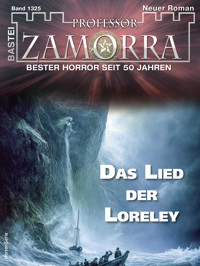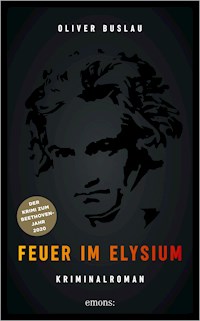
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann eine Sinfonie die Freiheit bringen? Als der junge Schlossverwalter Sebastian Reiser nach Wien gelangt, bereitet Ludwig van Beethoven gerade die Uraufführung seiner neunten Sinfonie vor. Die ganze Stadt fiebert dem Konzert im Kärntnertortheater entgegen. Doch die Aufführung ist umstritten – nicht nur bei den konservativen Musikenthusiasten, sondern auch bei verbotenen Burschenschaften. Reiser bekommt die Chance, im Orchester mitzuwirken, und gerät in ein gefährliches Geflecht aus Intrigen und geheimer Politik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen basieren auf historischen Tatsachen, sind aber teilweise frei erfunden.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
©2019 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: shutterstock.com/UGChannel Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-513-8 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unterwww.emons-verlag.de
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
was der Mode Schwert geteilt;
Bettler werden Fürstenbrüder,
wo dein sanfter Flügel weilt.
Beginn der Ode »An die Freude« von Friedrich Schiller, erste Fassung
Hast du einen Freund hienieden,
trau ihm nicht zu dieser Stunde,
freundlich wohl mit Aug’ und Munde,
sinnt er Krieg im tück’schen Frieden.
1
Mai 1874
Reiser schreckte hoch, als der Klang einer Violine durch das Schloss drang. Leere Quinten, Doppelgriffe, eine dazwischen aufblitzende virtuose Tonleiter.
War er eingenickt?
Ja, und offenbar hatten ihn die Geigentöne geweckt.
Jetzt begann der Spieler mit dem Solopart eines Konzerts. Eins dieser modernen Bravourstücke, nur darauf angelegt, den Solisten in bestem Licht dastehen zu lassen. Oberflächliches Zeug. Und doch erfüllte es Reiser mit Stolz, als er seinen Enkel da drüben so virtuos spielen hörte.
Er streckte seine müden Glieder. Die Gelenke schmerzten. Vor wenigen Wochen hatten sie seinen zweiundsiebzigsten Geburtstag gefeiert. Man war eben nicht mehr der Jüngste.
Die Tür ging leise auf, und Theresia erschien. Wie schön sie war– immer noch, nach all den Jahren. Im Dämmerlicht des Abends wirkte sie fast so anmutig wie damals, als er sie geheiratet hatte. Dabei war sie gerade mal fünf Jahre jünger als er.
»Stört dich der Franzl? Ich hab ihm gesagt, er soll nach dem Abendessen nicht mehr üben. Aber er kann’s nicht abwarten, nach den Ferien dem Herrn Professor das Konzert vorzuspielen.«
Reiser rang ein Gähnen nieder. Ja, der Herr Professor Joachim. Der war eine Kapazität in Berlin.
Warum musste der Franz eigentlich in Berlin studieren? Wo man doch hier in Österreich war? Im Land der Musik?
»Ach, lass den Jungen nur.«
Sie deutete auf das Kaminfeuer. Die Holzscheite waren heruntergebrannt. »Möchtest du es wärmer haben? Ich kann einheizen lassen.«
Das Violinspiel war wieder verstummt. Und im nächsten Moment drückte sich Franz an seiner Großmutter vorbei ins Zimmer, die rötlich glänzende Geige in der Hand. »Es tut mir leid, Großpapa, aber mir ging den ganzen Tag dieser Fingersatz durch den Kopf, und jetzt musste ich ihn einfach ausprobieren.«
Reiser setzte sich gerade hin. Es war ihm unangenehm, vor seinem Enkel wie ein Wrack im Sessel zu versinken.
Der Junge legte das Instrument vorsichtig auf Reisers Sekretär. »Ich wollte dich sprechen. Hast du einen Augenblick Zeit?«
»Um was geht es denn?«, fragte er. Dabei konnte er es sich denken. Und natürlich hatte er alle Zeit der Welt. Wenn er die Kleinigkeit außer Acht ließ, dass der Tod immer näher rückte.
Theresia hatte sich zurückgezogen. Franz setzte sich ordentlich auf den zweiten Sessel. »In Berlin wird zurzeit viel über die neunte Sinfonie von Beethoven geredet«, begann er.
Reiser hatte geglaubt, der Enkel brauche mal wieder Geld. Nun war es doch etwas anderes. Na gut.
»Das gehört sich auch so«, sagte er. »Ich hoffe, man studiert diese bedeutende Musik fleißig.«
»Papa meint, es gebe in der Familie ein gewisses Gerücht.« Er zögerte. »Es heißt, du hättest bei der ersten Aufführung der Sinfonie mitgespielt. Und hättest Beethoven sogar persönlich gekannt. Stimmt das?«
Reiser unterdrückte ein Seufzen. Oje, diese Geschichte… Na ja, kein Wunder, dass der Junge sich dafür interessierte. Als Musikstudent. »Wenn dein Vater es sagt.«
»Soll das heißen, es stimmt?«
»Nun… Vielleicht.«
»Vielleicht?« Franz hob die Augenbrauen. »Großpapa, wenn das wahr ist… Warum hast du es nie erwähnt? Ich möchte alles darüber erfahren. Du musst mir das erzählen, bevor…« Er brach ab.
Bevor du stirbst, dachte Reiser. Das hatte er sagen wollen. »Es ist nicht so einfach«, murmelte er, und ihm wurde klar, wie hilflos er klang.
»Schau, Großvater, die Musik bedeutet mir so viel. Da studiere ich Beethovens Kompositionen… die Sonaten, das Violinkonzert. Und mein eigener Großvater hat das alles erlebt, doch ich weiß nichts davon.«
Reiser seufzte. Diese Geschichte war nichts, was man jemandem zwischen Tür und Angel erzählte. Seinem eigenen Sohn gegenüber, der ebenfalls Franz hieß, hatte er einst Andeutungen die Ereignisse betreffend gemacht. Aber der Filius hatte sich mehr für die Zahlen in Geschäftsbüchern interessiert als für Musik. Sein Enkel dagegen…
»Ich habe tatsächlich einiges von ihm gespielt, als ich so alt war wie du. Und deine Großmutter hat mich am Klavier begleitet. Hier im Schloss.«
»War Beethoven etwa auch hier auf Sonnberg?«
»Nein, nein.« Rasch winkte er ab. Nicht dass noch mehr Gerüchte aufkamen.
Franz wirkte enttäuscht. »Weißt du eigentlich«, sagte er, »dass es fast genau fünfzig Jahre her ist, dass die neunte Sinfonie zur Uraufführung kam?«
Reiser stutzte. Er rechnete nach. Aber ja. Das stimmte! An das Datum würde er sich ewig erinnern. Der 7.Mai 1824. Heute schrieben sie das Jahr 1874. Ostern war gerade vorbei. Es war die gleiche Zeit wie damals.
Als alles begonnen hatte.
Die Jahre verrannen wie Sekunden. Franz hatte recht. Es konnte morgen zu spät sein. Aber wenn er das alles schon erzählte, dann wollte er es auch richtig tun. Gründlich. »Wir werden Zeit brauchen«, sagte er. »Und Ruhe.« Ächzend schickte er sich an, aufzustehen.
»Brauchst du etwas?«, fragte Franz. »Ich hole es dir gern.«
»Nein, das mache ich schon selbst.« Er kämpfte gegen die Schmerzen an, erhob sich, schlurfte hinüber zum Schreibtisch und öffnete eines der Seitenfächer.
Nach einigem Suchen entnahm er ihm eine lederne Mappe, die er auf die Arbeitsfläche legte und aufschlug. Der Inhalt bestand aus einigen Papieren. Es waren beschriebene Blätter, außerdem handschriftliche Noten.
Franz war aufgestanden und betrachtete die Sachen. »Ist das etwa Beethovens Schrift? Und was ist das hier? Eine Romanze für Violine und Klavier. Auch von Beethoven?«
»Nein. Aber das hier, das ist von seiner Hand.«
Franz machte große Augen. »Das ist ein Brief an dich.«
Reiser nickte. Er überflog die Zeilen, und mit jedem Buchstaben wurde die Erinnerung deutlicher.
Mein lieber Reiser,
bitte verzeihen Sie mir meine Unbeherrschtheit. Was vorgefallen ist, bedauere ich. Ich weiß, Sie sind ganz und gar auf meiner Seite und setzen sich für mich und meine Kunst– was dasselbe ist– ein. Ich schätze das sehr, und ich möchte Sie nicht im Zweifel darüber lassen, dass ich Ihnen zu Dank verpflichtet bin. Bitte lassen Sie in diesem Bestreben nicht nach. Wir alle, die wir die Kunst und das, was sie in der Welt vermag, lieben– wir alle, die wir zu einer brüderlichen Gemeinschaft derjenigen gehören, die auf bessere Zeiten hoffen–, wir alle finden uns in der Kunst zusammen.
B.
»Das ist ja unglaublich«, rief Franz. »Großpapa, das…«
»Setz dich«, wies Reiser ihn an, und es klang strenger als beabsichtigt. Er griff nach der Glocke, die neben ihm auf dem Schreibtisch stand, und klingelte. Als der Diener erschien, bat er darum, das Kaminfeuer anzuheizen. Und er trug ihm auf, den anderen im Haus auszurichten, dass sie nicht gestört zu werden wünschten.
Mit der Mappe in der Hand ging er zu seinem Platz zurück. »Ich hätte dir die Geschichte schon längst erzählen sollen, Franz. Aber wie oft warst du hier bei uns auf Sonnberg, seit du studierst? Zwei Mal, wenn ich mich recht entsinne. Bitte sieh es mir nach, dass ich nicht daran gedacht habe. Ach ja, du kannst uns etwas von dem Wein dort drüben servieren, dann muss ich nicht noch mal nach dem Diener klingeln. Das habe ich ihm aufzutragen vergessen. Ich werde eben alt.«
Franz gehorchte schweigend. Kurz darauf saßen sie wieder in den Sesseln.
Reiser konzentrierte sich.
Fünfzig Jahre, dachte er.
Es war nicht nur die Zeitspanne, die ihn erschreckte. Es waren die Veränderungen. Heute fuhren Eisenbahnen durch das Land. Auf der Donau konnte man mit dem Dampfschiff reisen. Maschinen leisteten die Arbeit von Tausenden von Arbeitern. Und anstatt Bilder zu malen, stellte man neuerdings einen Holzkasten auf, der Motive in unfassbarer Genauigkeit einfing.
»Großvater, ist alles in Ordnung?«, erkundigte sich Franz besorgt.
Das Kaminfeuer knisterte. Eine Flamme schoss hell nach oben. Und das orangerote Licht wurde in Reiser zu einem Klang– zu einem wütend auffahrenden Akkord.
»Was? Ja, ja.«
Der Enkel wurde ungeduldig. »Wie hast du Beethoven denn nun getroffen? Wie war das mit der neunten Sinfonie? Stimmt es eigentlich, dass Beethoven das Werk selbst gar nicht hören konnte, weil er taub war?«
Reiser schüttelte widerwillig den Kopf. Er durfte die Geschichte nicht mit Beethoven beginnen. Auch nicht mit sich selbst. Es begann auch nicht in Wien. Sondern in Nürnberg.
»In Nürnberg?«, fragte Franz überrascht.
Offenbar hatte Reiser es laut ausgesprochen.
»Allerdings. Es begann mit einem Studenten. Er hieß Kreutz. Theodor Kreutz.«
»Was war mit ihm?«
Das Feuer knackte. Ab und zu gab es ein Fauchen von sich. Der Akkord in Reisers Gedanken war verklungen. In der Stille, die er hinterlassen hatte, wehte ihn eine andere Erinnerung an. Es war eine weihevolle, erhabene Melodie in der raunenden Klangfarbe der tiefen Streicher eines Orchesters. Ganz allein schwebte sie im Raum, ohne jede Begleitung, fast bescheiden und doch kraftvoll und angefüllt mit großer Verheißung.
Reiser lauschte den Tönen ein paar Atemzüge lang hinterher.
2
Samstag, 24.April 1824
Die Nürnberger Lorenzkirche läutete gerade zur sechsten Stunde, als Kreutz in die kleine Gasse hetzte, den Korb mit Brot, ein wenig Käse und Wurst an den Körper gepresst. Gut, dass er das noch ergattert hatte, bevor der Abend hereinbrach.
Er öffnete die Haustür und wollte gerade die erste Stufe der Stiege nehmen, da hörte er von oben Stimmen. Ein dunkler Bariton sagte etwas Unverständliches. Eine zweite, heller klingende Stimme antwortete.
Die Wirtin!
Kreutz erstarrte.
Vor einigen Wochen hatte er bei Wellendorf Unterschlupf gefunden, der die Dachkammer bewohnte. Eingenistet hatte er sich bei ihm, so hätte es eine böse Zunge formuliert.
Wellendorf erhielt hin und wieder Geld von seiner Familie und hatte eine Anstellung als Hauslehrer in Aussicht. Kreutz dagegen schlug sich so durch. Er träumte davon, sein Studium zu beenden. Dem stand allerdings einiges entgegen. Zum Beispiel, dass er auf einer gewissen Liste gesuchter Personen stand.
Es war besser, wenn ihn die Wirtin nicht sah.
Aber Kreutz hatte zu lange gewartet. Zwei Personen kamen die Treppe herunter. Die Wirtin mit ihrer schmutzigen Schürze ging voran, gefolgt von einem schweren, bärtigen Mann. Als sie Kreutz bemerkte, warf sie ihm einen bösen Blick zu.
»Ach, der Herr ist auch zugegen«, sagte sie. »Und oben stirbt der Freund. Was soll man davon halten?«
»Er stirbt?«, fragte Kreutz. Dabei wusste er, wie es um Wellendorf stand. Er war lungenkrank, spuckte hin und wieder Blut und hatte Fieber.
»Sind Sie ein Freund von Herrn Wellendorf?«, fragte der Herr, der offenbar ein Arzt war. Jetzt erst sah Kreutz die Tasche, die er bei sich trug.
»Freund, Mitbewohner und Ausnutzer«, kam es bissig von der Wirtin.
»Ich nehme an, ich kann Ihnen die Pflicht auferlegen, sich um das Nötigste zu kümmern, mein Herr«, sagte der Doktor. »Ihrem Freund geht es sehr schlecht. Frau Weisendorfer hat recht gehandelt, mich zu holen. Seine Not kann nur gelindert werden, indem Sie ihm Ruhe gönnen.« Er lüftete den Hut, nickte Kreutz und der Wirtin zu und trat hinaus auf die Gasse.
Kreutz drängte sich an der alten Frau vorbei, die ihm etwas hinterherkeifte, das wie »Schmarotzer, elender« klang.
In der winzigen Dachstube, die nur eine kleine Luke nach draußen besaß und in der es auch tagsüber immer dämmrig war, brannte eine Kerze. Wellendorf lag auf dem Bett, das Gesicht schweißglänzend und grau. Sein Körper zeichnete sich schmal unter der eng anliegenden Decke ab. Er hatte die Augen geschlossen, atmete rasselnd und pfeifend.
»Schau, was ich habe«, sagte Kreutz. Als er den Korb abstellte, fiel sein Blick auf die kleine Holzschatulle auf dem Regal. Der Deckel war hochgeklappt. Ein paar Münzen fehlten. Der Arzt hatte sich sein Honorar wohl einfach genommen.
Das Bettzeug raschelte. »Theo…dor«, brachte Wellendorf mit schwacher Stimme hervor. Seine Augäpfel rollten wild hin und her. Plötzlich bäumte er sich auf. Ein Hustenanfall beförderte einen Schwall Blut hervor. Kreutz konnte ihm gerade noch einen von den alten Stofffetzen hinhalten, die für solche Fälle neben dem Bett bereitlagen.
»Du musst dich ausruhen, sagte der Doktor.«
Wie lächerlich das klang. Wellendorf tat ja nichts anderes als liegen. Und gesund machte ihn das nicht.
»Willst du was essen?« Er zeigte auf den Korb. »Milch konnte ich leider nicht auftreiben, aber ich habe…«
Wellendorfs Hand kroch unter der dünnen Bettdecke hervor. »Theo…dor. Hör… mir zu.« Er deutete mühsam auf das Fußende des Bettes, wo ein kleines Schreibpult stand. Es war gerade groß genug, dass ein Bogen Papier darauf Platz hatte. Auf der groben Holzfläche lag ein Brief. »Den… hat jemand… abgegeben«, sagte Wellendorf.
So war das also gewesen. Die Wirtin hatte den Brief heraufgebracht, dabei Wellendorfs Zustand bemerkt und den Arzt geholt. Dass Kreutz in der Stube mit untergekrochen war, wusste sie natürlich schon länger.
Der Brief war an den Freund adressiert. Kein Absender. Ein rotes Siegel verschloss den zusammengefalteten Papierbogen.
»Was ist das?«
»Öffne…«, kam es vom Bett.
»Ist er von deinem Vater?«
Wellendorfs Eltern lebten bei Erlangen. Der Vater war Geistlicher, genau wie Kreutz’ Onkel. Nach dem Tod seiner Eltern war Kreutz bei ihm aufgewachsen.
Nein, das war nicht die Schrift von Wellendorf senior. Der Brief kam woandersher. Er blickte wieder zum Bett. Sein Freund hatte die Augen geschlossen. Sein Atem rasselte noch.
Kreutz brach das Siegel, faltete das Papier auseinander und verzog überrascht das Gesicht. Es war gar kein richtiger Text. Es gab zwar Buchstaben, aber sie waren immer wieder durch andere Zeichen unterbrochen. Fünf Linien standen jeweils untereinander. Auf oder zwischen einer Linie gab es Punkte. Das waren Musiknoten.
Er stellte die Kerze auf das Pult und setzte sich auf den Schemel davor. Dann nahm er sich die Botschaft genau vor.
Die Buchstaben allein ergaben keinen Sinn.
IUNITRNRWRTNI!
Wellendorf wusste viel über Musik. Er hatte sogar in der Kirche seines Vaters Orgel gespielt. Kreutz dagegen konnte höchstens die verbotenen Burschenschaftslieder mitsingen. Und bei denen interessierten ihn weniger die Melodien, sondern eher die Texte.
Ob die fehlenden Buchstaben aus den Noten herzuleiten waren? Noten waren ja nach Buchstaben benannt. Wellendorf hatte ihm erklärt, wie man sie las. Wenn man den gebräuchlichen Violinschlüssel zur Grundlage nahm, dann befand sich auf der zweiten Linie von unten die NoteG. Danach kam dasA, dasH, dann dasC, dasD, dasE…
Kreutz versuchte es, und das Bild vervollständigte sich:
DIEUNICHTARENERWARTENDICH!
Aber das war noch nicht alles. Setzte man vor dasH ein kleines B-Vorzeichen, erhielt man die NoteB. Vor einemE ergab sich so die Note Es. Und diese beiden, Bund Es, kamen in dem Text ebenfalls vor. Wobei man das Es an der entsprechenden Stelle natürlich alsS schreiben musste.
DIEUNSICHTBARENERWARTENDICH!
»Wellendorf, das musst du dir ansehen!«, rief Kreutz, von Erregung gepackt. »Es heißt: Die Unsichtbaren erwarten dich!« Aber der Freund schlief, eine dicke Schweißschicht auf der Stirn.
Die Unsichtbaren…
Das klang wie die »Unbedingten«. Die Jenaer Studentenbewegung. Oder wie die Gießener »Schwarzen«. Oder der »Jünglingsbund«. Allesamt verboten und verfolgt. Die Mitglieder verstreut in alle Winde, seit Fürst Metternichs scharfer Verfolgung der Revolutionäre.
»Wer hat das gebracht?«, fragte er.
Wellendorf rührte sich nicht.
»Und warum hat er es dir gebracht?«, fragte Kreutz sich selbst. »Warum nicht mir?«
Weil man nicht wusste, wo er steckte. Er war ja auf der Flucht. Dass er hier untergetaucht war, konnten sie nicht wissen. Oder ahnten sie es und hatten den Brief deshalb zu Wellendorf gebracht? Dass das Gesetz ihn hier noch nicht gefunden hatte, lag wohl nur daran, dass die Mühlen der staatlichen Verfolgung gerade ganz woanders mahlten. Vielleicht da, wo sich diese Unsichtbaren trafen.
Wer waren sie? Wieder eine neue Bewegung?
Es gab so viele kleine, zersplitterte Gruppen. Jeder kochte nach den Kriegen gegen Napoleon und der Restauration der Adelsgesellschaft sein eigenes Süppchen. Nicht nur in den deutschen Ländern. In ganz Europa. Von Spanien bis nach Italien, von Frankreich bis nach Polen und weiter nach Russland. Kreutz klangen noch die Worte seines Gefährten Karl Follen im Ohr. Dem Gründer der Unbedingten, dem charismatischen Redner. Dem Genie unter den Revolutionären.
Es wird der Tag kommen, da werden wir uns vereinigen. Wir werden alle Kräfte, die jetzt vereinzelt und schwach wie kleine Flammen im Kampf gegen einen Wasserfall sofort verlöschen, bündeln. Und es wird eine neue Revolution geben. Nicht in einem einzigen Land wie damals im französischen Königreich.
In ganz Europa diesmal.
Auf der ganzen Welt.
Kreutz erfasste der gleiche Schauer, mit dem er immer seinen Reden gelauscht hatte. Der Schauer, den man in einem Moment der Wahrheit empfand. Wenn man sich der Ewigkeit verbunden fühlte. Wo mochte Follen jetzt sein? Sicher versteckte er sich, genau wie Kreutz.
Er murmelte das geheime Bundeszeichen vor sich hin, mit dem sich Angehörige der Burschenschaften zu erkennen gaben.
»Im Herzen Mut, Trotz unterm Hut, am Schwerte Blut, macht alles gut.«
In schriftlichen Botschaften kürzten sie die Worte mit den Buchstaben M,H,B undG ab.
War in dem Brief etwas davon zu finden?
Neugierig machte er sich daran, den Rest zu entschlüsseln, denn es folgten noch ein paar Zeilen. Sie enthielten eine Ortsangabe: Regensburg. Kornmarkt. Dazu ein Datum und eine Uhrzeit: am 27.April zur Mittagsstunde.
Er blickte wieder zu Wellendorf hinüber. Wenn der ihm doch wenigstens etwas über den Überbringer der Nachricht sagen könnte. Der Atem des Freundes war schwächer geworden. Langsam hob und senkte sich seine Brust, begleitet von leisem Rasseln.
Kreutz verbrachte die Abendstunden in der engen Stube bei dem schlafenden Freund. Nachdenkend. Grübelnd.
Die Unsichtbaren. War es der Versuch, alle Gruppen zu vereinen, endlich eine große, eine starke Verbindung zu schaffen, die für die staatlichen Verfolger bis zuletzt nicht zu erkennen wäre? Für konservative Augen unsichtbar?
Gegen Mitternacht sank er erschöpft auf sein Lager in der anderen Ecke der Kammer, ohne zu einem Ergebnis gekommen zu sein. Nach wilden Träumen erwachte er bei Tagesanbruch. Die Morgenglocken der Stadt ließen ihr Geläut hören.
3
Dienstag, 27.April 1824
Es war ein schöner Frühlingstag, etwas mehr als eine Woche nach dem Osterfest, und Reiser eilte, wie so oft in letzter Zeit, verstohlen die Schlossmauer entlang, hin zur hinteren Pforte. Die Rückseite des zweiflügeligen Schlosses– und damit von dort aus gesehen auch er– lag fast vollständig hinter hohen Eichen verborgen. Sollte jemand zufällig einen Blick aus dem Fenster werfen, würde er ihn nicht sehen.
Hinter der Mauer schlängelte sich ein Pfad durch ein kleines, verwunschenes Gehölz. Dann kam eine abschüssige Wiese, an deren Ende wie hingewürfelt ein Dutzend graue Felsbrocken lagen. Wenn man sich auskannte, wusste man, wie man auf direktem Wege durch das steinerne Labyrinth kam, woraufhin man an eine Felsnase gelangte, die einen weiten Blick über die Michelsklamm und die sich dahinter verlierenden Höhenzüge bot. Nur Wiesen und bewaldete Bergrücken waren hier zu sehen. Kein Haus. Außer der langen Holzbrücke über die Schlucht gab es nichts von Menschenhand Gebautes.
Der offizielle Spazierweg vom Schloss hierher war Reiser verwehrt, wenn er sich mit Theresia von Sonnberg traf, der neunzehnjährigen Tochter des Edlen. Was ihnen an gemeinsamer Zeit erlaubt war, beschränkte sich auf die wenigen Stunden pro Woche, die sie der Musik widmen durften. Wie es sich für eine höhere Tochter gehörte, spielte Theresia das Pianoforte. Reiser hatte in seiner Schulzeit in Wien das Violinspiel erlernt, und so musizierten sie zusammen, alle anderen Treffen mussten heimlich erfolgen.
Er setzte sich auf einen der Felsen und genoss den Anblick der Landschaft, die wie ein herrliches Gemälde vor ihm ausgebreitet lag.
Eigentlich durfte er sich solch romantische Stunden gar nicht erlauben. Als angehender Verwalter des Schlosses hatte er sich Tag für Tag mit Zahlen zu befassen. Erträge aus den Besitztümern des Edlen, zu denen nicht nur die Ländereien rund um das Schloss, sondern auch einige Kohlegruben im Osten gehörten. Der Edle war der Ansicht, nicht dem Holz, sondern der Kohle gehöre die Zukunft. Womit er wohl recht hatte, wenn man moderne Erfindungen wie die Dampfschiffe und verschiedene andere Maschinen betrachtete. Eines Tages, so hatte der Edle schon oft prophezeit, werde die Kohle sogar die Pferde abschaffen und dafür sorgen, dass die Wagen mit Hilfe einer eingebauten Maschine von allein fuhren. Und nicht nur auf Schienen, wie es das schon jetzt in England gab, sondern überall. Auf Straßen und Wegen. Wer dann Kohle als Brennstoff liefern konnte, war in der besten geschäftlichen Situation.
Reiser war fasziniert von diesen Gedanken. Mehr noch reizte ihn aber die Musik.
Er war sehr gut in seiner Arbeit in der Verwaltung, doch er konnte auch die andere, die musische Seite in sich nicht unterdrücken. Während seiner Schulzeit in Wien hatte er eine Sonate des Komponisten Ludwig van Beethoven abgeschrieben. Die Druckausgabe hatte er sich nicht leisten können, daher hatte er sie sich ausgeliehen und mühevoll von Hand kopiert. Alle Welt sprach derzeit von diesem Tonkünstler, dessen Werke so eigenartig neu waren. Reiser hatte die Abschrift aufbewahrt und das Stück mit Theresia geübt. Es begann nicht wie üblich mit einer richtigen Melodie, sondern mit einem ungewohnten Triller– einer musikalischen Liebkosung, die wie ein klanggewordenes zärtliches Streichen über eine weiche Wange war, ein hingehauchter Kuss. Sie hatten nie darüber gesprochen, aber Theresia empfand die Musik genauso, da war er sicher. Manchmal errötete sie beim Spielen– wenn eine Stelle kam, an der sie gemeinsam eine Melodie in eine Steigerung führten und sich der Ausdruck nach und nach ins Leidenschaftliche veränderte.
Auch die Landschaft war Musik. Das leise Säuseln des Windes, verbunden mit dem Gezwitscher der Vögel, die sich im blauen Himmel des Frühlings tummelten. Das ferne Rauschen des Michelsbaches, der in den Tiefen der Klamm schäumte.
Etwas riss Reiser aus seinen Gedanken. Eine Bewegung bei der Brücke, die als hellbraune horizontale Linie über dem dunklen Grün des Waldes schwebte. Für einen kurzen Moment glaubte er, zwischen den Tannen an der linken Seite eine Gestalt in ganz und gar dunkler Kleidung zu sehen. Ein Gesicht war nicht zu erkennen, nur ein dunkler Haarschopf. Die Erscheinung war wie ein Schatten, der sich aber sofort wieder in dem Dunkel zwischen den Stämmen aufzulösen schien. Reiser kniff die Augen zusammen. Vielleicht hatte er sich getäuscht.
»Sebastian«, sagte Theresia hinter ihm.
Er hatte sie gar nicht kommen gehört. Sie trug heute wieder ihr blassrosa Kleid, dazu den farblich passenden Hut und Schal. Ihr Vater hätte sie gerügt, hätte er gesehen, dass sie sich in diesem Aufzug auf die Felsen setzte.
Reiser stand auf und beugte den Oberkörper. Sie hielt ihm die rechte Hand hin, die in einem weißen Handschuh steckte, und er deutete einen Handkuss an. Ihr Lächeln zeigte, wie überflüssig sie diese formale Begrüßung fand.
Alles, was er seit seiner Ankunft hier empfunden hatte, verband sich in ihrer Gegenwart zu einem wunderbaren Glücksgefühl: der Eindruck der Natur, die Gedanken an die Musik. Theresias Nähe veredelte das alles zu einem wunderbaren Ganzen.
Dabei war sie noch nicht einmal hübsch. Jedenfalls nicht nach den Maßstäben der Zeit. Ihr Gesicht war ein wenig zu breit. Ihre Augen waren zu klein, um so kindlich naiv dreinzublicken, wie es das Schönheitsideal junger Damen verlangte. Und darüber hinaus tummelten sich in Theresias Gesicht Schwärme von Sommersprossen. Bis jetzt war jeder Versuch, sie mit Puder im Zaum zu halten, erfolglos gewesen.
Vielleicht war das der Grund, warum Theresia trotz ihrer neunzehn Jahre noch ledig war. Zwei Saisons hindurch hatte sie, wie es üblich war, Bälle besucht. Niemand hatte sie mehrmals zum Tanzen aufgefordert, was als Vorstufe zu einer Verlobung unerlässlich war. Eine dritte Saison zu besuchen und Gefahr zu laufen, wieder sitzen zu bleiben, wäre peinlich gewesen. Dabei hatte Theresia, einziges Kind des Edlen von Sonnberg, eine ordentliche Mitgift zu bieten.
Reiser wäre gern derjenige gewesen, der Theresia aus dem ledigen Stand befreite. Doch diesen Gedanken auch nur zu denken, war schon ein Abenteuer.
»Mein Vater wird dir etwas mitteilen«, sagte sie. »Etwas Bedeutsames. Ich habe ihn darüber sprechen hören.«
»Und weißt du, was es ist?«, fragte er.
Trotz der Ständeschranken duzten sie sich, wenn sie allein waren.
»Es hat sich in letzter Zeit so viel verändert. Zum Guten. Ich denke daher, es wird etwas Günstiges sein.« Ihr Lächeln wurde hintergründig.
Sie hielt ein kleines Buch in den weiß behandschuhten Händen. Offiziell unternahm sie den Spaziergang vom Schloss hierher, um in der schönen Umgebung ein wenig zu lesen.
Sie schlug den schmalen Band auf und las vor: »Willst du schon geh’n? Der Tag ist ja noch fern…«
»Romeo und Julia«, sagte Reiser. Theresia nickte und zeigte ihm den Einband. Es war die Übersetzung des Dichters August Wilhelm von Schlegel, für die sich Theresia seit Jahren begeisterte. »Ist es ein Zufall«, fragte er, »dass du heute diese berühmte Liebesgeschichte liest?«
»Vielleicht«, sagte sie und senkte den Blick. »Vielleicht auch nicht. Es ist nicht an mir, diese Dinge zur Sprache zu bringen.«
Ja, dachte Reiser. Und wie schon viele Male zuvor gestattete er sich für einen Moment die Vorstellung von etwas eigentlich Unvorstellbarem. Er sah sich zu dem Edlen von Sonnberg gehen. Er sah sich das Arbeitszimmer seines Dienstherrn betreten und selbstbewusst das Wort an ihn richten. Hörte sich sagen, welche Gnade ihm, dem Lakaiensohn, zuteilgeworden sei, indem er, der Edle, ihm die Ausbildung auf dem Gymnasium und den Besuch der Universität ermöglicht habe. Während er ihm gleichzeitig immer wieder verdeutlichte, dass sein Fleiß und sein Talent so groß seien, dass er, Reiser, bald Verwalter der Güter werden könnte. Weshalb es doch nur natürlich und vernünftig sei, im Beiseiteschieben der Standesgrenzen nicht nur dem Ruf von Talent und Fleiß, sondern auch dem der Liebe zu folgen. Der unschuldigen, reinen und von Gott gegebenen Liebe zwischen zwei Menschen. Was ihn, Reiser, zu der Entscheidung bringe, bei ihm, seinem gnädigen Dienstherrn, um Theresias Hand…
An dieser Stelle fielen seine Visionen mal so und mal so aus. In einer Fortsetzung der Szene trat ihm der Edle freundschaftlich entgegen, reichte ihm die Hand und erklärte, dass er einverstanden sei. Wenn auch Theresia ihn liebte. In einer anderen zeigte der Adlige ein so erzürntes Gesicht, wie man es nur sehr selten an ihm erlebte. Und was er sagte, machte deutlich, dass Reisers Ansinnen der Grund dafür war. Jahrelang habe er die Fürsorge seines Dienstherrn genossen, und nun wage er, der doch im Grunde ein Nichts war, sich zu erfrechen, etwas vorzubringen, das alles zunichtemache. Das Undankbarkeit beweise und, was das Schlimmste sei, den hohen Edlen von Sonnberg zutiefst enttäusche…
»Sei guten Mutes und hoffe auf morgen, mein Lieber«, sagte Theresia und erhob sich. »Meine Zeit ist leider um. Morgen werden wir auch wieder musizieren. Vielleicht können wir dann mit Beethovens Klängen etwas feiern, wovon wir jetzt noch nicht einmal zu träumen wagen.«
Reiser ließ Theresia vorausgehen. Wie kurz ihre Treffen doch immer waren. Und wie kostbar gerade deswegen.
Er wartete noch ein paar Minuten und blickte nachdenklich ins Tal hinab. Dann kehrte er über den Weg durch die Felsen und das Wäldchen ins Schloss zurück.
***
Kreutz saß eingeklemmt in der Kutsche auf dem Weg von Nürnberg nach Regensburg. Noch im Dunkeln war sie losgefahren– mit drei Reisenden und schwer beladen mit Gepäck. Kurz hinter Neumarkt hatten sie anhalten und eine gute Stunde warten müssen, weil ein Fuhrwerk in einem Hohlweg auf der Strecke zusammengebrochen war und ihnen den Weg versperrte.
Gegenüber saß ein dicker Kaufmann, der mehr als die Breite seines Platzes einnahm und so einen dünnen, bebrillten Geistlichen an die Seite drängte, der seinen Blick die ganze Zeit über in ein Brevier versenkte. Neben Kreutz hatte ein junger Mann Platz genommen, dessen Kleidung zeigte, dass er aus besserem Hause stammte.
Am Morgen nach Wellendorfs Tod hatte Kreutz das restliche Geld aus der Schatulle genommen, sich einen Platz in der Kutsche besorgt und die Tage bis zur Abfahrt in einem Wirtshaus am anderen Ende der Stadt verbracht. Das Geld zu nehmen war ihm ein bisschen wie Leichenfledderei vorgekommen, doch es galt, höheren Zielen zu folgen. Und war denn alles seine Schuld? Was konnte er dafür, dass die adligen Palastbewohner das einfache Volk in feuchten, unwürdigen Behausungen dahinvegetieren ließen? Dass ein Großteil der Neugeborenen nicht das erste Lebensjahr vollendete? Dass ein ganzes Volk, niedergedrückt von Steuern, in Knechtschaft leben musste?
Die Aristokraten wollten nicht sehen, dass ihr eigener Stand seit der Revolution in Frankreich, seit Napoleons eigenmächtiger Selbsterhebung zum Kaiser und seinem von grausamen Kriegen begleiteten Niedergang nur noch ein Schatten seiner selbst war. Ein Konstrukt, das nicht von Gottes Gnaden stammte, sondern ein System der Ausbeutung darstellte. Wenn das Volk das doch begreifen würde!
Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?
Das alte Zitat, das wohl aus den Zeiten der Bauernkriege stammte, war heute so aktuell wie eh und je.
»Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan«, postulierte einst Martin Luther. Und als freie Christenmenschen hatten sie gegen Napoleon gekämpft und seine Herrschaft gebrochen. Es hatte der Anbeginn einer neuen Zeit sein sollen– mit einer Verfassung, mit freier Selbstbestimmung. Doch man hatte sie getäuscht. Statt einen Neuanfang zu machen, restaurierte die Aristokratie die alten vorrevolutionären Verhältnisse. Kreutz packte der Zorn, wenn er nur daran dachte.
Als sie endlich die Donau überquerten und quälend langsam nach Regensburg hineinfuhren, begann schon das Mittagsläuten. Zwölf Uhr. Jetzt hätte er eigentlich am Treffpunkt auf dem Kornmarkt sein sollen.
Sein Nebenmann erwachte, hob den Kopf und sah sich verwirrt um. Die Kutsche hatte das Stadttor durchquert. Es herrschte Gedränge, hier war kein Durchkommen. Das Gefährt hielt. Das Läuten war verklungen. Kreutz ergriff seine Ledertasche und erhob sich. Der dicke Herr blickte von seiner Zeitung auf, der Geistliche duckte sich vor Schreck, und der Mann neben ihm protestierte: »Mein Herr, was haben Sie vor?«
Kreutz sparte sich die Antwort, er quetschte sich an den Beinen seiner Reisegefährten vorbei, öffnete die Seitentür und verließ die Kutsche genau in dem Moment, in dem der Postillion, der von der ganzen Sache nichts mitbekommen hatte, wieder anziehen ließ. Kreutz hatte erst einen Fuß aufs Pflaster gesetzt und kam ins Straucheln. Er fing sich, erntete aber einen erschrockenen Aufschrei einer Gruppe von Marktweibern, die mit ihren Körben ebenfalls durchzukommen versuchten.
»Nichts geschehen«, rief Kreutz, rannte der Kutsche nach, sprang von hinten auf und löste seinen kleinen Ledersack aus dem zusammengeschnallten Gepäck. Dann drängte er sich durch die Frauen, die erneut erschrocken aufschrien, ihm aber Platz machten.
Endlich erreichte er die Mauer des Turmes am Kornmarkt. Auf dem Platz tummelten sich Markt- und Fuhrleute. Dunkel gekleidete Beamte mit unter den Arm geklemmten Akten, die festen Schrittes irgendwohin eilten.
Was sollte er nun tun? Gab es ein Erkennungszeichen?
Vielleicht war der Brief selbst das Zeichen. Er nahm das Papier aus der Tasche, ließ es aber zusammengefaltet. Er hielt es so, dass es zwei Fingerbreit aus seiner Faust herausschaute.
Nichts geschah. Kreutz sank der Mut. Hatten die wenigen Minuten, die die Kutsche länger gebraucht hatte, alles zunichtegemacht?
Er war zu der Erkenntnis gelangt, dass die Nachricht nicht für ihn, sondern für Wellendorf gedacht gewesen war, auch wenn der Freund sich von politischen Zusammenkünften der Studenten meist ferngehalten und lieber über seinen Büchern gebrütet hatte. Sonst hätte sich in dem verschlüsselten Text doch irgendein Hinweis finden müssen. Wenn sie aber Wellendorf eingeladen hatten, stellte sich die Frage, ob sie wussten, wie er aussah. In dem Fall würde sein Abenteuer hier ein vorzeitiges Ende finden.
Wie viel Zeit sollte er verstreichen lassen? Er drängte sich näher an die Mauer. Da traf ihn ein heftiger Stoß von hinten. Kreutz taumelte und bemerkte aus den Augenwinkeln eine Gestalt, die in Richtung des Domes davonlief.
Nach einem Moment des Schreckens stellte er fest: Seine Tasche war weg!
Jemand hatte sie ihm aus der Hand gerissen und war damit fortgelaufen.
Er packte seinen Sack und rannte dem Dieb hinterher, in Richtung des Domes.
Nach einer Abzweigung blieb er stehen. Die Tasche lag vor der Dommauer.
Keine Spur von dem Dieb. Wahrscheinlich hatte er nur das Geld genommen.
Kreutz legte seinen Sack ab und untersuchte das Innere der Tasche. Alles war da. Auch die Münzen.
Und ein weiteres Papier.
***
Nach Stunden über Büchern, Urkunden und juristischen Bestimmungen nahm Reiser in der Gesindeküche das Abendbrot ein und ging in seine Unterkunft, die sich in einem der beiden Seitenflügel des Schlosses befand. Er bewohnte zwei Zimmer mit seinem Vater, der bei den von Sonnbergs Hofmeister war. In langer Treue hatte er sich über viele Jahre hinweg vom einfachen Lakaien hinaufgearbeitet.
Der Edle von Sonnberg legte Wert darauf, dass seine wichtigsten Untergebenen nah bei ihm wohnten und immer verfügbar waren. Trotzdem war die ganze Architektur des Adelssitzes so gestaltet, dass sich die Wege der Untergebenen und der Herrschaft nur dann kreuzten, wenn es vom Dienstherrn gewünscht war.
Für die Dienstboten gab es eigene, schmale Treppen, eigene Flure, eigene Ein- und Ausgänge. Die Welt, in der der Edle und seine Tochter Theresia lebten, war nah, oft nur durch eine ellenbreite Mauer von der ihren getrennt, und doch war sie gleichzeitig fast so fern wie ein anderer Kontinent. Reiser betrat die Räumlichkeiten nur, wenn es ihm gestattet war. Und er war noch privilegiert. Es dienten Küchenmägde und Fuhrleute auf Schloss Sonnberg, die den Salon der Herrschaft, das Musikzimmer und andere Gemächer der Edlen noch nie gesehen hatten.
In der Unterkunft fand er seinen Vater, noch in die dunkelrote Livree gekleidet, vor dem Stehpult. Das eine Bein gebeugt, den Fuß auf der Spitze, hielt er eine Feder in der Hand und malte langsam Buchstaben auf das Papier, setzte ab und tauchte die Feder in ein Tintenfass, neben dem eine Kerze stand.
»Sie schreiben, Herr Vater?«
Der alte Herr sah ihn überrascht an. Offenbar hatte Reiser ihn aus tiefen Gedanken geholt.
»Du weißt, dass ich es mir manchmal gönne, meine Gedanken festzuhalten«, entgegnete er. »Erinnerungen.«
»Ich werde Sie nicht dabei stören«, sagte Reiser, der ihm die kleine Freude gönnte. Sein Vater hatte, als er so alt gewesen war wie er, nicht lesen und schreiben können. Erst viel später, vor wenigen Jahren, hatte er es sich nach und nach angeeignet und schnell Fortschritte darin gemacht. »Ich werde schlafen gehen.« Reiser wollte sich an dem Stehpult vorbeidrängen.
»Warte«, sagte der Vater. »Sebastian, ich muss dich etwas fragen.« Seine Stimme klang streng.
Reiser blieb stehen.
»Du weißt, wie gnädig der Herr von Sonnberg mit uns ist.«
»Natürlich, Herr Vater.«
»Ich denke, dass deine Ausflüge mit dem Fräulein von Sonnberg nicht angemessen sind.«
»Wenn ich dort über der Klamm die Landschaft genieße, und Fräulein von Sonnberg kommt zufällig vorbei…«
»Zufällig?« Auf der Stirn des Vaters erschien eine steile Falte. »Willst du behaupten, eure Treffen seien zufällig? Halte mich nicht zum Narren, Sebastian.«
»Es geschieht in allen Ehren. Wir sprechen nur miteinander. Herr von Sonnberg erlaubt uns ja auch das gemeinsame Musizieren.«
»Und reicht das nicht? Muss man die Grenzen eigenmächtig ausdehnen? Dein Verhalten kann deinem Ansehen schaden. Es sorgt hier im Schloss für Gerede. Vor allem, wenn der gnädige Herr nicht zugegen ist. Was zum Beispiel morgen der Fall sein wird. Ich werde mit dem Herrn hinüber in die Wälder am Michelskogel fahren.«
»Ich werde es beherzigen.«
Der Vater sah ihn an, als wollte er mit seinem Blick das Gewissen des Sohnes erforschen. Schließlich nickte er.
»Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.«
Reiser nahm eine Kerze, entzündete sie an der auf dem Pult und ging hinüber. Als er die Tür schloss, sah er den Vater bereits wieder in seine Schreiberei versunken. Direkt hinter ihm stand das schmale Bett, auf dem er sich bald zur Ruhe begeben würde.
Kaum war Reiser hinter der geschlossenen Tür allein, stellte er das Licht auf den dicken Bohlen des Fußbodens ab, griff unter sein Bett und zog einen Holzkasten hervor. Darin stapelte sich ebenfalls Handgeschriebenes. Es war Reisers Notensammlung. Sie enthielt die Sonate, die er gelegentlich mit Theresia probierte, aber auch eigene musikalische Einfälle.
Manchmal, wenn er in seiner freien Zeit durch die Natur streifte, kam ihm die eine oder andere Melodie in den Sinn. Er spielte sie sich dann auf der Violine vor, schrieb sie auf und komponierte manches Mal sogar eine Klavierstimme dazu. Eine dieser Kompositionen, die er für besonders gelungen hielt, hatte er »Romanze« genannt. Es war eine einfache Weise in melancholischem Moll.
Während er die Partituren betrachtete, verlor er sich eine Weile in seinen Gedanken. Dann verstaute er alles wieder unter dem Bett, entkleidete sich bis auf sein Unterzeug, legte sich hin und löschte die Kerze. Unter der Tür war ein Lichtstreifen aus der Nebenkammer zu sehen. Der Vater stand also immer noch am Schreibpult.
Reiser wollte eben in den Schlaf hinübersinken, da traf ihn die Erkenntnis wie ein plötzlicher Schlag.
Der Edle von Sonnberg wollte morgen mit ihm sprechen!
Vielleicht wollte er ihn ja wegen der Treffen mit seiner Tochter zur Rede stellen? Es gab Gerüchte im Schloss, hatte der Vater gesagt. Waren sie ihm zu Ohren gekommen?
Musste Reiser mit einer Rüge rechnen?
Die Frage beschäftigte ihn lange. Immer wieder stellte er sich Theresia vor, sah, wie sie ihm zulächelte.
4
Mittwoch, 28.April 1824
Wie immer wurde Reiser mit Tagesanbruch wach. Und wie immer klopfte er, nachdem er sich erhoben hatte, zuerst an die Kammertür, bevor er sie öffnete. Heute hatte der Vater die Unterkunft bereits verlassen. Auf dem Tisch in der Ecke stand frisches Wasser.
Er beugte sich über die kleine Schüssel, wusch sich und genoss es, durch die Kälte wach zu werden. Nachdem er sich angekleidet hatte, führte ihn sein erster Weg in die Schreibstube, die sich im selben Flügel des Schlosses befand, allerdings eine Etage höher.
Dort tauchte er in den Geruch von Staub und altem Papier ein. Auf seinem Pult fand Reiser eine Notiz des gnädigen Herrn. In knappen Worten wurde er darüber unterrichtet, dass der Edle von Sonnberg mit Reisers Vater eine Inspektionsfahrt unternehme und am späten Nachmittag zurück sein werde. Noch vor einem halben Jahr hätte der gnädige Herr ihn anstelle seines Vaters auf seine Inspektionsfahrt mitgenommen. Nun aber wusste er über alles Bescheid, und sein Platz war bei den Akten.
Es folgte eine Auflistung dessen, was bis dahin zu erledigen war. Es handelte sich um leichte Aufgaben, die kaum mehr als zwei Stunden seiner Zeit in Anspruch nehmen würden. Ein anderer hätte wahrscheinlich Tage damit zugebracht. Doch Reiser verfügte über eine besondere Begabung. Schon von Kindheit an hatte er die Fähigkeit, Schriftstücke mit wenigen Blicken als Ganzes zu erfassen und sich das, was darin festgehalten war, zu merken. Er musste noch nicht einmal alles gelesen haben. Es reichte, wenn er das Papier vor sich gehabt und sich darauf konzentriert hatte. In seiner Erinnerung konnte er dann in dem Gesehenen lesen wie in einem Buch, das in seinem Kopf gespeichert war.
Schon während Reisers Studium in Wien hatte der Edle Wert darauf gelegt, ihn in sämtliche Details der Güterverwaltung einzuweisen. Und das nicht nur durch genaue Kenntnis der Bücher und Dokumente, sondern auch durch die Begehung der Güter selbst. Auf ausgedehnten Fahrten hatte der Edle ihm alles gezeigt, was er besaß– bis hin zu den Kohlegruben im Osten, die sie im vergangenen September besucht hatten. Darüber hatte Reiser den ordentlichen Abschluss des Studiums verpasst, was den Edlen aber nicht störte. Im Gegenteil. Er hielt die Praxis für wichtiger als die in Kollegien und Bibliotheken vermittelte Theorie. Überhaupt sei nicht Stand, sondern Fleiß entscheidend. Dazu Ehrlichkeit und Strebsamkeit. Diese Tugenden seien mehr wert als jedes Diplom, auch als jeder Adel und jede gesellschaftliche Stellung.
»Wenn wir durch die Kriege gegen Napoleon etwas gelernt haben, dann das«, sagte der Edle gern. Vielleicht folgte er dieser Haltung deshalb, weil er selbst noch nicht lange zu den höheren Kreisen gehörte. Das Prädikat stammte aus der Zeit Kaiser Josephs, dem die Familie von Sonnberg in einer Weise, über die Reiser nichts Näheres wusste, nützlich gewesen war.
Der Edle war stolz, seine Güter als Erster unter Gleichen zu führen. Sein Glück wurde allerdings getrübt. Theresias Mutter war verstorben, als Theresia noch ein Kind gewesen war. Der Edle hatte sich kein zweites Mal vermählt. Reiser war ebenfalls Halbwaise. Manchmal fragte er sich, ob dieses Schicksal ihn mit der jungen Frau von Sonnberg irgendwie verband.
In der Gesindeküche nahm Reiser einen Kaffee zu sich. Die Wanduhr zeigte noch nicht einmal halb sieben. So blieb ihm noch Zeit für einen Gang durch die Natur, bevor er mit seinem Dienst begann.
Als er das Schloss durch den Dienstbotenausgang verließ und auf den hellen Kiesvorplatz trat, sah er weit hinten neben dem Portal den Edlen stehen. Er unterhielt sich mit Baron von Walseregg, einem Freund der Familie, der manchmal Gast auf Schloss Sonnberg war. Er verbrachte die meiste Zeit in seinem Gemach. Ein steifes Bein zwang ihn zum Hinken und gleichzeitig in eine gebückte Haltung, sodass er jedes Gegenüber mit in den Nacken gelegtem Kopf ansah.
Der Edle von Sonnberg, der den Baron an Körpergröße deutlich überragte, sprach, und der Baron hörte auf seinen Stock gestützt zu. Ein Stück entfernt wartete der Zweisitzer, an dem sich noch der alte Kajetan, der Stallbursche, zu schaffen machte. Daneben stand Reisers Vater. Noch weiter hinten stand der Diener des Barons. Im Schloss nannten sie ihn nur den langen Anton, weil er sehr hager und groß war. In seiner hellblauen Livree mit den silbernen Litzen und den Schnallenschuhen wirkte er wie aus der Zeit gefallen.
Reiser folgte dem schmalen Weg durch die Buchsbaumhecken zur Rückseite des Schlosses, hielt sich abseits der ausladenden Terrasse und ging an der Mauer entlang zur hinteren Pforte. Der Gesang der Vögel schien das Licht der Sonne hinter dem Michelsberg zu begrüßen. Die Luft, erfüllt von Düften der Erde und des Waldes, kündigte die Milde eines sonnigen Tages an. Im Tal schlug eine Kirchturmuhr sieben.
Nach einer Viertelstunde erreichte er den Aussichtspunkt. Gerade wollte ihn erneut die Euphorie überwältigen, da wurde er durch ein Geräusch abgelenkt, das sich von den Hügeln her näherte. Pferdegetrappel, knirschende Räder, das typische Kollern von Holz und Metall auf Stein.
Dann erschien die Kutsche, in der Reisers Vater und der Edle von Sonnberg saßen. Der Vater hielt die Zügel, der gnädige Herr saß neben ihm. Auf dem holprigen Weg wurden die beiden Männer ordentlich durchgeschüttelt. Der Edle musste mit der einen Hand seinen Hut festhalten.
Der Weg vom Schloss bis zur Klammüberquerung war weit. Man musste vom Hauptportal erst die lange Allee zum Hauptweg nehmen, nach einer Abzweigung einige Serpentinen talwärts fahren und schließlich wieder hinauf. Auf dem letzten Stück des Weges lag ein kleines Wäldchen, in dem die Kutsche soeben verschwand. Ein paar Atemzüge lang war sie nicht mehr zu sehen, dann kam die braune Stute zwischen den Bäumen hervorgetrabt und hielt auf die Brücke zu. Unter der geraden hölzernen Linie konnte Reiser bis ins Tal schauen, wo die Sonne einen großen Lichtfleck auf die Futterwiesen malte.
Die Hufe der Stute trommelten auf den Bohlen. Reisers Vater, die Peitsche in der Hand, trieb das Pferd an. Da wandelte sich das Bild auf einmal in ein so unglaubliches Szenario, dass Reiser sich in einen Alptraum versetzt fühlte.
Das Wegstück, das die Kutsche bereits hinter sich gelassen hatte, schien sich vom Rest der Brücke abzutrennen. Das rechte hintere Rad griff ins Leere, das Gespann wurde nach hinten gerissen.
Die Stute wieherte erschrocken auf. Sie kämpfte um sicheren Stand und versuchte vergeblich, die Last, die sie unerbittlich nach hinten zog, zu halten. Reiser hörte das Trampeln der Hufe, dazu ein Kreischen wie von berstendem Holz, schließlich ein erschrockenes Schnauben. Im nächsten Moment war die Kutsche verschwunden. Das Pferd, unerbittlich im Geschirr gehalten, war noch kurz zu sehen, glitt dann aber rückwärts ins Bodenlose. Reste der Brücke brachen nach, es folgte ein hohles Gepolter, schließlich ein fernes Bersten.
Als Kind hatte Reiser gelegentlich in einem Buch mit Sagen des griechischen Altertums geblättert. Die Geschichte von Phaeton hatte sich besonders deutlich in sein Gedächtnis eingebrannt.
Phaeton war der Sohn des Helios, der den Sonnenwagen über den Himmel lenkte. Als er, voller jugendlicher Selbstüberschätzung, diese Pflicht eines Tages übernehmen wollte, kam es zu einer Katastrophe. Mitsamt dem Sonnenwagen stürzte er vom Himmel.
Diesen Moment hatte ein Zeichner auf einem Bild in dem Buch festgehalten. Der Schrecken der Erkenntnis, das Wissen um die Unausweichlichkeit der Katastrophe, stand mit verzerrten Zügen und weit aufgerissenen Augen nicht nur dem vermessenen Phaeton ins Gesicht geschrieben, sondern auch den Pferden.
In der Sage löste der Absturz eine Katastrophe kolossalen Ausmaßes aus. Die brennende Sonne landete auf dem afrikanischen Kontinent und verwandelte ihn in eine Flammenhölle. Ganze Landschaften trockneten zur Wüste aus.
Die Erinnerung an dieses Bild überlagerte sich vor Reisers innerem Auge mit dem gerade Erlebten, während er zurück zum Schloss rannte. Als Erstes traf er den alten Kajetan, der ihm erschrocken entgegenblickte.
»Zur Brücke, ein Unglück, schnell«, keuchte Reiser. Ohne anzuhalten setzte er seinen Weg durch das Tor fort. Dann ging es auf die Straße. Reiser rannte und rannte, aber es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis er die Unglücksstelle erreichte.
Er stoppte vor dem Abgrund, an dem noch der kürzere Teil der Brücke hing, beugte sich vor. Doch der Blick in die Klamm hinunter war durch Holzreste versperrt. Weit unten schäumte der Michelsbach. Kälte kam herauf. Zu seinen Füßen bröckelte Erde ab, Holz brach und rutschte hinunter.
Reiser fing sich im letzten Moment und riss den Schwerpunkt seines Körpers so heftig zurück, dass er taumelte. Als er ein weiteres Mal in die Tiefe sah, erkannte er die Reste der Kutsche. Ein Rad, das halb im Bach hing. Eine Deichsel. Dann die Umrisse des Pferdes.
5
Donnerstag, 29.April 1824
Ein weiteres Billett. Und etwas Geld.
Nicht irgendein Billett. Ein Platz in der Eilpost. Mit dem Zentrum der Weltmacht als Ziel der Reise.
Wien!
Wieder wartete Kreutz in einem Gasthaus bis zur Abfahrt. Dann ging es los. Passau, Schärding, Linz… Zwischen den Stationen schienen Wochen zu liegen, und je näher Kreutz seinem Ziel kam, desto langsamer schien es voranzugehen.
Was würde ihn in der Kaiserstadt erwarten?
Eine geheime Zusammenkunft. Natürlich!
Wie mutig, sie noch einmal in der Kaiserstadt zu planen!
Vor fast vier Jahren, kurz nach der Hinrichtung des Studenten Carl Ludwig Sand, hatte es in Wien schon einmal den Versuch gegeben, eine Burschenschaft zu gründen. Eine revolutionäre Zelle im Herzen des Reiches. Sie hatte nur wenige Tage bestanden. Metternich ließ alle Mitglieder, deren er habhaft werden konnte, verhaften. Die Namen einiger dieser Kameraden waren in Burschenschaftskreisen berüchtigt. Man sprach von ihnen voller Ehrerbietung. Sie waren Märtyrer, die leicht das Schicksal des seligen Sand hätte treffen können.
Johann Senn.
Georg Schuster.
Benedict Zeisel.
Von Zeisel hatte Kreutz sogar eine Wiener Adresse. Wobei er nicht glaubte, dass der inzwischen wieder Freigelassene dort noch wohnte. Trotzdem musste er versuchen, ihn zu finden. Vielleicht würde der wunderbare Follen ja auch kommen. Wenn er dabei war, würden sie erfolgreich sein. Der Misserfolg vor vier Jahren war vermutlich genau darauf zurückzuführen, dass sie nicht der richtige Anführer geleitet hatte.
Kreutz’ Herz schlug bei diesem Gedanken schneller, während die Landschaft in quälender Trägheit an der Kutsche vorüberzog. In einer Kurve öffnete sich ihm der Blick nach Westen, wo die bereits tief stehende Sonne einen bewaldeten Höhenzug beleuchtete. Es war der Wienerwald, die letzte natürliche Barriere, die sie von der Hauptstadt trennte.
Kreutz war noch nie in Wien gewesen, er kannte es nur aus Erzählungen. Um den inneren Kern der Stadt lag die alte Stadtmauer– die mächtige Bastei, durchlöchert von den tunnelartigen Stadttoren und trotz ihrer Größe heute praktisch ohne militärische Bedeutung. Die Tore waren rund um die Uhr offen und boten jedem, der hineinwollte, den Durchgang auf die Esplanade oder, wie man die freie Fläche auch nannte, das Glacis.
Reisende priesen die Schönheit dieser ringförmigen, von Alleen und Grasflächen bedeckten Ebene, die Wien fast ganz umgab– nur im Nordosten nicht, wo die Bastei direkt an den Donauarm grenzte. Man nutzte sie als Spazierweg oder zur Durchfahrt in die Vorstädte, die wie voneinander getrennte kleine Siedlungen das Innere umgaben. Schutz erhielt Wien dieser Tage durch eine zweite, äußere Stadtmauer, die auch die Vorstädte umgab. Die sogenannte Linie.
Und diese Linie war es, die Kreutz nun wachsende Sorge bereitete. Er hatte gehört, dass an ihren Toren Gepäck und Papiere kontrolliert wurden. Verbotene Bücher durften nicht nach Wien eingeführt werden. Die Zensur war streng. Auch alles, was in der Stadt gedruckt, auf Bühnen gesprochen oder in Opernhäusern und Konzerten gesungen wurde, unterlag strengster Kontrolle. Sogar die Inschriften auf Grabsteinen und Häusern waren davon betroffen. Jeder einzelne geschriebene Buchstabe.
Kreutz besaß keine Papiere. Vielleicht würde man ihn gar nicht durch die Linie lassen. Was dann?
Die Kutsche fuhr langsamer, denn der Weg führte bergauf, und es wurde anstrengender für die Rösser. Wald zog an den Fenstern vorbei.
Was würde an der Linie geschehen?
Auf einmal kam Kreutz ein furchtbarer Gedanke. Was, wenn es eine Falle war? Ein Schachzug des allmächtigen Metternich, mit dem Zweck, sich ein für alle Mal seiner Feinde zu entledigen? Wie viele revolutionäre Studenten gab es in den deutschen Ländern? Konnte man sie alle nach Wien locken, um sie dann festzusetzen? Und jede revolutionäre Bestrebung im Keim zu ersticken? Dann würde diese Kutsche ihn geradewegs ins Gefängnis bringen! Wo Follen und die anderen vielleicht schon auf ihn warteten.
Dann hatte Wellendorf die Einladung erhalten, weil sie herausgefunden hatten, dass er bei Wellendorf wohnte. Weil sie wussten, dass der Freund todkrank war und Kreutz diese Einladung anstelle von Wellendorf annehmen würde.
Angst kroch in ihm hoch. Er musste diese Kutsche verlassen. Am besten sofort. Oder beim nächsten Halt. Gab es überhaupt noch einen vor dem Linientor? Wie lange waren sie schon im Wienerwald unterwegs?
Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Hinter den Scheiben der Kutsche war es dunkel geworden. Nur ab und zu wanderte ein beleuchtetes Haus vorbei, wenn sie durch einen Marktflecken rumpelten.
Was konnte er tun? Übelkeit vortäuschen? Es war natürlich möglich, den Fuhrmann zum Anhalten zu bringen. Unwohlsein kam unter den Reisenden oft vor, und jeder hatte Verständnis dafür. Aber würde ihn das nicht erst recht verdächtig machen? Wahrscheinlich gehörte einer derjenigen, die hier im Dunkel mit ihm zusammensaßen, zu Metternichs Leuten. Ein vermeintlicher Mitreisender, der Kreutz beobachten sollte. Wenn er ausstieg, würde man ihn verfolgen.
Vielleicht konnte er im Schutz der Dunkelheit durch den Wald flüchten. Er war gut zu Fuß, und er würde sicher irgendwo einen Unterschlupf finden.
Er durfte nicht erst um das Anhalten bitten. Er musste es machen wie in Regensburg. Die Tasche schnappen und aus der Kutsche springen. Gut, das würde ihn auf jeden Fall verdächtig machen, und die Reisenden konnten ihn dann an der Linie oder bei einer Polizeistelle beschreiben. Aber dort kannten sie seinen Steckbrief ja sicher ohnehin.
Er versuchte zu erkennen, was hinter der Scheibe lag. Ein Licht erschien. Kreutz glaubte, es sei eine Laterne an einem Haus. Doch dann begann das Leuchten zu wandern, kam an die Kutsche heran und wurde immer heller. Der Wagen blieb stehen. Die Pferde schnaubten.
Das Gesicht des Postillions erschien hinter der Scheibe. Die Tür wurde geöffnet, und ein Schwall kalter, feuchter Nachtluft kam ins Innere. Sie brachte den Geruch von nassem Laub und Erde mit sich.
Hinter dem Postillion stand ein zweiter Mann. Seine untere Gesichtshälfte bedeckte ein dichter dunkler Bart. Dahinter konnte Kreutz einen weiteren Wagen erkennen, an dem eine brennende Lampe hing. Das war das Licht, das er gesehen hatte.
»Herr Wellendorf?«, rief der Mann in die Kutsche hinein.
Kreutz räusperte sich. »Ja?«, rief er nach draußen.
»Kommen Sie bitte heraus.«
Der bärtige Mann war nicht allein. Er hatte zwei Helfer dabei, die– ob mit Absicht oder nicht– Kreutz umstellten und ihm jeden Fluchtweg in den Wald versperrten.
»Mit wem habe ich denn das Vergnügen?«, fragte Kreutz.
»Mein Name tut nichts zur Sache. Daher bitte ich Sie, mich von der Pflicht, mich vorzustellen, zu entbinden.«
Die Eilkutsche fuhr weiter, man hatte seinen Sack mit dem Gepäck abgeladen. Wenn sie ihn wirklich ins Gefängnis stecken wollten, wäre dies die beste Möglichkeit, sich auf ihn zu stürzen, ihn zu binden und irgendwohin zu bringen, von wo er nie wieder zurückkehren würde.
Aber nichts davon geschah.
»Sie brauchen keine Angst zu haben, Herr Wellendorf«, sagte der Bärtige. »Kommen Sie bitte mit.«
In der kleineren Kutsche ging es ein Stück durch den nächtlichen Wald, dann einen steilen Berg hinauf. Als das Fahrzeug endlich hielt, fand sich Kreutz in einer Szenerie wieder, die ihn an einen der Ritterromane erinnerte, die manche seiner Kommilitonen so gern lasen.
Sie standen auf dem Vorplatz einer Burg. Der Eingang war durch eine schwere Gittertür geschützt, deren Flügel weit offen standen. Brennende Fackeln warfen ihr flackerndes Licht auf das Metall und brachten es zum Glänzen. Die Tür der Kutsche ging auf. »Wir sind da, Herr Wellendorf«, sagte der Mann.
Kreutz stieg aus, die Ledertasche mit beiden Armen fest umschlungen. Einer der Männer hatte den Reisesack genommen und trug ihn durch das Tor ins Innere der Burg.
»Was ist das hier?«, fragte Kreutz mit vorgespielter Entschlossenheit. »Sollte es nicht nach Wien gehen?«
»Es ist der erste Versammlungsort.«
»Der Versammlungsort für wen? Und wieso der erste?«
»Ihr Gastgeber wird alles erklären.«
»Und wer soll das sein?«
»Später.«
Kreutz ging dem Mann nach. Sie erreichten einen kleinen, von hohen Mauern umschlossenen Burghof, an dessen Wänden Fackeln brannten. Hinter einem länglichen Fenster im oberen Stockwerk war ebenfalls Licht. Davor bewegten sich Schatten.
Es ging durch eine niedrige Pforte und eine schmale steinerne Wendeltreppe hinauf in einen Saal, in dem an einem rohen Holztisch ein paar junge Burschen saßen. Als sie eintraten, blickten ihnen sechs, sieben Gesichter neugierig entgegen. Alle waren etwa in Kreutz’ Alter.
»Herr Wellendorf ist angekommen«, erklärte der Mann den Versammelten. Er wandte sich an Kreutz. »Machen Sie sich bitte selbst bekannt. Ich muss wieder fort.« Damit ging er.
Kreutz stand allein da, neben seinem Gepäck. Die anderen erhoben sich und begrüßten ihn mit einer Herzlichkeit, wie er sie aus den Zusammenkünften mit anderen Studenten kannte. Sie redeten auf Kreutz ein.
»Du heißt also Wellendorf?«
»Woher kommst du?«
»Wie ist dein Vorname?«
Die Angst vor einer Falle fiel von Kreutz ab. Beinahe hätte er die Frage nach seinem Vornamen wahrheitsgemäß beantwortet, aber dann erinnerte er sich daran, dass er den Platz seines toten Freundes einnahm.
»Julius«, sagte er. »Und ich stamme aus…«
Dass er wie Wellendorf aus Erlangen stammte, konnte er nicht behaupten. Sein Akzent hätte ihn der Lüge überführt. Hier blieb er bei der Wahrheit.
»…aus der Gegend von Erfurt«, sagte er. Zum Glück schien niemand den echten Wellendorf zu kennen.
Bald zeigte sich, dass alle auf die gleiche geheimnisvolle Weise hergekommen waren. Mit einer Einladung, die eine Reise zu den Unsichtbaren versprach. Mit anonym überbrachten Billetts, mit Geld. Über die verschiedensten Routen. Wer auch immer ihr geheimnisvoller Gastgeber war– er hatte viel Aufwand betrieben, um sie hier zusammenzubringen.
»Wir alle dachten, dass es nach Wien geht«, sagte ein schmächtiger Jüngling, der sich als Friedrich Eberlin vorgestellt hatte und aus Heidelberg kam. Angeblich hatte er auch in Gießen und in Jena studiert. In diesen Städten hätte er Follen begegnen können. Kreutz hätte ihn gern sofort nach dem Gründer der Unbedingten befragt, doch er wagte es nicht. Konnte man hier offen sprechen? Wenn das, was auf der Einladung gestanden hatte, stimmte, befand er sich nun bei den in dem Brief erwähnten Unsichtbaren. Der Bewegung, die sich hier formierte. Oder wurden sie noch einmal fortgebracht? Gab es eine größere Verbindung, zu der sie gesammelt stoßen sollten?
Lieber abwarten, gemahnte er sich.
Alle schienen diesem Prinzip zu folgen. Niemand erwähnte die neue Gruppierung. Stattdessen erzählten sie sich, wer sie waren und woher sie kamen. Eberlin, so erfuhr Kreutz, war nicht nur Student der Theologie, er sah sich auch als Poeten, der davon träumte, ein zweiter Novalis zu werden. Auch brüstete er sich damit, in Berlin den jüngst verstorbenen Dichter und Musiker Ernst Theodor Amadeus Hoffmann getroffen zu haben. Was einen der anderen zur Einmischung veranlasste.
»Musiker?«, rief der Bursche höhnisch. Er war ein hagerer Hüne, bei dem sich trotz seiner jungen Jahre schon Haarausfall bemerkbar machte. Über der Stirn hatte er große Winkel in die Haarpracht gerissen, was seinen Schädel vergrößert erscheinen ließ. »Es gibt doch heute gar keine Musiker mehr«, behauptete er abschätzig und sah sich beifallheischend um.
Niemand wollte darauf eingehen, und Kreutz war klar, dass der Bursche einer von denen war, die immer wieder gewagte Thesen in den Raum stellten und die Konfrontation suchten. »Wie heißt du noch mal?«, fragte er.
»Konrad Kiepenkerl«, kam es mit scharfer Stimme schulmeisterlich zurück. »Aus Göttingen. Und ich habe bei dem…«
»Ja doch, wir wissen Bescheid, Konrad«, rief ein anderer. »Du hast es uns mindestens hundertmal erzählt. Du hast bei Professor Forkel studiert, der über einen Komponisten, der seit mehr als siebzig Jahren tot ist, eine Biografie geschrieben hat.«
»Nicht irgendein Komponist!«, rief Kiepenkerl aufgebracht, nannte aber den Namen nicht. Offenbar war das hier eine Diskussion, die sie nicht zum ersten Mal führten. Er wandte sich wieder Eberlin zu. »Dein Hoffmann war kein Musiker. Da ihm mit dem Notenpapier nichts einfiel, hat er sich irgendwelchen unverständlichen Kram ausgedacht– von Sandmännern, Automaten, verzauberten goldenen Töpfen und Kinderspielzeug, das am Weihnachtsabend lebendig wird.«
»Aber dein Herr Forkel«, sagte Eberlin, »den niemand kennt, der hat etwas geleistet? Indem er über die Musik eines Toten schrieb und sie zum Maßstab aller Tonkunst ernannte?«
»Forkel wusste, dass er selbst kein Musikgenie war«, sagte Kiepenkerl. »Daher widmete er sein ganzes Leben der Kunst desjenigen, der eins war. Ein göttliches Genie. Der fünfte Evangelist, aber nicht in der Sprache der Bibel, sondern in der Sprache der Musik.«
»Wer soll das sein?«, fragte Kreutz, verwirrt darüber, dass hier so viel über Musik gesprochen wurde.
»Das, mein Freund, verrate ich dir gern: Johann Sebastian Bach. Ja, er ist schon lange tot. Er starb im Jahre des Herrn 1750, doch seine Musik wird ewig leben. Sollte uns bei diesem Abenteuer hier ein Klavier oder eine Orgel begegnen, werde ich es dir beweisen.«
»Bach gehört in ein ganz anderes Zeitalter«, sagte Eberlin abfällig. »Er ist tot und vergessen. Herr Hoffmann hat das erkannt. Auch wenn du es nicht glauben willst. Er sah eine Linie der Entwicklung, die von Bach ausgeht und sich in Mozart fortsetzt.« Er wandte sich Kreutz zu, als suchte er einen Verbündeten. »Eben deshalb hat sich Herr Hoffmann den dritten Namen ›Amadeus‹ zugelegt– aus Bewunderung für Mozart.«
Kiepenkerl lachte ungläubig auf. »Welch ungebührliche Vermessenheit! Mozart war sicher genial, und sich selbst mit so einem Kaliber zu vergleichen…« Er schüttelte den Kopf.
Eberlin beachtete ihn nicht. »Hoffmann sah außerdem einen Dritten in dieser Linie, über den er auch geschrieben hat. Den Meister der neuen Zeit, den Meister unserer Zeit…«
Kiepenkerl stöhnte auf. »Ja«, rief er. »Du meinst diesen Beethoven. Den Mann, der alle Gesetze der heiligen Harmonie niederriss und die Musik unverfroren einfach neu erfand. Und den niemand versteht.« Entnervt drehte er sich mit erhobener Hand zu den anderen um und ließ den Zeigefinger neben seiner Schläfe kreisen. »Kein Wunder, er ist ja auch verrückt. Und warum? Weil er taub ist. Da kann er ja nur Musik zusammenschreiben, die kein Mensch versteht, die alle Regeln dieser heiligen Kunst verhöhnt. Beethoven ist ein Verrückter! Ein Narr!«
»Ein Narr?«, rief Eberlin aufgebracht. »Hast du denn je die Musik dieses Mannes gehört? Weißt du überhaupt, wovon du sprichst?«
»Nicht nötig. Die Musik eines Tauben muss ich mir nicht anhören. Das muss niemand.«
»Dann lies wenigstens, was Herr Hoffmann darüber geschrieben hat!« Eberlin sprang auf und begann, wie ein Schauspieler auf einer Bühne zu rezitieren: »›In dem Gesange, wo die Poesie bestimmte Affekte durch Worte andeutet, wirkt die magische Kraft der Musik wie das wunderbare Elixier der Weisen, von dem etliche Tropfen jeden Trank köstlicher und herrlicher machen.‹«
»Geschwätz.« Kiepenkerl winkte ab. Die anderen beobachteten den Streit stumm und ohne sich einzumischen, die Bierhumpen vor sich.