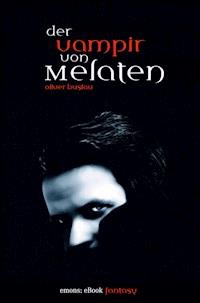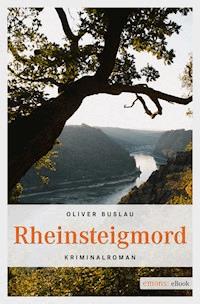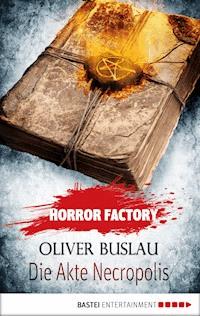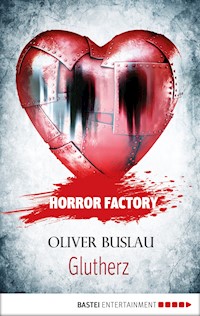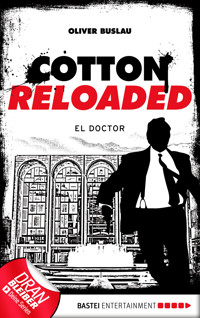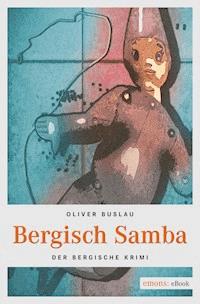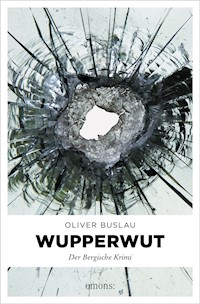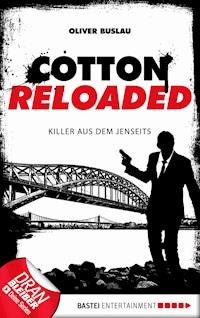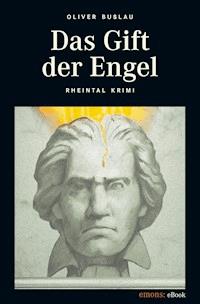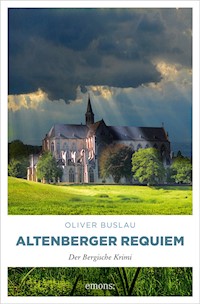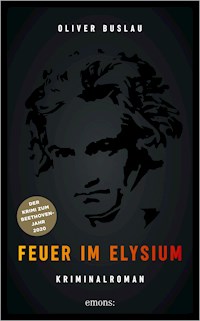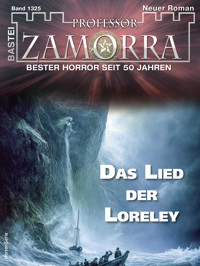Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historischer Kriminalroman
- Sprache: Deutsch
Potsdam unter der Herrschaft Friedrich des Großen: Die Farben der preußischen Uniformen prägen das Stadtbild, in den schnurgeraden Straßen der Residenz herrscht militärische Strenge. Doch auf den Hügeln vor der Stadt pflegt der König im neuen Schloß Sanssouci die schönen Künste, und der Kammermusiker und Flötenlehrer Johann Joachim Quantz glaubt, in der Nähe des Monarchen sein Glück gefunden zu haben. Doch dann werden Noten des Königs gestohlen und ein Lakai verschwindet gerät Quantz unter Mordverdacht und sieht sich plötzlich im Mittelpunkt einer geheimnisvollen Hofintrige. Bis sich der exentrische französische Philosoph La Mettrie auf seine Seite schlägt - ein Freigeist, der jedoch selbst im Fadenkreuz der Ordnungshüter steht...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Buslau, 1962 geboren, lebt in Bergisch Gladbach und ist seit 1994 freier Autor, Redakteur und Journalist. Er ist Gründer, Chefredakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift »TextArt – Magazin für Kreatives Schreiben«. Im Emons Verlag erschienen bisher sieben Kriminalromane um den Privatdetektiv Remigius Rott: »Die Tote vom Johannisberg«, »Flammentod«, »Rott sieht Rot«, »Bergisch Samba«, »Bei Interview Mord«, »Neandermord« und »Altenberger Requiem«. Außerdem die Rheintal Krimis »Schängels Schatten« und »Das Gift der Engel« sowie der Fantasy-Roman »Der Vampir von Melaten«. Darüber hinaus schrieb Oliver Buslau den Thriller »Die fünfte Passion«, der ins Italienische übersetzt wurde.www.oliverbuslau.dewww.remigiusrott.de
Dieses Buch ist ein Roman, und die darin geschilderte Handlung ist frei erfunden. Etliche auftretende Figuren sind historisch belegt. Über sie und die von ihnen ausgehenden Inspirationen zur Handlung informiert ein Abschnitt am Ende des Buches.
© 2012 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-162-6 Historischer Kriminalroman Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de Die La-Mettrie-Zitate auf den Seiten 142, 223 und 224 stammen aus: La Mettrie, Julien Offray de: Über das Glück oder Das höchste Gut (»Anti-Seneca«). Herausgegeben und eingeleitet von Bernd A. Laska. Aus dem Französischen übersetzt von Bernd A. Laska unter Mitwirkung von Gertraud Busse. LSR-Verlag, 2004 (2. Auflage) Das zitierte Motto von La Mettrie stammt aus: La Mettrie, Julien Offray de: Der Mensch eine Maschine. Deutsch von Theodor Lücke. Stuttgart 2001. Die zitierten Abschnitte aus dem Roman »Thérèse philosophique« des Marquis d’Argens folgen der deutschen Übersetzung von Heinrich Conrad (erschienen 1908). Sie ist unter dem Titel »Die philosophische Therese« in der digitalen Bibliothek www.zeno.org zu finden.
Ich liebe den Verrat, aber ich hasse den Verräter.
Friedrich II., König von Preußen
Die Natur hat uns einzig und allein dazu geschaffen,glücklich zu sein.
Julien Offray de La Mettrie,
Prolog
Potsdam, 7. Mai 1747
Die Musik begann, und für Andreas war es, als falle alles von ihm ab, was ihm tagtäglich Qual bereitete.
Der stupide Dienst in den Räumen des Königs. Das stundenlange Stehen. Das Gefühl, ein Nichts zu sein – oder nur ein Ding. Nicht mehr als einer von den damastbezogenen Stühlen. Nicht mehr als das Geschirr, in dem man Seiner Majestät den Kaffee reichte. Ein Spiegel. Ein Tablett. Manchmal kam es Andreas vor, als erstarrte er innerlich, wenn er regungslos an einer der Wände der königlichen Gemächer auf eine Aufgabe wartete. Doch jetzt, als hinter der reich verzierten Tür die Instrumente einsetzten, war es, als löse sich all das Versteinerte in ihm.
Eine Melodie wie eine lange Weinranke schwang sich durch die Räume. Zerbrechlich und edel, fein und kostbar. Er schloss die Augen und vergaß den Zierrat des Schlosses, der ihn umgab. All die goldenen Schnörkel, die Stuckornamente und bemalten Flächen. Sie waren hohl und brüchig. Nur die Musik war echt und wahr. Ein Umhang aus Klang, der ihn schützte.
Etwas riss Andreas aus seinem selbstvergessenen Lauschen.
Der Flötist hinter der Tür hatte noch nichts bemerkt. Er streute weiter seine heiteren, vielleicht vom Frühling draußen inspirierten Töne in die Welt, während sich aus den weitläufigen Zimmerfluchten Schritte näherten.
Andreas versuchte, die Musik festzuhalten und die immer lauter werdenden Tritte auszublenden, doch dann waren sie so nah, dass er die Augen öffnen musste.
Es waren zwei Männer. Schröder, der alte Lakai, und dahinter ein stämmiger alter Mann in Reisekleidung. Schröder übergab Andreas wortlos ein Silbertablett, auf dem ein zusammengefalteter Zettel lag. Eine Nachricht für den König.
Andreas wandte sich der Tür zu und zögerte. Er würde das Konzert stören müssen.
Am liebsten hätte er gewartet, bis das Stück zu Ende war. Hinter ihm räusperte Schröder sich. Der unbekannte Gast atmete schwer. Er hatte wohl eine lange Reise hinter sich, denn auf seinem Mantel lag der helle Staub der brandenburgischen Straßen.
Andreas musste gehorchen. Er drückte die Klinke hinunter und betrat den Raum, in dem hell Kerzen brannten. Da stand in blauem Rock, Stiefeln und mit Dreispitz auf dem Kopf Seine Majestät, umgeben von den in ihr Spiel vertieften Musikern. Die glatten gestromten Leiber der königlichen Hunde lagen in der Ecke. Eines der Tiere sah hoch, als erwarte es, dass sein Herr das Instrument wieder an die Lippen führte und weiterspielte. Die Bögen der Geigen fuhren auf und nieder, und jetzt setzte der König gerade die Flöte an, weil sein Einsatz kam. Da bemerkte er Andreas.
Die Musik brach ab. Die eintretende Stille schmerzte Andreas geradezu. Seine Majestät nahm das Blatt vom Silbertablett und faltete es auseinander.
Andreas zog sich zurück. Als er die Tür hinter sich geschlossen hatte und auf seinen Platz vor dem Konzertzimmer zurückgekehrt war, sprach der König drinnen ein paar unverständliche Worte. Kurz darauf wurde die Tür wieder geöffnet, Seine Majestät trat mit schwerem Schritt heraus und wandte sich an den Ankömmling in Reisekleidung, der allein wartete. Schröder war bereits gegangen
Der alte Mann senkte das von einer schweren Perücke bedeckte Haupt vor dem König, der ihn gleich in das Konzertzimmer bat. Beide verschwanden hinter der Tür. Andreas wagte es, sich den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen.
Auch er trug zur Livree der Lakaien eine Perücke. Unter der Schicht aus künstlichen Haaren juckte es heftig, aber natürlich war es verboten, den Kopfputz abzunehmen.
Er konzentrierte sich auf die Stimmen, die aus dem Zimmer hinter der Tür drangen. Andreas konnte nicht verstehen, was gesprochen wurde.
Nach und nach wurde es leiser. Dann erklang ein weicher, schlanker Ton. Und noch einer. Immerhin setzte man die Musik fort – wenn auch nur am Klavier.
Der Ankömmling musste ein Musiker sein. Einer, der von weit her an den Potsdamer Hof gekommen war.
Leise schritt eine Melodie eine Weile dahin. Jetzt sprach der König. Er schien dem Spiel Einhalt zu gebieten, und es brach ab.
Andreas beobachtete, wie die Dämmerung zunahm. Hinter dem großen Fenster verschluckte sie nach und nach die Dächer der Stadt. Immer noch wurde im Konzertzimmer gesprochen. Dazwischen waren die Geräusche zu hören, die aus den Gassen in der Nähe des Stadtschlosses heraufdrangen. Das Quietschen von Kutschen. Pferdegetrappel. Das ferne Abendläuten einer Kirche. Ab und zu der gebellte Befehl eines Offiziers der Schlosswache.
Entschieden und überraschend laut schlug nun jemand im Konzertraum auf dem Klavier Töne an. Es war eine feste, klare Folge von Noten. Andreas zuckte vor Schreck zusammen, beruhigte sich jedoch gleich wieder, denn die Melodie faszinierte ihn. Das war etwas anderes als die Flötenkonzerte. Die Töne stiegen auf wie Stufen einer Treppe. Langsam, fast bedächtig, aber felsenfest wie ein Fundament, das bereits ein imposantes Gebäude erahnen ließ. Streng und hart. In Stein gehauen.
Unerwartet sprang die Linie in die Tiefe, schien einen Moment Kraft zu sammeln, um dann den Tonraum weiter auszufüllen. Fest wie Granit, erzeugte sie in Andreas ein Bild von der gezackten Linie eines mächtigen Gebirges vor blankem Himmel. Eine zweite Stimme flocht sich ein, eine dritte. In engen Verzahnungen schritt die Musik voran, immer reicher wuchsen die Harmonien, als errichte der Klavierspieler auf dem Felsengrund seines Themas eine gewaltige Kathedrale.
Niemand anders als der Fremde spielte diese Musik. In seinen zwei Dienstjahren am Potsdamer Hofe hatte Andreas niemals so etwas vernommen.
Das majestätische Thema wanderte weiter, zog immer neue Stimmen und Harmonien mit sich – wie eine Offenbarung, eine alte, Ehrfurcht einflößende Prophezeiung. Wieder und wieder tauchte in dem Geflecht das ursprüngliche Thema auf, dessen Noten Andreas aus alter Gewohnheit zählte. Er kam auf einundzwanzig. Als die Musik verklang, hatte es sich tief in sein Bewusstsein gegraben.
Und noch spät in der Nacht, als er in der Dienerkammer auf seinem Lager ruhte, pendelten die Töne in seinem inneren Ohr dahin wie ferne Glockenschläge.
Der Morgen graute, und Andreas hatte kaum Schlaf gefunden. Als der Weckruf kam, tönte ihm immer noch die strenge Melodie in den Ohren. Schmerzlich wurde ihm klar, dass ihm die Konzerte des Königs nicht mehr genügen würden.
Der Fremde hatte die wahre Musik nach Potsdam gebracht.
1
Potsdam, ein Jahr später
Das leise Kratzen war das einzige Geräusch in der nächtlichen Schreibstube, in der Johann Joachim Quantz, königlicher Musiklehrer und Kammermusiker, die Feder über das Notenpapier führte.
Von der Nikolaikirche hatte es Mitternacht geschlagen. Wie jede Stunde hatte das Glockenspiel der Garnisonkirche fast gleichzeitig seine Melodien in den Himmel geschickt. Um diese Zeit waren in der Stadt nur noch die Patrouillen der Wache unterwegs.
In Quantz’ Haus am Potsdamer Kanal herrschte Stille. Im Erdgeschoss waren – ganz nach der Bürgerpflicht – zwei Soldaten des Leibregiments einquartiert, deren Schnarchen manchmal heraufdrang. Doch heute war nichts von ihnen zu hören, und Quantz konnte sich auf das konzentrieren, was er in seinem Inneren erlauschte: den Beginn einer heiteren, unbeschwerten Flötenmelodie, ein Thema für den ersten Satz eines neuen Konzerts. Die beiden anderen Teile – ein ausgedehntes, gesangliches Arioso und ein flottes Finale – hatte er bereits seit Tagen fertig. Den König würden diese Sätze erfreuen, aber ein Konzert war nichts ohne einen guten Beginn.
Schon beim Abendessen war Quantz diese Melodie in den Sinn gekommen – ein wenig pompös vielleicht, aber trotzdem lebhaft und vorandrängend. Elegant und doch voller Elan und Geist.
Leider war sie ihm wieder entfallen, als er in seinem Arbeitszimmer stand. Die Noten, die er, ein Stück kalten Braten im Mund, deutlich in seinem Inneren gehört und vor seinem geistigen Auge auf dem imaginären Notenpapier gesehen hatte, waren wie weggeblasen. Sie hatten sich verflüchtigt wie eine beleidigte Diva. Als habe es sie nie gegeben.
Quantz legte die Feder hin und wischte sich die von Tinte befleckten Finger ab. Seine innere Stimme, die genauso klang wie das schneidende böhmische Organ seines alten Lehrers Zelenka, erhob Einspruch.
Das soll ein Konzert werden?
Diese banalen Noten?
Du schreibst für einen König und nicht für eine Bauernkapelle.
Du willst ein Kammerkomponist sein?
Und du kannst dir noch nicht mal eine einfache Melodie merken, die du dir selbst ausgedacht hast. Du bist nicht würdig, das hohe Amt des königlichen Compositeurs zu bekleiden, wenn du dich bei jedem neuen Werk anstellst wie ein blutjunger Anfänger …
Er wandte sich von dem Pult ab. Die Dielen knarrten, als er die wenigen Schritte zum Schrank zurücklegte, wo er die Kopien seiner bisherigen Werke aufbewahrte.
Wie viele Konzerte hatte er bisher geschrieben? Es mussten mehr als zweihundert sein. Musik für einen König, der die Musik liebte, selbst die Flöte spielte und sogar komponierte. Wenn auch ziemlich stümperhaft.
Und der deswegen auf Quantz’ Hilfe angewiesen war.
Quantz hatte Friedrich zu einem ordentlichen Flötisten gemacht, und er war verantwortlich für die Musik, die in den königlichen Kammerkonzerten erklang. Und wenn Seiner Majestät eine Idee für ein Musikstück kam, war Quantz es, der sie ausarbeitete und dem König so zur Freude an künstlerischem Schaffen verhalf.
Welch ein Glück, dass Seine Majestät anders als andere Monarchen wenig Sinn für kompliziertes Hofzeremoniell besaß. Dass er die Jagd – eigentlich das typische Vergnügen des männlichen Adels – hasste. Dass er stattdessen den schönen Künsten zugetan war und Quantz brauchte. Auch wenn Quantz nicht mehr der Jüngste war und er die meisten anderen Hofmusiker – den jungen Bach, Graun, Benda – ein bis zwei Jahrzehnte an Lebenszeit übertraf.
Er wollte gerade den Schrank öffnen, um sich wenigstens am Anblick seiner Werke zu ergötzen, da hörte er ein Geräusch. Ein leises Trommeln klang vom Fenster her.
Quantz übersetzte es sofort in einen Rhythmus. Vier Sechzehntel und ein Viertel. Gar keine schlechte Idee. Daraus konnte man etwas machen. Es klang kokett, grazil. Ein schönes geschnörkeltes Motiv.
Er wandte sich um.
Hinter der Fensterscheibe schälte sich etwas aus der Dunkelheit. Eine weiße Hand mit langen Fingern. Ein Gesicht.
Quantz’ Herz setzte vor Schreck einen Moment aus. Dann erkannte er Andreas, den stummen Lakai. Er musste wieder einmal an einem der Bäume emporgeklettert sein. An einer der Linden, die entlang des Kanals wuchsen und deren Krone seitlich in die Fassade des Gebäudes ragte …
Andreas’ längliche Züge mit den traurigen dunklen Augen verzogen sich, als er pantomimisch eine Flöte an den Mund führte und mit der linken Hand eine Bewegung machte, als würde er darauf spielen. Mit der anderen hielt er sich am Baum fest.
»Kerl, willst du dir den Hals brechen?«, rief Quantz, als er das Fenster geöffnet hatte. Der Lakai kletterte mühsam herein. Seine helle Livree war verschmutzt, die Perücke, die schief auf seinem Kopf saß, war auch nicht mehr ganz weiß.
In letzter Zeit hatte er Quantz öfter besucht, allerdings tagsüber, wenn Andreas Botengänge erledigte. Es war ein Rätsel, wie er zu dieser Stunde überhaupt in die Stadt gekommen war. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden die Stadttore geschlossen. Sanssouci, wo Andreas seinen Dienst versah, lag außerhalb von Potsdam.
Aber dieser Mensch war eben merkwürdig. Niemand hatte ihn je sprechen hören. Doch im Dienst galt er als mustergültig. Er tat alles, was man von ihm verlangte, mit großer Genauigkeit.
»Was willst du hier?«
Andreas blickte ihm nicht in die Augen und bewegte sich seltsam schlaksig durch den Raum.
Unruhe erfasste Quantz. Er konnte den Jungen nicht gebrauchen. Er musste arbeiten. Außerdem hatte Andreas nicht hier, sondern bei seinem Dienst oder in der Dienerkammer zu sein.
»Du bist von einem Gang in die Stadt nicht ins Schloss zurückgekehrt«, stellte Quantz fest. »Du willst doch nicht etwa hier übernachten?«
Andreas verzog den Mund, schwieg aber, wie es seine Art war. Man konnte ihm ansehen, dass er sehr gut verstand, was man ihm sagte. Er lief unschlüssig in der Stube herum und blieb schließlich vor dem Pult stehen.
Im ersten Impuls wollte Quantz ihn zurückpfeifen, doch dann besann er sich darauf, dass in Andreas kleine Wunder steckten. Man musste ihm nur Zeit geben, sich in eine Sache hineinzufinden, und ihm gelangen die seltsamsten Dinge. Bei seinem letzten Besuch hatte er in unglaublicher Geschwindigkeit Sophies Restgeld gezählt, nachdem sie vom Markt zurückgekommen war. Kaum hatte er die Münzen in die Hand genommen, da hatten seine Finger die richtige Summe auf den Tisch gemalt.
Ein andermal hatte er es sogar geschafft, Quantz beim Komponieren zu helfen. Es war nicht herauszufinden, wie er darauf gekommen war, aber er hatte begriffen, dass man aus zufälligen Kombinationen von Noten die schönsten Melodien erfinden konnte.
Quantz war diese seltsame Fähigkeit klar geworden, als Andreas ein Stück Notenpapier in die Finger bekam, auf dem noch etwas Platz war und das Sophie eigentlich zum Feuermachen in die Kiste neben den Ofen gelegt hatte.
Wie besessen hatte Andreas vier, fünf Töne in immer anderer Reihenfolge aufgeschrieben, seine Arbeit auffordernd hingehalten, bis Quantz eingefallen war, es auf dem Cembalo im Arbeitszimmer zu spielen. Voller Freude über das Ergebnis war der Lakai im Zimmer herumgetanzt. Und Quantz erkannte, dass diese Art des Melodienerfindens sehr inspirierend war.
»Willst du wissen, wie das hier klingt?«, fragte er und deutete auf das Thema, über dem er seit Stunden grübelte und das einfach nicht in die herrliche Form kommen wollte, die ihm beim Abendessen vorgeschwebt hatte.
Andreas schien ihn nicht gehört zu haben. Er hatte schon zur Feder gegriffen. Akkurat tauchte er sie in das Tintenfass und ließ sie über dem Papier schweben, als müsse er einen Moment überlegen.
Quantz verließ die Hoffnung, dass ihm Andreas mit seinem seltsamen Hang zur Kombinatorik bei dem Konzert weiterhelfen könnte. Jetzt wirkte er, als wolle er den Kammerkomponisten des Königs nur nachahmen. Er hatte wahrscheinlich Quantz vom Fenster aus schon eine ganze Weile beobachtet und imitierte nun seine Gesten. Seine Arbeit an dem Stehpult. Quantz benutzte es, seit ihn zwischen Hüfte und Schulterblättern gelegentlich heftige Schmerzen heimsuchten.
Andreas wandte sich um und lächelte.
Er war vielleicht wirklich nur ein Idiot. Ein Idiot, in dem ein Talent schlummerte, wenn er bei Verstand wäre. Doch nun hing die Begabung unbenutzbar im leeren Raum – ohne Anleitung der Vernunft.
Mitleid erfasste Quantz. Am besten, er übergab den Jungen der Wache. Wenn man sich nachts auf die schnurgeraden Straßen von Potsdam wagte, traf man unweigerlich innerhalb von Minuten eine der Patrouillen, die nach einem festen System die Stadt durchschritten. Nur Andreas gelang es offenbar, ihnen zu entgehen. Hoffentlich wurde er nicht zu streng bestraft.
Quantz ging ans Instrument, um Andreas das missglückte Thema vorzuspielen. Seine Hand lag schon auf den Tasten, und in seinem Rücken meldete sich der altbekannte Schmerz, da begann die Feder zu kratzen.
Quantz richtete sich auf. Andreas schrieb konzentriert etwas auf das Notenpapier. Neugierig kam Quantz näher.
Es war nicht sein Thema, das da stand, es war … Das war unmöglich. Das konnte nicht sein!
»Was schreibst du da?« Eine dumme Frage, denn er wusste es ja.
Andreas wirkte, als habe man ihn gewaltsam aus einem Traum aufgeweckt. Er sah Quantz böse an und bedeckte mit der Hand, was er geschrieben hatte.
»Woher kennst du das?«
Und wieso war Andreas in der Lage, fehlerfrei Noten aufzuschreiben, die zuletzt vor einem Jahr erklungen waren? Doch da hatte sich Andreas von dem Pult gelöst. Quantz kam näher, während der Junge, das Blatt festhaltend, zum Fenster zurückwich.
»Gib mir das«, sagte Quantz.
Andreas’ schwarze Augen fixierten ihn. Er griff nach dem Zettel, doch Andreas zog ihn weg, langte nach hinten und öffnete mit überraschender Geschicklichkeit das Fenster.
Er wird sich hinausstürzen, dachte Quantz.
Er packte Andreas am Arm und entriss ihm das Blatt.
Dann spielte ihm seine Neugierde einen Streich. Er wollte prüfen, ob er richtig erkannt hatte, was da stand, und hielt das Papier kurz ins Licht.
Schnell wie ein wildes Tier war Andreas über die Fensterbank geklettert. Laub raschelte. Ein Ast krachte.
Quantz blickte hinaus, nach unten, wo sich im matten Licht einer Öllampe auf der Straße das schwarze Wasser des Kanals spiegelte. Andreas’ Gestalt tauchte im Lichtkegel auf, dann war sie verschwunden. Seine Schritte verhallten.
Quantz lief zur Tür seiner Stube. Viel zu lange dauerte es, bis er die Treppen hinuntergepoltert war und im dunklen Flur den Schlüssel vom Haken genommen hatte.
Er schloss die Haustür hinter sich und rannte in die Richtung, in die Andreas verschwunden war.
***
Die Wache!
Der Mann drückte sich tiefer in den Hauseingang und lauschte auf die Schritte, die sich unbarmherzig näherten.
Die Holztür hinter ihm hing schief in den Angeln und drohte herauszufallen. Er drehte sich um und tastete sich an dem verfaulten Holz vorbei.
Das alte Gebäude war ein gutes Versteck. Es wurde gerade abgerissen, um Platz für die neuen Häuser zu schaffen, die der König in seiner Residenzstadt haben wollte. Eines davon war bereits fertig und stand auf der anderen Seite des Kanals – gleich an der Abzweigung zur schrägen Straße, die zum Bassin hinüberführte.
Dort wohnte der königliche Musiker Johann Joachim Quantz. In der oberen Etage brannte Licht. Ab und zu konnte man sehen, wie der Musikmeister in seinem Arbeitszimmer umherging.
Der Mann hatte beobachtet, wie der Lakai Andreas einen der Bäume, die den Kanal säumten, hinaufgeklettert war. Wie eines dieser menschähnlichen Tiere, die manchmal den Weg aus Afrika in die Kuriositätenkabinette der Adligen oder der Wissenschaftler fanden.
Quantz hatte Andreas behandelt, als sei er ein normaler Mensch. Dabei war er ein Idiot. Oder spielte wenigstens die Rolle des Idioten. So ganz klar war das nicht. Denn Andreas sprach kein Wort.
Die Wache kam heran. Der Mann verbarg sich ganz im Dunkel des Hauses hinter ihm und versuchte, möglichst geräuschlos die Tür wieder in die Öffnung zu schieben. Der staubige, herbe Geruch nach abgeschlagenem Mörtel und feuchtem Holz umgab ihn.
Die Tritte der Soldaten waren sehr nah und zogen vorbei. Die Marschtritte verklangen in der Ferne. Der Mann zählte zwanzig Herzschläge.
Jetzt wagte er sich wieder auf die Straße. Er bekam das Haus von Quantz genau in dem Moment in den Blick, als sich Andreas vom Baum schwang und davonrannte.
***
Quantz war ein langes Stück am Kanal entlanggelaufen. Als er an die Beckergasse gelangte, wo die hell erleuchtete Stadtwache lag, gab er es auf, den Jungen zu verfolgen.
Es hatte keinen Sinn. Und er würde sich lächerlich machen: Ein gestandener Bürger, im hohen Sold des Königs, der einem Lakaien nachlief …
Ohne von einer Patrouille angehalten zu werden, erreichte er sein Zuhause. Kaum hatte er den Hausflur betreten, öffnete sich die Tür zu dem Soldatenquartier.
Kerzenschein drang heraus. Im Türrahmen stand eine bullige Gestalt und kratzte sich am Kopf.
»Muss das sein, ein solcher Lärm mitten in der Nacht?«, dröhnte die Stimme des Grenadiers. Er stand barfuß in Hemd und Hose da. »Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Morgenappell, Herr Quantz, und die würden wir gern schlafen.«
Der Geruch nach den Ausdünstungen ungewaschener Körper und der nicht minder unreinen Wäsche und Uniformen, der ihm aus der Stube entgegenkam, verursachte bei Quantz Übelkeit. Er überlegte, welcher der beiden vor ihm stand. Es war nicht leicht, sie auseinanderzuhalten. Der eine hieß Trakow, der andere Sperber. Wahrscheinlich hatte Quantz Trakow vor sich. Er besaß eine gezackte Narbe neben dem Mund, eine blasse Linie, die man aber in diesem Licht kaum erkennen konnte.
»Ist schon gut, es wird jetzt Stille herrschen.«
»Das hoffen wir«, brummte der Grenadier und zog sich zurück.
Quantz erklomm die Treppe und bemühte sich, leise aufzutreten. Oben erwartete ihn ein Lichtschein. Da stand Sophie mit einer Kerze. In ihrem Nachtgewand ähnelte die Magd einem Gespenst. Doch ihr ovales, ebenmäßiges Gesicht, das an eine Madonna erinnerte, jagte Quantz keinen Schrecken ein. Im Gegenteil.
»Ist jemand da gewesen?«, fragte sie mit einer Spur Ängstlichkeit in der Stimme.
»Ich erzähle es dir morgen«, sagte er. »Es ist nichts, was dich beunruhigen müsste.«
Sie gab ihm schweigend das Nachtlicht und kehrte in ihre Kammer zurück.
Quantz blieb unschlüssig stehen, und da tauchte, als habe es ihn die ganze Zeit begleitet, das Thema für sein Konzert wieder in ihm auf. Er eilte in seine Arbeitsstube zurück, stellte das Licht hin und nahm ein neues Blatt Notenpapier. Sechs Takte, acht …
Der alte Vivaldi aus Venedig hatte das Prinzip entwickelt, es selbst anhand Hunderter Werke für die verschiedenen Instrumente angewandt und sogar Quantz einst eine Lektion darin erteilt, wie man Konzerte gewissermaßen aus dem Ärmel schüttelte.
Über zwanzig Jahre war das jetzt her. Es war am Vorabend von einer der legendären Aufführungen von Vivaldis Opern gewesen – einem Spektakel, das weit bis in die Nacht gedauert hatte. Danach hatte sich der Venezianer – obschon geweihter Priester und offiziell im Zölibat lebend – mit der Sängerin Anna Giraud in einen der berüchtigten venezianischen Karnevalsbälle gestürzt. Quantz schwelgte in der Erinnerung an die feuchtschwüle Atmosphäre dieses Abends, an die bunten Masken und aufreizenden Kostüme, an den rot leuchtenden Wein, die ebenso roten Lippen der maskierten Damen, die rasenden Klänge des Orchesters. Den Rausch der Jugend …
Einen Moment war er versucht, sich in Sophies Schlafkammer zu schleichen, was er hin und wieder tat und was sie ihm nicht verwehrte, doch dann riss er sich zusammen und konzentrierte sich auf seine Arbeit.
Man erfand ein möglichst mitreißendes Kopfthema, das die Streicher vorstellten, während das Soloinstrument noch schwieg. War es einmal gefunden, leitete man aus einer der kleinen Notengruppen dieses Themas ein langes, sich auf verschiedenen Tonstufen wiederholendes Motiv ab und führte es zu einem brillanten Ende. Dann gab man dem Solisten – hier dem König mit der Flöte – den Einsatz mit demselben Thema. Der Solist hatte nun das Prinzip der sich wiederholenden Motive in allerlei Variationen vorzuführen, unterbrochen von den Streichern, die immer wieder das Hauptthema dazwischenwarfen, sodass ein Dialog entstand.
Dabei ging es durch mehrere Tonarten – mal wurde das Geschehen in melancholisches Moll gewendet, leuchtete dann wieder in erhabenem Dur, um ein prächtiges Ende zu finden, in dem alle Motive noch einmal wiederholt wurden.
Hatte man dieses Prinzip verstanden, konnte man damit erste und dritte Sätze für Konzerte bauen – wie ein Architekt, der einen Palast entwirft. Quantz selbst hatte das hundertfach getan – und hatte Vivaldi durchaus nachgeeifert. In den Mittelsätzen dagegen ging es um reine Melodien über sparsamer Begleitung.
Die Feder kratzte und kratzte über das Papier, und die Uhr schlug bereits zwei, als Quantz endlich mit dem Konzert fertig war.
Er hatte es wieder einmal geschafft. Es war ein Gefühl, als würde er nach einem langen, langen Marsch ein zentnerschweres Gewicht absetzen.
Vorsichtig legte er die Partitur zusammen, sodass ein kompakter Stapel Papier auf dem Pult lag. Sophie würde ihn morgen früh zum Kopisten bringen, der die Stimmen für die Aufführung vorbereitete.
Quantz wollte gerade das Licht nehmen und sich in sein Schlafgemach zurückziehen, da fiel sein Blick auf das Blatt, das Andreas mit seinen Noten beschrieben hatte. Es lag noch vor dem Fenster, wo es nach seiner Flucht zu Boden gefallen war. Vor lauter Arbeit an seiner Komposition hatte Quantz es vergessen.
Er faltete es auseinander. Und da stand das Thema wieder vor ihm.
Andreas hatte es hingeschrieben, als sei das gar nichts. Dabei war es nicht weniger als ein Wunder. Ein Rätsel.
***
Andreas reagierte zu langsam. Der Schatten bekam ihn am Arm zu fassen und zog ihn in den dunklen Eingang. Panisch versuchte er sich zu befreien, doch der Griff war eisern.
Bis zur Hauptwache war es nicht mehr weit. Zweihundert Schritte vielleicht. Wäre er nur sofort dorthin gelaufen! Aber er musste erst Herrn Quantz abschütteln, der ihm seine Melodie hatte stehlen wollen. Andreas hatte nicht verstanden, warum. Eigentlich war Herr Quantz einer von den Menschen, zu denen man Vertrauen haben konnte. Nun war Andreas kurz stehen geblieben. Das Blatt mit dem Thema war verschwunden. Offenbar hatte er es verloren. In diesem Moment hatte der Unbekannte zugeschlagen und wollte ihn ins Dunkel ziehen.
»Bleib ruhig«, zischte eine branntweingeschwängerte Stimme aus dem Loch. »Wenn sie uns kriegen, haben wir beide Ärger am Hals. Du mehr als ich.«
Eine Hand legte sich auf Andreas’ Gesicht. Sie stank nach Erde und Schmutz. Da war keine Haut, sondern eine dicke Schicht aus Horn und Narben. Das musste der Teufel sein.
Wärme breitete sich in seiner Hose aus. Er versuchte zu schreien. Doch er brachte nur ein Ächzen zustande.
Von irgendwoher trappelten Schritte. Soldaten näherten sich. Der Lichtkegel einer Laterne leuchtete das Loch hinter Andreas aus.
»Das büßt du mir bald«, zischte der Mann, gab Andreas einen Stoß, dass dieser auf das Pflaster stürzte, und rannte in die Nacht.
Ein brennender Schmerz am Knie ließ Andreas aufschreien. Mühsam erhob er sich. Seine Perücke war verrutscht. Er hatte es gerade geschafft, sie zurechtzurücken, als einer der Grenadiere ihn mit einer Handlampe anleuchtete.
»He, wer bist du?«, rief der Mann. Er trug als Einziger einen Hut mit drei Spitzen und nicht die hohen metallenen Grenadiersmützen. Es musste ein Offizier sein. »Bist du ein Mädchen? Hast du Angst im Dunkeln?«
Die Soldaten lachten. Der Offizier wurde als Erster wieder ernst. »Ein Lakai aus dem Schloss. Was treibst du dich hier herum?«
»Den kenne ich«, rief ein anderer. »Der ist nicht ganz richtig. Verpasst manchmal den Zapfenstreich.«
Der Offizier nickte. »Wir schaffen ihn morgen früh zurück.«
Zwei Grenadiere zogen Andreas mit sich fort in Richtung des Wachgebäudes. Es war ihm recht. Nur weg von dem Teufel.
»Du scheinst ja sehr erpicht auf deine Strafe zu sein«, sagte einer der Soldaten.
Je näher sie der Wache kamen, desto deutlicher machte sich Erleichterung in Andreas breit. Schließlich wurde er in das kleine Gebäude geschoben und auf eine Bank gesetzt.
»Ein Deserteur«, sagte der Offizier zu seinem Kameraden, der bei einer fahlen Lampe am Tisch saß, das Wachbuch vor sich. Das Gewehr lehnte gleich neben dem Stuhl.
»Er heißt Andreas Freiberger«, sagte der Soldat.
»Na, wenn ihn alle kennen, dann wisst ihr ja auch, was mit ihm zu tun ist.«
Andreas streckte sich auf der Bank aus. Die vier Mauern des Wachgebäudes sorgten für Sicherheit. So lag er da, die Augen zur Decke gerichtet, und wartete auf den Morgen.
2
In den warmen Monaten begann in Potsdam jeder neue Tag mit dem großen Wecken in der Morgendämmerung. Wenn das Licht so hell war, dass der wachhabende Offizier mit bloßem Auge einen Befehl lesen konnte, ging es los. Trommeln, Militärpfeifen und lautes Gebrüll rissen Bürger und Soldaten aus dem Schlaf. Innerhalb von Minuten strömten Tausende von blau, gelb und weiß gekleideten Gemeinen und höherer Dienstgrade durch die schnurgeraden Straßen. Um Punkt fünf Uhr hatten sie an ihren Appellplätzen zu stehen, um ihren Dienst zu beginnen. Wer zu spät kam, musste mit Prügeln oder sogar mit dem gefürchteten Spießrutenlaufen rechnen.
Zivilisten hätten in diesem Geschiebe und Gerenne nur im Weg herumgestanden, weshalb man am Morgen den Uniformierten den Vortritt ließ. Wenn man es nicht vermeiden konnte, auf der Straße unterwegs zu sein, quetschte man sich vorsichtig an den Häuserzeilen entlang – immer darauf gefasst, dass die nächste Tür aufflog und Rennende einen Grenadiere in voller Montur zur Seite stießen.
Quantz konnte sich an diesen morgendlichen Lärm, der Tag für Tag mit der Unbarmherzigkeit eines Erdbebens die Stadt heimsuchte, auch nach Jahren in Potsdam nicht gewöhnen. Er fuhr aus dem ersten tiefen Schlaf, drehte sich auf den Bauch, schob sich sein Kissen über die Ohren – vergeblich. Ihn störte nicht nur der Krawall der Soldaten unten in seinem Haus und auf der Straße. Das rasselnde Getrommel und das Gequäke der militärischen Oboisten bereiteten ihm Höllenqualen. Nach einer Stunde, gegen sechs Uhr, wenn der erste Sturm vorbei war, fand er gewöhnlich noch etwas Schlaf. Mit etwas Glück machten die aufscheuchenden Rhythmen des Militärs in seinen Träumen einer anderen Musik Platz – einem der königlichen Konzerte etwa, das sich inmitten des Spektakels wie eine liebliche Rose in einer Wüste ausnahm.
Er erhob sich gegen elf, streckte seinen schmerzenden Rücken und öffnete das Fenster. Ein Schwall der lauen Mailuft kam ihm entgegen.
Jetzt war es wieder stiller in der Stadt. Nur von Ferne wehte der rasselnde Klang von Trommeln herüber. Dazwischen waren markante Rufe zu erahnen. Unten am Stadtschloss hatte die tägliche Parade begonnen, die der König gewöhnlich persönlich abnahm.
Es klopfte an der Tür.
»Komm herein, Sophie«, sagte Quantz.
Die Dienstmagd trug ein Tablett in der Hand, auf dem sich eine kleine Kaffeekanne und ein Teller mit etwas Gebäck befanden. Diese Art des Frühstücks hatte sich Quantz in seiner Zeit in Paris angewöhnt. Sie belastete den Magen nicht so sehr wie das in Preußen verbreitete morgendliche Suppenfrühstück aus Milch oder zerstampften Kartoffeln.
»Was gibt es heute?«, fragte er, obwohl er es wusste, und setzte sich. Es gefiel ihm, dass Sophie nicht nur einfach eine Haushälterin war, sondern auch Anteil an seiner Arbeit hatte und dass sie sich für das interessierte, was er tat. Dass sie sich gelegentlich sogar seine Kompositionen anhörte, bevor er sie dem König vorstellte. Natürlich war sie ein ungebildetes Frauenzimmer und verstand nicht das Geringste von Musik. Nicht im fachlichen Sinne. Aber sie hatte einen sicheren Geschmack. Denn sie besaß nicht nur Verstand, sondern auch Herz.
»Am Nachmittag kommen Herr Graun, Herr Benda, Herr Engke, Herr Mara und Herr Bach. Danach haben Sie Konzert beim König. Und hier ist noch etwas. Ein Brief von Ihrer Frau.«
Sophie schob die Untertasse zur Seite. Ein zusammengefaltetes und versiegeltes Papier wurde sichtbar.
Den Brief konnte er vernachlässigen. Er ahnte, was darin stand. Anna hatte das Porto sicher wieder hauptsächlich dafür aufgewendet, um ihn um mehr Geld zu bitten.
»Ist die neue Partitur beim Kopisten?«
»Seit halb acht heute Morgen.«
Quantz nickte zufrieden. Am frühen Nachmittag hatten sie also die abgeschriebenen Einzelstimmen. Und es blieb noch genug Zeit für die Probe.
Es war natürlich unmöglich, ein Konzert im Schloss zu präsentieren, ohne das neue Stück durchzugehen. Eine Probe war wichtig, damit es keine Panne gab. Es konnten sich ja trotz sorgfältiger Arbeit Schreibfehler eingeschlichen haben. Und was würde das für einen Eindruck machen, wenn falsche Töne die Kammermusik verdarben?
Das Kopieren der Noten war eine Aufgabe, die nicht nur größte Genauigkeit erforderte, sondern auch Diskretion. Niemand anders als Quantz und Seine Majestät durften im Besitz der königlichen Partituren sein. In den großen Musikmetropolen wie Wien, Paris, Venedig oder Neapel kam es vor, dass Kopisten, die eigentlich nur die Exemplare vervielfältigen sollten, unter der Hand in ihren Schreibstuben gleich weitere Abschriften der in Auftrag gegebenen Stücke anfertigten, um sie dann als eigene Komposition heimlich weiterzuverkaufen. Friedrich würde so etwas niemals dulden.
»Wer schreibt die Noten ab?«, fragte Quantz, denn es gab mehrere Schreiber, die für den König arbeiteten, und nicht jeder hatte immer Zeit. Einige waren durch die Arbeiten an den Opernmanuskripten blockiert, die für das neue Opernhaus in Berlin entstanden.
»Herr Freudenberg«, sagte Sophie.
Das war gut. Johann Gottlob Freudenberg war zuverlässig. Er spielte selbst Geige in der Hofkapelle und komponierte sogar ein bisschen. Er hatte Sinn für den Gesamtzusammenhang und war mehr als eine taube Abschreibemaschine.
»Danke, Sophie, das wäre alles.« Quantz nahm die Kanne und goss sich Kaffee ein.
Bevor sie sich zur Tür wandte, zeigte sie ihre Ergebenheit mit einem höflichen Knicks.
Eigentlich konnte er es nicht leiden, wenn sich Sophie ganz und gar wie eine Dienstmagd verhielt. Am liebsten hätte er ein legales Verhältnis zu ihr gehabt, aber das ging nicht, solange er formal mit Anna verheiratet war.
Die Zeit bis gegen drei Uhr am Nachmittag verbrachte Quantz damit, einen kleinen Spaziergang durch die Stadt zu machen, denn das schien seinem Rücken ebenfalls gutzutun, ähnlich wie das Arbeiten im Stehen. Danach holte er seine Querflöte hervor und spielte sich für die bevorstehende Probe ein.
Bevor er zum privaten Flötenlehrer des preußischen Königs geworden war, hatte er in ganz Europa vor vielen gekrönten Häuptern konzertiert und dafür höchste Ehrungen entgegennehmen dürfen. Als Flötist am Hofe des prachtliebenden sächsischen Kurfürsten in Dresden hatte er bei einem königlichen Besuch den damaligen preußischen Kronprinzen Friedrich kennengelernt, der von der luftigen Leichtigkeit der Flöte besessen war. Ein volles Jahrzehnt hatte der Prinz versucht, Quantz dem Herrscher in Sachsen abzuwerben. Ein Jahr nach seiner Thronbesteigung war es ihm schließlich gelungen. Verbunden mit dem gewaltigen Gehalt von zweitausend Talern jährlich und sehr begrenzten Aufgaben: Vorbereitung der abendlichen Kammermusiken im Schloss. Dabei persönliche Anwesenheit. Auf Wunsch Seiner Majestät Unterricht auf der Flöte. Außerdem die Komposition neuer Konzerte oder Sonaten, die extra bezahlt wurden, sowie die Anfertigung neuer Instrumente, die er dem König ebenfalls gesondert verkaufen durfte.
Alles in allem kam Quantz damit auf ein Gehalt von über dreitausend Talern – ein Vielfaches dessen, was andere Mitglieder des Orchesters bekamen, die wesentlich mehr Verpflichtungen hatten als er. Carl Philipp Emanuel Bach zum Beispiel, immerhin der Sohn des großen Johann Sebastian aus Leipzig, hatte in der Kammermusik Klavier zu spielen, wirkte in Opernaufführungen in Berlin als Cembalist mit und musste seine Familie mit nur dreihundert Talern durchbringen.
Quantz schickte immer wieder neue Ketten von brillanten Flötentönen in den Raum. Nach und nach arbeitete er die Studien ab, die für die Fingergelenkigkeit wichtig waren und mit denen er Friedrich in dessen ersten Flötenstunden traktiert hatte. Doch nach und nach lenkte sich der Melodienfluss wie von selbst auf das Thema seines neuen Konzerts. Es gelang Quantz, das Solo aus dem Gedächtnis nachzuspielen. Immer weiter versank er in seiner eigenen Musik – und er erwachte wie aus einem Tagtraum, als Sophie an die Tür klopfte. Er rief sie herein. In der Hand trug sie einen Stapel Noten.
»Herr Freudenberg war gerade da«, sagte sie. »Und ich bitte Sie zu Tisch.«
Quantz, immer noch die Flöte in der Hand, nickte ihr zu. Die Tür war schon wieder geschlossen, als er das Instrument beiseitelegte, zum Stehpult ging, wo der Papierstapel lag, und über das raue Papier strich. Er blätterte in den Noten. Der Kopist hatte sauber gearbeitet.
Vorfreude auf den Nachmittag begann sich in Quantz zu regen, so als wäre in ihm eine kleine, muntere Quelle ans Licht gelangt, die ihn nicht mit Wasser, sondern mit Glück versorgte.
Er warf einen letzten Blick auf die Noten und verließ das Zimmer.
Noch im Stehen beugte Carl Philipp Emanuel Bach seine kleine, etwas dickliche Gestalt nach vorn, griff in die Tastatur des Cembalos und spielte mit einer Hand die ersten Töne des Stückes. Er wiederholte es mechanisch, fast zwanghaft, als wolle er eine seelenlose Spieluhr nachahmen. So klang es wie die fixe Idee eines Idioten. Ein spöttisches Grinsen erschien auf seinem feisten Gesicht.
»Nach zweihundert Konzerten gehen einem schon mal die Ideen aus – was, Herr Quantz?«
Die anderen Musiker waren damit beschäftigt, ihre Instrumente auszupacken. Benda hatte gerade seinen Geigenkasten geöffnet, den Bogen herausgeholt und spannte ihn nun vorsichtig. Mara hob sein Cello auf und zupfte prüfend die Saiten an.
Alle außer dem Hofflötisten trugen die blaue Livree der Hofkapelle. Quantz, der direkt dem König unterstellt und deshalb dazu nicht verpflichtet war, hatte sich für einen Rock entschieden, der dieselbe Farbe aufwies, allerdings in einem deutlich helleren Ton. Der Kontrast zu den offiziellen Uniformen der Musiker erinnerte an den Unterschied zwischen Offizieren und einfachen Soldaten. Bei den Ranghöheren war alles strahlender und glänzender. Tressen und Borten waren bei den höheren Rängen sogar mit Silber oder Gold durchwirkt. So etwas auf Zivilkleidung anzubringen, wäre übertrieben gewesen, aber Quantz hoffte, dass die von Sophie auf Hochglanz polierten Knöpfe einen ähnlichen Eindruck machten.
Als wäre es eine Gnade, dass er sich mit der Musik überhaupt befasste, nahm Bach umständlich am Cembalo Platz und klimperte mit beiden Händen, ohne Elan, mehr wie ein Lehrer, der die Arbeit eines Schülers prüft und voller Verzweiflung nach einem guten Gedanken darin sucht.
Quantz schluckte den aufkeimenden Ärger über das Verhalten des Pianisten hinunter. Ihm war klar, was dahintersteckte: der pure Neid. Die anderen Musiker ließen sich nichts anmerken, nur Bach zeigte Quantz immer wieder fast unverhohlen seine Missgunst. Als hätte er seine Gefühle nicht im Griff.
»Meine Herren, es ist spät«, sagte Quantz in Bachs Spiel hinein und legte Autorität in seine Stimme. »Seine Majestät erwartet eine gute Musik von uns. Ich bitte um Disziplin.«
»Der Fluss steigt nicht höher als die Quelle«, brummte Bach, der die Hände von der Tastatur genommen hatte. »Unser Spiel kann nie mehr Qualität besitzen als die Musik, die man uns vorlegt.«
»Gut gesagt, Herr Bach«, kam es von Benda in breitem böhmischem Akzent. Seine weit auseinanderstehenden Augen, die ihm das Aussehen eines Froschs gaben, wanderten über die bereitliegenden Noten auf dem Pult. »Doch, mein Lieber, Sie vergessen, wer die wahre Quelle dieser Musik ist. Und welcher Fluss kann schon höher steigen, als es der Geschmack eines starken Königs erlaubt?«
Ein schiefes sprachliches Bild. In Quantz begann sich heißer Zorn anzusammeln, er sah Bach abfällig an. Der Pianist gab den Musikern gerade den Kammerton zum Einstimmen.
Die Enge in Quantz’ Musikzimmer machte sich bemerkbar. Mara, der Cellist, war außer Bach der Einzige, der saß. Er drängte sich neben das Cembalo und las seine Bassstimme aus den Noten auf dem Flügel mit. Engke, der Bratschist, hatte das Stehpult im Rücken. Die beiden Geiger standen vor dem Fenster.
Für Quantz war kein weiteres Pult vorhanden. Er würde seinen Part auswendig spielen.
Er gab das Zeichen und sie begannen. Und da sprudelte sie wieder, die Quelle des Glücks in Quantz’ Seele. Er genoss es immer wieder, die Musik zu hören, die in den vergangenen Tagen nur in seinem Kopf gewesen war. Es erfüllte ihn mit einem befriedigenden Gefühl der Dankbarkeit und des Stolzes. Da konnte der junge Bach so viel Häme verbreiten, wie er wollte.
»Im Mittelsatz bitte mehr Zurückhaltung«, sagte Quantz, als sie das Konzert durchgespielt hatten.
Benda, auf dessen Stirn sich Schweißperlen zeigten, nickte. Im engen Zimmer war es warm und stickig geworden. Quantz bahnte sich den Weg zum Fenster und öffnete es.
»In einem großen Raum könnte das angehen, aber im Konzertzimmer des Schlosses …?«
»Wir werden sehen«, sagte Graun. Er sah Quantz an. »Wünschen Sie einen weiteren Durchgang?«
»Wir haben Zeit, und es würde Ihnen Sicherheit geben. Der König wird seine Partie nicht vom Blatt beherrschen, umso geschickter müssen Sie sein.«
Sie spielten das ganze Konzert, das insgesamt knapp zwanzig Minuten dauerte, noch zweimal durch. Am Ende kam Applaus von der Straße. Graun schloss das Fenster, ohne hinunterzusehen. »Wir sollen Musik für Seine Majestät machen. Nicht für das gemeine Volk.«
Bach stand auf. Mara erhob sich ebenfalls und legte das Cello auf dem Cembalo ab. »Sind wir dann fertig?«, fragte er. Quantz nickte. Sie würden bis zur Abfahrt zum Schloss einen kleinen Imbiss nehmen, den Sophie vorbereitet hatte.
Die Pulte wurden in eine Ecke gestellt, die Noten zusammengeräumt, die Instrumente verpackt. Als Quantz die vier Teile seiner Flöte auseinandergezogen und gereinigt hatte, fiel sein Blick auf Bach, der an seinem Pult stand. Quantz durchzuckte ein heißer Blitz, als er erkannte, dass der Zettel mit Andreas’ Noten noch dort lag.
Drei Schritte, und er nahm das Papier an sich. Doch es war zu spät.
»Versuchen Sie sich an etwas Ernsthaftem?«, fragte Bach.
»Und wenn es so wäre?«.
»Das scheint mir nicht Ihre Handschrift zu sein. Und was da steht, ist auch nicht von Ihnen. Erhalten Sie neuerdings beim Komponieren Hilfe?«
Quantz verfluchte sich innerlich. Er hätte den Zettel verbrennen sollen.
Die Tür öffnete sich. »Es ist angerichtet«, sagte Sophie.
Der kleine Benda und der große, schlanke Graun nickten lächelnd. Zum Glück hatten sie nichts mitbekommen.
»Diese Noten waren nicht für Sie bestimmt«, zischte Quantz Bach zu.
»Das weiß ich.« Der Pianist lächelte und schloss sich den anderen Musikern an, die den Raum verließen.
***
Andreas versuchte, nicht durch die Nase zu atmen, als er die hölzerne Schaufel unter den frischen Kothaufen schob, um den Dreck in den bereitstehenden Eimer zu befördern. Er hasste diese Arbeit, aber er war froh, dass man ihn wegen seines nächtlichen Ausflugs nur damit bestrafte.
Im Moment war ihm alles recht, was ihn an das Schloss Sanssouci band, denn hier fühlte er sich sicher. Die Erinnerung an den Mann, der ihm in dem dunklen Eingang aufgelauert hatte, war verblasst wie der üble Nachgeschmack eines Alptraums. Die Stadt war fern. Und das war gut so.
Ein tapsendes Geräusch näherte sich über das Parkett. Es war Biche, einer der königlichen Hunde, mit deren Hinterlassenschaft Andreas gerade beschäftigt war.
Biche und Alcmene, die Windspiele des Königs, durften im Schloss tun und lassen, was sie wollten. Meist hielten sie sich im engen Umkreis Seiner Majestät auf, doch wenn der Monarch in seinem Schlaf- und Arbeitszimmer saß oder sich mit hohen Herren beriet, wurde es ihnen zu langweilig, und sie erlaubten sich einen Rundgang durch die Zimmerfluchten oder in den Park.
Der Hund schnüffelte an der Schaufel, als wolle er nicht glauben, dass er vor nicht einmal einer halben Stunde für diesen Dreck gesorgt hatte. Er sah Andreas kurz bei der Arbeit zu, dann tapste er wieder davon.
Andreas verließ das schmale Audienzzimmer durch den Dienerausgang. Er durchquerte das Vestibül, wo der offizielle Schlosseingang lag, den er als Domestik nicht benutzen durfte. Er trug den Eimer durch die angrenzenden Dienerquartiere, die hinter der Reihe der Gästezimmer lagen. Schließlich erreichte er den Park, wo er den Hundedreck unter einem Busch ausleerte.
Der Sand hinter ihm knirschte. Schwere Schritte näherten sich. Andreas richtete sich auf. Er wagte selten, Menschen direkt in die Augen zu sehen. Doch der Mann, der auf ihn zukam, war Herr Fredersdorf. Vor ihm hatte Andreas keine Furcht.
»Andreas.« Die Stimme des hohen Herrn war mild. »Was höre ich da? Du bist in der Nacht dem Schloss ferngeblieben? Machst du uns Kummer?«
Nein, hätte Andreas am liebsten gesagt, aber er brachte wie immer keinen Ton heraus. Stattdessen liefen ihm Tränen über das Gesicht.
»Du weinst? Weißt du was? Ich glaube, sie haben dich genug bestraft mit diesem Kot hier. Es wartet eine bessere Aufgabe auf dich.«
Andreas blieb steif und starr stehen. Sein nasses Gesicht wurde kalt. Herr Fredersdorf hob die Hand und reichte ihm eine Nachricht. Angst beschlich Andreas. Er ahnte, was kam.
»Bring das in die Stadt.«
Es traf ihn wie ein Peitschenhieb. Nein! Nicht in die Stadt!
»Du gehst doch nun einmal gern hinunter. Aber du musst auch zurückkommen, verstehst du? Seine Majestät kann ungehalten sein, wenn die Domestiken nicht gehorchen.«
Andreas zitterte, doch Herr Fredersdorf bemerkte es nicht. Er sprach einfach weiter und erklärte, bei wem die Depesche abzugeben war.
»Du wirst hoffentlich uns und unserem König kein ungehorsamer Diener mehr sein. Sieh es als Prüfung an. Und als Beweis, dass Seine Majestät wieder Vertrauen zu dir hat.«
Andreas drängte sich gegen den Busch, die Äste schienen wie Hände nach seinem Rücken zu greifen, ihn abzutasten – als wollten sie ihn von hinten packen. Wie der Mann, der plötzlich in der Nacht aufgetaucht war …
»Es ist gut«, sagte Herr Fredersdorf. »Den Dreck da kann jemand anders vergraben. Geh jetzt.«
Plötzlich hatte Andreas die Botschaft in der Hand. Ein paar Atemzüge stand er noch zitternd da. Der hohe Herr war nicht mehr da. Schließlich siegte die angelernte Lakaiendisziplin, und Andreas setzte sich in Bewegung.
Mechanisch wanderte er die Straße hinunter, die in einigen Kurven zum Potsdamer Brandenburger Tor führte. Berittene Boten kamen ihm entgegen, zwei-, dreimal eine Kutsche. Niemand beachtete ihn. Die Lakaienlivree wies ihn als jemanden aus, der auf der untersten Stufe der Hofbediensteten stand. Ihn musste man nicht beachten.
Selbst die Torwache winkte ihn an den Schlangen von Wagen und Menschen zu Fuß vorbei, die ihre mitgebrachten Waren an der Akzisestelle kontrollieren ließen.
Kaum hatte Andreas die Stadt betreten, entstand vor seinem geistigen Auge der Grundriss der Stadt mit ihren schnurgeraden, manchmal etwas schräg angelegten Straßen, die sich unregelmäßig überkreuzten und schnitten. Während er weitermarschierte, schwebte vor ihm der Stadtplan, den er einmal zufällig in Herrn Fredersdorfs Arbeitskabinett gesehen und der sich seitdem in sein Hirn eingebrannt hatte.
Über dem südlichen Bereich um das Stadtschloss in der Nähe der mächtigen Havel verliefen mehrere Straßen quer, als habe der alte König, der die Stadt plante, einfach ein paar Striche gezogen.
Die breiteste davon war die Brandenburger Straße, der Andreas jetzt in Richtung des Bassins folgte – einem rechteckigen künstlichen See mit einer Insel in der Mitte. Neben dem Faulen See, den man trockengelegt und in einen großen bepflanzten Platz, eine Plantage, verwandelt hatte, bildete er auf Andreas’ innerem Stadtplan eine zweite leere Fläche.
Von diesem Bereich hielt sich Andreas fern. Er bog um eine Ecke und näherte sich dem Kanal. Dort, im Gasthof »Zur Goldenen Krone«, hatte er seinen Brief abzugeben.
Das Gewühl auf der Straße gab ihm Sicherheit. Doch irgendetwas sagte ihm, dass der Unbekannte um ihn war, ihn vielleicht genau in diesem Moment beobachtete. Aber jetzt, am Tage, konnte er ihm ja nichts tun. Überall waren die blauen Röcke der Soldaten zu sehen. Die Grenadiere würden ihn beschützen, wenn er Hilfe brauchte. Und niemand tat doch einem Schlossbediensteten etwas am helllichten Tag und auf offener Straße. Jedenfalls redete sich Andreas das ein.
Rechts neben ihm wurde die träge Wasserfläche des Kanals sichtbar. Ein längliches Boot schob sich geräuschlos vorbei.
Da war der Gasthof. Andreas beschleunigte seine Schritte und erreichte die Eingangstür.
Der Flur war dunkel. Es roch nach Kohl und Kartoffeln. Jetzt wurde die Erinnerung an das Erlebnis der Nacht wieder stärker. Etwas regte sich am Ende des Ganges. Jemand kam auf ihn zu. Die plötzliche Angst schnürte Andreas’ Brust ein, doch dann erkannte er, dass es nur der Gastwirt war.
»Was willst du? Ah, ein Brief. Für Herrn La Mettrie. In Ordnung, Junge. Kannst wieder gehen.«
Es war besser, solche Briefe persönlich abzugeben – um sicher zu sein, dass sie wirklich ankamen. Und wegen des Trinkgeldes. Doch Andreas wollte wieder hinaus. Weg von dem Flur, wo ihm jemand auflauern konnte. Er lief auf die Straße, den Kanal entlang.
Nur ein kleines Stück entfernt wohnte Herr Quantz. Vielleicht sollte er die Gelegenheit nutzen, um ihn zu besuchen. Es war immer noch etwas offen zwischen ihnen. Die Sache mit der Melodie, die er Herrn Quantz erklären wollte. Aber wie sollte er das tun? Er verstand selbst nicht, warum es ihm unmöglich war, einfach den Mund zu öffnen und zu sprechen. Er musste sich auf andere Weise ausdrücken. Schreiben konnte er mit Mühe, Lesen ein ganz kleines bisschen, wenn man ihm Zeit ließ.
Das Haus kam in Sicht. Drei Kutschen standen vor der Tür. Die Fahrer dösten auf ihren Böcken. Aus einem offenen Fenster aus dem ersten Stock drang Musik. Andreas sah in das Laub des Baumes vor der Fassade hinauf. Die Melodien von dort oben gaben ihm seine Sicherheit zurück. Sie beruhigten ihn.
Er blieb an dem Holzgeländer des Kanals stehen und schloss die Augen. Als die Musik zu Ende war, konnte er nicht umhin und klatschte in die Hände.
Und dann sagte jemand etwas. Andreas erkannte die Stimme. Sie hatte in der Nacht zu ihm gesprochen.
Das büßt du mir!
Er hatte die Worte noch genau in den Ohren.
Wo war die Stimme hergekommen? War der Mann in der Nähe? Andreas öffnete die Augen. Es klirrte, als jemand das Fenster schloss.
Ohne nachzudenken, lief Andreas an den Kutschen vorbei in das Haus. Die Tür war, wie bei den meisten Häusern in Potsdam, tagsüber unverschlossen. Oben unterhielten sich Menschen.
War er in die Falle gegangen? Was, wenn der Teufel hier auf ihn lauerte? Ihn herlocken wollte? Nein, Andreas war sicher, dass die Stimme nicht aus dem Haus gekommen war. Vielleicht hatte er sich auch getäuscht. Hier, bei Herrn Quantz, war er sicher.
Hinten führte eine weitere Tür in ein Gärtchen, das bis an eine Mauer reichte. Gerade Reihen aufgehäufelter Erde bedeckten die kleinen Beete. Hier konnte er sich nirgends verstecken.
Eine andere Tür. Eine Treppe. Da ging es in den Keller. Modriger Geruch drang herauf.
Andreas stieg hinunter ins Dunkel. Etwas Weiches streifte über seine Wange. Er zuckte vor Schreck zusammen. War da jemand? Vorsichtig streckte er die Hand aus. Seine Finger trafen einen Vorhang, der ein Regal bedeckte. Andreas stand in der Dunkelheit und wartete. Er konnte lange stehen, lange warten, sich lange unsichtbar machen.
Dann waren von oben wieder die Stimmen zu hören. Mehrere Personen kamen die hölzerne Treppe herunter und verließen das Haus.
Nach einigen Momenten schnaubten draußen die Pferde, und die Kutschen setzten sich in Bewegung.
Andreas, der immer noch reglos dastand, tastete sich in eine Ecke und kauerte sich hin.
3
Quantz nickte kurz dem Fuhrmann Lukas Brede zu, der mit seinen Gehilfen wie so oft für den Transport ins Schloss sorgte. Es waren drei Coupé-Kutschen, die die Musiker beanspruchten – kleine Fahrzeuge, mit denen man am besten durch die engen Straßen kam.
Quantz versuchte Bach zu ignorieren, der neben ihm saß, die feisten Knie angezogen, und mit der Hand eine imaginäre Melodie auf dem Oberschenkel spielte.
Es dauerte knapp zwanzig Minuten, bis man vom Haus des königlichen Flötisten aus das Schloss erreichte, und in dieser Zeit wollte sich Quantz dem Gefühl der wachsenden Erregung hingeben, das ihn erfüllte.
Gemütlich zogen die gleichförmigen Fassaden an ihnen vorüber. Je näher sie dem Tor kamen, desto mehr zwei- bis dreistöckige Steinhäuser gab es, die auf Befehl des Königs seit einigen Jahren nach und nach entstanden. Sie strahlten mit ihren gleichmäßigen Fensterreihen und den kleinen Freitreppen zu den hochgelegenen Eingängen hin eine beruhigende Ordnung aus. Die Kutsche wurde noch langsamer, als sich der Tross dem Tor näherte. Die Wachen kannten die Hofmusiker und wussten, wo sie hinwollten. Man winkte sie durch, und sie bogen nach rechts auf die Straße ab, die sich in großen Kurven nach Sanssouci hinaufwand. Dabei entstand Geruckel. Quantz und Bach stießen mit den Knien aneinander.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!