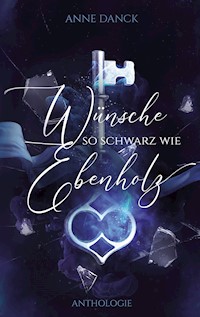8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Einem König widerspricht man nicht. Oder doch? Nachdem ich auf dem Acker einen goldenen Mörser ausgegraben habe, verlangte König Laurent den passenden Stößel dazu. Wütend und womöglich nicht sonderlich bedacht antwortete ich mit einem Brief – und einem Widerspruch. Doch obwohl mir der König zunächst zürnte, unterbreitete er mir ein überraschendes Angebot: Ich soll ihn beraten. Allerdings ist meine neue Aufgabe ernüchternd. Laurent scheint meine Einwände nur zu lesen, um sie dann zu übergehen. Und während ich allmählich an der Starrsinnigkeit des Königs verzweifele, wächst zugleich eine gefährliche Anziehung zwischen uns. Denn wenn Feuer und Papier aufeinandertreffen, kann am Ende etwas außer Asche bleiben? "Diese Geschichte ist so viel mehr als eine Märchenadaption - sie steckt voller Tiefe und hat mich durchweg verzaubert." - Maya Shepherd
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Feuerfeder
BRIEFE AN DEN KÖNIG
ANNE DANCK
Copyright © 2026 by
Lektorat: Maya Shepherd
Korrektorat: Jessica Strang
Sensitivity Reading: Daeny Levi
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlag- und Farbschnittdesign: Hannah Sternjakob
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-69130-034-5
Alle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.
Content Notes:
Misgendern, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder Sexualität, Blut, Entführung, Mobbing
Inhalt
Brief
Teil I
Das erste Treffen
Warum ich eine Hose trug
Das zweite Treffen
Das dritte Treffen
Drei Aufgaben
Die Auflösung
Teil II
Der Anfang
Ein ungewöhnliches Frühstück
Berater des Königs
Die Sache in Griffung
Wenn man gegen Anweisungen verstößt
Die Apfelbäume
Begossen
Briefe an mich selbst
Ein Ausflug
Das Problem mit den Vorsätzen
Die daran geknüpften Bedingungen
Die Sache mit dem Fohlen
Alte Scherben
Ein abwesender Bruder
Über das Abgeben von Kontrolle
Das Problem mit Zeugen
Weshalb das Richtige manchmal das Falsche ist
Taschas Tadel
Ein Esel
Wer ich wirklich bin
Nur ein Wort
Der oberste Diener
Dieser eine Morgen
Unpassend
Warum ich schon wieder Tascha brauchte
Teil III
Brief
Besiegelt
Fünf Briefe
Keine Antwort
Ein weiterer Brief
Nicht auf dem Weg, nicht neben dem Weg
Nachwort
Drachenpost
Für meinen kleinen Schatz –
Du hast mir die entscheidende Idee gegeben
und bei mir in der Trage geschlafen,
während ich diese Geschichte geschrieben habe.
Zunächst: Es tut mir leid.
Ich könnte das hundertmal wiederholen und es wäre dennoch nicht genug. Das ist mir bewusst.
Mir ist auch bewusst, dass kein Brief – und wäre er noch so lang – das Geschehene rückgängig machen kann. Auch wenn es dir vermutlich schwerfällt, mir das zu glauben: Mit diesem Brief verfolge ich nicht die Absicht, dich dazu zu bewegen, mir zu verzeihen. Er soll keine Rechtfertigung sein, denn wie du schon sagtest: Es gibt nichts, womit ich es rechtfertigen könnte.
Offen gestanden, war das hier ursprünglich gar kein Brief. Deshalb spreche ich auf den folgenden Seiten von dir auch in der dritten Person, statt dich direkt anzureden. Und deshalb verliere ich mich an manchen Stellen vielleicht in für dich unwichtigen Details und schreibe nicht ganz so zielgerichtet, wie ich es getan hätte, wenn ich eben das gehabt hätte – ein konkretes Ziel. Als ich diese Seiten zu schreiben begann, waren sie nur für mich gedacht. Als Gedankenstütze, um die Ereignisse der letzten Wochen zu sortieren. Um zu verstehen, was genau vorgefallen ist – und wann ich meine eigenen Prinzipien aus den Augen verloren habe.
Noch einmal: Es tut mir leid.
Aber inzwischen verstehe ich es. Und ich denke, dass die folgenden Schilderungen auch dir helfen werden, zu verstehen. Vielleicht gibt dir das wenigstens einen Teil dessen zurück, was du durch mich verloren hast. Deswegen möchte ich sie dir anvertrauen.
TeilEins
ZWISCHEN PAPIER UND SPATEN
Das erste Treffen
Das erste Mal begegnete ich ihm bei Tascha.
Es war in einer dieser Sommernächte, die eigentlich zu warm waren, um zu schlafen. Abgesehen davon hätte ich ohnehin nicht schlafen können. Ich hatte den ganzen Tag damit verbracht, den Acker umzugraben – und war danach ebenso aufgewühlt wie er. Die körperliche Arbeit hatte es wider Erwarten nicht besser gemacht. Im Gegenteil: Mit jedem Stück Erde, das ich bearbeitete, hatte sich die Wut stärker in mich hineingefressen. Und die Reaktion meiner Familie hatte dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt.
Deswegen stapfte ich auch durchs Dorf und dann den schmalen Weg durch die Wiesen entlang, ohne mir vorher auch nur das Gesicht gewaschen zu haben. Ich wollte, dass sie mich alle sahen – in der staubigen Hose und dem verschwitzten Hemd. Sollten sie doch über mich reden – nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern frei heraus, offensiv. Ich suchte die Provokation.
Außerdem wollte ich zu Tascha, gleich was meine Familie von der Freundschaft zu ihr hielt. Wenn das alles schon geschah, während sie in unmittelbarer Nähe war, dann würde ich mir auch Trost bei ihr abholen. Oder zumindest Ablenkung.
Musik und Stimmen hallten von Weitem über die hüfthohen Gräser, durch die ich mir barfuß den Weg bahnte. Während in meinem Dorf bereits die Kerzen in den Häusern gelöscht wurden, brannte das Lagerfeuer zwischen den Zelten hier umso heller. Deswegen war ich auch nicht die einzige Person aus dem Dorf, die es hierherzog.
Ich schob die Wäsche zur Seite, die zwischen zwei der äußersten Zelte gespannt war. Es roch nach geräuchertem Ziegenkäse und heißen Zwiebeln. Mondlicht und Feuerschein vermischten sich zu einem bunten Gemälde, zeichneten mehrere Dutzend Leute plaudernd auf abgenutzten Sitzkissen oder ausgelassen tanzend zum Takt von Laute, Flöte und Schellenring. Es war eine eigene Welt, eine, die mich jedes Mal mit Sehnsucht erfüllte. Nach einem anderen Leben. Einem anderen Selbst. Ich wäre gern wie sie gewesen. Mutig. Laut. Frei. Ich war nichts von alledem. Vor allem letzteres nicht, wie ich bitter hatte erkennen müssen.
Ich wich einer Langhaarziege aus, die zielgerichtet auf die andere Seite des Lagers zusteuerte, und hielt auf die Musikergruppe zu. Tascha stand bei ihnen. Ihr weißblondes Haar sah in dem flackernden Licht aus wie gesponnenes Silber. Mit rhythmischem Klatschen und lautem Rufen spornte sie die Tanzenden an. Sie trug ihr rotes Tanzkleid, dessen Saum zu üppigen Blüten aus Stoff gedreht war – das Kleid, in dem sie normalerweise selbst auftrat. Vielleicht hatte sie selbst gerade erst eine Vorstellung gegeben.
Der Moment, in dem sie mich ebenfalls entdeckte, war offensichtlich, denn ihr Klatschen geriet erst aus dem Takt und erstarb dann ganz. Sie scherte aus der Runde aus und eilte mir entgegen.
»Du meine Güte, Ran!« Ihre melodische Stimme stürzte geradezu ab, ihr Blick glitt perplex über mich. »Wie siehst du denn aus? Was hast du an?«
Aber wo hätte ich anfangen sollen? Wie die richtigen Worte finden?
»In Ordnung. Komm mit.« Tascha fasste nach meiner Hand, ihre Finger selbst bei Nacht sichtbar heller, und zog mich von dem Trubel in Richtung ihres eigenen Zeltes fort. Ihre Finger fühlten sich unglaublich schmal und zart zwischen meinen an, als wäre ich ein Raub- und sie ein Singvogel. »Du hast Glück, muss ich sagen.« Sie warf mir einen Seitenblick und ein schnelles Lächeln zu. »Eigentlich wäre ich heute nämlich verabredet gewesen, dann hättest du mich gar nicht angetroffen. Aber da er nicht aufgetaucht und anscheinend verhindert ist, kann ich ganz für dich da sein.«
»Verabredet?«, hakte ich nach.
Sie sagte es so leichtfertig, als wäre nichts daran. In meinem Dorf wäre es Grund genug gewesen, um hinter ihrem Rücken zu tuscheln, ihr verstohlene Blicke zuzuwerfen und sie nicht mehr ins eigene Haus zu lassen. Nur war sie nicht Teil des Dorfes, sondern des Fahrenden Volkes.
»Längere Geschichte. Geht schon ein paar Wochen, seit unserer Vorstellung auf dem Markt in Schloss Lavalle. Er folgt uns, wohin auch immer wir umsetzen.«
»Du meinst, er folgt dir«, korrigierte ich.
Tascha lachte. »Ja, genau das. Er …« Sie blieb stehen, ihre Hand um meinen Arm hielt auch mich zurück. Ihr Blick war nach vorn gerichtet, ihr entschlüpfte ein überraschtes Lachen. »Er steht dort vor meinem Zelt.«
Ja, dort stand jemand und schlug gerade die äußere Zeltbahn zurück, um hineinzuspähen. Jemand Pitschnasses. Das übergroße Hemd klebte ihm am Körper, der dunkle, kurze Zopf in seinem Nacken hatte sich halb aufgelöst.
Anscheinend war ich nicht die einzige Person, die heute für einen ungewöhnlichen Auftritt sorgte. Wie um alles in der Welt war er so nass geworden? Als wäre er in einen spontanen Schauer geraten – dabei hatte es seit Tagen nicht geregnet.
»Warte kurz«, bat Tascha. »Ich bin gleich wieder ganz für dich da. Aber ich muss … Das ist …« Sie blinzelte, drückte meinen Arm und ließ mich dann mit einem raschen, entschuldigenden Lächeln zurück.
»Fredrik! Was ist mit dir passiert?«, rief sie dem Neuankömmling zu.
Ihr Besucher fuhr herum. Ich schätzte ihn auf Anfang zwanzig, und damit etwa gleich alt wie Tascha und vielleicht drei Jahre älter als ich. Das silbrige Mondlicht zeichnete die Linie seines Kiefers nach und verfing sich im schmalen, dunklen Bart um seinen Mund. Bei Taschas Anblick sprang ein Lächeln auf seine Lippen, so gekonnt und geübt wie ein Schausteller auf einer Bühne.
»Natascha.« Seine Stimme war warm und samtig wie die Nacht. Er breitete übertrieben die Arme aus, als wollte er sie umarmen, klatschnass wie er war. Bevor sie ihn jedoch abwehren musste, ließ er die Arme bereitwillig wieder sinken. »Wie du siehst, ist etwas dazwischengekommen.«
»Du weißt schon, dass es auch einen Weg hierher über den Fluss gibt?«
Er lachte. »Jetzt weiß ich es auch.«
»Und wo hast du dein Pferd gelassen?«
»Ich bin zu Fuß.«
»Zu Fuß?« Tascha wiederholte es, als wäre das noch ungewöhnlicher als sein nasses Auftreten.
Er zuckte die Schultern. »So weit ist es dieses Mal nicht. Ich komme sonst selten dazu.«
Tascha lachte. »Angeber.«
»Verdiene ich dafür nicht eher dein Mitleid?«
»Weil du nächstes Mal wieder mit dem Pferd vorliebnehmen musst? Ganz sicher nicht.«
Hörte Tascha sie auch, diese kurze Verzögerung, bevor er seufzte? »Das ist unser letztes Treffen. Es wird kein nächstes Mal geben.«
»Oh?«
»Da ist auch … etwas dazwischengekommen.«
»Von dem du mir anscheinend aber keine Details verraten willst.«
»Natascha …« Er legte Tascha die Hand an die Wange, als hielte er eine der Stoffblüten an ihrem Kleid – behutsam und zärtlich, darauf bedacht, sie nicht zu knicken.
»Iieh! Fredrik, du bist verdammt kalt!«, entfuhr es ihr. Abrupt entzog sie sich seiner Berührung, musste jedoch lachen. »Wie wunderbar doppeldeutig.« Sie deutete mit einem Finger an ihm hinauf und hinab. »Ich nehme an, du bist deswegen trotzdem hier? Weil du trockene Kleidung brauchst?«
Er lächelte reumütig. »Wärst du so gut?«
Sie legte ihm vertraut die Hand auf den Unterarm. »Weißt du was? Ich bin noch viel besser. Ich werde dir auch ein Reittier besorgen, damit es nicht noch zu weiterer Verzögerung kommt.«
»Ihr habt Pferde hier?«
»Esel.« Ein Lächeln flitzte über ihre Lippen. »Oder bist du dir dafür zu fein?«
Er deutete schwungvoll an sich hinab. »Ich bin voller Flussalgen. Die Frage ist eher, ob sich besagter Esel nicht zu fein ist.«
Das entlockte ihr ein weiteres Lachen. Sie beugte sich vor und drückte ihm einen schnellen Kuss auf die Wange. »Gib mir einen Moment.« Und damit ließ sie auch ihn stehen und hastete davon.
Taschas verspäteter Besucher blieb dort, wo er war. Doch anstatt ihr nachzusehen, glitt sein Blick hoch zum Mond und er strich sich über den erstaunlich sorgfältig konturierten, dunklen Bart. Das Lächeln, das diesmal über sein Gesicht glitt, war alles andere als groß und für die Bühne gemacht. Es war vorsichtig und zerbrechlich. Als würde er mit der leuchtenden Scheibe eine Erinnerung teilen, die schon bei einem zu innigen Gedanken daran kaputtgehen konnte.
Die ganze Situation gab mir zu viele Rätsel auf. Ich kannte niemanden, der bei einer derartigen Nässe so entspannt geblieben wäre. Der sich daran erfreute, endlich mal zu Fuß zu gehen. Der offenbar aus dem Nichts die Beziehung beendete – und dafür nicht mit Wut quittiert wurde. Stattdessen forderte Tascha nicht einmal eine Erklärung, sondern lieh ihm sogar noch einen Esel. Und er schmachtete daraufhin den Mond an, als wenn … als wenn …
Abrupt löste sich sein Blick vom Himmel und fiel auf mich. Erwischte mich dadurch unverhüllt beim Starren.
Ein Teil von mir wäre instinktiv gern zurückgewichen, hätte sich in die Schatten zwischen den Zelten verkrochen. Aber Tascha hatte mir aufgetragen zu warten, und nichts anderes tat ich hier. War es meine Schuld, dass ich dadurch nah genug stand, um jedes Wort ihrer Unterhaltung mitangehört zu haben? War es ein Vergehen, dass ich ihn beobachtete?
Also zog ich mich nicht zurück, sondern erwiderte stur den Blick aus seinen dunklen Augen.
Er musterte mich aufmerksam, einmal von oben bis unten, als würde er Maß nehmen. Als müsste er einschätzen, was er von mir zu halten hatte, von dieser Gestalt in Hemd und Hose, mit kantigen Schultern und hagerer Brust. Mein Bruder Ottkar sagte stets, ich wäre wie ein unbehauenes Holzscheit. Keine Details, keine geschwungenen Linien, nur glattes, rohes Material. Selbst mein Gesicht war kantig. Die einzige Ausnahme waren die weichen, dunklen Locken meiner Haare, die sich nie ganz in einem Zopf bändigen lassen wollten.
Es hatte mich nie gestört. Ich sah eben aus, wie ich aussah. Verdammt, oft genug fühlte ich mich schließlich auch wie ein grobes Holzscheit. Ich schien nicht so recht zu meinen Mitmenschen zu passen. Ich konnte nicht wie sie Sätze um Sätze aneinanderreihen, einander charmant zulächeln und Treppen hinablaufen, ohne zu poltern.
Aber in dem Moment, in dem Taschas Gast mich ansah, verschob sich etwas in mir. Er nahm mich Maß und ich wollte dem gerecht werden. Wollte einen Eindruck hinterlassen, den er nicht vergaß. Ich wollte es mit derselben unerwarteten Heftigkeit, mit der ich am Nachmittag den ganzen Acker allein umgegraben hatte, bis meine Hände Blasen schlugen und der Schweiß mir die Lider verklebte.
Nur dass ich genau gewusst hatte, warum ich das getan hatte. Diese plötzliche Anwandlung ihm gegenüber … sie war mir selbst fremd.
Der Besucher – Fredrik – bewegte sich ein paar Schritte in meine Richtung. Und ich tat es ihm gleich, ging auf ihn zu, automatisch, als wäre ich eine Marionette und er hätte an meinen Fäden gezogen. Er war nur ein paar Fingerbreit größer als ich, ich musste kaum zu ihm aufsehen.
»Du gehörst zu ihr?« Seine Stimme war wie ein warmes Bad.
Niemand gehört irgendwem, wollte ich sagen. Ich rang kurz mit den Worten, aber ich war nicht so flink mit ihnen wie Tascha. Daher nickte ich nur steif.
Die Art, wie er das Nicken erwiderte, gab mir das Gefühl, Teil einer stummen Übereinkunft geworden zu sein. »Pass auf sie auf. Sie ist etwas Besonderes.«
Natürlich war sie das. Deswegen zog es mich zu ihr, wann immer sie sich in der Nähe unseres Dorfes befand – weil sie das Leben nahm, wie es kam. Weil sie für Sonderlinge ein Herz hatte.
Wenn du das weißt, warum gibst du sie dann auf?, wollte ich fragen. Aber um sie aufzugeben, hätte sie in irgendeiner Weise an ihn gebunden gewesen sein müssen. Ebenso wenig konnte man eine Schwarzdrossel aufgeben, die freiwillig zu einem kam, um zu singen. Das schien auch Fredrik zu wissen. Du gehörst zu ihr?, hatte er gefragt. Nicht: Sie gehört zu dir?
Also gab ich nur ein »M-hm« von mir und es geriet zu einem zustimmenden Brummen.
Er klopfte mir auf die Schulter. »Gut.«
Als würde er mir sein Vertrauen aussprechen. Als hätte er eine Verbindung zu mir, obwohl wir uns erst vor einigen Augenblicken begegnet waren.
Offenbar deutete er meinen Blick als Frage, denn er lachte leise und schüttelte den Kopf. »Was für eine Nacht. Wenn ich dir einen Rat geben darf: Traue niemals einer Wassernixe. Auch nicht einer menschlichen.«
Die Fragen drängten wie ein Strom zum Schleusentor und ich öffnete den Mund, wollte doch endlich eine hinauslassen, wollte wissen …
Aber ich brauchte zu lange. Tascha kehrte zurück und Fredrik wandte sich von mir ab. An ihrer Seite ging ein gleichmütig blickender Grauesel, mit einer kahlen Stelle zwischen den Brauen. Sie weckte in mir die unwillkürliche Assoziation eines Horns, das nun abgefallen war.
»Herbert – Fredrik, Fredrik – Herbert«, stellte Tascha sie einander vor. Dann ergänzte sie an ihren Gast: »Wenn du es nicht schaffst, ihn zurückzugeben, dann sorge bitte dafür, dass er auf die Weide darf und jeden Tag eine Karotte bekommt. Er ist verrückt nach ihnen.«
»Ein Feinschmecker, hm? Sehr sympathisch.« Fredrik hielt ihm eine Hand hin und ließ das Tier daran schnuppern, bevor er ihm über die pelzige Stirn rieb. Grauesel waren eine der wenigen Eselrassen, deren Körperbau tatsächlich ohne Probleme den Transport einer Person übernehmen konnte. Sie waren dabei vielleicht nicht so schnell wie ein Pferd, aber dennoch weitaus schneller als zu Fuß.
Tascha hielt Fredrik ein Bündel Klamotten hin. »Du kannst mein Zelt benutzen, um dich umzuziehen.«
Sein Lächeln war erneut so breit und intensiv, als wäre es für ein größeres Publikum gedacht. »Natascha, du bist meine persönliche Heldin.«
Die hob belustigt und eindeutig zweideutig die Brauen. »Oh, das war ich schon mehrfach und noch auf ganz andere Weise, das weiß ich.«
Er warf den Kopf in den Nacken und lachte.
Es war unerwartet, laut. Und etwas davon hallte in mir wider. Ich wollte auch wie Tascha sein. Redegewandt. Witzig. Aber vor allem wollte ich so sein wie er: jemand, dem die Sorge um sein Erscheinungsbild ebenso egal war wie das Wasser, mit dem man ihn offensichtlich begossen hatte. Jemand, der es stattdessen eher wie ein unterhaltsames Erlebnis genießen konnte. Er war so … ungehemmt. Selbstsicher. Unglaublich präsent.
Es zog mich an wie der Feuerschein zwischen den Zelten auf dem Weg hierher. Das Licht, die Hitze, die Lebendigkeit. Gleichzeitig mahnte mich etwas instinktiv, warnte, dass vermutlich nur Personen wie Tascha in seiner Nähe bestehen konnten. Personen, die selbst brannten. Die sich rechtzeitig lösen und weiterziehen konnten. Von mir, dem Holzscheit, würde dagegen nur Asche zurückbleiben.
»Ich werde dich vermissen«, versicherte Fredrik Tascha und schlüpfte ins Zelt, bevor sie etwas erwidern konnte.
Meine Freundin band Herbert lose an einer der Zeltstangen fest, kam dann zu mir und griff nach meiner Hand. »Jetzt zu dir. Aber am besten nicht hier, wenn mein Zelt jetzt belegt ist. Ich besorge dir von jemand anderem Schreibzeug.« Sie zog mich weiter.
Ich war zu paralysiert, um ihr sofort zu folgen, brachte ihre Bewegung dadurch ins Stocken. Sie warf mir einen fragenden Blick zu. Ich deutete auf den Schlitz in der Plane, durch den ihr Besucher gerade erst verschwunden war. »Aber … willst du nicht …«
Ihre Brauen schossen fragend nach oben. »Mich verabschieden?«, riet sie.
»Ja.«
Sie zuckte die Schultern. »Er hat alles, was er braucht. Es würde die Dinge nur seltsam machen. Besser, wir trennen uns mit einem Lachen.«
Als sie diesmal an meiner Hand zog, folgte ich ihr, wenn auch weiterhin zögernd. Etwas hielt mich zurück, ohne dass ich benennen konnte, was es war. Hatte ich womöglich das Gefühl, ich müsste mich von ihm verabschieden? Das war absurd. Er war nicht meinetwegen hier. Er war nicht einmal wirklich wegen Tascha hier.
Nur wegen der Wassernixe im Fluss.
* * *
Ich setzte mich noch in derselben Nacht auf meine Bettkante an den kleinen Tisch in meiner Kammer, um alle Gedanken in die richtige Reihenfolge zu bringen. Tatsächlich wurden mir unter dem Einfluss der Tinte mehrere Details klar. Plötzlich sah ich die Ereignisse in einem ganz anderen Licht.
Erstens: Fredrik war nicht jemand, der zu Fuß ging. Er war es gewohnt, dass man ihm bereitwillig Dinge – wie Reittiere – zur Verfügung stellte. Der die Aura eines Mannes hatte, der es gewohnt war, im Mittelpunkt zu stehen, weil genau das zutraf. Kurz: Er war ein Adliger.
Zweitens: Er folgt uns seit der Vorstellung auf dem Markt in Schloss Lavalle, hatte Tascha gesagt. Und sie hatte sich mit ihm auf eine Beziehung eingelassen, bei der sie von Anfang an gewusst hatte, dass das zwischen ihnen nicht von allzu großer Bedeutung oder langer Dauer sein würde. Deswegen ging sie auch so gelassen mit dem Ende um. Weil er nicht nur irgendein Adliger war. Fredrik war kein geringerer als Jannes Laurent Fredrik, König von Agarmundt. Er musste es sein. Immerhin erzählte man sich über ihn im ganzen Land, dass er einen Blick für alles Erlesene hatte – und meinte damit hübsche Frauen.
Drittens: Ebendieser König hatte mir auf die Schulter geklopft und mir etwas anvertraut, obwohl wir uns nicht kannten. Er hatte das nicht getan, weil ich eine besondere Verbindung zu ihm hatte, sondern weil ich an diesem Tag Hemd und Hose getragen hatte. So schlicht und ernüchternd war die Lösung dieses Rätsels: Er hatte mich behandelt wie einen Mann.
Warum ich eine Hose trug
Ich merke, um die Gedanken genügend zu sortieren, reichen die Schnipsel rings um Laurent nicht aus. Es spielt zu viel anderes mit hinein. Zum Beispiel, wie es überhaupt dazu kam, dass ich bei dieser ersten Begegnung eine Hose trug.
Ich saß auf unserem Hof, auf einer Bank vor unserem Wohnhaus, und pulte Erbsen aus ihren Schoten. Es war morgens, das Licht klar und silbrig, was einen weiteren heißen Tag versprach. Das Flattern und Zetern der Hühner hallte von ihrem Gatter herüber, wo sie sich die frisch servierten Küchenabfälle gegenseitig streitig machten.
Ich hatte die Beine überkreuzt, sodass sich mein Rock zwischen meinen Knien aufspannte und ich die Schoten darin sammeln konnte. Meine zehn Jahre jüngere Schwester Kráka saß mir gegenüber, die Hofkatze auf dem Schoß, und musterte die Erbsen, die ich vor ihr ablegte, um mit ihnen Rechnen für die Dorfschule zu üben. Sie sollte mir sagen, an wie viele Personen sie wie viele Erbsen verteilen konnte, ohne dass man eine der Erbsen zerteilen musste. Manchmal, wenn sie die Lösung nicht wusste, verschwanden ein paar der grünen Kugeln in ihrem Mund, bis das Ergebnis einfacher zu bestimmen war. Das diebische Grinsen auf ihrem Gesicht brachte mich jedes Mal gegen meinen Willen zum Lachen.
Aber die Stimmen, die aus dem Küchenfenster drangen, wurden lauter, bis es Kráka schwerfiel, sich zu konzentrieren. Mein Bruder stritt mit meinen Eltern – was bei uns bedeutete, dass man hauptsächlich die Stimme meines Bruders und die meiner Mutter hörte. Im Gegensatz zu meinem Vater konnten sie beide hervorragend streiten. Sie konnten überhaupt beide sehr gut reden. Viel und schnell.
Nach wenigen Momenten ging die Tür auf, und mein Vater trat nach draußen, vertrieben von dem Schwall an Worten. Er setzte sich auf die Bank und fuhr sich mit der Hand über seine Stirn und die Nase. Die Linien in seinem sonnengegerbten Gesicht wirkten noch ausgeprägter als sonst.
Kráka vergaß die Aufgabe, die ich ihr gestellt hatte, setzte sanft die Katze auf den Boden und hüpfte ihm auf den Schoß. Sie war wie der Klangkörper eines Instruments, der automatisch die Schwingungen aufnahm. Sie wusste genau, wann jemand Trost brauchte.
»Es war dein Leichtsinn, Ottkar«, drang die helle Stimme meiner Mutter nach draußen, jetzt noch lauter, da Vater die Tür nicht geschlossen hatte.
»Bei dir hört sich das an, als hätte ich es mir ausgesucht!« Die Antwort meines Bruders klang kratzig und derb wie eine Raspel.
»Du bist das Risiko bereitwillig eingegangen, oder nicht? Man setzt sich nicht einfach auf ein unbekanntes Pferd, egal, wie selten die Rasse ist. Was wolltest du beweisen? Ach, ich will es gar nicht hören! Zeig mir lieber, dass da wenigstens ein Fünkchen Verstand in deinem Kopf ist, und verrate mir, wie wir jetzt über die Runden kommen sollen. Der neue Acker bezahlt sich nicht von allein ab. Er muss bewirtschaftet werden, damit er Ertrag einbringt.«
»Ich werde –«
»Dich einbeinig auf den Acker stellen und ihn umgraben?«
»– mir was einfallen lassen.«
»Dann schnell, junger Mann. Ich warte.«
»Der Acker läuft nicht davon.«
»Nein, aber die Zeit«, erinnerte Mutter. »Glaubst du, dein Vater wird still sitzen können? Er wird die Aufgaben übernehmen, die du erledigen solltest und sich den Rücken noch weiter kaputtmachen.«
»Dann heuern wir Männer aus dem Dorf an.«
»Mit welchem …«
»Was weiß denn ich? Das Geld wird im Nachhinein schon wieder reinkommen.«
»Es muss wieder reinkommen, Ottkar. Das hier ist kein Spiel, es geht um unsere Existenz.«
»Dann ist Vater vielleicht ein zu großes Risiko eingegangen, als er den zweiten Acker gepachtet hat! Wenn ich mir nicht das Bein gebrochen hätte, dann hätte ich mir eine Lungenentzündung einfangen können oder sonst was. Was wäre dann sein Plan gewesen?«
»Das war ein wohl kalkuliertes Risiko, das dein Vater da eingegangen ist. Es ist nicht zu vergleichen mit dem …«
Ich hörte irgendwann nicht mehr zu, weil mir die Ohren klingelten. Kráka hatte ihre Wange an Vaters Brust vergraben, er strich ihr abwesend übers Haar.
Männer aus dem Dorf anheuern.
Sie redeten darüber, Schulden zu machen. Weil Ottkar nicht arbeiten konnte. Weil Vaters Gesundheit bereits angeschlagen war. Dabei …
Ich raffte meinen Rock, stand auf und schüttete die Schoten in einen Eimer. Dann ging ich um die Ecke herum zum offenen Küchenfenster, weil ich mir einen schnellen Rückzug offenhalten wollte. Ich lehnte mich mit dem Oberkörper in die dämmrige Küche zu den beiden Streitenden hinein. »Ich kann«, sagte ich.
Meine Mutter, die gleichen dunklen Locken wie meine, in einem wirren Dutt gezwungen, zuckte vor Überraschung zusammen. Dann warf sie die Hände hoch und drehte sich zu mir um. »Was, Randalín? Drück dich bitte klar aus oder gar nicht. Du siehst doch, dass wir gerade mitten in einer wichtigen Angelegenheit stecken.«
»Eben.«
Mutter seufzte auf diese Weise, die verriet, dass sie sich Mühe gab, Geduld für mich zu finden – und dennoch daran scheiterte. »Nicht jetzt, Randalín.«
Nur, dass es kein Später geben würde. Sie wartete nie darauf, dass ich die richtigen Worte fand.
Meine Nackenmuskeln krampften. Die Worte verursachten einen Stau in meinem Hals. Hilfesuchend sah ich zu meinem Bruder, der auf der Küchenbank saß, gesundes und gebrochenes Bein – mit Schienen – hochgelegt, als wäre er ein Fürst und würde auf die Bedienung warten. Er musterte mich einen Moment, die hohe Stirn gerunzelt. »Du kannst«, wiederholte er, als wäre es ein Rätsel.
Aus dem Stall hinter mir erklang lautes Blöken, als wüssten die Schafe die Antwort. In seinem Gesicht leuchtete etwas auf – nur schüttelte er gleich darauf mit einem entschuldigenden Lächeln den Kopf. »Nette Idee, Ran, aber du kannst nicht für mich einspringen. Du bist eben kein Mann und das ist …« Eine vage Geste füllte die Pause. »Das ist Männerarbeit. Dafür braucht man Kraft und Ausdauer. Es würde dich übermäßig belasten, damit machst du dir nur Rücken und Hände kaputt.«
Übermäßig belasten? Ich war beinahe genauso groß wie er, selbst sein Kreuz war nur wenig breiter als meins. Ich hatte schon oft genug beim Umstapeln der Heuballen geholfen und ihm dabei in Kraft und Ausdauer in nichts nachgestanden. Was machte das Umgraben des Ackers so anders?
Er hob die Schultern. »Ist die Wahrheit, guck mich nicht so an. Es gibt einen Grund, warum Männer die eine Arbeit machen und Frauen die andere – Hausarbeit, Schafe melken, Hühner rupfen. Du weißt schon.«
Er meinte es nicht böse. Es war einfach die Art, wie er die Welt sah. Aber in dem Moment traf er einen ohnehin schon wunden Punkt.
Männer– Frauen. Ich ballte die Hände zusammen, bis sich die Finger in meine Handflächen gruben. Waren das die einzigen Kategorien, die relevant waren? Wurde danach bemessen, ob man eine Sache konnte, oder nicht? Ich war so vieles nicht, was Frauen angeblich für gewöhnlich waren – ich war nicht geschickt, nicht schön, nicht höflich. Wenn Mutter mich bewertete, dann war ich immer zu – zu polternd, zu grob, zu steif, zu wortkarg. Auch die Leute aus dem Dorf redeten über mich, dass ich mich zu viel für Bücher, Briefe und Buchhaltungslisten interessierte und zu wenig für echte Menschen und Gespräche. Aber warf man Vater vor, dass er zu schweigsam war? Nein. Denn für ihn war es akzeptabel – weil er ein Mann war.
Meine Kiefer schmerzten, so sehr presste ich sie aufeinander. Es war unmöglich, zwischen ihnen Worte hindurchzuzwängen. Unmöglich, Ottkar und Mutter meine Gedanken entgegenzuschleudern. Ich kann das. Ich kann helfen.
Doch alles, was ich herausbekam, war ein würgendes Geräusch. Sie verloren beide das Interesse an mir, wandten sich wieder einander und ihrem Streit zu.
So war es immer. Egal, wie gut und richtig meine Vorschläge waren – wenn ich sie nicht aussprechen konnte, wurden sie überhört. Dann pflanzte mein Vater doch wieder die Tomaten, die schneller reiften, aber weniger Gesamtertrag brachten. Oder mein Bruder stieg auf ein fremdes Pferd und brach sich das Bein.
Wenn ich nicht reden konnte, musste ich ihnen anscheinend zeigen, was ich meinte.
Mit einem Blick versicherte ich mich, dass Kráka noch immer bei Vater auf dem Schoß saß. Dann stapfte ich über den Hinterhof, zog im Gehen Wäsche von der Leine – ein Hemd und eine Hose von Ottkar – und machte mich auf die Suche nach dem Handpflug.
* * *
Als ich zu meiner Familie zurückkehrte, verschwitzt und voller Erde, und es mir nach mehreren Anläufen gelang, ihnen klarzumachen, was ich getan hatte, stieß ich nur auf Unverständnis bis Fassungslosigkeit. Kein Dank für meine Unterstützung, keine Anerkennung dafür, dass ich es getan hatte, obwohl es doch Männerarbeit war. »Bei allen Goldeseln, ich hoffe, so hat dich niemand gesehen!«, entfuhr es meiner Mutter. Und mein Bruder lachte und klopfte mir auf den Unterarm. »Mensch, Ran, wir haben Spätsommer. Das Umgraben ist doch erst in einigen Wochen fällig. Was sollen wir denn jetzt damit?« Als wüsste ich das nicht selbst und es wäre viel mehr darum gegangen, zu zeigen, dass ich es konnte!
Deswegen zeigte ich ihnen nicht sofort den dreckverkrusteten Mörser, den ich gefunden hatte. Deswegen marschierte ich erst zu Tascha.
Nur war es nicht einfach irgendein Mörser, wie sich am nächsten Tag beim Säubern herausstellte. Unter all dem Schmutz verbarg sich weder Bronze noch Eisen, wie ich erwartet hatte, sondern Gold. Echtes Gold.
Das stellte uns vor ernsthafte Fragen: Sollten wir den Mörser verkaufen und auf einen Schlag alle Sorgen loswerden? Damit hätten wir ohne Probleme Ottkars fehlende Arbeitskraft ausgleichen können. Oder sollten wir ehrlich sein und den Mörser an den geben, dem er eigentlich gehörte? Auch wenn der König sicherlich nichts von seiner Existenz wusste, so war es dennoch sein Acker und wir nur die Pächter.
Wir stritten viele Tage darüber. Das heißt, vor allem Ottkar und Mutter stritten. Ich schob ihnen Briefe zu, die keiner las. Bereute, ihnen den Mörser überhaupt gezeigt zu haben, und überlegte, ihn einfach wieder an mich zu nehmen. Doch an dem Morgen, an dem ich mich endlich zu dem Entschluss durchgerungen hatte – überzeugt, dass es das Richtige war und nicht nur eine Ausrede, ihn, den König, noch einmal zu sehen –, war der Mörser bereits fort. Ebenso wie mein Vater.
In Numgart, einer der nahegelegenen Städte, war König Laurent angemeldet, um dort für einen Tag für Bittgesuche, Richtsprüche und Fragen aus dem Volk zur Verfügung zu stehen, und Vater nutzte die Gelegenheit, um den Mörser abzugeben. Doch keiner von uns ahnte, was das lostreten würde.
Das zweite Treffen
Jetzt machte ich mich doch auf den Weg zum König, zu Schloss Lavalle. Dieses Mal hatte ich mich bewusst für Hemd und Hose entschieden, wenn auch frisch gewaschen – oder zumindest so schweiß- und staubfrei, wie sie nach einem fast zweistündigen Marsch zum Schloss und dem Anstieg hinauf in praller Hitze sein konnten. Laurent musste mich wiedererkennen. Ich war darauf angewiesen, dass er das tat. Außerdem wollte ich Eindruck machen. Ich musste Eindruck machen.
Es war ungewohnt, die steinerne Brücke über den Schlossgraben allein zu überqueren, ohne jemanden aus meiner Familie, ohne Karren. Wir waren sonst nur hier, um auf dem wöchentlich stattfindenden Markt im Innenhof unsere Ernte anzubieten. Jetzt kam ich ganz ohne Gepäck, nur mit eng beschriebenen Zetteln in der Tasche und einem Nacken, der vor Anspannung und Sorge ganz starr war. Ich hatte mich noch nie an eine so große Unternehmung wie diese gewagt.
Ohne die vielen Leute, die Karren und Stände war der Innenhof riesig. Die drei Eichen standen in seiner Mitte wie uralte Wächter, ihre Äste bildeten ein ausladendes Dach. Das Schloss selbst zog sich um den Platz herum wie ein lauerndes Ungetüm, seine imposante Höhe von Efeu überzogen. Er kroch überall die Fassade hinauf, die Finger in Fensterrahmen und Vorsprünge gekrallt.
Es war schwer, sich vorzustellen, dass der pitschnasse Mann, der im Mondschein mit Tascha und einem Esel gescherzt hatte, hierher gehörte. Zu den verzierten Giebeln, den blau uniformierten Bediensteten, die über den Hof hasteten. Zu der Kutsche mit goldenem Greifen-Wappen, die im Schatten wartete. Ich stolperte beinahe im Vorbeigehen, so sehr nahm mich der Anblick der davor gespannten Pferde in Beschlag. Waren das Gramayrische Grauschecken? Sie mussten es sein; der elegante Bogen ihrer Hälse war unverkennbar. Mir schwindelte bei dem Gedanken daran, welches Vermögen allein für den Erwerb dieser Tiere nötig war. Den Reichtum, der hinter dem ganzen Hof steckte, konnte ich unmöglich ermessen.
Meine Hände wurden zunehmend schwitzig vor Nervosität. Wie konnte ich überhaupt nur daran denken, hier vorzusprechen?
Ich hatte keine Wahl, war die Antwort. Ich drückte die Schultern durch, steuerte weiter den offiziellen Eingang an und widerstand dem Drang, mich stattdessen an den für die Bediensteten und die Zulieferung zu wenden. Eine breite Treppe führte zu den prunkvollen Flügeltüren hinauf, ihr Geländer beidseitig mit blau blühenden Waldreben bewachsen. Oben warteten zwei Wachen in der Livree des Agarmundter Königshauses, mit eindrucksvollen Degen an ihren Gürteln. Allerdings war ihre Haltung nicht abweisend, ihre Mienen eher gelangweilt als wachsam.
Ich kann das, redete ich mir zu.
Dabei war ich mir meiner staubigen, bloßen Füße nur allzu bewusst, mit denen ich die Treppe hinaufstieg. Sie waren mit Hosen so viel deutlicher zu sehen als bei einem Rock, auch wenn ich die Menge an zusätzlichem Stoff nicht vermisste. Ich war mir sicher, dass auch die Gardisten jeden meiner großen Schritte genau verfolgten.
»Name und Begehr?«, erkundigte sich der linke Wachmann in einer überraschend tiefen Stimme, die durch mich hindurch vibrierte. Er selbst war kaum größer als ich und hatte einen stattlichen schwarzen Vollbart. Der rechte überragte mich um ein paar Fingerbreit, war blond und seine glattrasierten Wangen waren mit Flächen unterschiedlicher Pigmentabstufungen gemustert.
Warum trägst du Hosen? Ich konnte die Frage bereits klar und deutlich hören. Doch sie kam nicht. Stattdessen blieben ihre Mienen unbewegt, als würde ihnen nichts Unpassendes an mir auffallen. Es fühlte sich seltsam an. Ich war es gewohnt, dass die Aufmerksamkeit manchmal einen Moment zu lange an mir hängen blieb. Als würde ich mit meiner Kieferform auch wortwörtlich anecken. Aber jetzt …
Ich zog den Brief aus meiner Tasche und hielt ihn dem Fragenden hin.
Der tauschte einen Blick mit seinem Kameraden, ohne Anstalten zu machen, den Zettel anzunehmen. »Was soll das?«
Sah das raue Papier aus, als würde es ihn beißen? Ich kniff die Brauen zusammen. »Steht hier drin.«
»Du weißt nicht, wie du heißt und was du willst?«
»Ran. Randalín. Ich …« Die Worte klangen jetzt schon viel zu barsch. Ich ballte die freie Hand zur Faust, verfluchte meine trockene Kehle, meine stolpernden Gedanken. »Ich muss zum König.«
»Und warum glaubst du, er würde dich anhören?«
»Er liegt falsch.«
»Ach. Und du … liegst richtig?«, fragte er in seinem tiefen Bass. Seine Brauen schossen nach oben. »Womit?«
Mein Kiefer arbeitete, doch keine Worte kamen heraus. Ich erinnerte mich genau daran, welche ich auf das Papier gebannt hatte, aber sie passten hier nicht. Mündlich würden sie anders klingen als schriftlich.
Mein Bruder hatte recht gehabt. Das hier war keine Aufgabe für mich. Ottkar konnte sich mit einem Lächeln und einem Fingerschnippen durch alle Türen quatschen. Aber mein Bruder hatte sich das Bein gebrochen, er konnte nicht hier sein.
Und hätte er das nicht, wäre es gar nicht erst so weit gekommen.
»Lies doch einfach den verdammten Zettel«, entschlüpfte es mir, und ich biss mir direkt danach auf die Zunge. Zu grob. Zu hart. Wieder ganz der Holzklotz, kein Feinschliff, keine Höflichkeit. Meine Mutter hätte betreten den Blick abgewandt, Ottkar hätte mir verstohlen und mitleidig die Hand getätschelt.
Der Wachmann maß mich noch einmal von oben bis unten und griff dann nach dem Brief. Er las den Brief.
Als hätte ich das Richtige getan, nicht das vollkommen Falsche. Es fühlte sich seltsam an. Als hätten sich die Regeln der Welt verkehrt, als würde ich ein anderes Leben anprobieren.
Die Hose, schoss es mir jäh durch den Kopf. Ich trug sie wegen König Laurent. Ich hatte nicht darüber nachgedacht … Natürlich veränderte sie auch, wie andere Personen auf mich reagierten. Oder veränderte sie mich?
Plötzlich wurde es unruhig auf dem Innenhof hinter mir. Auch wenn es nur leise Stimmen und das Geräusch von einem Dutzend Füßen waren, veränderte sich spürbar die Atmosphäre. Automatisch wandte ich mich um. Eine Gruppe von Wachen begleitete drei Personen aus einem der unscheinbaren Seiteneingänge. Zwei von ihnen hatten dunkles, zu einem Zopf gebundenes Haar und trugen helle Anzüge, die dritte hellrotes, kürzeres Haar und die blaue Uniform eines Bediensteten. Sie schienen zu diskutieren. Dann trennte sich einer der Dunkelhaarigen zusammen mit dem Bediensteten vom Rest und kehrte wieder um.
»… aber beeilt euch!«, rief der Dritte ihnen hinterher, dass es über den Hof hallte. Eine Stimme, die mir unter die Haut fuhr. König Laurent von Agarmundt. Dann musste das eben neben ihm Prinz Felipe sein …
Meine Füße setzten sich in Bewegung, bevor ich zu Ende gedacht hatte. Das hier war meine Chance. Ich lief die Stufen hinab, immer zwei auf einmal nehmend, und hastete über den Innenhof.
Sofort schoben sich zwei der Gardisten direkt vor den König, ihre Hände auf den Degengriffen. Die ganze Gruppe kam zum Stocken. Verspätet wurde mir klar, wie es wirken musste, wenn ich so auf ihn zustürmte. Abrupt bremste ich ab, noch immer ein gutes Dutzend Schritte entfernt und etwas ratlos, wie ich stattdessen vorgehen sollte.
Tatsächlich nahm mir König Laurent selbst die Überlegung ab, denn er versuchte irritiert, die Wachen vor ihm auseinanderzuschieben. »Lasst mich doch wenigstens sehen …« An einer Schulter vorbei fiel sein Blick auf mich. Einen Moment sah er mich einfach nur an und ich wusste nicht, wie ich ihm klarmachen sollte, wer ich war und wo er mich schon einmal gesehen hatte. Alles, was ich tun konnte, war still zurückzustarren.
Aber vielleicht war es genau das, was ihn mich wiedererkennen ließ. In seiner Miene zuckte etwas. »Das geht in Ordnung«, sagte er, und die Wachen lösten ihre Formation. Sie setzten sich jedoch mit ihm in Bewegung, als er auf mich zusteuerte. Mit einem beiläufigen Wink hielt er sie auch davon ab.
Erst jetzt, während er auf mich zukam, wurde mir klar, mit wem ich es zu tun hatte. Er sah anders aus im Sonnenlicht. Größer, irgendwie. Das Gesicht schärfer geschnitten. Sein Haar war zu einem makellosen Zopf zurückgebunden, auf seinem sandfarbenen Anzug funkelten Goldstickereien. Ein Degen hing an seiner Hüfte, von dem ich mich unwillkürlich fragte, ob er ihn tatsächlich auch zu bedienen wusste. Er sah aus, als wäre er einem Gemälde – einer ganz anderen Welt – entstiegen. Wie konnte ich, Kind eines Bauern, es wagen, ihn auch nur anzusprechen?
Er blieb nur zwei Schritte von mir entfernt stehen. »Ist etwas mit Natascha?«, forderte er zu wissen, der Ton leise und eindringlich. Seine aufmerksame, lebendige Mimik war genau wie in meiner Erinnerung.
Er hatte mich erkannt. Noch mehr: Er sorgte sich um Tascha. Er, der König. Wie konnte er beides sein – König und derselbe Mann, der tropfend zwischen den Zelten des Fahrenden Volkes gestanden hatte? Es ließ meinen Kopf schwirren. Als wären da zwei Bilder übereinandergelegt, und ich wusste nicht, welches ich fixieren sollte.
»Nein, es …« Man verbeugte sich vor einem König, oder? Ich unterbrach mich selbst und holte es nach, auch wenn es schrecklich steif geriet.
Er winkte ab – mit einer Nachlässigkeit, wie man sie wohl nur als Adeliger besitzen konnte. »Komm zum Punkt.«
Da war es wieder, dasselbe absurde Gefühl, das ich auch bei unserer ersten Begegnung gehabt hatte. Es musste etwas in seinem Blick sein. Etwas in der Art, wie er mich betrachtete. Als würde er alle Ecken und Kanten von mir sehen – und sie respektieren.
Ich hatte das plötzliche und unerklärliche Bedürfnis, ihn so sehr beeindrucken zu wollen, dass es selbst ihm einmal die Sprache verschlug und er so starr und unbeholfen dabei sein würde wie … wie ich.
Wie ich jetzt.
Er wartete immer noch auf eine Antwort. Ich fummelte nach dem zweiten Brief in meiner Tasche und hielt ihn ihm hin – mit der Hand, deren Innenfläche mit blutigen Blasen überzogen war. Blasen, die ich seinetwegen hatte. Weil mein Vater wieder und wieder den Acker umgegraben hatte – und dabei sogar verzweifelt genug gewesen war, meine Hilfe zu akzeptieren.
König Laurent fischte mir das Papier sofort aus den Fingern. Vielleicht in der Erwartung, der Brief stammte von Tascha. Aber ein Blick auf die Unterschrift zeigte ihm, dass dem nicht so war.
»Randalín.« Er sah auf. »Das bist du?«
Anscheinend kannte er den Namen nicht. Er betonte ihn falsch, zog das zweite A lang und ließ ihn dadurch wie eine Abwandlung von Randale klingen. Also wusste er auch nicht, dass es ein Frauenname war, zumindest in Wedlund, dem Herkunftsland meiner Mutter.
»Randalín«, korrigierte ich, mit Betonung auf der letzten Silbe. Doch dann schob ich hinterher: »Ran.« Letztlich nannten mich bis auf meine Mutter alle so. Es war kürzer, einfacher.
»Wenn der Brief von dir stammt, warum sagst du mir nicht einfach direkt, was drinsteht?«
»Ich bin nicht gut mit Worten.«
Er hob amüsiert die Brauen und wedelte mit dem Papier.
Mein Nacken brannte. »Mit gesprochenen Worten.« Womit ich wohl direkt den Beweis erbracht hatte.
»Verstehe.« Er widmete sich wieder dem Brief.
In Gedanken ging ich selbst noch einmal durch, was ich geschrieben hatte. Ich hatte jedes einzelne Wort mit so viel Bedacht gewählt, dass es sich in meinen Verstand geschliffen hatte.
Verehrte Hoheit,
ich weiß, dass ein derartiges Schreiben von jemandem meines Standes an jemanden Eures unüblich ist. Ich bitte dennoch demütig um etwas von Eurer Zeit und Aufmerksamkeit. Mein Anliegen wird auch von beidem nicht viel in Anspruch nehmen, denn der vorgefallene Irrtum ist schnell vorgetragen und ebenso schnell behoben.
Mein Vater hat Euch bei der letzten Anhörung in Numgart einen goldenen Mörser übergeben. Dieser war in dem Acker vergraben, den wir erst kürzlich von der Krone gepachtet haben. Allerdings erwartet Ihr, auch den dazugehörigen Stößel zu bekommen. Da mein Vater ihn nicht mitbrachte, wurde ihm Diebstahl unterstellt. Ihr habt ihm eine sogenannte »Bedenkzeit« gewährt, um es sich anders zu überlegen und ihn doch noch auszuhändigen. Andernfalls droht meinem Vater der Kerker.
Erinnert Ihr Euch an besagten Vorfall?
Auch wenn es Euch vermutlich nicht umstimmt, möchte ich der Vollständigkeit halber noch einmal betonen: Ich habe diesen Acker eigenhändig und vollständig bis zur letzten Krume umgegraben. Wenn es besagten Stößel gibt, dann nicht auf dem von uns gepachteten Bereich.
Diesen Einwand hat auch mein Vater bereits vergeblich vorgebracht, doch Ihr habt ihm nicht geglaubt. Ob dies gerechtfertigt ist, maße ich mir nicht an, zu beurteilen. Ich bin nicht in der Position, zu bewerten, wem Ihr Euer Vertrauen schenken und wem Ihr misstrauen solltet. Ich bitte Euch nur, den Vorfall einmal aus dieser Perspektive zu betrachten:
Hätten wir den goldenen Mörser nicht abgegeben, hätten wir die Krone bestohlen – ohne dass diese jemals davon erfahren hätte, denn die Existenz des Mörsers war zuvor nicht bekannt. Wir wären allerdings um einiges Gold reicher gewesen. Stattdessen haben wir ihn abgeliefert und sind nun vor allem um einige Sorgen reicher: Wir sollen einen Stößel beschaffen, den es nicht gibt, andernfalls landet mein Vater hinter Gittern.
Was, wenn der Nachbar in seinem gepachteten Acker einen anderen, kostbaren Fund macht? Wird er auch den edlen Weg gehen oder lieber Stillschweigen bewahren, nachdem, was uns widerfahren ist?
Ich bitte Euch untertänigst, Eure Königliche Hoheit, Gnade walten zu lassen und von Eurer Forderung abzurücken. Ein solches Ultimatum kann nur das Gegenteil seines eigentlichen Zwecks bewirken.
– Ergebenst, Randalín
Der Blick von König Laurent flog so schnell über die geschriebenen Worte, dass klar war, dass er sie nur überflog. Zeitgleich schwand die Belustigung aus seiner Miene. »Du hältst dich wohl für klug? In jedem Fall klüger als mich.«
»Nein. Ich …«
»Doch, ganz offensichtlich.« Er tippte mit der freien Hand auf die Zeilen, so unwirsch, dass es wie ein Schlag klang. »Dein Vater hat beim Umgraben des von der Krone gepachteten Ackers einen goldenen Mörser gefunden.«
»Ich«, brachte ich heraus.
Er runzelte die Stirn, las die Wörter noch einmal. »Schön. Du hast den Mörser gefunden. Und du behauptest, der Stößel könne nicht in dem Acker sein, schließlich sei er bereits umgegraben worden.« Er richtete seinen Blick auf mich. »Denn mit einmal Umgraben findet man auch immer alles.«
Er wusste nicht, was er da verlangte. Er war ein König, er wusste nicht, wie viel Schweiß es kostete, diesen verdammten Acker umzugraben. Wie sehr es meinem Vater zusetzte, der seitdem mit mir jeden Fingerbreit absuchte. Noch tiefer grub. Sich den Rücken überlastete und nicht schlief, weil wir nur eine Frist von einer Woche hatten.
»Es gibt keinen Stößel«, beharrte ich stur.
Laurent neigte seitlich den Kopf und das Lächeln, das sich jetzt über seine Lippen legte, war genauso freigiebig und verspielt wie in meiner Erinnerung, im Mondlicht. Jetzt jedoch verursachte es mir trotz der Tageshitze eine Gänsehaut. »Und du hältst dich für klug, wenn du mich darauf hinweist, dass ich nicht mit dem Kerker drohen sollte. Weil – wenn sich das herumspräche – niemand auch nur das erste Fundstück zu mir bringen würde.«
»Ja.«
»Du bist ein Freund von Natascha, und nur deswegen habe ich diesen Brief nie gesehen.« Er hielt ihn mir zwischen zwei Fingern eingeklemmt entgegen. »Ansonsten könnte man derlei für eine Drohung und Anstiftung zu Diebstahl halten – und dann würde man dich ebenfalls festsetzen.«
Dieses Mal wiederum nahm ich das Papier nicht an. Ich krallte meine Finger in die Handflächen, bis die Blasen brannten, und kaute an zu vielen spitzen Erwiderungen, die alle nicht Form annehmen wollten, alle nicht hinauskonnten.
Mein Hinweis war nicht unangebracht. Er war richtig. Er war wichtig. Und es war keine Drohung – es war eine Bitte, ich hatte die Worte präzise und bewusst gewählt.
»Du«, korrigierte ich.
»Ich?«
»Du würdest mich festsetzen lassen. Nicht irgendwer.«
Er hob die Brauen. »Ich«, betonte er, »bin für dich Königliche Hoheit und Ihr, nicht du.«
Ich zuckte zusammen. Er hatte recht. Ich hatte beim Schreiben sorgfältig darauf geachtet. Nur im Gespräch, jetzt, wo er mir wieder auf Augenhöhe gegenüberstand wie der Landstreicher Fredrik … »Es macht es nicht weniger wahr«, presste ich heraus.
Er lachte auf. »Was für eine ungerührte Dreistigkeit. Du glaubst wirklich, du wüsstest besser, welches Ultimatum ich stellen sollte und welches nicht – du wüsstest besser, wie ich mein Land regieren sollte? Als Bauernsohn. Der noch nicht einmal seinen eigenen Acker genug kennt.« Er ließ das Papier ungerührt in der Tasche seines Anzugs verschwinden, wandte sich zu seinen Wachen um, im Begriff, ihnen ein Signal zu geben, wieder zu ihm aufzuschließen.
Doch dann hielt er noch einmal inne und drehte sich zu mir zurück. »Weißt du? Ich hatte nicht vorgehabt, deinen Vater wirklich einzusperren, wenn er den Stößel nicht findet. Es war lediglich ein Ansporn, um genau zu suchen. Aber nach diesem Zwischenfall hier … Wie du so schön geschrieben hast: Was, wenn der Nachbar einen kostbaren Fund macht, nachdem er von dir gehört hat, ich würde meine Drohungen nicht ernst meinen? Oder wie leicht es war, mich in meinem Urteil ins Wanken zu bringen?« Er lächelte noch immer. Es hätte sanft sein können, wäre das Thema nicht so ernst gewesen. »Jetzt rate ich euch wirklich, diesen verdammten Stößel aufzutreiben.«
Er hatte bereits drei Schritte gemacht, bevor ich den Mund endlich aufbekam. »Woran …« Der Satz erstarb auf meinen Lippen, kaum dass ich ihn begonnen hatte. König Laurent hörte mir nicht mehr zu, es hatte keinen Zweck.
Doch erstaunlicherweise hielt er nach zwei weiteren Schritten inne und drehte sich erneut um. Ich hörte ihn seufzen. »Meine Güte, du bist echt ein zu komischer Kauz. Jetzt will ich doch wissen, was du noch zu sagen hast. Na komm, lass hören.«
Meine Kiefer schmerzten, so sehr hatte ich sie aufeinander gepresst. Es kostete unendliche Mühe, sie auseinanderzukriegen. »Woran erkennt Ihr den passenden Stößel?«
»Es ist ein goldener Mörser«, gab er zurück.
Dann schien er zu verstehen, worauf ich hinauswollte. Ich sah es in dem kurzen Zucken in seinem Gesicht.
Er konnte nicht wissen, ob der dazugehörige Stößel golden war. Er konnte es annehmen. Jeder würde es annehmen. Aber wenn wir beispielsweise einen aus Metall fanden – oder uns einen besorgten – wer konnte beschwören, dass sie nicht doch zusammengehörten?
Er würde es festlegen können. Er war der König. Sein Wort war Gesetz.
Aber es war auch unbestreitbare Willkür. Und er wusste es.
Alle würden es wissen.
»Das ist die zweite Drohung innerhalb von wenigen Sätzen«, sagte er langsam. »Du hast Recht. Du solltest nicht sprechen. Oder schreiben. Du solltest mir am besten gar nicht mehr unter die Augen kommen. Verflucht! Vermutlich wirst du mir auch diese Worte im Mund umdrehen. Du wirst einfach nie wieder diesen Hof betreten … oder bereiten oder befahren oder was auch immer, hast du mich gehört?« Er schüttelte den Kopf. »Zu deinem eigenen Wohl.« Erneut wandte er sich ab und dieses Mal ging er wirklich.
Das dritte Treffen
Nach Ablauf der Woche kamen die Soldaten zu uns. Wir hatten den goldenen Stößel nicht gefunden. Als ich ihnen einen anderen anbot – ich war extra in die Stadt gelaufen, um einen zu finden, der in der Machart zumindest ähnlich aussah – zog der eine die Brauen hoch und sagte: »Wir wurden gewarnt, dass ihr so etwas probieren würdet.«
Und der Zweite warf mir einen Blick zu, der die Hühner verschreckt hätte. »Damit bleibt der goldene immer noch gestohlen.«
Meine Mutter weinte. Mein Bruder Ottkar sagte nichts. Kráka sah mich mit großen Augen an und wollte wissen, was das jetzt bedeutete.
Ich hatte es verscherzt, bedeutete das. Ich hatte einen König gereizt und er hatte mit Königsmethoden geantwortet. Vater war fort. Auf unbestimmte Zeit … bis König Laurent ihn begnadigen würde.
Es riss eine schmerzhafte Lücke in unsere Familie. Obwohl Vater nie viel sagte, wirkte die Stille neben Mutters und Ottkars Streitereien jetzt leer und kalt. Und dann wurde sie sogar ohrenbetäubend, als Mutter mitten in der Diskussion innehielt, das kochende Wasser auf dem Herd stehen ließ, sich auf einen Stuhl setzte und eine Weile lang gar nichts mehr sagte. Für einen Moment fürchtete ich, ihr ohnehin ständig besorgtes Herz würde wahrhaftig brechen.
»Was sollen wir jetzt bloß machen?«, murmelte sie schließlich, so leise, dass ich sie kaum verstand.