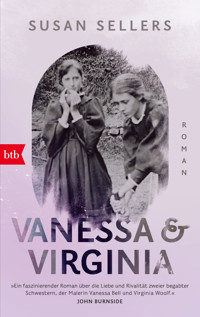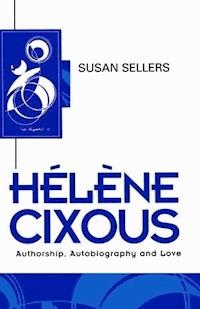9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebesgeschichte in drei Akten: Lydia Lopokova und John Maynard Keynes – zwei der brillantesten und ungewöhnlichsten Figuren des 20. Jahrhunderts.
Winter 1921, die Bohème von Bloomsbury wird aufgemischt, denn die Ballets Russes bringen eine extravagante neue Produktion auf die Bühne des Londoner Alhambra Theaters – mit der extrovertierten russischen Tänzerin Lydia Lopokova in der Hauptrolle. Im Publikum: John Maynard Keynes, der angesehene Ökonom, obwohl er sich wenig von dem Abend verspricht. Denn trotz Lydias zahlreicher Triumphe, darunter die Titelrolle in Strawinskys »Feuervogel«, hält Maynard sie für eine »miserable Tänzerin«. An diesem Abend jedoch ist er von ihrer Darbietung gerührt, und der Mann, der bislang ausschließlich homosexuelle Liaisons hatte, verliebt sich unsterblich in die Primaballerina.
Ihre unwahrscheinliche Affäre, dann ihre unerwartete Heirat in London im Jahr 1925, die ganz England erstaunt und bewegt, wird zur überraschendsten Liebesgeschichte ihrer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Winter 1921, die Bohème von Bloomsbury wird aufgemischt, denn die Ballets Russes bringen eine extravagante neue Produktion auf die Bühne des Londoner Alhambra Theaters – mit der extrovertierten russischen Tänzerin Lydia Lopokova in der Hauptrolle. Im Publikum: John Maynard Keynes, der angesehene Ökonom, obwohl er sich wenig von dem Abend verspricht. Denn trotz Lydias zahlreicher Triumphe, darunter die Titelrolle in Strawinskys Feuervogel, hält Maynard sie für eine »miserable Tänzerin«. An diesem Abend jedoch ist er von ihrer Darbietung gerührt, und der Mann, der bislang ausschließlich homosexuelle Liaisons hatte, verliebt sich unsterblich in die Primaballerina.
Ihre unwahrscheinliche Affäre, dann ihre unerwartete Heirat in London im Jahr 1925, die ganz England erstaunt und bewegt, wird zur überraschendsten Liebesgeschichte ihrer Zeit.
Zur Autorin
Susan Sellers ist Professorin für Englische Literatur und Kreatives Schreiben an der University of St. Andrews, Schottland. Ihre akademische Forschung zur Bloomsbury Group findet sich in ihren Romanen wieder. Ihr Debüt Vanessa and Virginia wurde in über 15 Sprachen übersetzt und international gefeiert. Mit Feuervogel erscheint erstmals ein Werk der Autorin auf Deutsch.
Susan Sellers
Feuervogel
Eine Bloomsbury-Liebesgeschichte
Aus dem Englischen von Andreas Jäger
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Firebird – A Bloomsbury Love Story« bei Edward Everett Root, Brighton.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Dezember 2022
by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Susan Sellers
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack, Hamburg.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by btb Verlag, München
Covergestaltung: semper smile, München
nach einem Entwurf von Jeremy Thurlow und Andrew Chapman
Covermotiv: Duncan Grant, Juggler and Tightrope Walker, c. 1918–19(private collection), © The Estate of Duncan Grant / courtesy of Piano Nobile, Robert Travers (Works of Art) Ltd.
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
JT · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-26635-6V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Sue Rabbitt Roff
»Das Tanzen … gibt dir nichts zurück, keine Manuskripte für die Schublade, keine Gemälde, die du dir an die Wand hängen oder vielleicht in Museen ausstellen kannst, keine Gedichte, die du drucken und verkaufen kannst – nichts als diesen einen flüchtigen Moment, in dem du dich lebendig fühlst.«
Merce Cunningham
»Das Erwartete tritt nie ein; es ist stets das Unerwartete.«
John Maynard Keynes
»… wie wunderbar die Zeit war, die ich mit dir im Schloss verbrachte …«
Lydia Lopokova
Erster Akt
»Auf einem Jagdausflug erblickt Prinz Iwan einen wunderschönen Vogel, dessen Federn leuchten, als ob sie in Flammen stünden. Gebannt folgt er dem Feuervogel tief in den Wald hinein. Der Feuervogel entflieht, lässt aber dem Prinzen eine Feder zurück und verspricht ihm wiederzukommen, sollte er Hilfe brauchen.«
Der Vorhang geht auf, und erwartungsvolle Stille legt sich über den Zuschauerraum. In diesem Frühling des Jahres 1921 ist London im Bann des russischen Balletts. Seit Wochen schon tobt die Debatte darüber, ob die kühnen Experimente der Truppe künstlerische Geniestreiche sind oder im Gegenteil barbarisch und geschmacklos. Doch auch wenn diese Kontroverse die Schlagzeilen beherrscht hat, ist sie nicht der Grund, weshalb das Palace Theatre heute bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. Nein – was auch Besucher, die dem Ballett sonst gleichgültig gegenüberstehen, dazu bewegt hat, auf konkurrierende Vergnügungen zu verzichten, und was ihr Getuschel verstummen lässt, als der Dirigent sich verbeugt, das sind die Skandalgeschichten um die Solotänzerin Lydia Lopokova. Nach ihrem mysteriösen Verschwinden, das nicht einmal die eifrigsten Journalisten zu erklären in der Lage waren, schlüpft sie heute wieder in ihre Rolle als Feuervogel.
Und es ist diese Lydia Lopokova, die jetzt mit ihrem Partner Prinz Iwan in den Kulissen wartet, mit ihrem juwelenbesetzten Kopfschmuck, aus dem eine Feder wie eine scharlachrote Flamme emporquillt. Sie bekreuzigt sich, als sie das leise Gemurmel der Streicher hört. Ob sie es aber tut, weil sie – wie sie mit entwaffnender Offenheit in Interviews erklärt hat – nervös ist und fürchtet, ihr Publikum nach so langer Abwesenheit zu enttäuschen, oder ob es die düster-ahnungsvolle Stimmung ist, die der Komponist – ihr Liebhaber Igor Strawinsky – mit diesen ersten Takten zaubert, ist unmöglich zu entscheiden.
Was immer ihr Motiv sein mag, jetzt ist keine Zeit, über Strawinsky nachzugrübeln. Und schon gar nicht über ihre Befürchtungen, dass er seine Frau, die kränkelnde Katya, und seine vier Kinder niemals verlassen wird, obwohl er plant, den Sommer mit Lydia zu verbringen. Und sie hat auch keine Zeit, über ihre eigene kriselnde Ehe mit dem Impresario der Truppe, Randolfo Barocchi, nachzudenken und über den Grund, weshalb sie ihre Tanzkarriere unterbrechen und untertauchen musste. Die Geigen spielen nun raschelnde Töne wie das Geflatter von Vögeln, und das ist für sie das Zeichen, sich bereit zu machen. Sie stemmt sich auf den Fußballen hoch und dehnt die Fußgewölbe, lässt die Arme abwechselnd kreisen.
Die Bühne ist ein dunkler Wald, der Mond eine silbrige Sichel am tiefschwarzen Himmelszelt. Die Bäume wirken wie schattenhafte Bilder, ihre Formen obskur, die Umrisse verschwommen. Ein Jagdhorn ertönt, und die Farben wechseln, zuerst zu Mitternachtsblau, dann zu einem tiefen Purpurrot. Es heißt, dass zu den ungewöhnlichen Talenten Sergei Djagilews, des extravaganten Chefs der Truppe, auch die Beleuchtung zählt, und wie zum Beweis beginnen rote Äpfel an den immer noch dunklen Ästen zu glitzern. Das perlende Glissando einer Harfe deutet an, dass diese Äpfel so vergiftet sind wie die im Paradies, die Eva pflückte, während die drohenden Klänge eines Englischhorns unsere Befürchtung bestätigen, dass der Wald, in dem wir uns befinden, ein verwunschener ist.
Lydia hat zu zählen begonnen, und beim überirdisch-hellen Geläut der Celesta sammelt sie sich, als wäre ihr Körper eine Feder, die sie zusammendrücken kann. Der Sprung, mit dem sie sich auf die Bühne wirft, ist so beeindruckend, dass sie nicht mit dem Applaus begrüßt wird, den das hingerissene Publikum gewöhnlich einer weltberühmten Ballerina spendet. Stattdessen hört man die Zuschauer nach Luft schnappen, während Köpfe sich drehen und Augen vergeblich ihrem Flug zu folgen versuchen. Aber ehe wir noch recht über ihre Kraft und scheinbar mühelose Grazie staunen können, ist das Spektakel schon vorbei, und Prinz Iwan, mit goldener Krone, scharlachroter Jacke und einem prächtigen Jagdbogen, betritt den Wald. Auch dieser Tänzer ist ein Star des russischen Balletts, doch die spürbare Erleichterung, als er abgeht und die Bühne für die Rückkehr des Feuervogels räumt, ist ein Zeichen dafür, dass es Lydia ist, die die Leute sehen wollen.
Streicher, Holzbläser und Schlagwerk steigern sich in anschwellenden Klangspiralen. Ein Becken wird geschlagen, und Lydia schnellt auf die Bühne, überzeugt alle, deren Blicke auf sie geheftet sind, dass ihr erster Auftritt keine Illusion war und dass sie tatsächlich ein Zaubervogel ist. So stark ist der Eindruck, den sie erzeugt, dass viele Zuschauer sich – nachdem sich die erste Begeisterung gelegt hat – zu der Mutmaßung gedrängt fühlen, ein unter ihrem Kostüm verborgenes Gurtzeug, verbunden mit einem System von Drähten, die von Helfern in den Kulissen bedient werden, müsse für ihre schier übermenschliche Schnelligkeit und Sprungkraft verantwortlich sein.
Der Prinz in seinem Versteck erspäht sie, er legt mit seinem Jagdbogen auf sie an und hat sie bald eingefangen. Der Feuervogel wehrt sich, verdreht den Oberkörper und schlägt mit den Flügeln im vergeblichen Bemühen, in die Luft zu entfliehen. Klarinetten und Hörner stoßen dringliche Hilferufe aus und geben zu erkennen, dass dies nicht der in solchen Momenten übliche romantische Pas de deux ist, sondern ein Paar in einem Kampf auf Leben und Tod. Der Feuervogel ist mutig und listenreich. Verzweifelt sucht er sich aus der Umklammerung zu befreien, und der Prinz braucht all seine Kraft, um ihn zu halten. Eine Solovioline lässt ein Klagelied ertönen, und endlich tanzen die Widersacher zusammen, als ob das Eingeständnis, dass sie einander ebenbürtig sind, einen Keim des Vertrauens gelegt hätte. Als die zwei nun ihre Kreise über die Bühne ziehen, spiegeln und ergänzen sich ihre geschmeidigen, poetischen Körperhaltungen. Der Prinz hebt seine schöne Beute hoch, und sie ist wieder der Feuervogel, ungezähmt, verführerisch, ein Wesen aus einer anderen Welt. Zu einer Kaskade von Flötentönen setzt der Prinz sie ab und bekommt zum Dank eine Feder geschenkt.
Und dann, den Kopf erhoben, die schlagenden Flügel ausgestreckt, verschwindet der Feuervogel. Der Prinz kann ihm nur betroffen nachsehen, das Publikum nur rätseln, wie diese Geschichte weitergehen wird.
An einem Tisch nahe einem Fenster, das auf einen ruhigen kleinen Londoner Park hinausgeht, sitzen vier Männer, alle um die vierzig, zusammen beim Lunch. Sie sind gerade mit dem Hauptgang fertig – es gab offenbar Lammkoteletts, wie sich an den abgenagten Knochen in erkaltender Bratensoße ablesen lässt, die kreuz und quer auf ihren Tellern herumliegen. Nun warten sie darauf, dass die Köchin den Apfelkuchen mit Vanillesauce zum Nachtisch serviert. Sie füllen die Pause mit ihrer Unterhaltung, die ungezwungen dahinfließt, als ob sie es gewohnt wären, Zeit miteinander zu verbringen.
Drei der Männer wohnen im Haus: der lange, schlaksige in Anzug und Krawatte; der, dessen höher werdende Stirn seinem Selbstbild als Intellektueller schmeichelt, der noch von sich reden machen wird; und der, dessen vollkommene Züge alle, die ihn sehen, zu Vergleichen mit griechischen oder gar indischen Göttern anregen. Der Vierte, dessen üppiger Vollbart seinen Mund umwallt und dessen Augen hinter der Brille spitzbübisch funkeln, wann immer er sich – wie jetzt – bewusst ist, eine geistreiche, wohlformulierte und höchstwahrscheinlich lästerliche Bemerkung vom Stapel gelassen zu haben, ist regelmäßig zu Gast.
Es sind nicht nur die räumliche Nähe und die Gewohnheit, die den Umgang dieser Männer miteinander so entspannt machen, und es ist auch nicht die enge Bindung, die zwischen zweien von ihnen durch die Mitgliedschaft in einem elitären Club in Cambridge, wo sie studiert haben, gewachsen ist; ja, nicht einmal die Tatsache, dass zwei von ihnen Cousins sind. Es sind vielmehr die komplizierten (manche würden sagen: anstößigen) sexuellen Beziehungen, die sie verbinden. Denn drei dieser vier Männer waren Liebhaber, bevor sie Freunde wurden – in einer Dreiecksbeziehung, die zwar nicht frei war von den unvermeidlichen schmerzhaften Enttäuschungen und erbitterten Rivalitäten, die aber auch von intensiven Gefühlen begleitet war, die keiner von ihnen je vergessen wird. Und auch der Vierte ist in dieses komplizierte emotionale Gewebe verwickelt, denn seine Frau ist in den Schönsten der drei verliebt.
Ihre Unterhaltung, während Maynard (im Anzug), Clive mit der hohen Stirn, Lytton mit dem rotbraunen Bart und der göttergleiche Duncan auf den Nachtisch warten, dreht sich um keines dieser Themen – wie nicht anders zu erwarten bei einem zwanglosen Lunch mit alten Freunden an einem unbedeutenden Dezembertag. Stattdessen reden sie über ein neues Ballett, das kürzlich im Alhambra Theatre Premiere hatte. Es handelt sich um The Sleeping Princess, inszeniert vom legendären Sergei Djagilew mit seinen Ballets Russes, dessen frühere Produktionen, darunter der berühmte Feuervogel, die Freunde mit Begeisterung verfolgt und auch – wenngleich sie sich in ihrem Urteil alles andere als einig waren – bewundert haben.
Das überschwänglichste Lob für das neue Werk kommt von Duncan – vielleicht, weil er Maler ist und weil eine von Djagilews zahlreichen Neuerungen darin besteht, dass er Künstler mit der Gestaltung seiner Produktionen beauftragt, mit eindrucksvollen Resultaten, wie sie alle finden. Clive, der ein Buch über Kunst und einen Artikel über das russische Ballett geschrieben hat, und Lytton, dessen Buch in literarischen Kreisen großes Aufsehen erregt hat, urteilen weniger wohlwollend. Maynard, der das Ballett noch nicht gesehen hat und in Gedanken halb bei dem Buch ist, an dem er selbst gerade schreibt, begnügt sich weitgehend mit Zuhören.
»Djagilews Sleeping Princess wirft das Ballett um dreißig Jahre zurück«, nörgelt Lytton mit seiner hohen, schnarrenden Stimme. »Es ist kleinmütig und ohne Zweck und Richtung.«
»›Kleinmütig‹ trifft es genau«, bestätigt Clive. Da der Nachtisch immer noch auf sich warten lässt, hebt er die Weinflasche hoch und blickt fragend in die Runde. Als Maynard, der an Wochentagen nur selten Alkohol trinkt, und Lytton, dessen Gesundheit angegriffen ist, ablehnen, schenkt er zunächst Duncan ein und gießt sich dann den Rest aus der Flasche ins Glas. Es ist ein hervorragender Côte de Beaune – ein Geschenk seiner Geliebten Mary –, und es wäre zu schade, ihn verkommen zu lassen.
»Das Aufregende an den Russen«, fährt er fort, während er sein Glas schwenkt und mit Befriedigung die Schlieren betrachtet, die die tiefrote Flüssigkeit an den Wänden des Glases bildet – das Kennzeichen eines guten Jahrgangs –, »war gerade ihre Bereitschaft, auf die übliche leichte Kost aus hübschen Füßchen und noch hübscheren Kleidchen zu verzichten und stattdessen das Zusammenspiel von Musik und Bewegung zu erkunden. Das Ergebnis war vielleicht nicht so unmittelbar ansprechend, aber es erhob das Ballett zu einer Kunstform.«
»Die Wahl von Tschaikowskis Musik war der erste in einer Litanei von Fehlern«, stöhnt Lytton. »Umso unverständlicher, wenn man an die Komponisten denkt, mit denen Djagilew schon zusammengearbeitet hat. Es war kaum mehr als ein Cocktail schmalziger Melodien.« Er verzieht das Gesicht, als ob die Erinnerung ihn schmerzt. »Ich habe ernsthaft befürchtet, mich übergeben zu müssen.«
Clive nickt. »Angeblich hat Strawinsky es überarbeitet, aber es ist schwer zu erkennen, wo.«
»Das Bühnenbild und die Kostüme waren großartig«, ruft ihnen Duncan in Erinnerung. Er kramt in der Innentasche seiner Jacke, die mit Farbe bespritzt ist, obwohl er sie statt des Kittels angezogen hat, ehe er sich zu Fuß von seinem nahegelegenen Atelier auf den Weg zu seinen Freunden machte, und zieht einen Notizblock und einen Bleistift hervor. »Man munkelt, die Bühnenarbeiter und die Näherinnen hätten am Ende sechzehn Stunden am Tag gearbeitet, damit alles für die Premiere fertig wurde. Sogar die Kleider der Hofdamen sind handbestickt, und diese Dekoration an der Jacke des Prinzen« – er schlägt seinen Notizblock auf und beginnt ein verschlungenes Muster aus Eichenlaub zu zeichnen – »muss mit Goldfaden genäht sein.«
»Sind die Vorstellungen gut besucht?«, fragt Maynard. Im Gegensatz zu Lyttons Stimme, die manche boshafterweise mit einem Quäken vergleichen, ist seine volltönend und melodisch. »Es muss doch einen Haufen Geld gekostet haben, so eine Produktion auf die Beine zu stellen.«
»Typisch, dass du gleich wieder daran denkst!« Clive kichert, während er das Etikett der leeren Weinflasche studiert und sich fragt, ob die anderen ihn für allzu extravagant halten würden, wenn er noch eine entkorkte.
Maynard lässt die Bemerkung unkommentiert. Nicht wegen Clives ablehnender Haltung gegenüber seiner Karriere als Wirtschaftswissenschaftler – einer Karriere, die in den Augen seiner Freunde allzu viele zusätzliche Verpflichtungen mit sich bringt, von denen sie einige, wie etwa seinen Posten als Schatzmeister des King’s College in Cambridge, als unangemessen und irgendwie erniedrigend für einen der ihren betrachten. Er schweigt, weil diese Karriere zu einem unerfreulichen, zumeist unausgesprochenen Konkurrenzdenken in Gelddingen geführt hat. Während Clive Anteile an den Kohlebergwerken der Familie Bell besitzt, bedeutet sein aufwendiger Bonvivant-Lebensstil in Kombination mit einer eher beiläufig verfolgten Karriere als Schriftsteller, dass sein Einkommen nur selten seinen Vorstellungen entspricht.
Maynard dagegen hat sein Vermögen stetig vermehrt. Neben seinem Universitätsgehalt, den Einkünften aus Buchpublikationen und journalistischen Arbeiten sowie Vergütungen für diverse Vorstands- und Aufsichtsratsposten hat er in großem Umfang Investitionen getätigt, mit denen er erhebliche Gewinne erzielt hat – trotz gewisser Rückschläge, vor allem im Frühjahr 1920, als eine katastrophale Entscheidung, Dollar zu kaufen, ihn vorübergehend an den Rand des Ruins brachte. Seinen Erfolg als Anleger verdankt er zum Teil seinem enzyklopädischen Wissen, zum Teil seiner – angesichts seines konventionellen Auftretens mit Anzug und Krawatte vielleicht überraschenden – Leidenschaft für das Glücksspiel, aber auch seiner rational begründeten, festen Überzeugung, dass Geld nicht untätig bleiben sollte.
Diese Ansicht hat er erstmals in seinen Jahren als Beamter im Londoner India Office formuliert, wo er unmittelbar nach seinem Abschluss an der Universität von Cambridge eine Anstellung fand. Hier gelangte er bald zu der Überzeugung, dass Indien sich schneller entwickeln würde, wenn man die Bevölkerung davon überzeugen könnte, ihre gesparten Rupien lieber zu investieren, statt sie zu horten. Und diese Haltung bestimmt nach wie vor nicht nur seine wirtschaftlichen Prinzipien und seine politische Ausrichtung, sondern auch seinen eigenen Lebensstil. Tatsächlich ist sein Einkommen zu diesem Zeitpunkt – wir schreiben Dezember 1921 – so beträchtlich, dass er schon eine beneidenswerte Sammlung nicht nur von Büchern, sondern auch von modernen französischen Gemälden zusammengekauft hat, darunter Werke von Seurat, Picasso, Matisse, Renoir und Cézanne. Und so ist es sowohl Feingefühl gegenüber Clive als auch der Wunsch, seine Freunde nicht mit einer neuerlichen Verteidigung seiner Karriere vor den Kopf zu stoßen, was ihn dazu bewegt, auf eine Retourkutsche zu verzichten.
»Es wird Djagilew und allen, die mit den Ballets Russes zu tun haben, schweren Schaden zufügen, wenn sie das Geld nicht wieder einspielen können. Ich habe gehört, dass Oswald Stoll ihnen zuerst zehntausend Pfund vorgeschossen hat und dann noch einmal zwanzigtausend, also müssen sie auf einen guten Vorverkauf zählen.«
»Die Vorstellungen waren miserabel besucht.« Clive pflichtet Maynard so prompt bei, als ob er dessen Gedanken gelesen hätte und ihm dankbar sei.
»Das Theater war zu drei viertel leer«, bestätigt Duncan, dessen eigene triste finanzielle Situation Maynard routinemäßig in Form von Zuwendungen und Aufträgen für Gemälde aufbessert.
Lytton stützt die Ellbogen auf den Tisch und legt die langen Finger aneinander. Auch er hat von Maynards Geldsegen profitiert, und obwohl der Verkaufserfolg seiner satirischen Biografie Eminent Victorians diese Unterstützung seit Kurzem überflüssig macht, ist das Bewusstsein der eingegangenen Verpflichtung noch so frisch, dass ein unangenehmes Gefühl der Unterlegenheit zurückbleibt. Er räuspert sich. »Sollten wir etwa annehmen, dass das britische Publikum mehr kritischen Verstand hat, als wir ihm zutrauen?«, fragt er und lenkt die Unterhaltung damit in eine andere Richtung.
»Wohl kaum«, entgegnet Clive. »Es war das Debakel bei der Premiere. Alles, was schiefgehen konnte, ging schief. Es war ein gefundenes Fressen für die Presse.«
»Es muss urkomisch gewesen sein«, wirft Duncan ein. Er zeichnet immer noch, allerdings sind es nun nicht mehr Eichenblätter, sondern die rußverschmierten Fassaden auf der anderen Seite des Platzes, die man durch die Silhouetten der kahlen Bäume im Park ausmachen kann. »Besonders, als die Fliederfee das Schloss verzauberte und die Kletterpflanzen, die an den Mauern emporwachsen sollten, stecken blieben, sodass die Tänzerin – es war Lydia Lopokova – vergeblich mit ihrem Zauberstab herumfuchtelte.«
Maynard, dessen Sinn für Humor von Duncans Schilderung geweckt wird, lacht. »Das hätte ich gerne gesehen.«
»Du könntest heute Abend hingehen«, sagt Clive. »Aber diese technischen Probleme haben sie wohl schnell behoben. Als ich da war, hat zumindest die Bühnentechnik reibungslos funktioniert.«
Maynard, der ungeduldig auf den Nachtisch wartet, nimmt sein mit Bratensoße verschmiertes Messer und leckt es ab. Lytton und Clive wechseln Blicke. Die ungehobelten Tischmanieren ihres Freundes sind schon länger eine Quelle für boshaften Klatsch, wann immer einer von ihnen über etwas verstimmt ist, was Maynard gesagt oder getan hat. Besonders akut war das während Maynards Affäre mit Duncan, die Lyttons eigener langer Liebesbeziehung mit seinem Cousin ein Ende setzte, ohne dass sie seine Eifersucht im Geringsten gemildert hätte.
Clive, der vielleicht Maynards Feinfühligkeit ihm gegenüber erspürt hat oder der einfach nur Lyttons Erbitterung keine Nahrung geben will, fügt beinahe freundlich hinzu: »Du müsstest nicht einmal früher gehen. Du bekommst sicher noch eine Karte an der Abendkasse.«
Maynard legt sein Messer wieder auf den Teller und schüttelt den Kopf. »Ich habe mir geschworen, auf alle Vergnügungen zu verzichten, bis mein Buch fertig ist. Und das ist es beinahe. Außerdem scheint es mir ziemlich sinnlos, wenn die Inszenierung so schlecht ist, wie ihr sagt. Ich fand immer schon, dass Lydia Lopokova eine miserable Tänzerin ist. Sie hat so einen steifen Hintern.«
»In Die übermütigen Frauen hat sie dir immerhin so gut gefallen, dass du sie in ihrer Garderobe besucht hast«, zieht Duncan ihn auf. »Ich glaube mich zu erinnern, dass sie dich aufgefordert hat, sie in die Waden zu kneifen, um dich von ihren kräftigen Muskeln zu überzeugen.«
Maynard grinst, als er sich das Bild der lebhaften, unleugbar hübschen Ballerina vor Augen ruft, noch mit der Bühnenschminke im Gesicht, wie sie ihr Bein ausstreckte, um zu demonstrieren, dass ihre Darbietung nichts mit Zauberei zu tun hatte, sondern allein mit ihrer exzellenten Kondition, und wie sie dabei ihrem Kanarienvogel, den sie liebevoll mit »Pimp« anredete, durch die Gitterstäbe seines Käfigs Leckerbissen zusteckte. Aber am meisten ist ihm in Erinnerung geblieben, dass sie fast ohne Unterlass redete, wobei sie abwechselnd über ihren Tanzpartner schimpfte (den sie für inkompetent und zu kurz geraten hielt) und über ihre eigene Choreografie, von der sie behauptete, es sei so, als müsse man meilenweit in Kartoffelsäcken laufen. Irgendetwas an der schelmischen Art und Weise, wie sie während dieser Tirade die Augenbrauen hochzog (immer noch blau angemalt, obwohl sie ihr Kostüm schon abgelegt hatte), ließ ihn vermuten, dass es ihre Absicht war, die Menschen zum Lachen zu bringen. Auch ihre Art zu reden hatte ihn beeindruckt, mit ihrer russischen Sprachmelodie und der gelegentlichen unerwarteten oder gar falschen Wortwahl, die dem, was sie sagte, eine merkwürdige Eloquenz verlieh und ihn an Shakespeares spöttische und scharfsinnige Narren erinnerte. Es fiel ihm schwer, seinen Eindruck des Balletts, das ihm von seinem Platz im Zuschauerraum aus wie eine magische, in sich abgeschlossene Welt vorgekommen war, in Einklang zu bringen mit dieser zierlichen, eleganten, schalkhaften Frau in ihrem schmuddeligen Kimono, die auf einen Topf mit blubbernder Milch blies und Tassen mit heißer Schokolade verteilte.
»Ich werde hingehen«, lenkt er ein. »Vor Weihnachten noch.«
Die Köchin, ihr Gesicht von der Ofenhitze und dem Treppensteigen gerötet, stellt einen Apfelkuchen und einen Krug Vanillesauce auf den Tisch.
Obwohl seine Freunde ihn schon darauf vorbereitet haben, ist Maynard doch überrascht, wie leer der Zuschauerraum des Alhambra ist. Da sind die üblichen Ballettomanen in der ersten Reihe, mit ihren Blumensträußen aus dem Treibhaus, die sie beim Schlussapplaus den besten Tänzerinnen zuwerfen werden. In den Logen zu beiden Seiten der Bühne sitzen Männer im Abendanzug, für die diese Vorstellung ein netter Auftakt zu einem späten Dinner ist. Ihre Begleiterinnen sind noch in ihre Pelze gehüllt, da die funkelnden Lichter im Zuschauerraum nur wenig gegen die Kühle im Saal ausrichten können. Die übrigen Plätze sind nur spärlich besetzt – hier und da ein Paar oder eine Familie, die das Ballett den ausverkauften Weihnachtsrevuen in den Londoner Theatern vorgezogen haben, und eine Gruppe junger Männer, die frech von ihren hinteren Plätzen nach vorne gehen, sobald klar ist, dass keine weiteren Zuschauer kommen werden. Aus ihren schäbigen Kleidern schließt er, dass es sich um Kunststudenten handelt, vielleicht von der Royal Academy of Arts an der Piccadilly, wo Clives Frau Vanessa, die jetzt hoffnungslos in Duncan verliebt ist, bei John Singer Sargent Malerei studiert hat. Er beobachtet die Männer, während er vorgibt, in sein Programmheft vertieft zu sein, und als ein Zwanzigjähriger mit dunklen Haaren und breitem, sympathischem Gesicht neben ihm Platz nimmt, fühlt er sich angenehm an seinen derzeitigen Geliebten Sebastian erinnert.
Sein momentanes Bedauern über Sebastians Abwesenheit weicht bald der Vorfreude darauf, Weihnachten mit ihm zu verbringen, in dem Haus in Berkshire, das Lytton zusammen mit seiner Freundin, der Malerin Dora Carrington, und ihrem frischgebackenen Ehemann Ralph (in den Lytton, wie Maynard vermutet, verliebt ist) gemietet hat. Im Übrigen ist Maynard selbst dafür verantwortlich, dass Sebastian heute nicht bei ihm ist, denn er ist nach dem Ende seiner Lehrveranstaltungen in Cambridge nach London gefahren, um sein Buch fertigzustellen – ein Vorhaben, das er just an diesem Nachmittag in die Tat umgesetzt hat. Er wird es noch einmal durchlesen müssen, ehe er es zum Abtippen schickt, und die eine oder andere Passage würde zweifellos von einer gründlicheren Ausarbeitung profitieren, aber im Großen und Ganzen ist er mit seiner Arbeit zufrieden.
Sein Ziel war es, sich mit der Kritik auseinanderzusetzen, die an seinem ersten Buch, Die wirtschaftlichen Folgen des Vertrags von Versailles, geübt wurde. Darin hatte er dargelegt, warum die Friedensverhandlungen nach dem Ende des Kriegs in seinen Augen ein Debakel waren. Er hat die Delegation des britischen Finanzministeriums bei der Konferenz in Paris 1919 geleitet und war über das Ergebnis entsetzt – nicht nur, weil es gegen die Vereinbarungen verstieß, die während des Waffenstillstands ausgehandelt worden waren, sondern weil Deutschland Reparationszahlungen abverlangt wurden, die es unmöglich leisten konnte. In Maynards Augen förderte dieses Abkommen keineswegs ein harmonisches Verhältnis zwischen den Nationen, sondern schuf im Gegenteil Bedingungen, die einen zweiten Krieg in Europa geradezu unvermeidlich machten. Was sein erstes Buch zu einem solchen Erfolg werden ließ – mit über hunderttausend verkauften Exemplaren in zwölf Sprachen –, waren die Portraits, die er darin von den häufig arroganten und gefährlich naiven Unterhändlern zeichnete, darunter auch Premierminister und Präsidenten. Nichts, was er in den knapp drei Jahren seither erlebt hat, gibt ihm irgendeinen Anlass, seine Schlussfolgerung zu revidieren.
Um seine Gedanken von dem Buch abzulenken, studiert er das Programm, und sein Blick bleibt am Namen von Lydia Lopokova hängen, die heute Abend tanzt. Das Bild von ihr in ihrer Garderobe, das er beim Mittagessen heraufbeschworen hat, steht ihm wieder vor Augen, und dazu kommt die Erinnerung an eine Party, die er und Clive in ihrem Haus am Gordon Square in Bloomsbury gegeben haben, und zu der auch sie eingeladen war. Er entsinnt sich, wie verärgert er war, weil Clive mit Lydia flirtete, zumal, da Clive darauf bestand, Französisch zu sprechen, eine Sprache, in der er selbst nicht mithalten kann.
War es nach dieser Party, überlegt er, dass er ihr ein Exemplar seines Buchs geschickt hat? Zur Antwort erhielt er eine Karte mit ein paar Zeilen in ihrer ausladenden Handschrift. Sie bedankte sich für sein Geschenk mit einer Förmlichkeit, die man für schwülstig hätte halten können, wären da nicht ihre Orthografiefehler und die faszinierenden Absonderlichkeiten ihrer Ausdrucksweise gewesen. Danach verschwand sie, mitten in der laufenden Produktion, was Djagilew und die Truppe zweifellos ein Vermögen kostete, und es gab Gerüchte, wonach sie mit einem General der russischen Weißen Armee durchgebrannt sei – eine Geschichte, die in seinen Augen zu romantisch war, um glaubwürdig zu sein. Eine viel plausiblere Erklärung ist seiner Ansicht nach, dass sie schwanger war und sich zurückgezogen hat, um das Kind zu bekommen. In diesem Fall ist es allerdings verwunderlich, dass in den Zeitungen, die wochenlang immer wieder Artikel über sie gebracht haben, kein Wort davon zu lesen war.
Die Ouvertüre hat begonnen, und als der Vorhang sich hebt, stellt Maynard erfreut fest, dass das Bühnenbild – es zeigt das Innere eines Königspalasts mit Dutzenden prächtig gekleideter Gäste – wirklich so beeindruckend ist, wie Duncan es geschildert hat. Wenn er heute Abend hierhergekommen ist, um selbst beurteilen zu können, ob diese neueste Produktion der Ballets Russes wirklich so enttäuschend rückschrittlich ist, wie Clive und Lytton behaupten, so ist jeder Gedanke daran rasch vergessen, als ihn die Geschichte von Prinzessin Auroras Taufe – sie ist ihm von den Märchenspielen vertraut, die er als Kind mit seinem Vater gesehen hat – in ihren Bann zieht. Als die bei der Einladung übergangene Fee Carabosse auftritt, mit ihrem haarigen Gesicht, den skelettdürren Fingern und dem langen blutroten Gewand, erinnert er sich an das wohlige Gruseln, das er als kleiner Junge empfunden hat.
Und jetzt ist es Lydia selbst, die als Fliederfee auftritt, und er sieht entzückt zu, wie sie die rachsüchtige Carabosse verbannt und deren Fluch über die kleine Aurora in einen milderen Zauber umwandelt. Ihre Leidenschaft reißt ihn mit, und so ist er, als sie über die Bühne wirbelt, nicht nur von der Wahrheit dieser Fantasiewelt überzeugt, in der sie sich bewegt – er ist auch bereit zu glauben, dass ihr kühnes Umwandeln des Fluchs den Triumph des Guten über das Böse repräsentiert.
Wenn er Lydia je für eine miserable Tänzerin gehalten hat, so muss er dieses Urteil nun revidieren. Er hat sagen hören, es mangele ihr an der technischen Perfektion ihrer Mit-Solistin Tamara Karsawina, aber seiner Ansicht nach macht sie das durch ihr schauspielerisches Talent mehr als wett. Sie vermittelt den Eindruck, dass sie das alles zum ersten Mal erlebt. Ihre Bewegungen wirken so vollkommen spontan, dass man gar nicht glauben mag, wie viele anstrengende Proben dem vorangegangen sind oder dass das Stück heute nicht zum ersten Mal aufgeführt wird. Es ist eine Fähigkeit, die er bewundert, wie er auch ihre Konversation bei der Party bewundert hat, nachdem Mary, Clives Geliebte, in einem Anfall von Eifersucht Clive von ihr weggezerrt hatte und er mit ihr allein sprechen konnte. Er fand es beeindruckend, dass sie seine Fragen nicht in der gelangweilten, mechanischen Manier beantwortete, die man hätte erwarten können – so oft, wie sie vermutlich mit derartigen Banalitäten traktiert wird –, sondern so, als ob das, wonach er fragte, interessant und neu sei.
Im Nachhinein scheint es klar, dass sein Entschluss, Lydia in ihrer Garderobe aufzusuchen, um ihr zu gratulieren, in dem Moment gefasst wurde, als sie die Bühne betrat, aber bewusst gesteht er es sich erst ein, als der Prinz die schlafende Prinzessin mit einem Kuss weckt. Trotz des enthusiastischen Beifalls der Kunststudenten, trotz der Blumen, die auf die Bühne geworfen werden, und der Bravorufe der Ballettomanen, scheint ihm der Applaus, als der Vorhang fällt und die Tänzerinnen sich verbeugen, zu spärlich für Lydias außergewöhnliche Darbietung.
Als die Lichter im Zuschauerraum angehen und sich das Theater leert, macht er sich auf den Weg zu ihrer Garderobe.
Er ist ungewöhnlich nervös, als er sich ihrer Tür nähert. Es liegt nicht daran, dass er sich nicht sicher wäre, was für ein Empfang ihn erwartet – er ist ihr ja nicht mehr gänzlich unbekannt, und an einem Höflichkeitsbesuch in ihrer Garderobe wird sie sicher nichts auszusetzen haben. Nein, es liegt an den Emotionen, die das Ballett in ihm aufgewühlt hat. Seine neue Wertschätzung für Lydia, die er nun als außergewöhnlich talentierte Künstlerin erkannt hat, lässt sein Herz rasen und seine Hände schwitzen. Er ist so selten nervös, dass die ungewohnten Empfindungen eine seltsam berauschende Wirkung haben.
Als er in der offenen Tür verharrt, kann er Lydia im ersten Moment gar nicht sehen. In ihrer Garderobe wimmelt es von Gratulanten, die hinter die Bühne geeilt sind, um einen Blick auf die berühmte Ballerina zu erhaschen. Er hält die Stellung, bis er sie schließlich durch eine Lücke zwischen den Leibern erspäht. Sie sitzt auf einem Hocker, bekleidet mit dem gleichen schmuddeligen Kimono, den er vom letzten Mal in Erinnerung hat. Ihr Haar ist zu einem Knoten hochgebunden, und sie hat noch die Bühnenschminke im Gesicht – die übertriebene Schattierung um ihre Augen verleiht ihrem ansonsten symmetrischen Gesicht ein merkwürdig windschiefes Aussehen, mit komischem Effekt.
Lydia selbst scheint sich nicht um ihr Aussehen zu scheren. Als er sie anschaut, wie sie lacht und ihren Verehrern die Hände zum Kuss hinhält, erinnert er sich erneut mit Widerwillen daran, wie Clive sie bei der Party mit Beschlag belegt hat. Seine Gefühle, als nun eine Schar von Ballettomanen sie umdrängt, sind ganz ähnlicher Natur, und das würde er vielleicht bedenklich finden, wäre er nicht so zufrieden in seiner Beziehung mit Sebastian, und wäre da nicht die Tatsache, dass er noch nie eine Frau körperlich begehrt hat. Stattdessen schreibt er seine Empfindung der Verärgerung darüber zu, dass diejenigen, die da um Lydias Aufmerksamkeit buhlen, es nur tun, um hinterher damit angeben zu können.
Sein Motiv dagegen ist … was? Obwohl es tausend Fragen gibt, die er ihr gerne stellen würde, kann er kaum behaupten, irgendwelche zwingenderen Gründe zu haben – anders als vielleicht Clive mit seinem Artikel über das Ballett, oder Duncan mit seinem Malerverstand. Und er kann auch nicht behaupten, dass er eng mit den russischen Emigranten in London verbunden wäre, anders als etwa Clives Schwägerin Virginia, die Frau seines guten Freundes Leonard, die Werke von russischen Schriftstellern ins Englische übersetzt. Nein, er ist hier, weil ihn Lydias Auftritt an diesem Abend berührt hat und weil die wenigen, allzu kurzen Begegnungen, die er in der Vergangenheit mit ihr hatte, ihn neugierig gemacht und in ihm den Wunsch erweckt haben, sie näher kennenzulernen.
Hinter ihm auf dem Gang gibt es einen Aufruhr, und für einen Moment glaubt er die Stimme von Lady Ottoline Morrell zu hören, die als Kunstmäzenin bekannt ist und die Ballets Russes während ihrer Londoner Spielzeiten tatkräftig unterstützt hat. Die Person dreht ihm den Rücken zu, und obwohl sie mit kräftiger Stimme redet, kann er sie bei dem Lärm in der Garderobe nicht mit Sicherheit identifizieren. Falls es Ottoline ist, wird er auf eine andere Gelegenheit für ein vertrauliches Gespräch mit Lydia warten müssen.
Er zieht einen Stift und einen Zettel aus der Tasche und benutzt die Wand als Unterlage, um zu schreiben: »Leisten Sie mir doch bitte beim Dinner imSavoyGesellschaft, wenn es Ihnen möglich ist – Maynard.« Er hält ein Dienstmädchen an, das gerade vorbeikommt, und nimmt ihr gegen ein üppiges Trinkgeld das Versprechen ab, seine Botschaft zu überbringen. Dann wartet er, während das Mädchen sich seinen Weg durch das Gedränge zu Lydia bahnt.
Sie liest die Nachricht, blickt sich suchend um, und als sie ihn erspäht, lächelt sie.
Wie ungezwungen Lydia doch mit den Leuten plaudert, stellt Maynard fest, während er beobachtet, wie sie auf den Ober im Savoy einredet, der ihr den Mantel abnimmt. Er studiert ihre kompakte Statur und ihre anmutigen Bewegungen, als sie zwischen den voll besetzten Tischen hindurch zu ihm geführt wird. Was ihn anzieht, ist ihr erfrischender, beinahe kindlicher Eifer, kombiniert mit einer selbstsicheren Körperlichkeit, erworben durch viele Jahre des Tanzens. Die erstgenannte Eigenschaft erinnert ihn an Duncan, in den er immer noch vernarrt ist, obwohl ihre Affäre längst vorbei ist, während er von der zweiten selbst gerne mehr hätte. Obwohl er kein Problem damit hat, vor Publikum zu sprechen, und bei Bedarf jeden Kontrahenten in Grund und Boden argumentieren kann, war es ihm immer schon unangenehm, angeschaut zu werden. Ja, er hatte schon öfter den Eindruck – etwa bei Sitzungen an seinem College, wo die versammelten Geistesgrößen in der Lage sind, stundenlang zu debattieren –, dass er mit seinem Standpunkt vielleicht eher durchgedrungen wäre, wenn er ein attraktiverer Mann wäre.
Als er aufsteht, um Lydia zu begrüßen, stellt er befriedigt fest, dass etliche Gäste ihre Gespräche unterbrechen, um zu spekulieren, ob die Frau, die er küsst, die gefeierte russische Ballerina sein könnte.
Der Ober bemüht sich eifrig und länger als nötig um Lydia, rückt ihren Stuhl zurecht, klappt ihre Speisekarte auf, schüttelt die gefaltete weiße Serviette auf und legt sie ihr über die Knie. Maynard fällt auf, mit welcher Natürlichkeit Lydia diese Aufmerksamkeiten über sich ergehen lässt, als sei es ihre Pflicht, sich darüber zu freuen. Er vergleicht dies mit seiner eigenen unbeholfenen und zweifellos herablassenden Reaktion und kommt zu dem Schluss, dass sie recht hat: Es ist besser zu zeigen, dass man die erbrachten Dienstleistungen zu schätzen weiß, als so zu tun, als bemerke man sie nicht oder als wären sie unwichtig.
Er beobachtet sie, als sie ihre Handtasche auf dem Boden abstellt, und wundert sich, dass dieser Körper, der ihm in diesem Moment ganz und gar gewöhnlich vorkommt und der gerade mit einer alltäglichen Handlung beschäftigt ist, die er selbst hätte ausführen können, noch vor kurzer Zeit in solcher Vollendung tanzen konnte. Er wüsste gerne, wie sie es fertigbringt, so hoch zu springen oder auf den Zehenspitzen zu laufen, doch er verkneift sich die Frage – nicht aus Verlegenheit (eine der Eigenschaften, die er an Lydia bemerkt hat, ist, dass sie nie verlegen ist), sondern weil er fürchtet, dass er ihre Antworten nicht verstehen wird. Das ist jedenfalls seine Erfahrung, wann immer Duncan oder Vanessa über Malerei diskutieren. Ganz gleich, wie genau sie ihm einen bestimmten Effekt erklären, er hat danach jedes Mal das Gefühl, dass er selbst es genauso wenig hinbekommen könnte, wie er auf den Händen gehen könnte.
Nachdem sie ihre Tasche sicher unter ihrem Stuhl verstaut hat, stützt Lydia die Ellbogen auf den Tisch und das Kinn in die Hände. Sie hat die Haare straff zurückgekämmt und im Nacken zum Knoten gebunden, was ihre breite Stirn und ihre auffallend blauen, lebhaften Augen betont. Ihre Nase, die er, von vorne betrachtet, als ebenso makellos geformt bezeichnen würde wie die der Statuen, die er und Duncan bei ihrem Urlaub in Griechenland bewundert haben, wirkt, wie er nun erkennt, von der Seite gesehen, dramatisch verändert. Im Profil ist ihre Nasenspitze leicht nach oben gebogen, sodass er sich, wenn sie den Kopf dreht, an jene Daumenkinos erinnert fühlt, die er als Kind so geliebt hat und mit denen er, indem er die Zeichnungen ganz schnell durchblätterte, ein Ei in einen Vogel oder einen Mann in eine Frau verwandeln konnte. In Lydias Fall, sinniert er (in Gedanken immer noch beim griechischen Altertum), kippt das Bild zwischen Helena, deren legendäre Schönheit sie verletzlich machte, und einer robusten, schelmischen Elfe. Während beide Gestalten ihren Reiz für ihn haben, ist ihre Kombination einfach unwiderstehlich.
»Möchten Sie bestellen? Es ist natürlich schon spät, und vielleicht haben Sie gar keinen Hunger mehr.«
»Im Gegenteil«, erklärt Lydia, während sie die Karte studiert. »Ich habe Hunger wie Wolf. Wenn ich tanze, wird alles Essen in meinen Eingeweiden aufgewühlt, so danach ich bin ganz hohl. Ich hätte gerne zwei von diesen« – sie deutet auf das Sirloin-Steak –, »aber nicht bleu, wie Franzosen kochen, dass es auf Teller blutet, als ob es noch zu Kuh gehört. Das ist nicht schön zu sehen, wenn man es sich einverleiben will. Ich habe mein Fleisch gerne wie weiches Leder. Oh«, fügt sie hinzu, als ihr Blick zum Ende der Seite springt, wo die Desserts aufgeführt sind, »und Chester Pudding. Das ist sicher genau wie Lemon Meringue Pie, die ich in Amerika gegessen habe, aber Name klingt interessanter.« Sie runzelt die Stirn, als überlege sie, ob ihr Eindruck korrekt ist. Dann gibt sie es auf, das Rätsel lösen zu wollen, und strahlt Maynard an, als ob sie die Gerichte erfunden und nicht bloß ausgesucht hätte.
Wie schon bei ihren früheren Begegnungen fällt ihm ihr unkonventionelles Englisch auf. In ihrer Aussprache scheint das Russische durch – oder das, was er dafür hält, denn er hat der Sprache bisher keine große Beachtung geschenkt. So lässt sie oft den letzten Konsonanten eines Worts aus, sodass sein eigener Name zu »Maynar’« verkürzt wird, oder sie spricht ein »V« statt eines »W« und umgekehrt. All das hätte er aufgrund seiner begrenzten Erfahrung mit russischen Gesprächspartnern, etwa bei Spendengalas für die vor dem Bürgerkrieg geflohenen Emigranten, erwarten können. Was ihn eher verblüfft und amüsiert, ist, dass ihr Englisch mit Wörtern und Wendungen gespickt ist, die – obwohl in den meisten Fällen klar ist, was sie sagen will – ein Engländer so nicht verwenden würde. Sie erinnern ihn an die Wortspiele, die er zu Hause in Cambridge nach dem Sonntagslunch mit seiner Familie gespielt hat oder mit seinen Schulkameraden in Eton, und bei denen er immer besonders geglänzt hat. Er fragt sich, was seine schriftstellernden Freunde von Lydias sprachlichen Idiosynkrasien halten würden. Er vermutet, dass sie manche davon durchaus korrigieren könnte, wenn sie wollte. Für seine Ohren haben sie einen exotischen, geradezu lyrischen Klang.
Ihre Angewohnheit, alles auszusprechen, was ihr in den Sinn kommt, fasziniert ihn ebenfalls – als ob er ein enger Freund wäre und sie sich ihm anvertraute. Von seinen Freunden am Gordon Square, wo Freizügigkeit zur Norm geworden ist, ist er offene Gespräche gewohnt. Allerdings hat er manchmal den Eindruck, dass dort der Effekt einer Bemerkung auf den Gesprächspartner höher geschätzt wird als das Bedürfnis, einem Gedanken Ausdruck zu verleihen. Was zur Folge hat, dass Diskussionen, wenn man ihnen freien Lauf lässt, durch den Zwang zu schockieren aus der Bahn geraten können und dadurch paradoxerweise vorhersehbar werden.
Lydia ist anders, nicht etwa, weil sie fürchtet, gegen die guten Sitten zu verstoßen (er schätzt, dass sie durchaus ihren Spaß an einem Skandal haben kann), sondern weil sie spontan und ohne Vorbedacht äußert, was ihr in den Sinn kommt. Dass er häufig keine Ahnung hat, was sie als Nächstes sagen wird, erheitert ihn.
Der Ober tritt an ihren Tisch, um die Bestellung aufzunehmen. Maynard ist ein bisschen enttäuscht, dass der Mann offenbar zu gut geschult ist, um sich über ihren gewaltigen Appetit erstaunt zu zeigen. Er hätte es vorgezogen, wenn er wenigstens die Augenbrauen hochgezogen hätte angesichts ihres Wunsches nach zwei Sirloin-Steaks, gefolgt von einem Dessert.
»Sind Sie in Sankt Petersburg zur Schule gegangen?«, will er wissen.
»Auf Kaiserliche Ballettschule, mit meiner Schwester und meinem Bruder«, erklärt sie mit unüberhörbarem Stolz. »Um hervorragende Tänzerin zu werden, muss man sehr jung anfangen, mit Unterricht jeden Tag. Deshalb haben wir in Schule geschlafen, obwohl unser Haus war ganz nahe. Hat uns nichts ausgemacht«, fährt sie fort, wie um seiner besorgten Nachfrage zuvorzukommen, »weil Zar für Ballett schwärmte und uns gut behandelte.«
Sie spricht vom Zaren fast so, als ob er noch lebt, denkt er, aber ehe er etwas dazu sagen oder spekulieren kann, wer wohl dem schwer erkrankten Lenin nachfolgen wird, hat sie schon von sich aus das Thema gewechselt.
»Mädchen und Jungen waren in gleichem Gebäude untergebracht, aber es war so konstruiert, dass wir uns nicht mischen. Sogar wenn wir zusammen getanzt haben, durften wir uns nur berühren, wenn Schritte es verlangt haben, und nie mit Augen. Ich habe nicht gehorcht, weil wir Mädchen hatten noch nicht Gebärmütter, um schwanger zu werden, und die Jungen hatten noch nicht Gehänge. Einige ältere Mädchen waren schon erfahren in Sex. Im Kaiserlichen Theater gab es spezielle Gänge, damit wir direkt in Logen von Großherzögen gehen konnten.«
Er könnte nicht faszinierter sein, wenn sie von einem der merkwürdigen Nebel gekommen wäre, die Edwin Hubble angeblich mit seinem Teleskop beobachtet hat und die die Existenz von Galaxien außerhalb unserer eigenen zu bestätigen scheinen. Es ist ein Gefühl, das er von ihren früheren Begegnungen kennt: Lydia stürzt sich so schnell auf ein neues Gebiet, dass er es unmöglich vorhersehen kann und sein Verstand (der normalerweise jedem Gesprächspartner mehrere Schritte voraus ist) sich abhetzen muss, um sie einzuholen.
Sie bricht das Brötchen auf ihrem Beilagenteller in zwei Teile, spießt mit dem Messer eine Portion Butter auf und klemmt sie zwischen die zwei Hälften. Die Butterportionen haben die Form von vierblättrigen Kleeblättern.
»In meiner Schule gab es keine Mädchen«, fühlt er sich ermutigt zu sagen.
Lydia leckt sich Krümel und Butter von den Fingern. »Dann muss es viele Affären Junge mit Junge gegeben haben.«
Wieder hat er das Gefühl, auf unerwartetes Terrain geraten zu sein. Er nimmt sich ein Brötchen und bestreicht es ebenfalls dick mit Butter.
»In Ihnen steckt ja noch Bauer drin!«, spöttelt sie, als er es ihr nachmacht und sich auch die Finger ableckt.
Nicht alle Haare sind aus Lydias Gesicht zurückgekämmt. Über jedem Ohr ist eine Stelle kurz geschnitten, und die struppigen Büschel wirken unordentlich im Kontrast zu ihrer gepflegten Gesamterscheinung. Er würde gerne die Hand über den Tisch ausstrecken und die Stoppeln berühren.
»Mein Großvater hat Dahlien gezüchtet.« Er beobachtet, wie sie verwirrt die Stirn in Falten zieht. »Gartenblumen«, erläutert er. »Das erwies sich als äußerst lukrativ. Er verdiente damit genug Geld, um meinem Vater eine Ausbildung finanzieren zu können.«
»Lopukow ist auf Russisch Name von Blume. In England ihr sagt Klette. Wurzeln sind essbar, und sie hat schlaue Methode, Samen zu verbreiten. Mein Großvater hat sie auf Feld ausgegraben, aber dann hat Zar die Leibeigenen befreit. Für meinen Großvater hat nicht viel geändert, aber er hat seinen Sohn zu Armee geschickt. Das war Schule von meinem Vater, auch wenn er da nie Lesen oder Schreiben gelernt hat.«
Der Ober bringt Lydias Steaks, übereinandergestapelt, damit auf dem Teller noch Platz für Kartoffeln, eine gegrillte Tomate und eine Portion Champignons bleibt, die sie, soweit er sich erinnern kann, gar nicht bestellt hat. Die Steaks sind an den Rändern braun, dennoch befürchtet er, sie könnten nicht so gebraten sein, wie Lydia es verlangt hat. Doch ehe er sie fragen kann, macht sie sich schon darüber her und kaut, als ob sie ihren Zubereitungswunsch vergessen hätte.
»Keynes ist englischer Name«, mutmaßt sie mit vollem Mund.
»Französisch. Der erste Keynes kam mit William dem Eroberer nach England, aber damals schrieb man den Namen noch anders. Er war wohl aus der Art geschlagen, denn nach ihm hat sich aus der Familie niemand mehr weit von zu Hause entfernt.«
»Pah, er musste doch nur Ärmelkanal überqueren!« Lydia breitet die Arme aus, wie um zu demonstrieren, dass sie, wenn es von ihr verlangt würde, eine so kurze Strecke auch schwimmen könnte. »Urgroßvater von meiner Mutter war Ingenieur und ist von Schottland nach Schweden gegangen. Sein Enkel hat sich in Lettland niedergelassen. Da ist meine Großmutter geboren, aber sie ist mit ihrem Mann nach Estland gegangen. Er war Bandit und ganz anders als meine Mutter, die betet und geht jeden Tag in Kirche.«
Bilder tauchen vor Maynards geistigem Auge auf, während Lydia redet – zuerst der schottische Ingenieur, der, wenn er richtig gerechnet hat, seine Heimat in der Folge der berüchtigten Highland Clearances verlassen haben dürfte; dann der mit Pistolen bewaffnete Räuber, den er sich in Tartan-Kilt und -Mütze vorstellt, wie eine Romanfigur von Walter Scott. Er will sie eben fragen, ob ihr Vater in der Armee geblieben ist, doch sie kommt ihm abermals zuvor.
»Mein Vater hat als Platzanweiser in Theater gearbeitet«, verrät sie ihm, während sie den letzten Bissen Steak hinunterschluckt und sich Champignons auf die Gabel lädt.
Er blickt sich im Restaurant um. Bildet er sich das nur ein, oder sind die anderen Gäste, die noch vor einer Stunde so langweilig und gesetzt wirkten wie eine Verlängerung der verzierten Säulen und überladenen Vorhänge des Speisesaals, seit Lydias Eintreffen wirklich lebhafter geworden?
»Ihre Mutter ist in Estland geboren?«
»In Reval, wo man Deutsch spricht. Sie spricht es immer noch lieber als Russisch.« Sie spießt ein letztes Stück Tomate auf und lässt dann ihr Besteck auf den Teller fallen.
»Als ich klein war, hatten wir deutsche Kinderfräulein«, erzählt er. »Es ist die einzige Sprache außer Englisch, Latein und Griechisch, in der ich einigermaßen beschlagen bin.«
Der Ober bringt die Nachspeise. Lydia stößt ihren Löffel durch die verwirbelte Baiserkruste. »Himmlisch«, verkündet sie, dann taucht sie den Löffel noch einmal hinein. »Probieren«, befiehlt sie und hält ihm die zuckrige Köstlichkeit hin.
Und ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, gehorcht er.
An einer Staffelei vor einem Fenster steht eine Frau und malt. Ihre hochgewachsene, schlanke Gestalt ist von einem dunkelblauen Malerkittel verhüllt, der um die Taille von einer gestreiften Männerkrawatte zusammengehalten wird. Ihr flachsblondes Haar trägt sie offen, doch damit es ihr nicht ins Gesicht fällt, hat sie sich ein Kopftuch umgebunden, das mit orangefarbenen, blauen und grauen Rechtecken gemustert ist. Es ist aus dem Rest eines Stoffs geschnitten, den sie selbst entworfen hat. Das Tuch betont ihren frischen English-Rose-Teint und ihre grüblerischen meergrauen Augen, die auf die Menschen, die sie kennen, so oft distanziert oder zerstreut wirken, die aber im Augenblick ganz in ihre Arbeit vertieft sind.
Der Blick, den sie auf die Leinwand überträgt, geht auf die Bucht von Saint-Tropez, wo sie über den Winter eine Villa gemietet hat, zusammen mit Duncan, den sie mehr als irgendeinen anderen Menschen liebt – mit Ausnahme ihrer zwei Jungen, Julian und Quentin, und ihrer Tochter Angelica. Denn es handelt sich um Vanessa, die Frau von Clive, mit dem sie eine erstaunlich einvernehmliche offene Ehe führt, die es ihm erlaubt, seine langjährige Beziehung mit Mary fortzuführen und zugleich einen bedeutenden Platz in ihrem und – was das Wichtigste ist – im Leben ihrer Kinder einzunehmen. Die Tatsache, dass nur die beiden älteren von ihm sind, während Angelica Duncans Tochter ist, ist ein Detail, in das vorläufig nicht einmal Angelica selbst eingeweiht ist. Jedenfalls misst sie ihm weniger Bedeutung bei, verglichen mit den heiklen Balanceakten und der harten Arbeit, die erforderlich sind, um dieses enge Beziehungsgeflecht intakt zu halten.
Sie legt den Pinsel ab und blickt über die Terrakotta-Dächer und die grünen Olivenhaine hinweg bis dorthin, wo das Meer, ein Streifen reinsten Azurblaus, in der Ferne schimmert.
Es ist typisch für Vanessa, dass sie sich für die Perspektive aus dem Zimmer heraus entschieden hat, sodass das Fenster – unterteilt von horizontalen Streben und gesäumt von bodenlangen weißen Vorhängen – ebenso in den Fokus ihres Bilds rückt wie das Panorama dahinter. Die Wirkung des Interieurs, das die Komposition rahmt, wird noch verstärkt durch einen kleinen Holztisch, auf den sie eine Vase mit Blumen gestellt hat. Die polierte Oberfläche des Tischchens reflektiert das Blau des Himmels, wenn auch nicht in den gleichen Proportionen wie auf ihrem Gemälde, wo der Himmel durch den oberen Rand der Leinwand begrenzt ist. Während diese Spiegelung eine effektive Methode darstellt, die unendliche Weite des Himmels zu suggerieren, ist es schon schwerer zu ergründen, warum sie die Tischbeine in voller Länge und dazu noch die Hälfte des daneben stehenden Rohrstuhls mit den rosa Polstern in das Bild einbezogen hat.
Als sie den Blick auf den mahagonifarbenen Fußboden senkt, auf dem das Tischchen steht, ist Vanessa sich bewusst, dass diese Kombination von Interieur und Exterieur so gut wie alle Betrachter ihres Gemäldes verwirren wird und dass sie das Ergebnis als allzu sehr mit der häuslichen Sphäre befasst abtun werden. Mancher wird vielleicht gar zu dem Schluss kommen, dass sie keine gute Malerin sein kann, weil es ihr an der Fähigkeit mangelt, sich ganz und gar auf ein Thema zu konzentrieren.
Im Gegensatz zu ihrer Schwester Virginia, die noch die Bücher schreiben muss, die ihr Genie unter Beweis stellen werden, und die in Vanessas Augen von einer bedenklichen Gier nach Anerkennung getrieben ist, fällt es Vanessa leicht, solche Überlegungen zu ignorieren. Das liegt nicht etwa daran, dass ihr – wie manche schon ungnädigerweise gemutmaßt haben – die Leidenschaft fehlt, die ihre Schwester befeuert. Sie hat den gleichen hohen Anspruch an ihre Kunst wie Virginia. Der Unterschied ist, dass sie wenig Interesse an den Geschehnissen in der Welt hat, sofern sie keine unmittelbaren Auswirkungen auf ihr Leben haben. Es ist ein Charakterzug, der bei ihr schon in jungen Jahren angelegt war, als der tägliche Spaziergang in den nahen Kensington Gardens mehr oder weniger die einzige Möglichkeit war, aus dem behüteten Elternhaus zu entfliehen, doch das unbegreifliche und entsetzliche Gemetzel der vier Kriegsjahre schien sie darin zu bestärken. Geblieben ist ihr Bedürfnis, alle, die ihr wichtig sind, stets in ihrer Nähe zu haben, auch wenn ihr das bisweilen eine beinahe übermenschliche Beherrschung ihrer Gefühle abverlangt.
Auf ihrer Palette mischt sie Elfenbein, helles Zitronengelb und Grau. Die Sonne lässt den Streifen Wand zwischen dem Fensterrahmen und dem Vorhang wärmer wirken – ein Effekt, den sie gerne hervorheben möchte. So kann sie ein Gegengewicht zu dem schweren Block des dunklen Fußbodens erzeugen, der – obwohl notwendig für die Komposition – den Blick von den Blumen auf dem Tisch und der Aussicht auf Dächer, Bäume und Meer abzuziehen droht. Sie schätzt, dass ihr noch eine oder allenfalls zwei Stunden bleiben, ehe die Kinder zum Mittagessen nach Hause kommen werden, hungrig nach einem Vormittag am Strand mit Grace, der jungen Frau, die Vanessa aus England mitgebracht hat und die sich als willige und fähige Helferin erwiesen hat.
Duncan ist mit seinem Skizzenblock zum Hafen gegangen, und obwohl sie weiß, dass sein Entschluss zum Teil von der Hoffnung motiviert war, einen jungen Mann wiederzusehen, mit dem er sich gestern unterhalten hat, ist sie nicht übermäßig beunruhigt. Es ist schon einige Jahre her, dass Duncan zuletzt eine Affäre hatte, die ernst genug war, um von ihr als Bedrohung empfunden zu werden, so wie damals, als er sich in Bunny Garnett verliebte und sie notgedrungen Bunny einladen musste, bei ihnen zu wohnen, weil sie sonst riskiert hätte, Duncan zu verlieren. Obwohl sie in ständiger Angst lebt, dass so etwas wieder passieren könnte, und obwohl sie zu realistisch ist, um auf eine Wiederholung jener Nacht zu hoffen, als Duncan zu ihr ins Bett kam und sie Angelica empfing, ist sie zufrieden, hier in Saint Tropez zu sein, wo es wenige Verpflichtungen gibt und sie ihre Tage mit Malen verbringen kann. Trotz seines Ausflugs zum Hafen an diesem Morgen und anderer – zum Glück kurzer – Eskapaden scheint Duncan ihr so eng verbunden zu sein, wie es ihm überhaupt möglich ist. Während sie das Zitronengelb in das Grau der Wand einarbeitet, fühlt sie sich ganz von der Arbeit in Anspruch genommen, erfüllt, beinahe unbeschwert.
Irgendwo im Haus fällt eine Tür ins Schloss. Langsam, als wollte sie den Moment hinausschieben, da sie sich von den faszinierenden Farben auf der Leinwand lösen muss, fügt sie der sich entwickelnden Textur der Wand noch einen Tupfer Zitronengelb hinzu. Endlich legt sie Pinsel und Palette weg und blickt zunächst zum Fenster mit dem Tisch und der von Vorhängen gesäumten Aussicht, dann auf ihr Bild.
In dieser Haltung, die Arme in die Seiten gestemmt, den Kopf zur Seite geneigt, findet Duncan sie vor.
»Da.« Vanessa deutet auf die Stelle, wo sie die Tischbeine und das Holzparkett des Fußbodens zu malen begonnen hat.
Sie wartet, bis Duncan neben ihr steht und sein Blick ihrem folgen kann, vom rötlichen Mahagoni des Parketts zur gebrannten Umbra des Tischs und von dort zum Fenster hinaus. Ohne dass er auch nur ein Wort sagt, weiß sie, dass er nicht nur ihr Dilemma versteht, sondern auch genau erkannt hat, was ihre Intention ist – als ob sie in der Lage wäre, sich seinen Blick zu eigen zu machen und dadurch ihren eigenen zu schärfen. Nun wird ihr klar, dass das Problem nicht im Übergewicht von Braun liegt, sondern darin, dass sie es versäumt hat, es an anderer Stelle wiederaufzunehmen. Plötzlich erkennt sie, dass sie zuerst die Terrakotta-Dächer hinter dem Fenster dunkler machen muss, und dann vielleicht – die Idee kommt ihr wie ein Aufblitzen reiner Glückseligkeit – das reife Braun der Samenkörner in den Blütenköpfen ihrer getrockneten Sonnenblumen akzentuieren.
Es sind Momente wie dieser, denkt sie und dreht sich lächelnd zu Duncan um, die alles andere – die Nächte, in denen sie allein zu Bett geht, brennend vor Verlangen nach ihm, ihre Qualen, wenn er sich auf eine neue Affäre einlässt und sie Sorge hat, dass er diesmal nicht zu ihr zurückkehren wird –, die all dies erträglich machen.
Duncan hat ihr vom Postamt in der Stadt Briefe mitgebracht. Sie sieht den Stapel rasch durch. Die meisten steckt sie in ihre Rocktasche, um sie später zu lesen. Einen – von Maynard – behält sie in der Hand. Sie hat seine säuberliche, gleichmäßige Schrift sofort erkannt. Sie sieht ihn vor sich, als sie den Umschlag aufreißt, wie sein Stift hastig über das Papier fliegt, um mit dem schnellen Fluss seiner Gedanken Schritt zu halten. Sie hat sich oft gefragt, ob das der Grund ist, warum er immer einen Abstand zwischen dem letzten Wort eines Satzes und dem Punkt lässt, als ob dies die Stelle wäre, an der er Luft holt.
»Lydia?«, fragt Duncan, während sie liest.
Er spielt auf Maynards letzte Briefe an, die er kurz vor Weihnachten geschrieben hat und in denen er beschrieb, wie er die russische Ballerina zum Essen eingeladen hatte, nachdem er sie in The Sleeping Princess hatte tanzen sehen. Was sie beide stutzig gemacht hatte, war Maynards Beharren darauf, dass er Lydia als in jeder Hinsicht vollkommen erachtete. Da es sein Plan war, die Feiertage mit Sebastian zu verbringen – eine Liaison, die er mit den Worten »ganz nett, aber keine lodernde Leidenschaft« heruntergespielt hat –, taten sie seine Worte schließlich als Ausdruck einer vorübergehenden Vernarrtheit ab, zweifellos beeinflusst von seiner Schwäche für opulente Bühnenspektakel.
»Er steckt bis über beide Ohren drin«, berichtet Vanessa, die seine Formulierung wörtlich zitiert. »Und er hat Angst.«
Obwohl Duncan schweigt, scheinbar noch mit den braunen Flächen auf ihrer Leinwand beschäftigt, spürt Vanessa seine Bestürzung. Es wird ihn schwer treffen, wenn Maynard sich in Lydia verliebt haben sollte, auch wenn er durch seine Unfähigkeit, sich festzulegen, das Ende ihrer Beziehung selbst herbeigeführt hat. Sie erinnert sich an ein Gespräch mit Maynard, in dem er ihr gestand, wie sehr es ihn schmerzte, dass Duncan sich mehr und mehr zu ihrem jüngeren Bruder Adrian hingezogen fühlte.
Es gibt zwei Arten von Liebe, sinniert sie, während sie den Brief noch einmal überfliegt: die Liebe, die niemals ganz erlischt, und die Liebe, die dem Schönwettergesicht auf einer Uhr gleicht, das nur zu sehen ist, wenn die Sonne scheint, und verschwindet, sobald die Temperatur sinkt. Duncans Gefühle für Maynard sind so unveränderlich wie ihre für Duncan, und es wird ihn zusätzlich schmerzen und schockieren, dass Maynard im Begriff sein könnte, seine Liebe einer Frau zu schenken. Ihr ist bewusst, dass Duncan Bunnys Heirat mit Ray Marshall immer noch nicht verwunden hat. Danach hat er ernsthaft überlegt, ob er versuchen müsste, sich ebenfalls umzuorientieren. Zwar gibt es nichts, was Vanessa sich mehr wünschen würde, doch rechnet sie nicht damit, dass sich an ihrem gegenwärtigen Arrangement irgendetwas ändern wird, das ihr – obwohl alles andere als ideal – immer noch unendlich lieber ist als jede Form von Unehrlichkeit oder Heuchelei.
»Lydia ist ganz amüsant«, erklärt Duncan schließlich, als die wohlwollende Seite seines Charakters wieder die Oberhand gewinnt. Er greift nach einem Pinsel und korrigiert die Winkel von Vanessas Dächern mit energischen, aggressiven Pinselstrichen. »Diese Party bei den Courtaulds, als sie auf dem Flügel getanzt hat! Ihre Bewegungen waren so ruckartig und mechanisch – sie sah aus wie eine Puppe, die zum Leben erwacht ist.«
Vanessa betrachtet die Dächer, die sich jetzt klar vom Grün der Bäume und Wiesen abheben. »Was immer es ist, es wird nicht von Dauer sein«, prophezeit sie. »Maynard kennt Dutzende kluge Frauen, und er hat nie auch nur das geringste Interesse an ihnen gezeigt. Nicht mal an dieser Sekretärin, die sich regelrecht an ihn rangeschmissen hat. Er wird Lydia bald satthaben.«
Ihre Worte haben die gewünschte Wirkung. Duncan arbeitet weiter an ihren Dächern, aber ruhiger und entspannter, als ob das Malen nicht länger eine Ablenkung wäre, sondern eine Aktivität, die ihm Freude macht. Obwohl Vanessa es nicht gewohnt ist, so viel auf einmal zu reden, zwingt sie sich fortzufahren.
»Clive glaubt, dass man sich mit Lydia nicht vernünftig unterhalten kann. In seinem letzten Brief hat er von einem Lunch am Gordon Square geschrieben, zu dem Maynard sie eingeladen hatte. Man kam auf das Glück zu sprechen und auf die Frage, ob es richtig sei, nach persönlicher Erfüllung zu streben, wenn dies auf Kosten des Wohls der Allgemeinheit ginge. Just als die Diskussion am intensivsten war, sprang Lydia auf und verlangte, dass man das Fenster öffnete, damit sie das Gezwitscher der Spatzen in einem Baum vor dem Haus hören könne.«
»Clive schien mir immer schon scharf auf sie zu sein«, bemerkt Duncan, den Blick immer noch auf die Leinwand geheftet. »Da war diese andere Party, wo Clive sie mit Beschlag belegt hat, bis Mary ihn wutentbrannt wegzerrte.«
Vanessa nimmt einen Lappen und wischt sich die Hände ab, während sie darüber nachdenkt. Clives boshafte Bemerkungen über Lydia in seinem Brief haben sie selbst überrascht. Obwohl sie darüber gelacht hat und sich irgendwie bestätigt fühlte, kamen sie ihm unaufrichtig vor – als ob er sich selbst davon überzeugen müsste, dass er keinen Grund haben könnte, Lydia zu mögen.
»Eines ist klar«, erklärt sie, mehr an sich selbst als an Duncan gerichtet, »Lydia ist viel zu verrückt und zu flatterhaft, um einen Mann wie Maynard auf Dauer zu interessieren.«
»Er weiß einen guten Witz zu schätzen«, bemerkt Duncan, während er seine Änderungen begutachtet. Eine Reihe von Rundbögen entlang der weißen Wand des größten Gebäudes fällt ihm ins Auge, und er sieht sich nach den Farbtuben um.
Er ist hin- und hergerissen, erkennt Vanessa, als sie zusieht, wie er Zinnoberrot und gebrannten Ocker auf ihre Palette drückt. Er will das Beste für Maynard, selbst wenn ihn das unglücklich machen sollte.
»Alles andere als ein kurzer Flirt wäre absurd. Stell dir Lydia in Cambridge vor oder bei einem Dinner im Schatzamt, wo sich die Gespräche um Politik und Finanzen drehen.« Sie rubbelt mit dem Lappen an einem Farbfleck an ihren Fingern herum. »Ist ja schön für sie, dass sie im Waldorf residiert wie eine Prinzessin, aber was ist, wenn sie mit dem Tanzen aufhört? Und das wird bald der Fall sein – sie muss an die dreißig sein.« Vanessa runzelt die Stirn. An den Fleck muss sie mit Terpentin ran, und sie macht sich auf die Suche nach der Flasche. »Nein, Maynards Brief ist eindeutig ein Hilferuf, und wenn er sich nicht selbst losreißen kann, dann ist es die Aufgabe seiner Freunde, ihn zu retten. Wie lange wird er mit der Royal Commission in Indien sein?«
»Mehrere Wochen. Wieso?«
»Die räumliche Trennung von Lydia wird ihm Gelegenheit geben, in Ruhe nachzudenken.« Sie hört, wie die Haustür geöffnet wird, dann das Getrappel von Kinderfüßen in der Diele. Warum kommen sie immer hereingestürmt wie eine Herde wilder Tiere?, fragt sie sich, während sie ihren Lappen einsteckt. »Nach dem Lunch schreibe ich an Maynard und rate ihm, sich auf Indien zu konzentrieren. Ich werde keinen Zweifel daran lassen, dass von uns niemand findet, dass Lydia die Richtige für ihn ist.«