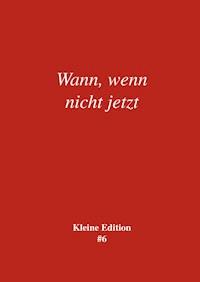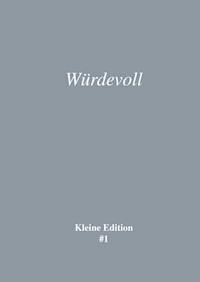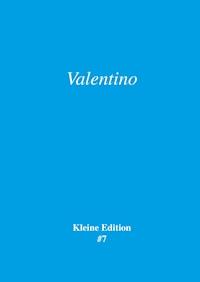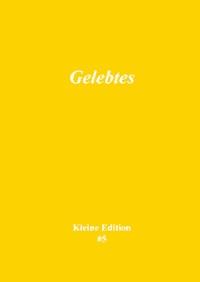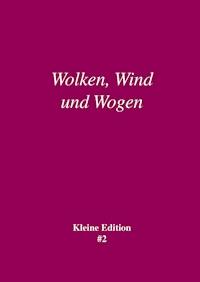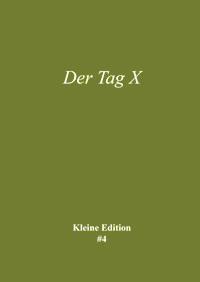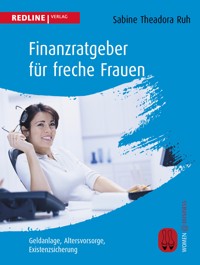
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Alles über individuelle weibliche Existenzsicherung. Auf eigenen Füßen stehen heißt: unabhängig rechnen und seine eigene Schatzmeisterin sein. Frauen gehen anders mit Geld um als Männer und legen ihr Vermögen anders an. In schwierigen Börsenzeiten erzielen sie oft sogar mehr Rendite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Sabine Theadora Ruh
Finanzratgeber für freche Frauen
Sabine Theadora Ruh
Finanzratgeber für freche Frauen
Geldanlage, Altersvorsorge, Existenzsicherung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Nachdruck 2012
© 2006 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Vierthaler & Braun, München
Coverabbildung: Corbis
Satz: Fotosatz Amann, Aichstetten
Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt
ISBN Print 978-3-86881-379-1
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-070-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-773-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter
www.muenchner-verlagsgruppe.de
eBook by ePubMATIC.com
Inhaltsverzeichnis
Anmerkung
Vorwort
1 Weniger Moneten – andere Geldbeziehung
Männer verdienen besser – bei gleicher Qualifikation
Innovationstreiber Frau
Spröde Geldbeziehung
Elterngeld und Hilfe bei der Kinderbetreuung
2 Längeres Leben zu finanzieren
Die Lebenserwartung steigt rasant
Karriere plus Familie hält Frauen fit
3 Altersarmut ist weiblich
Risikogruppe Frauen
Geringeres Einkommen, geringere Rente
Die gesetzliche Rentenversicherung – ein Füllhorn mit großen Problemen
Ist die Rente noch sicher?
Renditen fallen stark, bleiben aber positiv
Inflation schmälert Rente
Der Märchenprinz hat ausgedient – zur Altersvorsorge
Familie fürs private Glück – Abstriche bei der Rente
Plötzlich allein
Elternzeit – die neue Form des Erziehungsurlaubs
4 Selbst ist die Frau
Private Altersvorsorge ist überlebenswichtig
Betriebliche Altersvorsorge: empfehlenswert
Haftpflichtversicherung: ein Muss
Private Berufsunfähigkeitsversicherung: leider teuer
Wissen ist Macht
5 Frauen bevorzugen solide Geldanlagen
Sicherheit geht vor
Frauen sind anders – das zeigen auch die verschiedenen Geldanlagen
Der Hype um die Riester-Rente
Vermögenswirksame Leistungen: Altersvorsorge mit Zuschuss
Zum Geldparken geeignet: Sparbuch/Festgeld/Geldmarktfonds
Banksparpläne – gefangen im unrentablen Korsett
Bundesschatzbriefe, Obligationen und andere Anleihen – fest mit Zinsen rechnen
Aktien: Miteigentümer werden
Investmentfonds: große Möglichkeiten
Kapitallebensversicherung/private Rentenversicherung: steuerlich nicht mehr bevorzugt
„Rürup-Rente“ oder Basis-Rente: geeignet nur für wenige
Risikoprodukte: nur für Erfahrene
6 Kassensturz für den Überblick: Wo stehen Sie heute?
Blick in die Zukunft
So könnte es sein, wenn ich 67 bin
7 Wie Sie zu ausreichend Geld für das Alter kommen
Geld im Alter ist wie Schnee im Juni
Ein lebenslanges Thema: Steuern
Empfehlungen nach Lebensphasen
Tipps für Ihre sichere Geldanlage und Altersvorsorge
8 Wo Sie „die etwas andere Beratung“ bekommen
Frauen holen sich gerne Rat
Frauen beraten Frauen
Anmerkung
Um das Arbeiten mit diesem Buch für Sie möglichst einfach und effizient zu gestalten, haben wir wichtige Textpassagen mit folgenden Icons gekennzeichnet:
Achtung, wichtig!
Aufgabe, Übung
Das sollten Sie auf jeden Fall vermeiden.
Beispiel
Tipp
Vorwort
Der Mann ist geschaffen, um Geld zu machen,und die Frau hält die Kasse.Andre Kostolany, Börsenguru
Auch beim Umgang mit Finanzen zeigt sich der kleine, aber bedeutende Unterschied zwischen den Geschlechtern.
Frauen verdienen für gleiche Arbeit weniger. Ihre Erwerbsbiografien verlaufen selten gerade und steil, sie zeigen stattdessen Karrierebrüche und Auszeiten durch Familienphasen. Und Frauen müssen dann aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung mit weniger Geld länger auskommen.
Spätestens durch die hohen Scheidungsquoten ist außerdem klar, dass Ehe und Ehemänner keine ausreichende Altersvorsorge sind. Denn Altersarmut ist vorwiegend weiblich.
Doch das ist die Herausforderung der Zukunft für alle Frauen: Sie müssen heute – egal in welchem Familienstand – für ihre individuelle Existenzsicherung sorgen.
Denn: Die aktiven und modernen Frauen des 21. Jahrhunderts sind in Geldangelegenheiten selbstständig und emanzipiert.
Ihre Sabine Theadora Ruh
Umdenken tut Not!
Die Bundesbürger haben hohe Erwartungen für ihr Alter. So ist es 74 Prozent sehr wichtig, geistig beweglich zu bleiben. 65 Prozent betrachten es als sehr wichtig, körperlich flexibel im Alter zu sein. Um dies zu gewährleisten, halten 67 Prozent der Deutschen regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und medizinische Check-ups für sinnvoll. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen meint, um geistig flexibel zu sein, sei es förderlich, aktiv im Leben zu stehen (91 Prozent), zu reisen oder Neues kennenzulernen (71 Prozent). Gleichzeitig sehen 31 Prozent der Deutschen ausschließlich oder hauptsächlich den Staat in der Pflicht für die finanzielle Versorgung im Ruhestand. Im Osten sind es sogar 44 Prozent. Weniger als ein Drittel, nur 29 Prozent, der Bundesbürger sagen, die Verantwortung für die Altersvorsorge trägt jeder für sich selbst.
1 Weniger Moneten – andere Geldbeziehung
Männer verdienen besser – bei gleicher Qualifikation
Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern von bis zu 25 Prozent ermittelte das Karriereportal Monster bei der Auswertung von 128.000 Jahresgehältern im Vergleich. Besonders gravierend sind die Unterschiede im Bereich Marketing. Dort verdienten Frauen mit sechs bis zehn Jahren Berufserfahrung im vergangenen Jahr knapp 15.000 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen mit gleicher Qualifikation.
In anderen Berufsgruppen sieht es ähnlich aus: Berufsanfängerinnen mit ein bis fünf Jahren Erfahrung erhalten in den Bereichen Recht, Verwaltung und Organisation rund 10.000 Euro weniger Jahresgehalt als ihre männlichen Kollegen, im Finanzwesen sind es durchschnittlich 6.800 Euro. Beraterinnen im Consulting müssen sich mit rund 4.000 Euro weniger zufriedengeben, im Bereich Pharma und Medizin liegen Frauen mit circa 3.600 Euro hinten. Mit rund 960 Euro pro anno am geringsten ist die Gehaltsdifferenz im Personalwesen.
Leider kein rein deutsches Phänomen. In ganz Europa werden Frauen für ihre Arbeit schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Das zeigt eine Erhebung des europäischen Statistikamts Eurostat, die alle vier Jahre durchgeführt wird und die Einkommensstrukturen innerhalb der Europäischen Union untersucht. Der Studie zufolge ist das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern in Slowenien mit 11 Prozent am geringsten, am größten dagegen mit mehr als 30 Prozent in Großbritannien.
Verdienst von Frauen in Prozent des Männerverdienstes
(gemessen am Bruttostundenverdienst im Industrie- und Dienstleistungssektor)
Slowenien
89,0
Schweden
84,7
Frankreich
83,4
Italien
81,2
Portugal
80,3
Dänemark
80,0
Niederlande
76,4
Spanien
75,0
Deutschland
74,4
Großbritannien
69,7
Quelle: Eurostat
Der Gender Datenreport geht noch einen Schritt weiter. Er sieht Deutschland als Schlusslicht in Europa – und die absoluten Zahlen mit absteigender Tendenz. All dies bedeutet: Die Arbeit von Frauen ist nicht nur auf dem deutschen Arbeitsmarkt weniger wert. Zudem sind in Beschäftigungsgruppen mit niedrigen Gehältern Frauen überrepräsentiert.
Diskriminierung berufstätiger Frauen
Der niedrige Verdienst ist Folge der direkten Diskriminierung durch Männer, die ja üblicherweise über Frauenkarrieren entscheiden. Das zeigt sich am besten an den Gehaltsunterschieden in Führungspositionen. Dabei beginnt die Diskriminierung häufig schon zu Beginn der Berufstätigkeit. Bereits bei der Einstellung werden Frauen anders behandelt als Männer – das zieht sich dann das ganze Erwerbsleben durch. Zudem unterbrechen Frauen ihre Tätigkeiten wegen der Familienphase – und das kostet Gehalt, auch noch in späteren Lebensphasen. Auch gibt es noch immer – auch wenn die Grenzen verschwimmen – so genannte Frauenund Männerberufe. Und die typischen Frauenberufe sind der Gesellschaft schlicht weniger wert, führen häufig in die Karriere-Sackgasse ohne Möglichkeit der weiteren beruflichen Qualifikation.
Emanzipation vonnöten
Anteil der Fraueneinkommen an den Männereinkommen in Prozent
1995
2003
Italien
92
94
Portugal
95
91
Belgien
88
88
Frankreich
87
88
Luxemburg
81
85
Schweden
85
84
Irland
83
83
Finnland
83
83
Griechenland
83
83
Dänemark
85
82
Spanien
87
82
Niederlande
77
82
Österreich
78
80
Großbritannien
74
78
Deutschland
79
77
Quelle: Gender Datenreport des BMFSJ
Frauen bevorzugen Fixgehalt, Männer Leistungsbezahlung
Vor die Wahl zwischen Fixgehalt und leistungsabhängiger Bezahlung gestellt, entscheiden sich Frauen weit häufiger als Männer für die feste Entlohnung, auch wenn sie ansonsten mehr verdienen könnten. Das zeigt eine Studie des Instituts zur Zukunft der Arbeit an der Universität Bonn.
Die Wissenschaftler hatten ein Laborexperiment konzipiert, an dem insgesamt 119 Männer und 121 Frauen teilnahmen. Sie sollten über einen Zeitraum von zehn Minuten Zahlenpaare miteinander multiplizieren. Zuvor konnten sie sich entscheiden, wie sie dafür entlohnt werden wollten: Entweder erhielten sie die feste Summe von 7 Euro oder sie ließen sich pro korrekt durchgeführte Multiplikation knapp 20 Cent ausbezahlen. Alternativ konnten sie auch in einer Art Turnier gegen einen zufällig bestimmten Gegner antreten. Wer die meisten Aufgaben löste, durfte sich über 20 Euro freuen; der Gegner ging leer aus.
„In unserem Experiment entschieden sich nur 44 Prozent aller Teilnehmerinnen für die leistungsabhängigen Bezahlungsvarianten, obwohl viele damit mehr hätten verdienen können“, fasst der Bonner Ökonom Professor Dr. Armin Falk die Ergebnisse zusammen. „Bei den Männern lag dieser Anteil dagegen bei 68 Prozent.“ Die Ergebnisse korrespondieren mit den statistischen Daten des sozio-ökonomischen Panels, einer Umfrage, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung jährlich durchführt. Demnach arbeiten 33 Prozent aller Frauen im öffentlichen Sektor, einem Bereich, in dem in der Regel feste (und auch relativ niedrige) Gehälter gezahlt werden. Dagegen sind nur 21 Prozent aller Männer dort beschäftigt.
Karriereknick Kind
Die Mutterrolle ist oft ein Hindernis für den beruflichen Werdegang von Frauen. Unverheiratete Akademikerinnen bezahlen das Kinderkriegen mit sozialem Abstieg, verheiratete mit Karriereknick und Konsumverzicht. Zwar rücken immer mehr Frauen in Führungspositionen auf, aber Kinder sorgen noch immer häufig für Rückschläge beim beruflichen Fortkommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine 2006 von der Bertelsmann-Stiftung in Kooperation mit dem Familienministerium herausgegebene Studie. Für die Untersuchung wurde der Karriereweg von 500 erfolgreichen Frauen analysiert.
Die Befragung hat die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) vorgenommen. Ein Großteil der Frauen arbeitet Vollzeit. Zum Jammern waren sie offenbar nicht aufgelegt. Sie schilderten das Leben mit Kindern nicht nur als Belastung, sondern auch als Inspirationsquelle. 85 Prozent räumten ein, ohne einen Partner, der die Berufstätigkeit seiner Gefährtin akzeptiert und durch aktives Zupacken unterstützt, ginge es nicht. Die Frauen, so Helga Lukoschat von der EAF, wünschten sich ihren Arbeitgeber nicht „überfürsorglich“. Genauso wenig solle aber das Mutterdasein gänzlich ignoriert werden. Müttern ein wenig bei der Gestaltung der Arbeitszeit, des Arbeitsortes (konzeptionelle Arbeiten können auch von zu Hause erledigt werden), aber natürlich auch durch innerbetriebliche Einrichtungen zu helfen, wäre willkommen. Die Vize-Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung, Liz Mohn, sagte, in den engeren Führungsetagen der 30 Dax-notierten Unternehmen finde sich nur eine Frau. Länder wie Dänemark, Finnland und Schweden, aber auch Frankreich hätten inzwischen eine ganz andere Führungskultur entwickelt, von der Deutschland lernen müsse.
Die Schere klafft weit auseinander: Zusätzlich zu den Gehaltsunterschieden zwischen Frauen und Männern kommen mit Kindern weitere Einkommenseinbußen hinzu: Das Lebenseinkommen von Frauen mit Kindern liegt um bis zu einem Drittel unter dem der Männer mit Kindern bei gleicher Bildung. Dies liegt vor allem an den verringerten Erwerbszeiten sowie an den Erwerbsunterbrechungen in Phasen der Kinderbetreuung, ergab eine aktuelle Studie der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt und der Universität Hohenheim.
DIW-Studie: 25 Prozent der Akademikerinnen bleiben kinderlos
Der späte Abschluss der Universitätsausbildung ist der entscheidende Grund, wenn Akademikerinnen kinderlos bleiben. Doch ihre Zahl ist deutlich geringer als bislang angenommen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Die Ergebnisse der Studie liegen seit Anfang 2005 vor, sie wurden 2006 vom DIW noch einmal differenzierter ausgewertet. Wieder zeigt sich, dass etwa 25 Prozent der Akademikerinnen kinderlos bleiben. „Unsere neuen Berechnungen haben abermals gezeigt, dass die Zahlen, die in der öffentlichen Debatte genannt werden, deutlich zu hoch sind. Wer behauptet, 38 Prozent oder gar 45 Prozent der Akademikerinnen in Deutschland blieben kinderlos, der gibt deutlich zu hohe Zahlen an“, informiert Christian Schmitt, Wissenschaftler am DIW. Die Zahl kinderloser Akademikerinnen sei lange Zeit überschätzt worden, weil man Geburten nach Vollendung des 35. Lebensjahres nicht ausreichend gezählt habe. Außerdem seien im Mikrozensus jene Kinder, die das Elternhaus schon verlassen haben, nicht hinreichend berücksichtigt worden. Inzwischen blieben insgesamt mehr als 20 Prozent aller Frauen in Deutschland kinderlos.
„Gebärstreik“ der Akademikerinnen
Bei Frauen aus den alten Bundesländern, die ein Universitätsexamen oder den Abschluss an einer Technischen Universität besitzen, liegt die Kinderlosigkeit deutlich über dem Durchschnitt. Schmitt warnt aber davor, von einem „Gebärstreik“ der Akademikerinnen zu sprechen: „Egoismus und Karrierestreben sind nicht der Grund, sondern entscheidend ist der späte Abschluss der universitären Ausbildung.“ Nach dem Examen wollten die Akademikerinnen ihre Investitionen in die Ausbildung in eine „stabile Arbeitsmarktposition umsetzen“. Vielen Frauen bleibe nur ein „Zeitfenster von wenigen Jahren“, um das erste Kind auf die Welt zu bringen. Fehle in dieser Zeit ein Partner, dann blieben diese Akademikerinnen trotz Kinderwunsch kinderlos.
Problem Teilzeitarbeit
Die Frau als Zuverdienerin
In Deutschland gibt es weiterhin die traditionelle Arbeitsteilung: Während der Mann das Familieneinkommen sichert, gilt die Frau als Zuverdienerin. Eine Analyse des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass zwar fast die Hälfte aller Beschäftigten weiblich, doch die Hälfte davon teilzeitbeschäftigt ist. Insgesamt steigt zwar der Anteil der erwerbstätigen Frauen, nicht aber ihre eigenständige soziale Absicherung: Dem deutlichen Zuwachs an Teilzeitjobs steht eine fast genauso große Abnahme an Vollzeitarbeitsplätzen gegenüber. Die Zahl der von Frauen geleisteten Arbeitsstunden hat also nicht zugenommen: Stattdessen teilen sich immer mehr Frauen den gleichen Kuchen. Dabei sind viele dieser Teilzeitstellen nicht existenzsichernd. Das wird besonders deutlich, wenn man sich bewusst macht, dass auch Mini-Jobs in die Statistik eingehen. Ungefähr zwei Drittel aller Mini-Jobber sind Frauen.
Innovationstreiber Frau
Dabei sind Frauen heute besser qualifiziert als früher. Nie zuvor haben so viele Frauen studiert, gearbeitet und so viel verdient wie heute. Frauen sind im Berufsleben erfolgreicher denn je – und das ist nicht allein einem freundlichen Entgegenkommen der Männer zu verdanken. Es ist im Gegenteil eine wirtschaftliche Notwendigkeit.
Volkswirtschaftlich ist die Verdrängung in nicht-sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse ohne Aufstiegschancen ruinös. Damit wird die Abhängigkeit der Frau beziehungsweise der Familie vom Einkommen des Mannes zementiert. Im Fall des Verlustes des Ernährers stehen Frauen (und Kinder) dann vor dem finanziellen Nichts. Auch deshalb ist die Kinderarmut in Deutschland so viel höher als in anderen europäischen Ländern.
Die Frauen ökonomisch emanzipieren wollte bereits Silvio Gesell vor über 100 Jahren: Der 1862 geborene Gesell war Finanztheoretiker, Sozialreformer sowie Begründer der Freiwirtschaftslehre und propagierte eine Mutterrente. Damit wollte er Frauen von Männern wirtschaftlich unabhängig machen, damit sie den Vater ihrer Kinder nach seinem Charakter und nicht nach dessen Geldbeutel aussuchen können. Finanziert werden sollte dieses Grundeinkommen durch die Abschöpfung der Bodenrenten, also jener Einkommen, die an die privaten Eigentümer des Bodens fließen und bei Verpachtungen als leistungslose Erträge besonders deutlich hervortreten. Hinter dem Gesell’schen Vorschlag steckte die Idee, dass alle nicht vermehrbaren Güter wie Boden, Bodenschätze, Wasser und Luft allen Menschen zur gemeinsamen Nutzung geschenkt sind.
Frauen als Antriebskraft der Wirtschaft
Wissenschaftler und Politiker sind sich darin einig, dass Wohlstand und Überleben der Sozialsysteme in hohem Maße von der Arbeitskraft der Frauen abhängen, von ihrer Entscheidung, einen Beruf auszuüben und eine Familie zu gründen. Frauen sind diejenigen mit den besseren Zeugnissen und Studienabschlüssen. In den jüngeren Altersgruppen haben Frauen durchschnittlich einen höheren Bildungsabschluss als die Männer. Frauen sind innovativ und übernehmen mehr und mehr und mit immer größerem Erfolg Führungspositionen – nicht nur als Kanzlerin.
Frauen sind, wie die englische Wochenzeitung Economist, schreibt „die wichtigste Antriebskraft der globalen Wirtschaft“. Ihre Fähigkeiten seien besonders in der Wissensgesellschaft gefragt. Doch in der deutschen Realität sind nur 59 Prozent der Frauen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren erwerbstätig, in Schweden sind es hingegen 72 Prozent, in Dänemark 71 Prozent.
Alice Schwarzer, die mittlerweile in breiten Gesellschaftskreisen akzeptierte Frauenrechtlerin, sieht es als Problem an, dass Frauen immer die Möglichkeit hätten, statt zu arbeiten ins Private zu „flüchten“. Nach ihrer Aussage könnten sich allerdings 95 Prozent aller jungen Frauen keine Zukunft mehr ohne Beruf vorstellen. Seit Anfang der 70er Jahre, dem Beginn der Frauenbewegung, seien die Frauen nicht aufzuhalten.
Frau überholt rechts: Sind Männer das schwächere Geschlecht der Zukunft?
Artikel in der FAZ von Christian Schwägerl, erschienen am 7. Juni 2006
Den Arbeitsmarkt von morgen werden die Frauen beherrschen
Ein gigantisches Frauenbeförderungsprogramm steht bevor, weil auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft die Frau als das stärkere Geschlecht dastehen wird. Das Jahr 2010 markiert den Zeitpunkt, zu dem in Deutschland ein Umbruch der demographischen und ökonomischen Verhältnisse anläuft, der tradierte Geschlechterfrontverläufe heillos verwirren wird. … Den Arbeitsmarkt von morgen werden die Frauen beherrschen. Sie sind gebildet, flexibel und als Fachkräfte gefragt. Wo die Globalisierung zuschlägt, trifft es schon heute hauptsächlich die Männer. … Frauen werden auf dem Arbeitsmarkt begehrt sein, weil sie in großer Zahl Bildung, Energie und Motivation frei Haus mitbringen. Seit Frauen sich an Schulen und Universitäten entfalten können, ist ihr Aufstieg phänomenal. Anfang der sechziger Jahre waren sechzig Prozent der Gymnasiasten Jungen und vierzig Prozent Mädchen. Heute haben sich die Verhältnisse beinahe umgekehrt. 2004 besuchten vierzig Prozent der siebzehn- bis achtzehnjährigen Mädchen die gymnasiale Oberstufe, aber nur dreißig Prozent der Jungen. … Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet damit, dass „junge Frauen künftig weiter aufholen, denn sie haben die Bildungsdefizite in den letzten Jahrzehnten nicht nur verringert, sondern die jungen Männer in weiten Bereichen der allgemeinen wie beruflichen Bildung bereits überholt“. Der Frauenanteil an den Fachkräften werde „deutlich ansteigen“. … Der Umbruch wird am heftigsten die Frauen selbst treffen. Ihnen wird die Welt zu Füßen liegen.
Erste Risse in der Glasdecke
Die Finanzbranche selbst ist eine Männerdomäne. An die Spitze deutscher Finanzdienstleister schaffen es kaum Frauen, an der Wall Street dagegen sind die unsichtbaren Netzwerke der Männer aufgebrochen.
Michael Dieckmann, Vorstandschef der Allianz, hat die Brisanz des Themas erkannt. „Ich möchte nicht mehr in einer Männer-WG wohnen“, sagte er auf der Allianz-Hauptversammlung im Mai 2006. Kein Einzelfall. Auch bei den anderen deutschen Finanzhäusern wie der Deutschen Bank, der Münchener Rück oder der Commerzbank sitzen ebenfalls keine Frauen am Vorstandstisch.
An der Wall Street, obwohl traditionell ebenfalls ein Männerclub, ist frau da etwas weiter. Einer Umfrage des Branchenverbandes SIA zufolge stellen Frauen immerhin 15 Prozent der Spitzenmanager bei Investmentbanken. Auch bei Tochtergesellschaften amerikanischer Banken in Deutschland machen Frauen Karriere. Amerikanische Unternehmen haben begriffen, dass es sinnvoll ist, eine vielfältige Führungsmannschaft zu haben, wenn man ein globales Geschäft aufbauen will. Dabei geht es nicht nur allein um das Geschäft, sondern auch um die Angst vor Klagen, die Banken auf Minderheiten und Frauen achten lässt. Der Hintergrund: In Amerika gibt es harte Antidiskriminierungsgesetze.
Auch hierzulande beginnen die Banken zu erkennen, dass sie gut ausgebildete Frauen nicht aus ihrem Talentreservoir ausschließen sollten. Und so stellen die Finanzdienstleister immer mehr junge Hochschulabsolventinnen ein. Und das auch aus wirtschaftlichen Gründen. Denn Frauen sind zunehmend wichtig als Kunden.
Nach Zahlen des Bundesverbands Deutscher Banken arbeiteten zwar im Jahr 2004 schon 12.000 weibliche Führungskräfte in den privaten Banken – immerhin zwölf Mal mehr als 1980, aber in unteren Führungsebenen. Der Weg nach oben ist den Frauen oft durch unsichtbare Barrieren versperrt.
Frauen stoßen oft an die gläserne Decke
Arbeitspsychologen nennen das eine gläserne Decke. Männliche Seilschaften bilden dabei einen tragenden Pfeiler, kulturelle Wertvorstellungen einen anderen. Die Diskussion über „Rabenmütter“, ein im internationalen Vergleich langer gesetzlicher Erziehungsurlaub von bis zu drei Jahren und schlechte Angebote für Kinderbetreuung behindern den Aufstieg in die Führungsetagen ebenso. Alles das führt dazu, dass nach einer Studie der Unternehmensberatung Accenture nur 16 Prozent der deutschen Frauen glauben, sie hätten gleiche Karrierechancen wie Männer.
Spröde Geldbeziehung
Historisch und sozial ist der Umgang von Frauen mit Geld noch immer nicht wirklich selbstverständlich. Eine Konsequenz jahrhundertelanger Männerdominanz in Wirtschaft und Gesellschaft. Bei Frauen gibt es deswegen teilweise immer noch das Gefühl, dass Geld nicht feminin und deswegen unangenehm sei.
Kein Wunder: 99 Prozent des Weltvermögens ist noch immer in der Hand von Männern. Sie setzen sich aktiver mit Geld und Finanzen auseinander. Geld hat bei Männern ein positives Image. Die Beziehung von Frauen zu Geld ist anders – sie ist immer noch kein Selbstverständnis für alle Generationen. Wie auch? Noch 1977 konnten Frauen nur mit Zustimmung ihres Ehemannes ein Konto eröffnen! Klingt wie eine Geschichte aus der Steinzeit der Finanzen. Doch auch das war Realität: Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts konnte der Ehemann mit der Begründung, die berufliche Tätigkeit der Frau störe den häuslichen Frieden, die Arbeitsstelle der Frau kündigen.
Immerhin besitzen deutsche Frauen seit 1919 das aktive und passive Wahlrecht. Die Schweiz führte dies erst 1971 ein, im letzten Kanton sogar erst 1990. Und bis in die 50er Jahre regelte hierzulande nichts Geringeres als das Bürgerliche Gesetzbuch das Entscheidungsrecht in der Ehe: Natürlich hatte der Mann in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten das Sagen. Er bestimmte Wohnort und Wohnung. Die Frau durfte nur berufstätig werden, wenn der Göttergatte damit einverstanden war und wenn sie darüber ihre häuslichen Pflichten nicht vernachlässigte. Denn sie war verpflichtet „das gemeinsame Hauswesen zu leiten“. Diese Doppelbelastung dürfte vielen Frauen auch heute bekannt vorkommen. Nur wenn der Mann nicht genug verdiente, dann durfte sie arbeiten, das heißt musste sie mitarbeiten. Und es war noch schlimmer: Auch das von der Frau in eine Ehe eingebrachte Vermögen gehörte nach dem geltenden Recht nicht ihr, sondern stand dem Mann zur Verwaltung und Nutznießung zu. Das Vermögen der Frau wurde durch die Eheschließung dem Ehemann unterworfen.
Geld ist nicht nur Männersache
In den letzten Jahrzehnten hat sich mittlerweile einiges verbessert und normalisiert, sodass jüngere Frauengenerationen mit neuem und gewachsenem Selbstverständnis auch die beschriebene Diskrepanz zum Thema Finanzen nicht mehr empfinden. Selbstbewusste Österreicherinnen: Laut einer von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG in Auftrag gegebenen repräsentativen Befragung der Österreicherinnen über 14 Jahre verneinen 86 Prozent die Vorstellung, dass Männer besser mit Geld umgehen können. Professor Dr. Fritz Karmasin, Geschäftsführer des Österreichischen Gallup-Institutes: „Frauen sind nicht der Meinung, dass Männer besser mit Geld umgehen können. Jüngere Frauen unter 30 Jahren weisen diesen Gedanken zu 90 Prozent zurück, Frauen über 50 Jahre zu 83 Prozent.“
Auf die Frage, wer in einem Haushalt Entscheidungen über die Geldanlage trifft, antworten über ein Drittel, genau 37 Prozent, der Frauen, dass sie diese Entscheidungen selbst treffen. Mit 59 Prozent gibt die Mehrheit der Befragten an, solche Entscheidungen gemeinsam mit ihrem Partner zu treffen. Nur 4 Prozent der Frauen sagen, dass der Partner die Entscheidungen über die Geldanlage trifft.
Wissenslücken beim Thema Finanzen
Für 94 Prozent der deutschen Frauen steht die finanzielle Unabhängigkeit ganz oben in der Lebensplanung, so das Ergebnis einer Untersuchung aus dem Jahr 2002. Doch den eigenen finanziellen Wünschen stehen noch erhebliche Wissenslücken beim Thema Finanzen entgegen, fand NFO Infratest in der im August 2003 von der Commerzbank in Auftrag gegebenen „Detailauswertung Frauen“ zur Studie „Finanzielle Allgemeinbildung in Deutschland“ heraus. Die repräsentative Untersuchung, die auf einer Befragung von über 1000 Bundesbürgern im Alter zwischen 18 und 64 Jahren basierte, ergab, dass nur 48 Prozent der befragten Frauen mindestens die Hälfte der Fragen richtig beantworten konnte. Vergleichsweise gut schnitten sie bei den Themen Einkommen und Zahlungsverkehr sowie Kredite ab, deutlicheren Nachholbedarf zeigten sie bei der privaten Vorsorge und der Geldanlage. Doch Finanz-Know-how ist keine reine Männersache: Frauen, die sich selbst um ihre Finanzangelegenheiten kümmern, liegen über dem Durchschnitt.
Dennoch beschäftigen sich rund drei Viertel der Frauen nicht gerne mit ihren privaten Finanzen. Zu diesem Ergebnis kommt die Detailanalyse zum „Finanzverhalten von Frauen“ der Sinus Sociovision-Studie „Die Psychologie des Geldes“. So gehen 23 Prozent der Männer, aber nur 14 Prozent der Frauen „souverän“ beziehungsweise „ambitioniert“ mit ihren privaten Finanzen um. Mitverantwortlich für die geringe Bereitschaft vieler Frauen, sich aktiv mit dem Thema Geld und Vermögensbildung zu beschäftigen, sei die Angst, bei der persönlichen Finanzplanung etwas falsch zu machen und Geld zu verlieren, erläutert der Psychologe Wolfgang Plöger vom Marktforschungsinstitut Sinus Sociovision, das im Auftrag der Commerzbank die Einstellungs- und Verhaltensmuster der Deutschen im Bereich der persönlichen Finanzen untersucht hat.
Frauen sind vorsichtiger beim Geldausgeben und bei der Geldanlage
Frauen beweisen nicht nur im Alltag, dass sie mit Geld gut umgehen können. Auch achten sie nach Erkenntnis der Studie stärker als Männer darauf, nicht über ihre Verhältnisse zu leben. Mehr noch: Dank ihrer eher vorsichtigen und realistischen Anlegermentalität, die zahlreiche Untersuchungen den Frauen bescheinigen, haben sie beispielsweise die Börsenbaisse Anfang des Jahrtausends besser überstanden als die männlichen Aktienbesitzer.
Prinzipiell ist festzuhalten: Viele Frauen sind beim Thema Geld weniger fordernd als die Männer. Nun ist es nicht richtig, das männliche Geschlecht immer zu imitieren. Doch Frauen bleiben ansonsten häufig eher auf der Strecke: beim Verwirklichen der eigenen Karriere, beim Aufstieg in eine höhere Position, bei Gehaltserhöhung oder dem angemessenen Honorar. Frauen haben nicht nur eine spröde Beziehung zum Geld – sondern auch zu ihrem eigenen (Geld-)Wert. Denn sie wissen, was sie tun, aber nicht, was sie wert sind.
Taschengeld für die Ehefrau
Verbrauchertipp am 12. März 2006 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
Taschengeld vom Ernährer bekommen nicht nur Teenies, damit sie sich etwas leisten können. Der Ehepartner hat sogar einen Anspruch, wenn er sich zu Hause um Kinder, Küche und Wäsche kümmert. Selbst wenn die Frau – und das sind die meisten Fälle – arbeiten geht und weniger als ihr Mann verdient, sollte noch ein kleines Taschengeld drin sein.
Die obersten Richter im Bundesgerichtshof betrachten 5 bis 7 Prozent des Nettoeinkommens als angemessen. Bringt also der Mann 3.000 Euro im Monat nach Hause, müsste er seiner Haus-Frau mindestens 150 Euro zustecken – und zwar ohne zu meckern und ohne Bedingungen. Die Frau darf und soll mit dem Geld machen, was sie gerne möchte.
…
In einer guten Partnerschaft verständigen sich die Eheleute in Gelddingen. Doch oft gibt es Streit, der schwer zu schlichten ist. In der Praxis haben meistens die Frauen die schlechteren Karten. Oft werden sie absichtlich vom Mann ahnungslos gehalten. Sie wissen vielfach gar nicht, wie viel der Ernährer verdient, und können deshalb ihren „Anspruch auf Zahlung eines Taschengeldes“ gar nicht geltend machen.
Daran will nun die Politik zumindest formal etwas ändern. Der Ehegatte soll einen „Auskunftsanspruch“ erhalten. Das heißt, der Ernährer muss der Hausfrau belegen, wie viel er verdient.
Die Politiker aus dem Bundesrat verstehen dies als Signal für die Gleichstellung des Partners, der zu Hause arbeitet. Wohl wissend, dass alle schönen Ansprüche nichts nützen, wenn sie von den betroffenen Eheleuten nicht gelebt werden.
Die Beschäftigung mit Geld bringt Sicherheit
Expertin Christine Bortenlänger verrät, wie Frauen gute Finanzplaner werden.
Studien ergaben, dass Frauen ein sehr geschicktes Händchen im Umgang mit Geld haben. Warum kümmern sich dennoch viele ungern um Finanzen?
Christine Bortenlänger: Das liegt an der Erziehung. Als Kind haben wir erlebt, dass der Vater sich um Geld kümmert. Das wird dann in der eigenen Partnerschaft weiter gelebt. Das Thema Geld und Finanzen weckt bei vielen Frauen ein Unbehagen. Drehen Sie den Spieß doch einfach um! Die Beschäftigung mit Geld bringt Selbstbestimmtheit und Sicherheit.
Was machen Frauen anders als Männer?
Christine Bortenlänger: Sie gehen vorsichtiger mit Geld um, scheuen riskante Anlagen. Sicherheit ist wichtiger. Unterm Strich fahren sie damit oft besser.
Was raten Sie den Frauen?
Frauen sollten mehr über Geld sprechen und aktiver damit umgehen. Selbstbewusste Frauen mit positiver Einstellung zu Geld zeigen, dass Frauen ihre Finanzen durchaus erfolgreich in den Griff bekommen.
Wie erkennt man eine gute Beratung?
Christine Bortenlänger: Sprechen Sie mit mehreren Beratern, um Angebote zu vergleichen. Fragen Sie so lange, bis Sie alles verstehen. Erst unterschreiben, wenn Sie absolut sicher sind.
Christine Bortenlänger ist Geschäftsführerin der Börse München.
Elterngeld und Hilfe bei der Kinderbetreuung
Die Politik versucht, Anreize für Frauen zu setzen. So beschloss die große Koalition am 17. März 2006 das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung. Kern des Gesetzes ist die erweiterte steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten. Eltern können danach zwei Drittel der tatsächlichen Kosten, jährlich bis zu 4.000 Euro, für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren geltend machen. Diese Regelung gilt, wenn die Alleinerziehende oder beide Elternteile berufstätig sind. Familien mit nur einem Verdiener können nur die Kosten für Kinder zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr geltend machen.
Ein weiteres Instrument soll das Elterngeld werden. Von 2007 an können Eltern nach der Geburt eines Kindes bis zu 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen. Dem Beschluss vom 2. Mai 2006 ging wochenlanger Streit in der Koalition voraus. Nun sollen Familien, in denen ein Verdiener zugunsten der Kinderbetreuung auf Einkommen verzichtet, zwölf Monate lang 67 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens des Pausierenden erhalten, höchstens 1.800 Euro monatlich. Weitere zwei Monate werden als Bonus finanziert, wenn in dieser Zeit der andere Elternteil – wohl der Vater – zwei Monate im Beruf aussetzt und sich stattdessen ausschließlich um das Kind kümmert. Die Bezugszeit kann bei Halbierung der Leistungen verdoppelt werden. Das Mindestelterngeld für Arbeitslose, Hausfrauen oder Hausmänner soll 300 Euro betragen. Allerdings dürfen diese 300 Euro nicht mit Sozialleistungen wie dem Arbeitslosengeld II verrechnet werden. Alleinerziehende erhalten das Erziehungsgeld 14 Monate lang.
Als Berechnungsgrundlage dient – so wurde es am 14. Juni 2006 vom Bundeskabinett beschlossen – das durchschnittliche Einkommen der letzten zwölf Monate und nicht nur der letzten drei. Damit soll verhindert werden, dass durch kurzfristige Einstellungen mit hohen Gehältern das Elterngeld missbraucht wird. Zudem wurde die Frist, innerhalb deren Väter ihre Auszeiten ankündigen müssen, um eine Woche auf nun sieben Wochen verkürzt. Damit sollen sie gegen Kündigungen geschützt werden, für die eine Frist von acht Wochen gilt. Das Familienministerium rechnet damit, dass rund 27 Prozent der Väter die Partnermonate in Anspruch nehmen. Bislang widmen sich nur 5 Prozent der Väter der Familie.
Ziel ist, die Babypause finanziell abzufedern und auch Väter zu ermutigen, sich – wenn auch nur für ausgesprochen kurze Zeit – dem Nachwuchs zu widmen.