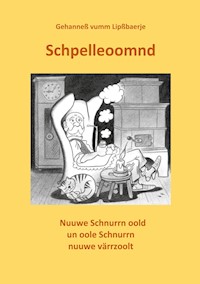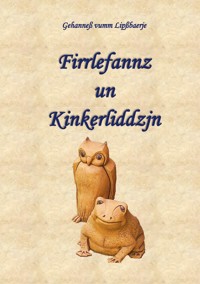
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Was in diesem Buch als Firlefanz und Kinkerlitzchen angeboten wird, sind die vielen kleinen, fast unauffälligen Ereignisse aus dem Alltag des Lebens. Ihre Bedeutung liegt in der unverzichtbaren Wirkung, Sorgen und Frust mit gesundem Humor und Gesang zu vertreiben. Die Glossierungen von Ereignissen, menschlichen Schwächen, Schabernack oder übertriebenen Sicht- und Verhaltensweisen sind in dem typisch eichsfeldisch-ländlichen Stil auf Mundart geschrieben. Der Blick in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfolgt durch die Brille der Prägung der Eichsfelder und zeugt von einer ungebrochenen Liebe zur eichsfeldischen Heimat. Erneut befasst sich der Autor mit der Schwierigkeit der Verschriftung der Mundart. Sein Appell, den Klang der Eichsfelder Mundart auch als Schrift für kommende Generationen zu sichern, soll Autoren ermutigen, ihren eigenen Dialekt lautgerecht zu verschriften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unsere Mundart gehört zu den Wurzeln unserer Identifikation als Eichsfelder und ist daher auch ein Bekenntnis zur Heimat.
Ziirt uchch nitt, Plaad z schtorjen. D Muuloort äßß kenn Unsinn, brännget abber Fraide.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Schwierigkeit, in Mundart zu schreiben
Autoren der Eichsfelder Mundart
Ein Vergleich
Die Schriftbilder
Daer Ungerschiid
Ein Ratschlag
Bekriffe dich eeßd saelber
D beßßde Schprooche
D Geschichtn im DDR-Sozijalißmußß
Daer Baabßd worr do
Woaßß färr Ziidn?
Enne haikle Sachchn?
ß Wißße Kriddze
Noch enn wißßeß Kriddze
Enn guuder ooler Rood
Un enne Frooge
Orijendiirunk
D rainzde Woorhait
Firrlefannz
Kinkerliddzjn
Enn Gaßßd in Firrlefannz
Kinkerliddzjn machcht Mussik
Firrlefannz un Kinkerliddzjn
Reklaame färrß Aikßfaelld
Kichchnmaißder Schmoalhannz
Minn Oppa
Kumm haime!
Enn uußgezaichnetn Schpiersinn
Bijm Kaffeekladdsch
Enn Deßßd in Rellijoon
Dannte Juulchn sinne Kaddzn
Daß Hochchznbillt
Enn krooßeß Risiko
Eer leddzder Wille
Kenne Brobbleeme mee
Enn Värrschpraechchn
Enn braggdischeß Klaichnißß
Lufftschußß
Därchschaut
Beßßer raseere
ß Aumnmooß
Konntnraamn
Imme enn Hoor äbberfaarn
Daer Trikk enneß Weggedarijerß
D raine Woarhait
Do hotteß sich geärrt
Sonn daemischeß Dibpn
Daer Bewaiß mußß bliiwe
Ennm geschänktn Guul, …
D leddzde Rettunk värrm Klooßder
D beßßde Leesunk
Saekß Frijekrinne
D Wunnschfrijaate
Uffnhaerzich
Nuur ennmool frijje
Enn lange gehutteß Gehaimnißß
ß Gaelld worr sinne Liibe
ß kreßßde Gehaimnißß
Meetgiffd färr d Eewichkait
Hii wärrt nitt rimmgekroffn
Enne Radtikaalkuur
Kenn Äbbernaachdunkßgaelld
D Donnenuur
Deß Guudn zeveele
Woaßß me morjenz zeeeßte machcht
Enn kloarer Hännwiiß
Daer Priefunkßraim
Gaißdije Naarunk
Enne kluuge Andworrt
Eeßd n Drilling, dann Drillinge
Daer Sunndaggßjaejer
Enn guudeß Trinnkgaelld
Nachch inner Schpuur
Enn raineß Lotterijschpeel
Ne Aanschaffunk färrn Aijenbedarf
Wiinaachtn gerettet
Gollne Reegln färr Ränntner
Enn harter Kampf in Uuder
In dousend Joorn
Mee singn plaad
Hidde nachch uff Plaad z schtorjn
Aikßfaelld, Haimat
Enn ooleß Hoddznliid
Min Lengenfald
Daer Lutteraner Kärmeßßgesank
Die alte Dorflinde
Quellenverzeichnis
Vorwort
Angeregt durch den Mundartabend anlässlich des Jubiläums 1050 Jahre Heiligenstadt am 30. Mai 2023 kann ich nicht umhin, mich der Arbeit an einem weiteren Buch in Mundart zu widmen. Die Beiträge aus verschiedenen Orten des Ober-eichsfeldes hatten die Akteure selbst und auch die zahlreichen Besucher hellauf begeistert. Noch Wochen später wurde davon gesprochen. Eine solche Begeisterung für unsere Eichsfelder Mundart wünsche ich mir auch für diejenigen, die an jenem Abend nicht dabei waren, jetzt aber zu diesem Buch gegriffen haben. Es ist nicht nur die Freude an einer gelungenen Veranstaltung, die mich zu diesem Buch inspirierte, sondern vielmehr meine zunehmende Sorge um den Erhalt unserer Mundart.
Der Pflege unserer Eichsfelder Mundart fühle ich mich seit vielen Jahren verpflichtet. Die Erfahrung, dass das Interesse daran in unserer Region mehr und mehr schwindet, bewegt mich immer wieder. Mir ist bewusst, dass ich diesen Trend nicht aufhalten kann. Dass die Mundart ihren Weg in die sozialen Medien findet, ist wohl eher eine Illusion. Also wird in naher Zukunft kaum noch jemand im alltäglichen Umgang unsere Mundart zu hören bekommen. Damit reißt die unbedingt erforderliche akustische Weitergabe der mundartlichen Aussprache an die nächste Generation ab. Die spärlichen Ambitionen in Heimatvereinen zur Pflege der Mundart sowie die weit verbreitete Auffassung, sie sei eine reaktionäre, ungebildete und nicht mehr zeitgemäße Konversationsform, haben ihr in der Vergangenheit über viele Jahre hinweg gewissermaßen das Grab geschaufelt. Die Identifizierung als Eichsfelder über die mundartliche Alltagssprache ist, gegenüber anderen Regionen wie Bayern, Norddeutschland und Sachsen, nicht mehr wahrnehmbar. Daher habe ich einen Buchtitel gewählt, der eine besondere Aufmerksamkeit wecken soll. Keineswegs soll er auf eine Fülle von Beiträgen über wertlosen Kram, Albernheiten, Torheiten, Kindereien und Unsinnigkeiten im alltäglichen Leben verweisen. Vielmehr soll er die gefühlte Einstellung der Eichsfelder zu ihrer Mundart provokativ als wertlose Umgangssprache, als Unsinn zum Ausdruck bringen. Die noch an ihrer Muttersprache hängenden Eichsfelder empfinden eine solche Äußerung vielleicht als unerhört. Jedoch möchte ich sie keinesfalls davon abbringen, ihre liebgewonnene und althergebrachte Konversation zu vernachlässigen. Im Gegenteil, ich möchte sie ermutigen, ohne jegliche Einschränkung an ihrer Mundart festzuhalten. Vor allem in den Familien, aber darüber hinaus auch in der dörflichen Gemeinschaft sollte sie gepflegt werden, solange es Eichsfel-der gibt, die unseren Dialekt noch beherrschen. Dies ist der beste Weg zur Weitergabe einer Aussprache, in der unsere nächsten Vorfahren sich noch verständigt haben.
Meinen Weg zur Konservierung der Aussprache unserer Mundart habe ich in meinen Veröffentlichungen, vor allem im Wörterbuch, deutlich beschrieben. Er ist nicht mehr aber auch nicht weniger als eine bescheidene Hilfe zur Bewahrung eines unschätzbaren immateriellen Kulturgutes. Ob mein erneuter Appell dazu führt, Mut zu fassen, in Eichsfelder Mundart zu reden und vor allem zu schreiben, das muss sich erst noch zeigen. Gerade in der Verschriftung der Mundart liegt die größte Schwierigkeit, da es darauf ankommt, den ortstypischen Akzent abzubilden. Daher erscheint mir eine analytische Sicht auf diesen Tatbestand unbedingt erforderlich zu sein.
Heiligenstadt, im Juli 2023
Die Schwierigkeit, in Mundart zu schreiben
Die Werke der deutschen Literatur geben ein sichtbares Zeugnis unserer Sprachentwicklung über viele Jahrhunderte. Bevor es verbindliche Regeln für Orthographie und Grammatik gab, hat man so geschrieben, wie man es für richtig hielt oder gesagt bekam. Weitgehend waren dabei die regionalen Dialekte das Fundament der Ausdrucks- bzw. Schriftweise. Diese Handhabung bürgerte sich im Laufe der Zeit ein, ohne jedoch die Akzente im Schriftbild exakt zu berücksichtigen. Vielmehr schlugen diese sich phonetisch in den Lauten des Wortbildes nieder, ohne dass es für kurze oder gedehnte, helle oder dunkle Aussprache jeweils eigene Laute gab oder eine zusätzliche Setzung von Sonderzeichen dies deutlich machte. Durch die mündliche Überlieferung ist somit die Differenz von Aussprache zum Schriftbild erhalten geblieben. So weiß jeder, dass z. B. das a in lang kurz, in tragen aber stärker betont wird, oder dass n in an und von genauso (scheinbar mit zwei n hintereinander) ausgesprochen wird wie in kann. Abgesehen vom Dehnungs-h und -e oder einem Doppelkonsonant, die einem Vokal folgen und damit die Phonetik beeinflussen, ist meine Darlegung hier nur eine punktuelle Sicht. Sie soll aber deutlich machen, wie schwierig es ist, das gesprochene Wort entsprechend seinem Klang abzubilden. Wer sich diesbezüglich den Duden und auch mein Wörterbuch anschaut, wird feststellen, dass es nicht immer gelungen ist. Meine Darlegungen entsprechen den eigenen Erfahrungen, nicht aber einem sprachwissenschaftlichen Studium. Frühe wissenschaftliche Darlegungen zur Herausbildung unserer Mundart sind nachzulesen bei Jäger (1925), Hentrich (1934) und Michaelsen (1949).
Was die Überlieferung des Sprachklanges unserer Mundart betrifft, so gerät die mündliche Weitergabe mehr und mehr ins Abseits. Tonaufnahmen sind nicht bekannt oder es gibt sie nur in wenigen Fällen als private Aufnahmen u. a. anlässlich familiärer Ereignisse. Anders als z. B. in Bayern oder in Norddeutschland ist das Potenzial zur Pflege der Mundart im Obereichfeld sehr stark eingeschränkt und weiterhin rückläufig. Um zu verhindern, dass unsere Mundart völlig ausstirbt und die Sprachmelodie der nächsten Generation nicht überliefert werden kann, gibt es nur die Möglichkeit, sie lautgerecht zu verschriften. In der Mundart des Untereichsfeldes scheint dies besser gelungen als in der des Obereichsfeldes. Meine Hypothese ist, dass die Untereichsfelder in ihren ersten Schriftwerken mutiger waren, sich grundlegend nach der Aussprache zu richten. Sie vermieden möglichst eine orthographische Anpassung an Hochdeutsch. Hinzu kommt, dass das Niedereichsfeldi-sche aus dem Niederdeutschen hervorging und damit auch seine Prägung aus diesem Sprachraum erhalten hat. Dagegen ist die unseres Mitteleichsfeldischen im Hochdeutschen zu finden. Diese Handhabung hat sich als Tradition in der Schreibweise durchgesetzt. Wiederholt ergeht mein Appell an alle unsere Mundart beherrschenden Landsleute im Obe-reichsfeld: Seid mutig und schreibt auf, was Ihr Euren Nachkommen gern in Eurer Muttersprache sagen möchtet! Dabei kommt es auch darauf an, dass moderne Begriffe, im Slang der Mundart ausgesprochen, ebenfalls so geschrieben werden.
Mit einer kurzen Analyse der Schreibweise verschiedener Autoren der Mundart im Obereichsfeld möchte ich die Schwierigkeit, in Mundart zu schreiben, deutlich machen. Dabei geht es nicht um Kritik oder Bewertung, sondern um Anerkennung des Mutes, den die Autoren aufbrachten, die Eichsfelder Mundart als einheimische Literatur für den interessierten Leserkreis zugänglich zu machen. Die Bedingungen für eine exakt gleichbleibende Orthographie bei der Abfassung der Texte, entsprechend dem jeweiligen Akzent, waren für alle Autoren, aber auch für die Druckereien eine Herausforderung. Es gab weder Nachschlagewerke (Mund-artduden) noch Computer, die für die Autoren eine Hilfe hätten sein können. Besonders mittels Computertechnik kann heutzutage eine Standardisierung1 der Schreibweise angegangen werden. Das Mühen um die jeweilig typische Wiedergabe der sprachgerechten Akzente unter Beachtung der hochdeutschen Orthographie wird bei allen Autoren deutlich. Sie ist besonders bei Karl Leineweber zu erkennen. Da er seine Werke in größeren Zeitabständen verfasste, hat er u. a. gleichlautende Begriffe unterschiedlich geschrieben2. All das blieb den Lesern weithin verborgen, spielte letztlich aber auch keine Rolle. Was aber alle mehr oder weniger bekannte mundartlichen Werke betrifft, so muss man feststellen, dass sie ausnahmslos bei der Leserschaft dem sprichwörtlichen Frohmut der Eichsfelder Raum verschaffen.
1 v. Lipßbaerje, 2021:58.
2 v. Lipßbaerje, 2018:39.