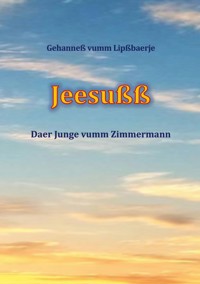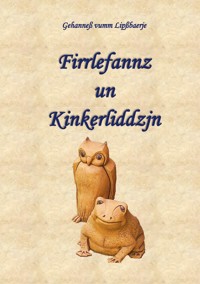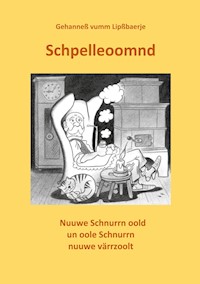
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Weitergabe der Mundart in ihrem typischen Sprachklang ist in der alltäglichen Umgangssprache weitgehend ausgestorben. Der dringenden Aufgabe, dieses Kulturgut zu erhalten und für kommende Generationen zugänglich zu machen, sieht sich der Autor verpflichtet. Damit verbunden geht sein Appell an alle, denen die Eichsfelder Mundart am Herzen liegt, ihre dörflich geprägte Mundart in lautgerechter Verschriftung der Öffentlichkeit zu präsentieren. In diesem Buch sind neue Verse und Erzählungen zu historischen und aktuellen Ereignissen enthalten. Dabei stützt sich der Autor sowohl auf eigene Erlebnisse als auch auf Quellen seiner Landsleute. Der Begriff Schpelle bzw. Schpelleoomnd ist im Sprachgebrauch nicht mehr geläufig. Im Wörterbuch des Autors ist er als Abendbesuch(e) erklärt. Der Begriff leitet sich aus dem Englischen ab. So bedeutet for a spell: für eine Weile, ein Weilchen, eine Zeit-lang. Schpelle gehen bedeutet also, dass man für eine Weile, ein Weilchen, eine Zeitlang oder kurze Zeit (a short spell) zu Besuch (zum miteinander reden - schtorjen) geht. Und wenn es sich um einen Abendbesuch handelt, so ist das eben ein Schpelleoomnd. Wobei sich auch schtorjen von story (engl.) Erzählung ableiten lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unsere eichsfeldische Mundart ist ein hohes Kulturgut, das es zu bewahren gilt. Sie gehört daher untrennbar zu den Wurzeln unserer Identifikation als Eichsfelder.
Kummet haer, me wunn d ooln Schnurrn ae mool wärre meet uuß daer Kißdn loange. Gehanneß vumm Lipßbaerje hätt uchch doozu nachch ne goanze Bakkunk nuuwe uffgeschrämmn.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Schpelleoomnd
Dii guude oole Ziit
Schmekkschniißjen
Uußgetrikkßt
Kreßßde Veersicht gebonn
Enn pleddzlicheß Bedärfnißß
Dr Haeringßbißß
Genau genummn
D beßßde Leesunk
Bauer Boint
Fallsche Veerschtellunk
Korona
Värrdoocht uff Korona
Kwarranndääne
Koronadeßßt
Buußdern
Inzidennz
Laifschtriimn
Kenn Faelkriff gemachchd
Schtokkaendn
Daer Ungerschiid
D Bijodonne
Daß worr aemm dachch ze veele
Värrschlißßelte Diagnoose
Nummer 274
Schpeete Rachche
Veersorje
ß Unklikk bijm Unklikke
Doodeßaanzaige
Nulldariif
Hoore uffn Zeen
Ne zwaite Mainunk
Waer z schpeete kimmet, …
Woßßt oab
Uffm Waeje bijn Bokk
Waer veele freeget…
Härbeßtgeschprääch
Nachch guude Diinßde
Maenndern didt daer Schtorch nischt
Mällchbrieder
ß Schprängeln hätt gehullfn
Ne Kwidtunk färr d Schwoarzoarwait
D raine Woorhait
D värrhaekßdn Fikkel
Enn dummer Gennsehärrte
FKK inner Leemkruumn
D Bichchte im Kornhaufn
Enn Wunner noo daer Bichchte
Faelzinndunk
De nuuwe Schpriddzn
Ne värrhängnißßvulle Fijerweeriebunk
D Guudmietijn hätt Gott liib
Ußßem Dummn kann ae woaßß gewaere
Keppchn, Keppchn mußßme haa
Schichdern, abber schlau
Immer eeßd uußreede looße
Wo äßß dii enne Mark geblämmn?
Dißß gunk mool nitt no sirr Middzn
Vunn nischt kimmet nischt
Woaßß äßß daenn jeddzt?
ß Geschbaennßd im eeßdn Kraamn
Waer hätt hii bescheßßn?
ß Schtrimmpeschtobpn luug aemm nitt
Enn Haellfer inner Noot
Daß worr aemm dachch zu loange
Do hätt aemm dr Hailje Gaißd nitt gehullfn
Kenne Leesunk
Värrwaeßßelt
Wii schnaell me enn Schpiddznoamn krijjet
Enn Schlißßlärrlaebnißß
Schlaagfärtich
Geproolt, abber nitt geloggn
Kanniichnmuul
Wii Lutter zu sinnm Noamn koom
Enne schiir unklaubliche Geschichtn
Nitt mett Oabsichchd
D Eeselzbrikkn
Rollaadnfrikkaßßee
Wii im Schlaraffnlanne
Leyjndeijwlz Willaim
Sinn leddzdeß Liid värrm Ungergannk
Uußsichchd färr ne Raise zum Moond
ß äßß nischt mee sa, wii eß friejer woar
Zaen Geboote färrn Aikßfaeller
Färrn Schprichcheklopper
Aangeschtichchelt
Aanschtannd
Daer Zauberbaum
Kaddznjammer
Mool Dammp oablooße
Wii ich bänn uff d Waellt gekummn
Worimm ässeß in Lutter scheen?
Woaßß lääd daenn hii uff dr Schtrooßn?
Enn Plaatschtorjeliid
Quellenangabe__
Kleines Vokabular__
Danksagung __
Vorwort
Unsere Eichsfelder Mundart pflegt man am besten, wenn man so redet, wie es früher in den Dörfern üblich war. Man muss jedoch feststellen, dass unser modernes Zusammenleben nur noch wenig Gelegenheit bietet, sich im alltäglichen Kontakt mittels Mundart zu verständigen.
Zu besonderen Gelegenheiten wie Familienfeiern, Heimatabenden und Karnevalssitzungen konnte ich immer wieder erleben, dass meine Beiträge in Mundart eine ganz besondere Atmosphäre des Frohsinns und der Heiterkeit bewirkten. Was enge Heimatverbundenheit bedeutet, wurde mir bei solchen Gelegenheiten immer mehr bewusst.
Unsere Mundart als hohes Kulturgut zu pflegen und zu bewahren, wurde ein Ziel, dass mich vor unerwartete Herausforderungen stellte. In Mundart zu sprechen, war die einfachste Form der Pflege. Die Texte von Martin Weinrich, Karl Leinewerber und anderen Mundartdichtern zu lesen, war schon eine gewisse Herausforderung. Ich hatte aber bald einen Schlüssel gefunden, der darin lag, beim Lesen den jeweiligen Text sofort in luttersche Mundart zu transkribieren. Damit las und „sprach“ ich aber nicht das, was ich als Schriftbild schwarz auf weiß vor Augen hatte.
Die Versuche, eigene Texte in Mundart zu schreiben, drängten mich fortan immer mehr dazu, von der mir bekannten Schreibweise abzuweichen und mich weitgehend nach dem Sprachklang zu richten. Denn den Sprachklang in Schriftform zu konservieren, erkannte ich als die eigentliche Aufgabe zur Bewahrung unseres sprachlichen Kulturgutes. Die Wiederbelebung längst ausgestorbener Begriffe, die z. B. Martin Weinrich noch verwendete, stand somit nicht mehr im Focus meiner Überlegungen.
Erst Konrad Hentrichs Aufsatz Wie sollen wir unser Eichsfeldisch schreiben? (Eichsfelder Volksblatt 1934) sowie Sprachtests haben mich dazu bewegt, in dem Schriftbild zu schreiben, wie ich es in Faefferkerner und Soolzschtangn präsentiere. Aber erst mit der Arbeit an meinem Werk Eichsfelder Mundart, Wörterbuch, Ein Weg zur lautgerechten Verschriftung hat die Anpassung des Schriftbildes an den Sprachklang eine weitere Entwicklung genommen.
Besonders die Sprachtests haben mir bestätigt, dass auch Unkundige der Eichsfelder Mundart, die sich ganz auf das Geschriebene konzentrierten, den typischen Akzent der Aussprache wiedergaben. Aber auch zahlreiche Leser der oben genannten Bücher haben mir bestätigt, dass sie mit dem Verstehen von Begriffen keine Probleme hatten, wenn sie das gelesene Wort laut aussprachen.
Aus dieser Tatsache ist mir die Gewissheit geworden, den Sprachklang des lutterschen Dialekts weitgehend getroffen zu haben und ihn damit für die Zukunft bewahren zu können. Ein großer Traum ist mir dadurch gleichermaßen erwachsen, da eine solche Chance auch für andere Dörfer besteht. Diese sollte unbedingt genutzt werden, solange es noch Menschen gibt, die ihre ortsübliche Mundart beherrschen. Allerdings ist ihre lautgerechte Wiedergabe in Schriftform zweifelsohne eine große Herausforderung. Doch die Früchte einer solchen Arbeit dienen letztlich dazu, im Zeitalter vielseitiger Umbrüche und Auswirkungen der Globalisierung etwas Sinnvolles für die Pflege und Erhaltung unserer regionalen eichsfeldischen Kultur getan zu haben. Insofern ist das 2021 erschienene Wörterbuch für mich nicht nur ein Meilenstein zur Bewahrung der Identität der regionalen Sprache, sondern mehr noch ein Signal an alle, die ihrem Dialekt den typischen Sprachklang für kommende Generationen sichern wollen.
Die in diesem Buch enthaltenen teilweise bekannten aber auch neuen Verse und Geschichten bedeuten natürlich für die Leser auch wieder eine gewisse Herausforderung, da sie nun in Lautschrift geschrieben sind, wie diese im Wörterbuch präsentiert ist. Die Annahme dieser Schreibweise wird durch zunächst lautes Lesen schnell erreichbar und so der Liebe zum Plaad-Schtorjen förderlich werden.
Heilbad Heiligenstadt im Januar 2022
Hans-Gerd Adler
Schpelleoomnd
Daen Uußdrukk Schpelleoomnd odder Schpelleoobed kennn nitt me veele Lidde. Daß kimmet dohaer, wail d Lidde hiddezedaage oalle dahaime värrm Färnseejer eere Loangewiile värrbränngn. Am Änge wunndern se sich, daß d Kondaggde ungernannder immer wännjer waern un d Lidde sich anschainend glichchgilldich värrhooln. Nunn, d Ziidn hann sich j ae daermooßn värrändert. Me hätt manchmool daen Inndrukk, d Lidde keemn värr lutter Oarwait un Värrflichdungn äbberhaubt nittmee zu sich saelber. Un wänn se nachch frijje Ziid äbberich hann, do hann se sa veele nuuwe Hobbiiß, daßße färrn Schpelleoomnd goar kenne Ziid mee hann. Un worimme sulltn se daenn do nachch wißße, woaßß enn Schpelleoomnd äßß?
Wämme sa an Friejer zrikke dännket, do mußßme sich j wunndere, daß d Lidde domoolz färrn Schpelleoomnd äbberhaubt nachch Ziid hottn. Se hottn dachch sonn Haufn Oarwait un muttn sich daggdääglich vunn morjenz biß oobedz hellsch oabkweele. Un wänn se dann ß Naachtbrood hinger sich gebroocht hottn, do wärrn se am libbeßdn doodmiede innz Bette gegenn. Woaß sulltn se daenn ae annerte machche? Färnseejer gobbß nachch nitt, un enn Radijo hottn veele ae nachch nitt. Un wänn dr Schtroom uußgefalln worr, do muttn se n Wakkßlijcht aanschtikke, un dißß worr j manchmool ae nur n Haebpchn dunkler wii ne fimwenzwannzijer Beern inner Lammpn.
Schpelle gungn d Lidde haubtsächlich, wänn d Faelldoarwait gedonn worr, oalso im Schpeethärbeßte un im Winnter biß innz Friejoor rinn, jenoodaem wiiß Waettr eß dann zuluuß. Maißd gungn se noomn Naachtbroode bij eerer Värrwoandtschaffd odder birr Napperschafft Schpelle. Me troof sich inner Kichchn, wailz j do ae hebbsch woarme worr. D guude Schtommn worrte bij daen klenndern Hußßhooltn saelltner benuddzd. Inner Kichchn hulln sich d Lidde daagßäbber hauptsaechlich uff. Hii worrte gekochcht un gegaeßßn. Ae oalle klenndern Hanntoarwaitn un d Besuuche schpeeltn sich hii oab, sa ae d Schpelleoomnde. Zum Schpelleoomnd koomn hechchßdenz zwaije odder drijje, abber niimoolz d hallbe Värrwoandtschaffd, dißß baßßeerte eer bijm Noamnßdagg un manchmool ae zum Schloachtekool.
Am Schpelleoomnd worrtn eeßdmool d nuuweßdn Nuuwichkaitn vumm Därfe uußgeduuscht. Abber ae oalle Sorjen un Neede, dii jeder saelber sa hotte, aebb mettn Kinnern odder daen Ooln, aebb Gesunnthait, Kochchrezaeppte, Hußß un Hobb odder ß Viizigg, oalleß koom zur Schprooche. Natierlich koomn ae Schtörjerchn, oole Schnurrn un Geschichtn uffeß Drapeez. ß worrte zsammn gelachcht un manchmool ae gehiilt. Dißß gobb daen Liddn Zesammnhoolt, daer kraade im Krijje un in daen Joorn donoo wichdich worr. Bijm Schpelleoomnd worrte abber nitt nuur geschtorjet, manchmool worrtn ae d scheenn ooln Liider gesungn. Ennz worr wichdich, daß d Hännge ae woaßß z duun hottn un nitt nuur ß Muulwaerk. D Wiiweßlidde hann maißd Wesche geflikket un Schtrimmpe geschtobpt odder se hann geknittet. D Mannzlidde hann Koortn geschpeelt, Schkaat, wänn drijje zesammnkoomn. Jenoodaem woaßß in daem Huuse nachch aanschtunn, worrtn ae Faeddern geschleßßn, Bonne uffgeknaifelt, Linnsn uußgelaesn odder Moonkapßeln uffgeschnänn. Dobij hullfn ae d kreßßern Kinner. Wänne Oarwait gedonn worr odder d Uure uff Niine odder manchmool ae uff Zaene schtunn, gungn d Lidde dann hännhaime.
So kinnte eß gewaen sij
Jo, un do kloppdeß uff ennmool anner Kichchndeer un Napperß Lissebettchn koom Schpelle. ß suuß sich naemn n Oomn uffn Hollzkaaßdn un fung glichch ann, d nuuweßdn Noorichdn ußßem Därfe zu värrzeeln. Naemnbij hotte Mudtr n Disch oabgeriemet, Kroßßvoatr hotte mettm Fiddibußß sinnn Muddz aangeschtukket un dann daen dikkn Dabbakkwallm mett Genußß inne Kichchn gebloosn. Kroßßmudtr schtobpte Schtrimmpe un Voatr gunk nachchmool ruuß innn Kieweschtoall, wail Schakke korz värrm Kallmn schtunn. D Kinndr dorfdn nachch n bißßjen uffbliibe un sooßn hebbsch schtille hingerm Dische uff dr Bank un schpiddztn eere Oorn.
No ungefaer enner hallmn Schtunne schprooch Mudtr: „Nunn ässeß abber guud, Lissebettchn, jeddzd lang eeßd mool Lufft, domett de mich nitt vumm Hollzkaaßdn fellßd.“ Druffe Lissebettchn: "Najach, ß maißde haa ich uchch j ae värrzoolt. Abber du kinnteßt mich j mool gefrooge, aebb ich dahaim schonn woaßß gegaeßßn haa!“ Druffe gobb Mudtr aemm n Daelldr mett Katuffl un Soosn, daen se woolwaißlich naemnbij zraechte gemachchd hotte. Lissebettchn hotte imnuu daen Daelldr leergebuddzt, wischte sich ß Muul oab, un sinn Muulwaerk koom aumnplikklich wärre in Schwunnk. Kerr koom z Worrte. Jedeßmool wänn Mudtr aanhoob un saete: „Abber Lissebettchn…“, langete eß korz un diif Lufft un schprooch: „Abber dißß enne mußß ich dich umbedinkt nachch sae!“ Un witter gunkß.
Ungefaer sa imme hallb Niine koom Voatr vunn drußßn rinn un schprooch: „Lissebettchn, nunn ässeß abber genunnk färr hidde. Machch daßßde ennhaim kimmeßd, odder du mußßt mich im Kieweschtoall jeddzd mool haellfe. Schakke schtedd naemmlich korz värrm Kallmn, un ich bruchche waen, daer d Kuu schtraichelt un beruicht. Dobij därfßde abber kenn Worrt schtorje, sißßt wärrd se ß Kallb nitt ruußkrijje!“ Lissebettchn schtunn aumnplikklich anner Kichchndeer un schprooch: „Nae, nae, disse Värrantworrdunk äßß mich dachch z krooß. Do kumme ich libber morjen Oobed wärre un värrzeele, woaßß ich dissn Oobed nitt geschafft haa.“
Dii guude oole Ziit
Nischt kann mich schennder intreßßeere,
Oalz wänn ich woaßß värrzoolt vunn ooln Liddn heere,
Wii ainfach dii friejer gelaebet hann.
Aebb me woll oalleß geklauwe kann?
Abber ß äßß schonn woor un raecht intreßßant,
Mancheß äßß unz j saelber vunn friejer bekannt.
Wii dii sich gekweelt hann un geschunngn,
Un troddzdaem hann se frooe Liider gesungn,
Worrn lußßdich un guuder Dinge,
Kunntn vunner Oarwait kenn Änge finge.
Naachtz imme drije gunkß Draeschn krait looß,
Dißß koßßdete oalln enn Laecheln blooß.
Gedroschn hann se, dasseß Hußß hätt gewakkelt,
Und Finnger, dii hann se bijm Aeßßn gelaekket,
Wail d Katuffelbreezel sa knußberich worrn,
Uffm Oomn drußßn gebakkn, ooße jeder gaern.
S gobb drijje Hoozeln un enn Dibpn vull Muußt,
Un gobbß mool Katuffelkuuchn, worr dißß enn Genußß.
Dann hann se geschpunn, un Kerbe geziirt,
Schtroozeppe geflaechchdet un Schpinnschtommn gefiijert,
Abber nitt birr hunndertkärzijen Beern,
Gott bewoaare, driebe Eellijchter in Schtommn un Hußßeern.
Jo, d Ziidn worrn diijer, un do huußeß schpoare,
D Wiiber machchtn sich Waelln mett dr Brännscheern inne Hoore.
Un Kroßßvoatr suuß uff dr Oomnbank,
Rauchte sinn Muddz un worr kennmool krank.
Un gunk sinn Muddz aemm dachch mool uuß,
Do gommn me aemmß Fijer mettm Fiddibußß.
Un Kroßßmudtr knittete färr unz oalle d Schtrimmpe,
Hätt mett unz Kinndr gesungn, abber kennmool geschimmpet.
Un plaat hann me geschwaddzt, d Ooln, d Kinndr,
Nuur inner Schuule schproochn Hoochdidtsch d Minndr.
Un unse Voatr, daer hätt mett uns gekreelt,
Wänn me z luude uffm Klaweere geschpeelt.
Inne Schuule gunkß maißd mettm drijjen Schtikke Brood,
Dachch doochtn me nii, daß dißß äßß ne Noot.
Un wänn inner Schuulschtunne mool ne Noodl rungerfull,
Do hätt meß gehoort, wailz worr do sa schtill.
Dachch ennmool, do treente sonn Feff därch d Schuule,
Do schprang unse Schulleer glichch uff vunn sinnm Schtuule:
„Wer war das, wer pfiff denn da so?“
Mee Kinndr sooßn oalle wii värrschtainert nur do.
„Du warst es, Mienchen, sag nur nicht nein!“
„Ach, Herr Lehrer, ich baustete bloß mal in das Tintenfass rein!
Und da war uff einmal sa ne große Blauster da,
Und uff einmal, Herr Lehrer, da feif es sa!“
„So, so, da pfeif es sa und ne Blauster war da?
Und ich blaustete hinein?!
Mein Gott, was soll das für ein Hochdeutsch nur sein?!“
Enn Hoochdidtsch sullz sij, abber woasseß färr ennz worr,
Dißß worr daem Mienchen ae nitt goanz kloar.
Schmekkschniißjen
Do wärrd aanduernd vunner guudn ooln Ziit geschwaddzt. Jouwoll, ß hättz j mannd mancher vunn uchch mool meetmachche sulln, aebbß do daadsächlich sa richdich dikke haergunk. Jednfallz hammeß dachch hidde fillichte goarnitt sa schlaechd, wii mancher maint. Gukket mool hänn, d oole Frannsißchn, Gott hätt se krait seelich, dii hotte domoolz n Dröbpchn Junkß, dii hottn immer Kooldammp. Manchmool hätt se oobedz rässeneert, wänn se d gekochchdn Katuffel zum Naachtbroode värrdailte. „Jeder krijjet zwaije, un wail Beeter mich hidde sa dichdich gehullfn hätt, krijjet daer nachch sonn klaineß Illderchn dobij.“ Abber Gehanneß, woaßß daer Aeldeßde worr, daer knutterte äwwer ß eewije Ainerlai un wullte umbedinkt Soolzkatuffel haa. „Jouwoll!“, hättse do gesaet, „Soo enn Schmekkschniißjen, wäll daer ae nachch Soolzkatuffel haa!“
Uußgetrikkßt
Vetter Willaim un dr oole Frannz Wäber troofn sich mool wärre bijm Friseer. Se worrn schonn baide zeemlich oold, abber eere Wipperchn gommn se immer nachch zum Beßßtn. Se trikkßdn sich dobij gaejensiidtich uuß, un mee hottn jedeßmool unsen Schpoaß immesißßt un d Ziit bijm Friseer gunk hänn wii nischt. Ennmool koomß zu disser Sachche:
„Na, Frannz, wii gettz dich daenn? Gaelle, du witt dich ae nachch n baar Waelln mett dr Brännscheern in dinne Fussln bränne looße?" „Na, Wilhelm, i loass mei Kopf mit Bienhonich einreim, woas meinst, wie doa mei Hoaar sprießt. Da kann ichs näschte Wocha wieda kämma!" „Äbberijenz, Frannz, woaßß ich dich schonn immer mool sae wullte. Domoolz, oalz ich in Frankraich inner Gefangnschafft worr, Junge, do hottn se Koolzkeppe - wiin Woaßßeremmer sa krooß. Mett zwai Mann muttn me sonn Koolzkopp uffn Waan heebe. Und Koolzfaelldr, dii worrn soo krooß, wänne do ennmool drimmerimmegelaufn bißßt, do worrß schtokkeraamnnaacht!" „Doas issa nix, Wilhelm. Bei uns daham in Oberschlesien, doa hats a Kesselschmied ghabt, der hoat a Kessel gmacht, so groß wie die Stub hier!" „Na, na, na, Frannz, nunn prool abber hallb so. Woaßß wulltn se daenn mett sonnm krooßn Keßßl machche!" „Ja, weißts, Wilhelm, da wolltns deine Kohlskepp drinna kocha!"
Kreßßde Veersicht gebonn
Michl worrß eeßdemool inner Schtaadt gewaen, un nunn värrzoolte haa daen naechßtn Sunndagg inner Wärrtschafft am Schtammdische dovuune:
„Do mußß me villichchte uffbaßße, lutter Gescheffde, d goanze Schtrooßn lank, un dann waiß me nachch nittmool woaßß daß äßß. Do schtunn ich zum Baischpiile värr sonnm Loadn, daer sogg raecht appedittlich uuß. Manniküre schtunn do draane. Na, doochte ich, daß häßßde ae nachch nitt gegaeßßn. Un do bänn ich rinngegenn. Woaßß maint de woll, do gobbß nischt zum Aeßßn, abber dofeer hann se mich de Fingernaele oabgeschnänn. Ich worr froo, wii ich wärre drußßn worr. Ne Ekkn witter worr nachch sonn Loadn, do schtunn Beddiküre draane, ich do ae rinn. Deijwelnachchmool, daß worr bainlich. Do hann se mich dachch d Zeechnaele oabgeschleffn. Un nachch ne Schtrooßn witter worr en goanz krooßeß Gescheffde mett sonnm krooßn Schille, un do schtunn Wallküre druffe. Do bänn ich abber nitt mee rinn gegenn. Waer waiß, woaßße mich do nachch oabgeschnänn hettn. Drimme äßß d kreßßde Veersicht gebonn, wämme inner Schtaadt ne guude Wärrtschafft siecht.“