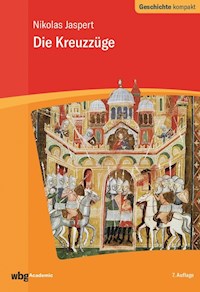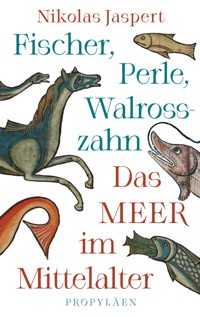
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Meer und Mensch – eine andere Geschichte des Mittelalters Bauern und Ritter prägen unser Bild vom Mittelalter, und bei der mittelalterlichen Seefahrt denken wir an bauchige Hansekoggen und schnelle Wikingerschiffe. Doch was wussten die Menschen über das Meer selbst, über seine Lebewesen? Welchen Nutzen zogen sie aus seinen Rohstoffen? Der Historiker Nikolas Jaspert schreibt die erste Geschichte des Mittelalters von der Warte des Meeres aus: Er erzählt von Fischerei und Walfang, vom Handel mit eleganter Muschelseide, duftendem Ambra und kaiserlichem Purpur. Vor allem aber handelt sein Buch von den Schätzen des Meeres, von ihrer atemberaubenden Schönheit und Vielfalt. Indem Jaspert zum ersten Mal eine ganze Epoche der Menschheitsgeschichte anhand der Lebewesen und Stoffe des Meeres beschreibt, führt er uns eindringlich vor Augen, dass unser Überleben als Spezies nicht zuletzt von diesem Ökosystem abhängt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Korallen, Muscheln und Bernstein, Hering, Wal und Thunfisch: Nikolas Jaspert erzählt von der faszinierenden Beziehung zwischen Meer und Mensch über einen Zeitraum von 1000 Jahren. Indem er zum ersten Mal eine ganze Epoche der Menschheitsgeschichte anhand der Lebewesen und Schätze des Meeres beschreibt, führt er uns eindringlich vor Augen, dass unser Überleben als Spezies nicht zuletzt von diesem Ökosystem abhängt.
Der Autor
Prof. Dr. Nikolas Jaspert, geboren 1962 in Melbourne, lehrt Mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg. Er war mehrere Jahre Präsident der Société Internationale des Historiens de la Méditerranée und ist Mitherausgeber der Zeitschrift für Historische Forschung, verschiedener anderer wissenschaftlicher Zeitschriften sowie der Reihen Mittelmeerstudien und Geschichte und Kultur der Iberischen Welt. Zahlreiche Publikationen zur Geschichte der Kreuzzüge, der Ritterorden, zu christlich-muslimischen Beziehungen und zur Geschichte des Mittelmeeres.
Propyläen wurde 1919 durch die Verlegerfamilie Ullstein als Verlag für hochwertige Editionen gegründet. Der Verlagsname geht zurück auf den monumentalen Torbau zum heiligen Bezirk der Athener Akropolis aus dem 5. Jh. v. Chr. Heute steht der Propyläen Verlag für anspruchsvolle und fundierte Bücher aus Geschichte, Zeitgeschichte, Politik und Kultur.
Nikolas Jaspert
Fischer, Perle, Walrosszahn
Das Meer im Mittelalter
Propyläen
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-3561-2
© Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2025
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagmotive: akg-images / British Library (Fische und Fabelwesen des Meeres. Aus einem Bestiarium, England, 1230-1240) und Yvan Travert (Ausschnitt aus der Bilderdecke der Kirche St. Martin in Zillis, Schweiz, 1130-1140)
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt
Über das Buch / Über den Auotr
Titel
Impressum
Widmung
Das marine Mittelalter: Einleitung
Meer und Mensch
1. Das Meer verstehen
Religiöse Deutungen
Gelehrtes Wissen
Literaturen
2. Vom Meer leben
Fischer
Handwerker und Seeleute, Boote und Schiffe
Kaufleute
Fischverkäufer
3. Fische fangen, verkaufen, essen
Vom Fischverzehr erzählen
Fischspeisen und Speisefische
Methoden und Kontrolle des Fischfangs
Zubereitungen
Reale und fiktive Meereslebewesen
4. Jäger und Gejagte
Hering
Kabeljau
Thunfisch
Sardine
5. Gut und Böse
Nützliche Feinde: Wale
Der Freund des Menschen? Delfine
6. Monster und Mythen
Ambivalente Verführung: Sirenen
Meeresungeheuer
Fischmenschen und Unterwassergesellschaften
7. Wertvolle Zähne und die Macht des Einhorns
Walrosse und Walrosswissen
Das Einhorn und der Narwalzahn
Natternzungen
Schätze des Meeres
8. Muschel- und Schneckenpracht
Perlen
Perlmutt und Muschelseide
Purpur
9. Feine Düfte und Körperpflege
Ambra
Schwämme
10. Sehnsucht dreier Glaubensgemeinschaften: Die Koralle
Wissen und Glaube
Korallen fangen
Marine Luxusprodukte zwischen Christen, Juden und Muslimen
11. Gehärtetes Feuer aus dem Meer: Bernstein
Wundersames Gestein
Wirkung und Verarbeitung
Die Herren des Meeresgolds
12. Der weiße Riese: Salz
Land- und Meersalz
Zentren der Salzwirtschaft
Salz, Steuern, Staat
Meer oder weniger Mittelalter: Eine Einordnung
Literaturliste
Danksagung
Bildteil
Bildnachweis
Nachweis der Karten
Anmerkungen
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Orientierungsmarken
Cover
Inhalt
Textbeginn
For Twinkle, Ding, Toff and Bo
Das marine Mittelalter: Einleitung
Fischer, Perle, Walrosszahn: Das Meer im Mittelalter. Der Titel des Buches soll neugierig machen und dessen Inhalt umreißen. Eine menschliche Berufsgruppe macht den Anfang, weil das Verhältnis unserer Vorfahren zum Meer im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen wird. Aber nicht die in der Forschung allgegenwärtigen Kaufleute des Mittelalters repräsentieren diesen Bezug, sondern die Fischer. Mit ihnen wird angedeutet, dass in diesem Buch Gesellschafts- und Berufsgruppen in den Blick genommen werden sollen, die ebenso sehr wie die Händler oder noch stärker als diese mit dem Meer verbunden waren, auch wenn sie in der Forschung vernachlässigt worden sind. Perle und Walrosszahn wiederum verweisen auf unterschiedliche geografische Räume: auf Meere des Südens und des Nordens. Beide Dinge entstammen Meerestieren, sie geben zu erkennen, dass dieses Buch ebenso von Lebewesen wie von Substanzen des Meeres handelt.
Auch wenn der Untertitel dieses Buches »Das Meer im Mittelalter« heißt, geht es um die Fauna unterschiedlicher Gewässer. Die Untersuchung von Ambra wird in den indopazifischen Raum führen, die von Perlen und Perlmutt in den Persischen Golf, die Darstellung der Koralle und des Schwamms, des Thunfischs und der Sardine in das Mittelmeer, die der Wal-, Herings- und Kabeljauwirtschaft in den Nordatlantik, die der Bernsteingewinnung und -verarbeitung in die Ost- und Nordsee. Nicht »das Meer«, sondern die vielen Meere des Mittelalters gilt es vor Augen zu führen.
Vor allem ist dies eine marine Geschichte. Das bedeutet: Wir schauen vornehmlich in die Unterwasserwelt und auf deren Nutzung durch den Menschen, an zweiter Stelle stehen Entwicklungen der Seefahrt und des Handels. Unsere Perspektive ist damit eher marin als maritim, eher vertikal als horizontal. Damit vertritt dieses Werk entschieden ein »anderes Mittelalter« – nicht nur eines, das Geschichte mit Blick auf das Meer schreibt, sondern mehr noch: ein Mittelalter, das konsequent aus den Tiefen des Meeres erschlossen wird. Eine Untersuchung des Landwesens Mensch mittels des Meeres und seiner Bewohner überprüft geläufige Mittelaltervorstellungen und eröffnet neue Einblicke in eine Menschheitsepoche.
Es lassen sich viele etablierte Felder der Mittelalterforschung identifizieren, die durch die hier verfolgte Perspektivierung neu konturiert werden. Die Ideengeschichte des Mittelalters etwa, die gelehrte Welt der Theologen, Geografen, Naturkundler und Mediziner, erhält ein ganz eigenes Gepräge, wenn deren Wissen um das Meer und seine Tiere ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Gelehrte ordneten Meerestiere in diesseitige wie jenseitige Weltvorstellungen ein und überhöhten sie literarisch. Ähnliches gilt für die Literaturen des Mittelalters, für die Epen, Heiligengeschichten und anderen erzählenden Texte: Einhorn, Sirene und Meermensch, fantastische und natürlich auch reale Meereslebewesen sind ein selten erörtertes, aber, wie wir sehen werden, schillerndes Thema in allen Sprachen Europas und des Nahen Ostens.
Eine marine Perspektive eröffnet auch spezifische Fenster in die Kunstgeschichte des Mittelalters. Sie schärft die Sensibilität für die Verwendung von Meeressubstanzen und -lebewesen in Gemälden, Skulpturen und in anderen Darstellungsformen. Der marine Blick offenbart, wie Meereslebewesen und Substanzen genutzt wurden, um Menschen das Dies- und Jenseits zu erklären. Ob als Naturgegenstände, zu Ketten, Ohrringen oder anderen Schmuckstücken verarbeitet oder als höfische Gebrauchsgegenstände neu gefasst: Das Meer ist auch in seinen Hervorbringungen ein Gegenstand der Kunstgeschichte.
Zugleich aber schärft eine marine Geschichte die Aufmerksamkeit für Materialität im Mittelalter, für die Beliebtheit von Gegenständen, die aus Lebewesen und Substanzen des Meeres geschaffen wurden. Deren Bewertung war stark emotional belegt: War die tiefe See im mittelalterlichen Judentum, Christentum und Islam schon mit Ängsten, gelegentlich auch mit Hoffnungen verbunden, so galt dies auf je eigene Weise auch für einzelne Tiere und Stoffe des Meeres. Auch im Umgang mit ihnen lassen die Quellen Furcht ebenso erkennen wie Faszination, Neugier und manchmal auch Sympathie.
Eine marine Geschichte des Mittelalters wird damit zur Emotionsgeschichte einer Epoche – und zu einer Form von Fremdheitsforschung. Im Mittelalter nämlich blieb das Meer für das Landtier Mensch doch stets das bedrohlich Andere – bei aller räumlichen Nähe der Küstengesellschaften zu ihm, bei aller wirtschaftlichen Abhängigkeit von ihm, bei allem Profit, den es brachte. Diese Einschätzung färbte auch auf die Tiere des Meeres ab. Grundsätzlich von mittelalterlichen Philosophen als das nächste Andere des Menschen angesehen, wurden manchen Tieren höhere Eigenschaften zugeschrieben als anderen. Die Meerestiere blieben dabei in aller Regel fremde Wesen, die aus philosophischer und theologischer Sicht zur moralischen Unterweisung der Menschen herangezogen wurden, wie wir am Umgang mit realen und fantastischen Tieren des Meeres beobachten werden.
Zugleich regte das Meer die Sinne auf unterschiedlichste Weise an, es bietet sich daher als Forschungsgegenstand einer neuen Sinnesgeschichte des Mittelalters an. Die Schätze des Meeres sind multisensorisch. Sie beanspruchen die fünf Sinne mit unterschiedlicher Intensität. Aus Walrosszahn hergestellte Hörner regen den Hörsinn an; aber öfter dürfte der Tastsinn gefordert sein, man denke nur an Meeresschwämme oder an die gerade wegen ihrer Stofflichkeit geschätzten Gebetsketten aus Korallen oder Bernstein. Stärker noch reizen Meerestiere und -stoffe den Sehsinn, sie vermitteln in starkem Maße farbliche Eindrücke. Die See selbst ist blau, Schnecken liefern den begehrten Purpur, Heringe sind als das Silber des Meeres bezeichnet worden, Salz als das weiße, Korallen als das rote Gold. Tatsächlich goldfarben ist Bernstein, und in unterschiedlichen Farben schillernd treten uns schließlich Perlen und Perlmutt entgegen.
Und sogar vor dem Sehen dürfte in der Hierarchie der Sinne der Geruchssinn stehen: Die Purpurherstellung etwa geht mit beträchtlicher Geruchsbelästigung einher, die Frische der Fische wird vor allem nach ihrem Geruch beurteilt, dieser verändert sich bei der Konservierung. Auch bei anderen marinen Produkten lassen sich olfaktorische Wandlungen beobachten: Frische Ambra riecht bei ihrer Auffindung völlig anders als nach ihrer Oxidation. Ihre besondere Wertschätzung für die Parfumindustrie in der islamischen Welt und Byzanz lenkt den Blick auf die Körperpflege und die vergleichende Geschichte der Hygiene im Mittelalter – und nuanciert damit geläufige Vorstellungen vom »dreckigen Mittelalter«.
Aber an erster Stelle unter den fünf Sinnen steht aus mariner Sicht der Geschmackssinn: Viele organische Substanzen des Meeres wurden – zerstoßen, zerrieben, verbrannt oder aufgelöst – als Medizin eingenommen, und vor allem wurden Meerestiere in großen Mengen als Nahrung verzehrt. Dieses Buch ist daher auch ein Beitrag zu einer Geschichte des Kochens und Essens im Mittelalter. Lateinisch-, arabisch-, romanisch- und deutschsprachige Kochbücher zeigen, wie schillernd diese Welt ist, und lenken den Blick auf die Sozialgeschichte des Mittelalters. Auch für sie eröffnet die marine Perspektive neue Einsichten – in höfische Kulturen und gesellschaftliche Distinktion, in die Zurschaustellung wundersamer Meereserzeugnisse und in Ängste vor Vergiftungen. Aber nicht nur Eliten, auch Gesellschaftsgruppen am unteren Ende der sozialen Skala wie die an der Fischwirtschaft Beteiligten, die Tagelöhner, die Sklaven treten bei einer marinen Betrachtung in den Blick. Zu diesen in der Wirtschaftsgeschichte noch immer oft übersehenen Gruppen gehören auch die Frauen, deren Beteiligung an der Fischereiwirtschaft immer wieder zu beobachten sein wird.
Die Handelsgeschichte des Mittelalters wiederum erfährt durch einen marinen Zugang ebenfalls Anregungen, weil er den Blick von prominent erforschten Fernhandelsgütern wie Textilien und Luxusprodukten auf weniger berücksichtigte, aber wirtschafts- und alltagsgeschichtlich enorm bedeutsame Massenwaren wie Fisch oder Salz lenkt. Dieses Buch analysiert daher einen spezifischen Bereich der Wirtschaftsgeschichte: Es ergründet, welche ökonomischen Potenzen des Meeres auf welche Weise genutzt wurden.
Ähnliches gilt für die Technikgeschichte, wird deren traditionelle Beschäftigung mit der Nautik doch um Erörterungen zu Netzen, Reusen etc. ergänzt. Schließlich die Politik- und Verwaltungsgeschichte: Herrschaftliche Monopolbildung und der Ausbau des Steuerwesens (am Beispiel von Bernstein und Salz) werden danach befragt, was Macht über Meer und Küste bedeutete, welche Konkurrenzen das Ringen um marine Ressourcen hervorbrachte und durch welche Maßnahmen und Institutionen weltliche Herrschaftsträger im mittelalterlichen Jahrtausend das Meer zu erschließen versuchten.
Eines werden die Quellen deutlich zeigen: Die Menschen des Mittelalters hatten eine klare Vorstellung von ökologischer Nachhaltigkeit. Sie waren sich darüber bewusst, dass Überfischung zu einer Minderung der Artenvielfalt oder sogar zum Verlust einzelner Spezies führen kann. Und sie handelten entsprechend, wie Regelungsversuche im Bereich der Fischerei bezeugen. Offenbar war es nicht so, dass das, was gemeinsam benutzt, auch gemeinsam vernachlässigt wurde, oder dass die Verfügbarkeit von Fluss oder Meer notwendigerweise zu deren übermäßiger Ausbeutung führen musste. Es gab Widerstand gegen Netze, die allzu großen Beifang verursachten oder die Bestände einzelner Arten zu stark minderten; man entschied rational darüber, wie viel und mit welchen Methoden gefischt werden sollte, und man schützte gezielt einzelne Fischarten. Offenbar besaßen die Menschen des Mittelalters sehr wohl ein entwickeltes Problembewusstsein für die Fragilität der erneuerbaren Ressource Fisch, vielleicht sogar eine sensiblere Vorstellung als viele moderne Gesellschaften mit ihrem Streben nach grenzenloser Ausbeutung. In der Tat: Wir konnten auch anders.1
Aber das Mittelalter war keine Epoche besonderer Tierliebe, und dies galt auch für den Umgang mit Meereslebewesen.2 Philosophie und Theologie lehrten, dass Tiere geschaffen worden waren, um vom Menschen genutzt zu werden. Meereslebewesen wurden im Mittelalter nicht wegen ihrer Schönheit gehalten, noch weniger waren sie den Menschen Freunde. Sie wurden ausgebeutet, gejagt, getötet und verzehrt. Genauso wenig wollen wir bei aller Fokussierung des Meeres vergessen, dass das mittelalterliche Denken und Handeln das Land den Gewässern vorzog; dies wird durch Auswertungen unterschiedlicher Texttypen immer wieder deutlich werden.
Zugleich aber prägten das Meer und seine Lebewesen menschliche Gesellschaften stärker als gemeinhin angenommen, und die Verflechtungen zwischen den Menschen und den Meerestieren waren enger als oftmals vermutet. Es gehört schon längst zu den Grundannahmen einer maritimen Geschichtsforschung, dass Meere nicht nur trennten, sondern auch verbanden. Dieses Buch wird zeigen, dass dies auch auf die Lebewesen und Substanzen des Meeres zutrifft. Zuerst mit Blick auf die hier behandelten Tiere selbst: Insbesondere Fische durchqueren nicht nur ganze Meere, sondern können auch von einem Meer zum anderen migrieren. Verflochten waren aber auch die Menschen, denen Meereslebewesen Anlass zum Austausch über weite Entfernungen und über politische bzw. religiöse Grenzziehungen hinweg gaben.
Dieser Austausch umfasste Migration und Handel ebenso wie Literatur und Philosophie. Christliche Korallenfischer gingen ihrer Tätigkeit in islamisch beherrschten Ländern nach, mitteleuropäische Heringsfischer zogen alljährlich in den Norden zur Saisonarbeit, die Welt der mittelalterlichen Fischereiwirtschaft war eine der grenzüberschreitenden Migration. Nicht minder verflochten waren die Handelsräume marinen Warenaustauschs. Der schonische Hering war ein Verkaufsschlager, der über Tausende Kilometer hinweg über Land und Wasser in Massen vertrieben wurde, ebenso wie Salz, Sardinen, Kabeljau und Thunfisch. In geringeren Mengen, aber nicht weniger grenzüberschreitend gelangten Ambra, Perlen und Perlmutt aus dem Indopazifik und dem Persischen Golf an die Meerenge von Gibraltar und darüber hinaus in den Ostatlantik und in die Länder der Nord- und Ostsee. Mediterrane Korallen und Schwämme waren im Orient ebenso populär wie im lateinischen Westen, baltischer Bernstein gelangte bis nach China. Dieses Buch ist eine Verflechtungsgeschichte.
Das gilt auch für das Nachdenken über Substanzen und Meereslebewesen: In jüdisch, christlich und islamisch geprägten Gesellschaften gleichermaßen fußte die philosophische und theologische Beschäftigung mit den Dingen des Meeres auf antiken Grundlagen. Dieses etablierte Wissen wurde im Mittelalter übersetzt, kommentiert und rezipiert. Gerade arabischsprachige Erkenntnisse jüdischer, orientchristlicher und muslimischer Gelehrter überquerten durch Glaubenslehren gezogene Grenzen. Zugleich offenbart der vergleichende Blick auf die lateinische, griechische, hebräische und arabische Welt bei allem Austausch auch Eigenheiten, etwa hinsichtlich der Wertschätzung gewisser Düfte oder der Bedeutung von Fastenzeiten.
Dieses Buch ist geschichtswissenschaftlich orientiert und stützt sich vorrangig auf mittelalterliche Textquellen unterschiedlicher Gattungen: auf Verwaltungsschriftgut, Literatur, diplomatische Korrespondenz, Briefe, literarische, theologische und naturwissenschaftliche Schriften. Das für diese Studie zusammengestellte und ausgewertete Quellencorpus stammt vorrangig aus den christlich geprägten Gebieten Europas, es umfasst aber auch viele Texte muslimischer und jüdischer Autoren aus der arabischen Welt des Mittelalters.
Der doppelte Perspektivwechsel vom Land auf die See und vom Menschen auf die Meereslebewesen bedeutet, disziplinäre Fachgrenzen zu überschreiten, über das engere Feld der Geisteswissenschaften hinauszugehen und von den Erkenntnissen der Naturwissenschaften zu lernen. Das Buch knüpft daher Verbindungen zwischen Geschichtswissenschaft, Meeresbiologie und Geografie.
Besonders folgenreich sind die dynamischen Entwicklungen in der Zooarchäologie. Die Schnittstellen zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften werden seit mehreren Jahrzehnten durch innovative Forschungsmethoden gestärkt. Isotopenanalysen und andere Untersuchungsmethoden vermitteln wichtige Impulse, die dank Verfeinerungen der Methoden und Erweiterungen des Datenmaterials an Verlässlichkeit noch weiter gewinnen werden.
Besonders wertvoll sind diese Instrumente in den Regionen und für die Zeiten, in denen schriftliche Zeugnisse rar sind. Die Dynamik des Forschungsfeldes hat zu einer beachtlichen Zunahme zooarchäologischer Studien, Zeitschriften, Datenbanken, Arbeitsgemeinschaften und Verbundforschungsinitiativen geführt. Diese rege Fachgemeinschaft bleibt derzeit weitgehend unter sich, ihre wichtigen Forschungserträge werden von der allgemeinen Mittelalterforschung zu wenig zur Kenntnis genommen. Ein Anliegen dieses Buches besteht darin, zu einem Gespräch über die Disziplinen hinweg beizutragen.
Die vorliegende Untersuchung behandelt weder alle Meere der Welt noch all ihre Gesellschaften in der Epoche zwischen 500 und 1500 unserer Zeitrechnung.3 Der Fokus liegt auf dem lateinischen und griechischen Christentum, der arabisch-muslimischen Welt und dem Judentum des sogenannten euro-mediterranen Raums und seiner Meere. Das heidnische Skandinavien und die slawische Welt spielen demgegenüber eine untergeordnete Rolle. Das bedeutet: Es geht um die Nord- und Ostsee, den Nordostatlantik und das Mittelmeer, den Indopazifik und die Arabischen Meere, in geringerem Maße um das Schwarze Meer. Diese Gewässer ermöglichten Kontakte zwischen den Ländern Nordeuropas und des Südens, sie verknüpften die mediterranen Regionen Südeuropas mit denen Nordafrikas und Westasiens, sie machten die Arabische Halbinsel und Ostafrika zu Nachbarn des indischen Subkontinents.
Die Meere und ihre Küsten unterscheiden sich stark voneinander, was Folgen für die Nutzung durch den Menschen und für dessen Siedlungsaktivitäten hatte.4 Die Topografie der Küsten wirkt sich auch auf das Leben im Meer aus. Tektonische Kräfte schufen vor Jahrmillionen auch unter Wasser Gebirge und Täler, Gletscher formten während der Eiszeit Landschaften, die heute vom Meer bedeckt sind, Vulkanaktivitäten veränderten das Gelände. Nicht minder wichtig für das marine Leben sind Faktoren wie Strömungen und Winde. Sie haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Temperatur und den Salzgehalt das Meereswassers, sie verursachen Wasserzirkulationen, die in horizontaler wie in vertikaler Richtung verlaufen können und für den Austausch von Wassermassen sorgen.
Diese Strömungen wiederum wirken auf die Lebewesen ein, denn Vorkommen, Verteilung und Diversität von Meerestieren werden in starkem Maße durch Tiefe, Temperatur und Zusammensetzung des Wassers bestimmt. Wärmere Wassertemperaturen begünstigen zum Beispiel die Entstehung von Plankton – Kleinstlebewesen, die als Grundlage der marinen Nahrungskette dienen: Pflanzliches Plankton (Phytoplankton) wird von tierischem Plankton (Zooplankton) verzehrt, das die Ernährungsgrundlage größerer Meerestiere darstellt, die ihrerseits Glieder der sich fortsetzenden Nahrungskette sind.
Die spezifische Wassertemperatur des Nordostatlantiks vor den Lofoten zum Beispiel bedingt eine hohe Dichte an Kleinstlebewesen und macht diese Region für den Kabeljau zu einem besonders attraktiven Laichgebiet – und für Menschen zu einem bevorzugten Ort des Fischfangs. Vergleichbare Faktoren sind für die hohe Artendichte der galicischen Küsten, des Golfs von Biskaya und anderer Zonen intensiver Fischereiwirtschaft verantwortlich. Umwelteinflüsse verändern die jährliche Migration von Fischarten, die zum Laichen küstennahe Regionen aufsuchen, und wirken sich auf die Menschen aus, die zum Beispiel auf das Ausbleiben gewisser Fischarten oder auf den Wandel ihrer Wanderrouten reagieren müssen (vgl. Karte S. 106).
Nicht alle Schätze des Meeres sind dem Menschen zugänglich. Im nordöstlichen Atlantik und im Mittelmeer zum Beispiel lassen sich die ca. 1100 Fischarten grob in solche unterteilen, die nahe der Wasseroberfläche leben und daher für den Menschen erreichbar sind, und die in größerer Meerestiefe lebenden Tiere.5 Von großer wirtschaftlicher und ökologischer Bedeutung sind die vom Meer bedeckten Randbereiche der Kontinente, die Schelfe – bis zu 200 Meter tiefe Übergänge zur tiefen See und das aquatische Gegenüber der Küstengebiete. Sie sind die Kontaktzonen zwischen marinem und menschlichem Leben6 und waren das Betätigungsgebiet der mittelalterlichen Fischer (Abb. 9).7
Jedes in diesem Buch behandelte Lebewesen bzw. jede Substanz des Meeres wird aus vier Blickwinkeln untersucht, deren Relevanz in den jeweiligen Kapiteln variieren kann. Die erste dieser Perspektiven liefert eine naturwissenschaftliche Hinführung – im Falle eines Tieres etwa eine Darstellung seines Habitats, seiner biologischen Eigenheiten, seiner Lebensformen, seines geografischen Vorkommens etc. Dabei wird die mittelalterliche Situation mit der gegenwärtigen verglichen, um Verschiebungen und Verluste marinen Lebens vor Augen zu führen und die Spezifika des Mittelalters erkennbar zu machen.
Ein zweiter Blickwinkel fokussiert menschliche Deutungen des behandelten Lebewesens oder Stoffs, insbesondere deren Stellung innerhalb christlicher, aber auch muslimischer und jüdischer Ordnungssysteme. Vor allem Sammlungen gelehrten Wissens wie Naturkunden oder Enzyklopädien werden auf Erwähnungen mariner Lebewesen und Substanzen hin überprüft. Diese weithin anerkannten Autoritäten liefern Hinweise darauf, welchen Schätzen des Meeres im christlich beherrschten Latein-Europa, im Judentum und in der islamisch geprägten Welt (dem Dār al-Islām) Potenzen, Symbolcharakter und damit Zeichenkraft zugeschrieben wurden.
Ein dritter, vorwiegend wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Zugang fragt nach der Gewinnung von Fischen und Substanzen durch Fang, Sammeln, Abbau, aber ebenso nach deren Vertrieb. Wir wollen erfahren, wie die Schätze des Meeres eigene Berufs- und Gewerbezweige hervorbrachten, zum Aufstieg von Gruppen und Gesellschaften, von Städten oder Regionen führten. Ebenso interessieren die Folgen beim Ausbleiben oder beim Rückgang gewisser Ressourcen bzw. beim Zusammenbruch von Handelsketten.
Eine vierte und letzte Perspektive folgt einem materialsensiblen Zugang zum Thema Mensch und Meer: Hier stehen die mittelalterlichen Sachzeugnisse im Vordergrund des Interesses – also die Artefakte, die aus den Rohstoffen des Meeres hergestellt, und die Bildnisse, die von ihnen geschaffen wurden: die heute vorwiegend in Museen befindlichen Gemälde und die Erzeugnisse aus Walross- und Narwalzahn, aus Perlen und Perlmutt, aus Korallen und Bernstein etc. Damit ist das Buch jüngeren kulturwissenschaftlichen Initiativen verpflichtet, Geschichte anhand von Objekten zu schreiben.8 Es greift solche Ansätze auf und unterscheidet sich zugleich von ihnen, indem es weniger herausragende Einzelgegenstände betrachtet als vielmehr das Material, aus dem diese gefertigt wurden, und den Blick auf die aquatische Herkunft dieser Dinge lenkt. Damit wird, so hofft der Autor, das Bewusstsein für die fundamentale Abhängigkeit des Menschen vom Meer geschärft.
Meer und Mensch
Abb. 1. Duccio di Buoninsegna, Christus ruft die Fischerapostel Andreas und Petrus (ca. 1308–1311).
1. Das Meer verstehen
Die meisten Menschen des Mittelalters kannten das Meer nicht aus eigener, täglicher Anschauung. Es war vielmehr ein Raum ihrer Vorstellungswelt, durch Erzählungen, Bilder und Texte geschaffen. Die Grundlagen dieser Vorstellungen vom Meer entstammten teils dem religiösen Bereich, teils volkstümlichen Geschichten, teils der Gelehrtenkultur. Während mündlich weitergegebene Schilderungen größtenteils untergegangen sind, vermitteln die Kunst und mehr noch die schriftliche Überlieferung Einblicke in die Formen, wie mittelalterliche Menschen das Meer verstehen konnten.1 Dass diese Vorstellungen sich je nach Bildungshintergrund, sozialer Gruppenzugehörigkeit und Geografie unterschieden haben dürften, liegt auf der Hand.
Religiöse Deutungen
Die drei abrahamitischen Religionen – Judentum, Christentum und Islam – beruhen wesentlich auf kanonischen Texten, in denen das Meer keine prominente Rolle spielt. Doch an einigen wenigen Stellen gehen sie auf die Gewässer und ihre Bewohner ein. Nicht nur das: Diese Texte tragen implizit oder explizit Wertungen marinen Lebens in sich, die sich als folgenreich erweisen sollten. Sie reichen von grundsätzlicher Ablehnung bis zu großer Akzeptanz, von maximaler Ferne zu unmittelbarer Nähe – Meereslebewesen können in diesen Texten das Eigene symbolisieren, aber ebenso das radikal Andere, ihre Bedeutungen sind ambivalent.2
In der Hebräischen Bibel, die aus christlicher Sicht als das Alte Testament bezeichnet wird, spielen die Fische des Meeres keine besonders bedeutende Rolle.3 Dies kann nicht wirklich überraschen, denn das Judentum war in seinen Ursprüngen weniger maritim als terrestrisch geprägt. Bezeichnenderweise sind es keine Juden, sondern die andersgläubigen Einwohner der Hafenstadt Tyrus, die nach dem Buch Nehemiah (13:16) am Sabbat Fische von der Küste ins Binnenland, nach Judäa und Jerusalem, bringen. Während im Alten Testament gelegentlich der Fang von Süßwasserfischen erwähnt wird (Ez 26:5; 47:7–11), werden die Tiere des tiefen Meeres in den Schriften als tendenziell bedrohlich dargestellt. Erinnert sei an den furchterregenden Leviathan aus den Psalmen (104:26 und 74:14) und dem Buch Hiob (40–41), der in der Bibelauslegung im Laufe der Jahrhunderte zunehmend als Meeresungeheuer interpretiert wurde; oder an den »großen Fisch«, der den Propheten Jona verschlingt und ihn drei Tage in seinen Eingeweiden trägt (Jona 1–2).4
Selbst Süßwasserfische können nach Ausweis der Hebräischen Bibel gefährlich sein, wie die Geschichte von Tobias (Tob 6:1–5) zeigt, der an den Ufern des Tigris von einem aggressiven Fisch bedroht wird. Doch tötet er ihn und nutzt dessen Leber, Herz und Galle auf Anraten seines Begleiters, des Erzengels Rafael, um mit ihnen Dämonen zu vertreiben, dem Tod zu entgehen und letztlich Sara als Frau zu gewinnen (Tob 6–8). Die Skepsis gegenüber dem Meer und seinen Bewohnern wurde im Alten Testament auch bildhaft aufgegriffen. So etwa in Habakuk 1:14–17, wo das Böse oder gar der Teufel als unheilvoller Menschenangler konstruiert wird (»Sie ziehen alles mit der Angel heraus und fangen es mit ihrem Netz und sammeln es mit ihrem Garn. Darüber freuen sie sich und sind fröhlich«). Und natürlich hielt die Geschichte der Sintflut das Bewusstsein für die potenzielle Zerstörung ganzer Gesellschaften oder sogar der gesamten Menschheit wach.
Am deutlichsten wird der Vorbehalt gegenüber gewissen marinen Lebewesen im Judentum an den Speisevorschriften erkennbar, die unreine von reinen Speisen abgrenzen und dabei auch auf Meerestiere eingehen. Nach Levitikus 11:9–12 und Deuteronomium 14:9–10 dürfen schuppen- und flossenlose Meerestiere nicht gegessen werden: Damit ist Menschen jüdischen Glaubens unter anderem der Verzehr von Delfinen, Aalen, Meeresfrüchten, Kopffüßern (etwa Tintenfischen), Krebsen usw. verboten.
Im Neuen Testament des Christentums wurden ältere Ängste vor den Gefahren des Wassers wachgehalten: Auf dem See Genezareth bedroht ein Sturm das Leben der Jünger, bis Christus ihn auf wundersame Weise besänftigt (Jo 6:16–21; Mt 8:23–27). Auch Kapitel 27 der Apostelgeschichte erzählt von einem fürchterlichen Sturm, der im östlichen Mittelmeer den als Gefangenen nach Rom fahrenden heiligen Paulus und seine 270 Mitinsassen überkommt. Die Seeleute werfen die Ladung über Bord, um nicht unterzugehen; dank Gottes Hilfe bleiben aber alle Passagiere (wie von Paulus prophezeit) am Leben.5
Bei der Lektüre des Neuen Testaments begegnet man auch den Schätzen des Wassers. Es fällt nämlich auf, dass Fische – insbesondere Süßwasserfische – und Fischfang in den Evangelien eine herausgehobene Rolle spielen (Abb. 1). Nicht weniger als vier Jünger Christi – Simon Petrus, Andreas, Jakobus (der Sohn des Zebedäus) und Johannes – lebten als Fischer am See Genezareth (Mt 4:18–22; Mk 1:16–20), und dieses Binnengewässer ist auch der Ort, an dem Christus Wunder gewirkt und den Fischern reichen Fang beschert haben soll (Lk 5:1–11; Jo 21:3–14). Ganz in dieses Bild passt es, dass verschiedentlich die Evangelien vom gemeinsamen Fischverzehr der Apostel und ihren frühen Begleitern erzählen (Lk 24:42; Jo 21:9; 21:13; Mk 6:38).
Die frühen Christen ergänzten dieses Erbe um weitere Zuschreibungen, etwa indem sie eine folgenreiche zeichenhafte Verbindung der neuen Glaubensgemeinschaft und ihres Heilands mit den Tieren des Meeres schufen:6 Christus selbst wurde nämlich mit dem Wort Ichthys = Fisch belegt, weil sich die fünf griechischen Buchstaben des Wortes als Anfangsbuchstaben der Formel »Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser« (ἸησοῦςΧριστόςΘεοῦΥἱόςΣωτήρ) lesen lassen. Dieses Akronym des Fisches wurde im frühen Christentum sowohl in sprachlicher Form als auch bildlich verwendet. Es findet sich auf Grabstelen, aber auch in vielen anderen frühchristlichen Zeugnissen.7 Ob es in Zeiten der Verfolgung als Erkennungsmerkmal unter Glaubensbrüdern und -schwestern, als ein Geheimzeichen diente, ist ungewiss. Aber in den ersten vier Jahrhunderten des Christentums symbolisierte der Fisch zweifellos Christus, bevor andere Tiere, insbesondere das Lamm, diese Funktion übernahmen.8
Nach dem Siegeszug des Christentums wurde die »ichthyologische« um allegorische Zuschreibung erweitert: Christus wurde in frühchristlichen Werken selbst bildhaft mit einem Fisch verglichen, weil er ohne Sünde geblieben sei – wie ein Meerestier trotz der Tiefe des Wassers am Leben bleibe.9 Noch bekannter ist der aus Matthäus 4:19 (»Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern machen!«) überlieferte Vergleich Jesu mit einem Fischer: Wie dieser mit seinem Netz die Meerestiere fange, so gewönnen der Heiland und seine Jünger die Seelen der Menschen. Das allegorische Denken erlaubte solch scheinbare Widersprüche: Christus war zugleich Fisch und Fischer, Lamm und guter Hirte.
Ganz aus dem Alltag ist auch das Bild bei Matthäus 13:7–48, wo es heißt, dass im Himmelreich alle wie in einem Netz versammelt würden, um dann die Bösen und die Gerechten zu scheiden wie genießbare und ungenießbare Fische. Texte und bildliche Darstellungen des Mittelalters feierten Christus folglich als »Seelenfischer«.10 Das Meer war auch für die Ausbreitung der neuen Glaubensgemeinschaft relevant, denn diese vollzog sich ganz wesentlich über das Meer. Die Apostel und ihre Anhänger nutzten die Konnektivität des Mittelmeeres für ihre Reisen entlang der Küsten und von Insel zu Insel.11 Die Geschichte der frühen Christen erlangt daher ein ganz eigenes Gepräge, wenn man sie aus der Perspektive des Meeres betrachtet.
Die dritte abrahamitische Glaubenstradition, der Islam, hatte wie das Juden- und Christentum ihren Ursprung nicht in einer Küstenregion, sondern im Binnenland des arabischen Hidschāz. Doch werden die Lebewesen des Meeres im Koran durchaus erwähnt, so in Sure 5:96, wo ausdrücklich der Fang und der Genuss von Fisch gutgeheißen werden (»Erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und [all] das Essbare aus ihm als Nießbrauch für euch und für die Reisenden«), denn nach Sure 16:14 habe Allah den Menschen »das Meer dienstbar gemacht […], damit ihr frisches Fleisch daraus esst und Schmuck aus ihm hervorholt«.12 Zwar ist auch im Koran verschiedentlich von den Gefahren des Meeres die Rede (Sure 10:22–23; 17:67–69; 24:40; 44:24), und auch ein Hinweis auf das Abenteuer des Jona findet sich in ihm (Sure 37:142).13 Doch wird hier viel häufiger als im Alten und Neuen Testament auf den Seehandel und die Reichtümer verwiesen, welche auf dem Meer zu erlangen sind (vgl. etwa Sure 14:32; 16:14; 18:79; 22:65; 31:31; 42:32; 45:12; 55:29).14 Der Siegeszug des Islam seit dem 7. Jahrhundert führte dazu, dass auch viele Küstengesellschaften des Mittelmeerraums die neue Lehre annahmen und das Meer bzw. seine Lebewesen noch mehr zu einem festen Bestandteil der islamischen Welt wurden.15
Neben dem Koran ist die Sunna des Propheten die bedeutendste Grundlage des islamischen Rechts. In dieser nehmen die Hadithe, die gesammelten Aussprüche und Handlungen des Propheten Muhammad bzw. herausragender Dritter, eine wichtige Stellung ein. Auch die Hadithe beinhalten Hinweise auf das Meer im Allgemeinen und seine Fauna im Besonderen, sie wirken wegen ihres normativen Charakters maßgeblich auf islamische Gesellschaften ein. So schildert die in besonders hoher Wertschätzung stehende Hadith-Sammlung des Sahīh al-Buchārī (gest. 870), Das umfassende Gesunde (al-Ǧāmiʿ aṣ-ṣaḥīḥ), wie die Prophetenschaft Muhammads mit der Frage auf die Probe gestellt wurde, was wohl die erste Mahlzeit sei, die Neuankömmlinge im Paradies einnähmen – denn diese Frage könne nur ein Prophet korrekt beantworten. Muhammad erwidert, es handele sich um ein gutes Stück Fischleber, worauf sein Gegenüber bezeugt, er sei in der Tat der Gesandte Gottes.16 Der Text belegt die Wertschätzung des Fisches als Nahrungsmittel in der Gemeinschaft der muslimischen Gläubigen (der »Umma«) und verstärkt sie zugleich.
Mittelalterliche Fortentwicklungen
Wie wurden die in den Anfangszeiten und in den fundamentalen Schriften der drei abrahamitischen Religionen grundgelegten Haltungen zum Meer in den darauffolgenden Jahrhunderten des Mittelalters aufgegriffen und fortentwickelt? Der karolingerzeitliche Gelehrte Hrabanus Maurus (gest. 856) fasste in seinem Werk De Universo Auslegungen der marinen Welt zusammen, wie sie den heiligen Texten des Christentums entnommen werden konnten.17 Hrabanus verstand das Meer als einen Ort, der eine Vielzahl an Lebewesen, darunter auch Monster und übergroße Tiere, hervorbringen könne. In Anlehnung an Matthäus 13:47–48 verglich er die Kirche mit einem großen Netz, das alle Menschen anziehe, um dann die Guten von den Schlechten zu trennen.
Die Unterscheidung zwischen Vögeln und Fischen aus Psalm 8:9 wiederum interpretierte Hrabanus als einen Hinweis auf die Philosophen, die sich nicht wie stolze Menschen in die Lüfte schwängen, sondern wie Fische mit Neugierde für die Welt und gesenkten Köpfen, in schwerer Arbeit und mit Verstand den Sachen auf den Grund gingen.18 Die Apostel werden in Anlehnung an Matthäus 4:19 schließlich als »Fischer des Evangeliums« bezeichnet, Christus selbst als ein Fisch, der im Feuer der Drangsal gebraten worden sei (Lk 24:42).
Spätere christliche Autoren entwickelten diese Deutungen über die Jahrhunderte fort.19 Der Fisch wurde als Symbol des Geistes ausgelegt, als Speise der Armen. Am Fisch lässt sich damit beobachten, was für Darstellungen der Tierwelt im Mittelalter allgemein gilt: Die meisten Tiere können in den Auslegungen der Zeitgenossen sowohl positive als auch negative Bedeutungsträger sein.20
Ähnlich ambivalent wird das Meer verstanden, als ein Sinnbild des Himmels und der Auferstehung21 wie auch als ein Ort der Gefahr, was die Sintflut überdeutlich zeigt. Von einigen Autoren des früheren Mittelalters wird es sogar unmittelbar mit dem Dämonischen verbunden und in Sonderheit mit der Hölle assoziiert.22 Das Meer verschluckt seine Opfer, gelegentlich tun dies auch die in ihm lebenden Tiere wie der Wal. Nach der Vita des heiligen Amandus, Bischof von Maastricht (gest. um 675), bricht sofort ein schrecklicher Sturm aus, als die Fischer eines Bootes, auf dem der Gottesmann reist, einen großen Fisch fangen – offenbar steht das Tier mit dem Teufel im Bunde.23 Folgerichtig wurden die Tiefen des Meeres von Theologen des früheren Mittelalters nach religiösen Gesichtspunkten hierarchisiert: Auf dem Meeresboden lebten Tiere, die als Sinnbilder der Sünde und der Verdammnis gesehen wurden, die an der Meeresoberfläche symbolisierten hingegen jene, die dem spirituellen, gottgefälligen Leben nahe stünden.24
Im Mittelalter wurden die biblischen und nachbiblischen Schriften, die mitunter von Seereisen der Apostel und Jünger erzählen, um hagiografische Quellen erweitert – also um Schriften und Artefakte, die das Leben und Wirken der Heiligen schildern und deren Kult begründeten oder verstärkten. Griechische und lateinische Texte erzählen von Heiligen, die vor Seeräubern schützen, Schiffe an der Weiterfahrt hindern, die Stürme besänftigen oder im Gegenteil Unwetter heraufbeschwören.25 Andere Texte schildern, wie der Leichnam eines Heiligen oder Teile seines Körpers über das Meer transportiert werden und an einem neuen Ort kultische Verehrung erlangen.26 Apostel wie Markus und Jakobus der Ältere, aber auch Heilige wie Nikolaus von Bari27 sind nur besonders berühmte Beispiele solcher hagiografischer Meeresreisen, die in der europäischen Kunst einen breiten Niederschlag erfuhren.28
Manchen dieser Heiligen wurde auch nach ihrem Tod eine besondere Wirkmacht auf den Meeren beigemessen. Jesus hatte Wind und Wasser besänftigt, als seine Jünger auf dem See Genezareth in Seenot gerieten. Einigen Heiligen wurden ähnliche Kräfte zugeschrieben. Seit dem 9. Jahrhundert im griechischen Christentum und in der Folge auch in Latein-Europa weit verbreitet war der Kult des heiligen Nikolaus als Beschützer der Seefahrer.29 Bildliche Darstellungen zeigen ihn als himmlischen Helfer, der aus den stürmischen Wolken Schiffbrüchigen zu Hilfe eilt. Ein Gemälde Gentiles da Fabriano (gest. 1427) aus dem Jahr 1425 etwa vermittelt die Dramatik der Situation (Abb. 2): Die Reisenden haben Waren über Bord geworfen, um die Last zu verringern und vielleicht doch das Kentern zu verhindern, aber vergebens. Das Schiff fährt seinem Untergang entgegen, als plötzlich aus himmlischen Höhen der Retter herbeieilt: der heilige Nikolaus im vollen Bischofsornat.
Abb. 2. Gentile da Fabriano, Errettung durch den heiligen Nikolaus von Bari (1425).
Ähnliche Wirkmacht zur See wurde dem heiligen Nikolaus von Tolentino und dem heiligen Rainer (Ranieri Scacceri, gest. 1160) zugeschrieben, einem Kaufmannssohn aus Pisa, der ein gottesfürchtiges Leben in der Levante und in seiner Heimatstadt führte und vor allem von seinen ehemaligen Berufsgenossen verehrt wurde, weil er angeblich gegen Stürme und die Angriffe muslimischer Seeräuber schützen konnte (Tafel 1).30 Die Wirkung des Bischofs von Bari, des Kaufmannssohns aus Pisa und anderer Heiliger zur See wurde nur von derjenigen Marias übertroffen, der verehrtesten aller maritimen Helfer und Helferinnen.31
Zugleich verdeutlicht die Anrufung der Heiligen in der Not einmal mehr, dass die mittelalterlichen Menschen das Meer in erster Linie als Bedrohung und Gefahr verstanden, selbst wenn es wirtschaftliches Auskommen und sogar Reichtümer versprach.32 Vorannahmen romantischer »Landtreter«, wonach Küstengesellschaften eine tendenziell positivere Einstellung zum Meer pflegten als Gesellschaften des Landesinneren, gehören kritisch überprüft. Denn gerade die Küstenbewohner gaben sich über die Gefahren des Meeres keinen Illusionen hin.33 In Dithmarschen an der Nordsee zum Beispiel sah man die Natur, mit der man täglich konfrontiert war, nicht nur mit Respekt und Angst, sondern sogar mit Ablehnung und Feindschaft,34 und auch an anderen Orten fürchteten gerade die Seeleute das Meer.35
Mit guten Gründen riefen Matrosen und Reisende des Mittelmeeres im späteren Mittelalter, sobald sie das sichere Land aus den Augen verloren, voller Sorge und mit speziellen Gebeten die in Küstenorten verehrten Heiligen um Beistand an.36 Zahllos sind die mittelalterlichen Texte, die vor den Gefahren des Meeres warnen und die See als Sinnbild für die – seelischen, physischen, moralischen – Gefährdungen des Menschen benutzen. Die Heiligenerzählungen spiegelten damit Alltagserfahrungen maritimer Gesellschaften.37
In einigen wenigen hagiografischen Erzählungen des Mittelalters, aber auch in didaktischer, also lehrhafter Literatur jener Zeit werden mitunter Wundergeschichten von Meeresbewohnern erzählt.38 Meerestiere konnten – wie Landtiere auch – in hagiografischen Erzählungen als Symbole dienen, um die Gottgefälligkeit gewisser Menschen zum Ausdruck zu bringen, die in Anlehnung an das Vorbild Christi Fische vermehrten, für erfolgreichen Fischfang sorgten oder denen auf wundersame Weise Fische als Speisen zukamen.39 Ähnlich den erwähnten Mirakeln Jesu, der seine Tempelsteuer mit der Münze bezahlt, die ein Fisch des Sees Genezareth im Maul trug (Mt 17:27), schilderten Viten und Mirakelberichte (des Arnulf von Metz, gest. 640, des Ambrosius von Cahors, 7. oder 8. Jh., und vieler anderer), wie ein vermeintlich für immer verloren geglaubter (weil ins Meer geworfener, in einen Fluss gefallener) Gegenstand auf wundersame Weise wieder zum Vorschein kommt: Der Fisch, der ihn verspeist, wird seinerseits gefangen und landet als Gericht auf dem Teller desjenigen, der das Objekt seinerzeit verloren hatte.40
Der Gregorius des Anfang des 13. Jahrhunderts verstorbenen Dichters Hartmann von Aue überliefert eine Variante dieser Erzählung, wonach der spätere Papst Gregor sich als Sünder an einen Felsen ketten und den Schlüssel des Schlosses ins Wasser werfen lässt, nur um 17 Jahre später von Klerikern befreit zu werden, die eben jenen Schlüssel in einem Fisch wiederfinden.41 Meerestiere dienen hier als Boten Gottes, um eine Nachricht zu übermitteln. In vielen anderen hagiografischen Erzählungen manifestiert sich die Heiligkeit eines Menschen gerade dadurch, dass sie von grundsätzlich als unvernünftig angesehenen Kreaturen bestätigt wird: Wilde Tiere, die einen Heiligen zerfleischen sollen, stellen sich auf seine Seite und beginnen zu reden etc. Die zeitlich begrenzte Aussetzung der Naturgesetze durch Tiere belegt die besondere Gottesnähe eines Menschen. Doch im Vergleich mit Landtieren wurden Meereslebewesen nur selten auf diese Weise hagiografisch und narrativ genutzt.42
Auch im Judentum und Islam gelten gewisse herausragende Gestalten – wie die Heiligen im Christentum – als verehrungswürdige Vorbilder. Die Chronik des Aḥimaʿaẓ ben Paltiel zum Beispiel, ein jüdischer hagiografischer Text, erzählt von den Taten verschiedener Rabbis des 9. bis 11. Jahrhunderts auf ihren Fahrten zwischen Jaffa und Konstantinopel, italienischen Seestädten, Nordafrika und dem Mittleren Osten. Das Werk schildert unter anderem die wundersame Besänftigung des wilden Meeres, vor allem aber zeigt es die See als einen ambivalenten Raum, der bedrohlich sein kann, an dem sich Gott aber auch den Menschen offenbart.43
Hoch- und spätmittelalterliche arabisch-muslimische Schriften wiederum zeigen die Gottverbundenheit verehrter Sufis und anderer als besonders heiligmäßig geltender Personen durch Schilderungen von Wundern, die sie auf dem Meer bewirkten: Diese Männer konnten über das Wasser gehen oder sich sogar auf dem Meeresgrund fortbewegen, auch sie besänftigten Stürme und schützten vor Angreifern.44 Ihre Gottgefälligkeit wird natürlich auch durch Tiere zum Ausdruck gebracht, durch Kamele, Esel und Löwen, gelegentlich aber auch durch Fische: Solche kamen angeblich aus den Tiefen des Meeres, um den Segen von Aḥmad ar-Rifāʿīs (gest. 1182) zu erlangen – »sie drängten sich um ihn wie Kamele um Wasserplätze« –, und wenn er oder auch Ğamāl ad-dīn Burullusī (14. Jh.) Appetit auf Fisch hatten, eilten die Tiere herbei, um sich ihnen anzubieten; und auch in der islamischen Welt gehört die Geschichte vom verlorenen Ring, den ein Fisch zurückbringt, zum Repertoire verschiedener Biografien kultisch verehrter Menschen.45
Vergleichend betrachtet dient das Meer in den religiösen Vorstellungen des Judentums, Christentums und Islam damit häufig als Bühne oder als Medium, mit dessen Hilfe die Macht des Guten oder des Bösen den Menschen erfahrbar gemacht wird. Die Lebewesen des Meeres spielen in diesen Darstellungen eine untergeordnete Rolle.
Sicher stößt man gelegentlich auf sehr aufschlussreiche Texte: Vereinzelte muslimische Sufis waren Fischer, daher wird ihre Gottesnähe durch besondere Fähigkeiten und Erfolg in diesem Metier zum Ausdruck gebracht.46 Der Geograf al-Muqaddasī (gest. ca. 1000) wiederum verglich den Fischreichtum zweier Meere und deutete diesen religiös. Nach ihm war das Mittelmeer ärmer an Fischen als die Arabische See, weil es auf die Frage Gottes, welche Gnade es den Menschen bereiten werde, knapp geantwortet habe: »Nun, Herr, ich werde sie ertränken«, worauf Allah voller Zorn ausruft: »Weg von mir! Wahrlich, ich verfluche dich! Ich werde dich weniger schön und weniger fischreich machen!« Das Arabische Meer hingegen erwidert auf die gleiche Frage, es wolle die Menschen gern auf seinem Rücken tragen und ihre Gottesfurcht stärken. Darauf Allah: »Geh! Ich segne dich! Ich will dich noch schöner und fischreicher machen!«47 Doch insgesamt sind solche Textzeugnisse sowohl in islamisch wie in christlich geprägten Gebieten selten.
Speisegebote
Insbesondere im christlich geprägten Latein-Europa wurde Fischkonsum durch religiöse Fastengebote reglementiert. In welchem Maße dies geschah, wird in der Forschung unterschiedlich beurteilt. Einerseits ist nicht zu bestreiten, dass auch in nichtchristlichen, etwa in heidnischen oder muslimischen, Gesellschaften Fisch in Mengen verzehrt wurde, die sich nicht substanziell von denen in christlichen Gemeinden unterschieden. Außerdem ist mit Recht angeführt worden, dass nicht nur die Fastengebote, sondern auch die Stadtentwicklung und der durch sie gesteigerte Bedarf an halt- und bezahlbaren Speisen sowie andere Faktoren mehr im Mittelalter auf den Fischkonsum einwirkten.48
Andererseits zeigen die Quellen aber, dass zur Fastenzeit die Fischverkäufe in christlich geprägten Territorien entscheidend zunahmen und die Fischpreise stark anstiegen.49 Rechnungslegungen von Klöstern und Höfen, aber auch Einfuhrlisten spätmittelalterlicher Städte belegen eine markante Korrelation zwischen Fastenzeit und Fischkonsum. Fisch wurde von Gläubigen als Fastenspeise gegessen, für die Armenspeisung in Spitälern gereicht und in kirchlichen Einrichtungen bei Gedenkfeiern für Verstorbene aufgetischt.50 Die Bedeutung des Fastens in den Beziehungen zwischen dem Menschen und dem Meer ist nicht zu unterschätzen. Doch worauf ging diese Praxis kulinarischer Enthaltsamkeit zurück, und wie entwickelte sie sich im Verlauf des mittelalterlichen Jahrtausends?
Spezielle Speiseregelungen existierten zu allen Zeiten und in sehr vielen Gesellschaften. Man unterscheidet dabei zwischen dem vollständigen Verzicht auf Nahrung, dem Fasten, und der Entsagung gewisser Speisen, der Abstinenz. Beide Praktiken dienen der spirituellen Reinigung und können als Demuts- oder als Bußübung geleistet werden. Das Christentum führte einerseits entsprechende Gewohnheiten des Judentums fort, setzte sich aber andererseits von seiner Herkunftsreligion dadurch ab, dass nicht mehr der Montag und Donnerstag, sondern Mittwoch und Freitag zu wöchentlichen Fastentagen erklärt wurden. Bereits aus dem 1. Jahrhundert liegen Hinweise auf diesen Richtungswechsel vor, der im 4. Jahrhundert schon fest verankert war. Im Verhältnis zwischen lateinischem und griechischem Christentum gaben in dieser Zeit die Fastenpraktiken Anlass für Streit und Abgrenzung.51 Im lateinischen Christentum setzte sich im Laufe der Spätantike die Abstinenz durch, die im Wesentlichen aus der Entsagung von Fleisch und Milcherzeugnissen bestand.
Ergänzt wurden die wöchentlichen Fasttage um jährliche: an den Sonntagen vor Weihnachten und insbesondere an den 40 Tagen von Aschermittwoch bis Karsamstag. Diese für die Geschichte des Christentums bedeutendste jährliche Fastenzeit, die österliche Quadragesima, erinnerte an Christi Aufenthalt und Fastenzeit in der Wüste. Spätestens zum Ende des Frühmittelalters hatte sich dieser Brauch im lateinischen Westen weitgehend durchgesetzt, in neu christianisierten Gebieten teils mithilfe drakonischer Strafen: So drohten die Kapitularien Karls des Großen (gest. 814) für die unterworfenen Sachsen denen die Todesstrafe an, welche das 40-tägige Fasten vor Ostern missachteten und Fleisch aßen.52 Neben der Quadragesima wurde zusätzlich vor hohen Festtagen gefastet (Vigilfasten), sodass über das Jahr hinweg eine stattliche Menge an Fasten- und Abstinenztagen zusammenkam, mit zunehmender Tendenz im Laufe des Mittelalters.53 Es lässt sich daher durchaus fragen, ob die markante Zunahme des Bedarfs an Meeresfischen, die für das hohe Mittelalter beobachtet worden ist (vgl. Kapitel 3), nicht frömmigkeitsgeschichtlich beeinflusst worden sein könnte.
Allerdings ist in Rechnung zu stellen, dass die Fastenpraktiken regional variierten; es lassen sich daher keine genauen Angaben für ganz Europa treffen. Aber grundsätzlich kann man festhalten, dass im Jahr weit über 150 Fastentage (in einigen Gegenden sogar bis zu 200) zu befolgen waren. Hinzu traten das rigorose Fasten einiger Orden und Kongregationen sowie das individuelle Fasten als Bußleistung, wie es die frühmittelalterlichen Bußbücher vorschrieben und manche religiös verehrten Gestalten des Hochmittelalters wie Franziskus (gest. 1226) und Klara von Assisi (gest. 1253) vorlebten.54 Da in diesen Tagen auf Fleisch und Milchprodukte verzichtet wurde, musste – insbesondere während der langen Quadragesima – der Eiweißbedarf durch andere Nahrungsmittel ersetzt werden. Hier nun kam der Fisch ins Spiel, bzw. genauer: die Meereslebewesen. Denn im Mittelalter galten alle Tiere als Fische, deren Habitat das Wasser war. Daher durfte auch das Fleisch von Meeressäugern wie Delfinen oder Walen, die heutzutage nicht zu den Fischen gezählt werden, während der Fastenzeit gegessen werden.
Männer und Frauen jüdischen Glaubens hatten ebenfalls ihre Speisegebote zu beachten, die von denen der Christen abwichen, von der Mehrheitsgesellschaft abgelehnt und zu einem Instrument der Verfolgung werden konnten. Auf der Iberischen Halbinsel zum Beispiel führte strukturelle (und häufig auch physische) Gewalt dazu, dass Jüdinnen und Juden offiziell zum Christentum konvertierten, insgeheim aber ihren Glauben beibehielten. Die christlichen Zeitgenossen warfen ihnen vor, sie seien »Judaisierer« (span. »judaizantes«, in der Forschung wird auch von »Krypto-Juden« gesprochen).
Christen ehemals jüdischen Glaubens bzw. ihre Nachkommen wurden daher insbesondere im 15. Jahrhundert argwöhnisch beobachtet, um Hinweise zu entdecken, dass sie ihrer alten Glaubensgemeinschaft treu geblieben waren, und solche Hinweise waren die Speisepraktiken. Inquisitionsakten aus den iberischen Reichen belegen, dass der Verzicht auf Delfinfleisch, Krustentiere oder andere durch die jüdischen Speisegebote untersagte marine Nahrungsmittel Anlass zur Verfolgung bot.55 Zugleich lassen sich zwischen jüdischen und christlichen Gemeinden auch harmonischere Verflechtungsprozesse beobachten. Möglicherweise in Analogie zu dem durch das Fastengebot bedingten christlichen Fischverzehr an hohen Festtagen bevorzugten auch Jüdinnen und Juden des Mittelalters in einigen Regionen bei Festen Fisch statt Fleisch, insbesondere bei Bestattungen, aber auch bei religiösen Festen wie Yom Kippur und Purim.56
Im Islam wiederum sind nicht alle Fische »ḥalāl«: Wie im Judentum gelten nach Ansicht einiger einflussreicher Rechtsschulen schuppenlose oder verendet aufgefundene Meerestiere als eine unreine Speise.57 Die Praxis des Mittelalters sah indes häufig anders aus. Fisch war in weiten Teilen der islamischen Gesellschaft eine geläufige Alltagsspeise, und ein sehr detailliertes andalusisches Kochbuch aus dem 13. Jahrhundert belegt, dass die Vorbehalte gegenüber schuppenlosen Meerestieren keineswegs uneingeschränkt galten.58 Überraschend ist auch die in einigen muslimischen Rezeptbüchern zu findende Empfehlung, Fisch stets mit viel Wein zu genießen.59 Hier lässt sich eine Diskrepanz zwischen religiösen Normen und gelebtem Alltag beobachten. Dazu trug nicht zuletzt der Aufschwung naturkundlichen Wissens im hohen Mittelalter bei, dem wir uns nun zuwenden wollen.
Dieses Feld der im weitesten Sinne wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Meer ist weit und unübersichtlich – zumal dann, wenn wir seine Geschichte auf ihre antiken Grundlagen zurückführen und Judentum, Christentum und Islam gleichermaßen berücksichtigen wollen. Um Ordnung in das Gewirr zu bringen, werden im Folgenden wesentliche Gattungen der Literatur und deren herausragende Repräsentanten vorgestellt: zuerst und ausführlich die häufig von Klerikern, insbesondere Mönchen verfassten, in der Nachfolge des Aristoteles (gest. 322 v. u. Z.) und Plinius (gest. 79) stehenden Tierkunden und Enzyklopädien; dann die auf den frühchristlichen Physiologus zurückgehenden Bestiarien; schließlich medizinische Traktate und Kochbücher.
Es kann nicht ausbleiben, dass bei einer solchen Übersicht viele Autorennamen genannt werden. Aus der verwirrenden Vielfalt seien daher die zwölf Gelehrten herausgehoben, die in diesem Buch besonders häufig zur Sprache kommen werden. Es handelt sich um die beiden gerade genannten antiken Autoren Aristoteles und Plinius, um den anonymen Autor des frühchristlichen Physiologus, um den 630 gestorbenen Universalgelehrten Isidor von Sevilla, um Hrabanus Maurus und al-Ǧāḥiẓ aus dem 9. Jahrhundert, um den 1048 verstorbenen al-Bīrūnī, um Ibn al-Baiṭār (gest. 1248), Thomas von Cantimpré (gest. 1272) und Albertus Magnus (gest. 1280) aus dem 13. Jahrhundert sowie aus dem späten Mittelalter um Konrad von Megenberg (gest. 1374) und um den anonymen Autor des von Jakob Meydenbach (gest. nach 1495) gedruckten Hortus sanitatis von 1491.
Gelehrtes Wissen
Zu den geläufigen Vorurteilen gegenüber den Menschen des Mittelalters gehört die Behauptung, sie hätten die Natur nicht erforscht, sondern sie lediglich aus der Perspektive der Theologie zu verstehen versucht. Erst in der Neuzeit hätten Menschen – gegen den Widerstand kirchlicher Autoritäten – den wissenschaftlichen Weg der Naturbeobachtung eingeschlagen und Licht in das Dunkel jahrhundertelanger Ignoranz gebracht. Doch bei genauerem Hinsehen lassen sich viele Schriften nennen, die die Natur im Allgemeinen und die Tierwelt im Besonderen auf der Grundlage von Naturbeobachtung und rationalen Schlüssen beschreiben und erklären wollen, dies vor allem seit dem 13. Jahrhundert.60
Zwischen 1241 und 1245 verfasste der englische Franziskaner Roger Bacon (gest. 1292) ein solches Werk unter dem Titel Über die Tiere (De animalibus). Während diese Schrift verloren ist, sind verschiedene in ihrer Folge entstandene, ähnlich umfassend angelegte Texte auf uns gekommen: die Untersuchungen über das Buch ›Von den Tieren‹ des Aristoteles (Questiones super libro ›De Animalibus‹ Aristotelis) des Petrus Hispanus (gest. wohl 1277),61 das Buch der Natur (Liber de natura rerum) des Dominikaners Thomas von Cantimpré,62 das Buch der Tiere (Liber de animalibus) des kastilischen Franziskaners Petrus Gallego (gest. 1267),63 Arnolds von Sachsen (13. Jh.) De naturis animalium,64 die Schrift über die Tiere (De animalibus) des deutschen Dominikaners Albertus Magnus65 u. a. m.
Noch allgemeiner, aber ebenfalls die Tierwelt behandelnd, waren die großen »Enzyklopädien«66 jener Zeit, welche unter anderem der Dominikaner Vinzenz von Beauvais (gest. 1264)67 und der Franziskaner Bartholomäus Anglicus (gest. 1250)68 vorlegten. Wie auch Autoren vor ihnen verstanden diese Gelehrten des 13. Jahrhunderts das Meer als einen Raum der Wunder, der eine Unzahl an Lebewesen und Monstren hervorbrachte, auch sie deuteten mitunter die das Meer bevölkernden Geschöpfe theologisch. Doch zugleich versuchten sie, die Tierwelt in Systematiken (Taxonomien) zu gliedern und naturwissenschaftlich zu beschreiben. Als »Fische« erachteten sie dabei alle im Wasser lebenden Tiere – also Kiemenatmer ebenso wie marine Weichtiere, Kopffüßer, Krebse, Säugetiere, Reptilien sowie biblische, mythische und andere aus heutiger Sicht fantastische Tiere des Meeres.
Diese Gesamtdarstellungen und Ordnungsversuche tierischen Lebens waren alles andere als vollständige Neuschöpfungen. Vielmehr handelte es sich bei ihnen in erster Linie um Sammlungen, Kommentare und Bearbeitungen einschlägigen antiken Wissens. Von herausragender Bedeutung für die mittelalterlichen Autoren waren die Werke des Aristoteles.69 Der einflussreichste Philosoph und Naturforscher der Antike griff ältere, aus Reisebeschreibungen hervorgegangene Abhandlungen und Erzählungen über Tiere auf, wertete sie wissenschaftlich aus und ergänzte sie um eigene Beobachtungen. Seine Tierkunde (die Περὶτὰζῷαἱστορίαι/Historia animalium) liefert eine umfassende Klassifizierung von über 500 Tierfamilien nach äußerer Erscheinung und innerem Aufbau, ergänzt um Angaben zum jeweiligen Lebensraum der Tiere, zu ihren Gewohnheiten und ihrer Fortpflanzung. Ausführlich geht Aristoteles dabei, vor allem in den Büchern 5, 6 und 8 seines Werkes, auf das marine Leben ein. In der Rubrik der blutführenden Tiere finden sich detaillierte Kapitel zu den Fischen und den Meeressäugern, unter den blutlosen Tieren behandelt er Weich-, Krusten- und Schalentiere des Meeres.
Die antike Tradition der Naturbeobachtung und -beschreibung erschöpfte sich aber keineswegs mit Aristoteles. Vor allem im 1. und 2. nachchristlichen Jahrhundert verfassten römische Autoren grundlegende Werke, welche teilweise ebenfalls im Mittelalter aufgegriffen wurden. Allen voran steht die Historia naturalis des Plinius, eine monumentale Enzyklopädie in 37 Büchern, welche älteres Wissen zusammenfasst und ordnet.70 Auch der berühmte römische Biograf Plutarch (gest. 120) verfasste Schriften über die Natur und die Klugheit der Tiere. Zu nennen sind weiterhin die Anleitung zum Fischen (Halieutika) – ein Lehrgedicht des griechischen Dramatikers Oppian (2. Jh.) – oder die Tiergeschichten (De natura animalium) des um 222 verstorbenen Claudius Aelianus (Ailianos). Zum Ende des 3. Jahrhunderts kompilierte Solinus das Werk des Plinius in seiner Schrift über die Wunder der Welt (De mirabilibus mundi), was wesentlich zur Kenntnis des Plinius im Mittelalter beitrug.71
Im frühen und dann im hohen Mittelalter griffen Autoren und Autorinnen dieses antike Wissen über Tiere rege auf und deuteten es religiös um. Vor allem ein Werk diente als Brücke zwischen der römischen Antike und dem lateinisch-christlichen Mittelalter: der Physiologus (»Der Naturkundige«).72 Dabei handelt es sich um eine irgendwann zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert, wahrscheinlich in Alexandria, von einem anonymen Autor niedergelegte Sammlung verstreuter Kenntnisse und Allegorien über Tiere und einige Gesteine.73
Das Werk führt griechisches, römisches, ägyptisches, jüdisches und indisches Wissen zusammen und deutet es christlich um. Es wurde ursprünglich auf Griechisch verfasst und dann ins Lateinische, aber auch in andere Sprachen übersetzt (es existieren frühe Übersetzungen ins Äthiopische, Koptische, Syrische, Arabische, Georgische und Armenische). Im Mittelalter fand es in den lateinischen Versionen der Dicta Chrysostomi aus der Zeit um 1000 und im Physiologus Theobaldi aus dem 12. Jahrhundert weite Verbreitung.74 Die Menschen des Mittelalters erlangten mithilfe des Physiologus nicht nur fragmentarisches Wissen über einzelne Tierarten, sondern auch eine religiöse Unterweisung.
So schwimmt nach dem Physiologus der Segelfisch über viele Kilometer neben den Schiffen, um dann, von dieser langen Anstrengung ermüdet, in den Tiefen des Meeres zu versinken. Diese vermeintliche Naturbeobachtung wird im Folgenden allegorisch ausgelegt: Das Schiff, das unbeschadet der Stürme usw. über das Meer segelt, versinnbildlicht jene Menschen, die dauerhaft gute Werke vollbringen. Diejenigen aber, die nur kurze Zeit gute Werke tätigen, werden – wie der Segelfisch im Meer – in den Tiefen der Hölle versinken.75
Der Physiologus war außerordentlich einflussreich. Kirchenvätern wie Ambrosius (gest. 397), Augustinus und Gregor dem Großen (gest. 604) war er bekannt, er floss in die Etymologien des iberischen Gelehrten Isidor von Sevilla (gest. 630)76 und in die erwähnte Schrift des Hrabanus Maurus (De natura rerum)77 ein; hochmittelalterliche Autoren wie Petrus Damian (gest. 1072), Rupert von Deutz (gest. 1129), Cäsarius von Heisterbach (gest. 1240), Abälard (gest. 1142) griffen ihn auf.78 Emblematische Tiere des Physiologus, etwa der Panther und der Pelikan, wurden aufgrund ihrer theologischen Auslegung im Mittelalter immer wieder abgebildet – etwa in Prachthandschriften oder in Glasfenstern und Skulpturen der Klöster und Kathedralen.79
Neben dem Physiologus wirkten insbesondere die Etymologien (bes. Buch 13) des iberischen Gelehrten Isidor von Sevilla aus dem 7. Jahrhundert und das rund zwei Jahrhunderte später entstandene De natura rerum des Hrabanus Maurus stark auf das mittelalterliche Denken über das Meer und seine Lebewesen ein. Beide interpretierten die Tierwelt zeichenhaft. Isidor von Sevilla widmete den Meereslebewesen ein umfangreiches Kapitel, in dem er 64 unterschiedliche Spezies abhandelte. Sein Interesse an der Fauna des Meeres übertraf bei Weitem seine Beschreibungen von Süßwasserfischen.80
Gelehrte des 12. und 13. Jahrhunderts wie die Äbtissin Hildegard von Bingen (gest. 1179) oder der englische Abt Alexander Neckam (gest. 1217), der in seinem De naturis rerum 24 ihm bekannte Fischarten erwähnt, ließen Isidors Schrift in ihre Abhandlungen einfließen und entwickelten sie fort. Allerdings gilt festzuhalten, dass die Zahlen der abgehandelten Meereslebewesen sich keineswegs mit denen der Landtiere und Vögel messen können, die in aller Regel leichter zu beobachten waren als Unterwasserfauna.81 Alle diese Autoren interpretierten die Natur und ihre Tierwelt allegorisch als Sinnbild Christi und anderer biblischer Gestalten, aber auch sündiger Menschen.
Im 13. Jahrhundert erhielt die Beschäftigung mit der Tierwelt einen starken Impuls durch das Predigtwesen. Neue Orden entstanden, die sich der moralischen Unterweisung der Gläubigen in verstärktem Maße zuwandten. Deren Mitglieder – die Dominikaner, aber auch die Franziskaner und andere Bettelordensbrüder – hielten Predigten, in denen gern auf die Natur zurückgegriffen wurde. Denn Vergleiche mit der Tierwelt schufen Anschaulichkeit und machten komplizierte theologische Sachverhalte einem breiten Publikum verständlich. Damit entsprangen diese Werke dem gleichen Geist wie der Physiologus.
Um nur ein Beispiel aus dem späteren Mittelalter zu geben: Anfang des 15. Jahrhunderts verfasste der Valencianer Dominikanermönch Vicent Ferrer (gest. 1419) für den Festtag der heiligen Petrus und Paulus am 29. Juni eine Predigt, in der er die Metapher der Seelenfischer unter Rückgriff auf die Alltagswelt seiner Zuhörerschaft erklärte. So, wie die Fischer große und edle Meerestiere wie den Delfin oder Thunfisch, aber auch kleine Sardinen fingen, habe der ehemalige Fischer Petrus und diejenigen, die es ihm gleichtäten, die Seelen angesehener Herren und Damen, aber ebenso diejenigen einfacher Menschen gewonnen. Hier dient die Tierwelt als Gleichnis für Predigt und Bekehrung, zugleich aber auch als Erklärung für soziale Hierarchien und Abhängigkeiten zwischen den Menschen.82
Diese Texte verraten viel darüber, wie mittelalterliche Gelehrte – Theologen und Philosophen – die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Tier und Mensch einschätzten.83 In der vergleichenden Gesamtschau fällt auf, dass sie in der Regel selten an Tieren an sich interessiert waren, sondern diese, ganz anthropozentrisch, als Folie für die Beschäftigung mit dem Menschen nutzten. Tiere waren das »nächste Andere« und damit ein Spiegel, der die Ausnahmestellung des Menschen im göttlichen Schöpfungswerk zum Ausdruck brachte.
Tiere waren nicht zuletzt dazu geschaffen worden, den Menschen moralische Lehren zu erteilen, wenn Gott oder die Heiligen sie hierzu einsetzen wollten. Daher war ihre Nutzung – auch ihre Tötung und ihr Verzehr – für die Zeitgenossen keine moralische Frage. Tiere hatten keine rationale und unsterbliche Seele wie diese. Aber unbeseelt waren sie nicht: Theologen und Philosophen gestanden den Tieren sehr wohl eine Seele – nur keine rationale, unsterbliche – zu, insofern standen sie den Menschen näher als Pflanzen. Tiere durften gebraucht, aber nicht missbraucht werden. Sie wurden als Lebewesen mit der Fähigkeit zur Wahrnehmung angesehen, und manche – etwa Vögel – verfügten über gewisse kognitive Fähigkeiten wie zum Beispiel Sprache. Umgekehrt konnten auch Menschen sich wie Tiere verhalten. Auch wenn die Grenze zwischen ihnen nie gänzlich aufgehoben wurde, standen sich beide im zeitgenössischen christlichen Denken doch verhältnismäßig nah.
In der Welt des Islam wurde ebenfalls, sogar mehr noch als in Latein-Europa, älteres Wissen über die Tierwelt aufgegriffen und systematisch erweitert.84 Meerestiere werden in arabischsprachigen Schriften des Mittelalters in vielen Textgruppen und Gattungen erwähnt: im Koran und in Rechtstexten, in Dichtung und Lexikografie, in medizinischen, geografischen und historischen Werken, in Philosophie und Naturphilosophie, in dem als »Adab-Literatur« bezeichneten Bildungskanon und in tierkundlicher Literatur im engeren Sinne.85 Die meisten dieser Werke entfalteten vor allem oder sogar ausschließlich in der arabischsprachigen Welt Wirkung: Einflussreich war das siebenbändige, heute mehr als 2000 Druckseiten umfassende Buch der Tiere (Kitāb al-Ḥayawān) des 868 verstorbenen al-Ǧāḥiẓ, der die Allmacht Gottes anhand einer umfassenden, das aristotelische Werk erweiternden zoologischen Systematik aufzeigte.86 Auch das 984 abgeschlossene, zwischen Philosophie und Literatur angesiedelte Buch der Freuden und Konvivialität (Kitāb Al-Imtāʿ wa al-Mu’ānasa) des arabischen oder persischen Gelehrten Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī (gest. 1023) enthält umfassende Passagen zum marinen Leben, das der Autor nach Tierarten klassifiziert.87
Ähnliches gilt für die Kosmografie, etwa für Die Wunder der Schöpfung (ʿAǧāʾib al-maḫlūqāt) des persischen Arztes, Astronomen und Geografen Zakariyya al-Qazwīnī (gest. 1283) und für eine Reihe weiterer Texte.88 Besonders umfassend ist das an die tausend Spezies verzeichnende Leben der Tiere (Hayāt al-Hayawān) des spätmittelalterlichen Naturhistorikers und Rechtsgelehrten ad-Damīrī (gest. 1405).89 Manche medizinische Schriften schließlich empfahlen die Nutzung tierischer und in Sonderheit mariner Substanzen wie Koralle, Krabben, Perlen, Tintenfische, Ambra etc. als Heilmittel.
In diesen Werken wird auch Überraschendes geschildert. So berichtete zum Beispiel Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, dass sich manche Fischer die Häute von Ziegen überziehen und auf allen vieren am Strand entlangkriechen würden. Der Grund: Wildziegen und Fische würden ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegen; da die Fische ihren vermeintlichen Freunden zueilen würden, könnten die solcherart verkleideten Menschen diese leichter fangen. Oder: Sollten zwei Personen das Fleisch einer »būt/būs« genannten Fischart gemeinsam essen, dann würden sie sich zeitlebens lieben; die Haut des qūqī-Fisches besänftige alle Stürme, weswegen Seeleute sie gern an ihren Schiffen befestigten usw. 90 Teils fantastische, teils zutreffende Informationen über marine Lebewesen finden sich auch in arabischsprachigen geografischen Abhandlungen und Reisebeschreibungen des Mittelalters.91 Wie al-Ǧāḥiẓ einschränkend feststellte: Es sei schwierig, über das Leben unter Wasser verlässliche Information zu erhalten, und er fügte hinzu, dass man überdies den Angaben der notorisch unglaubwürdigen Seeleute nicht trauen könne.92
Weit über den arabischen Sprachraum hinaus schließlich wirkten aufgrund ihrer Übersetzung ins Lateinische verschiedene Kommentare der aristotelischen Zoologie aus der Feder muslimischer und jüdischer Gelehrter des 11. und 12. Jahrhunderts.93 Unter ihnen ragen die einflussreichen Kommentare des Abū Alī al-Husain ibn Abd ʿAllāh ibn Sīnā (in Latein-Europa Avicenna genannt, gest. 1037) und Abū l-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Rušd (ebendort als Averroes bekannt, gest. 1198) heraus.94 Die im 12. Jahrhundert im lateinischen Europa erfolgte Neuentdeckung und die im 13. Jahrhundert beginnende Übersetzung des aristotelischen Werkes und seiner muslimisch-arabischen Kommentatoren geschahen vor diesem Hintergrund.95
Um 1210 übersetzte der Naturforscher Michael Scotus (gest. 1232) in Toledo die Mitte des 9. Jahrhunderts ins Arabische übertragenen zoologischen Texte des Aristoteles (Historia animalium, De partibus animalium und De generatione animalium) ins Lateinische, ebenso die arabischsprachige Zusammenfassung des De animalibus durch ibn Sīnā/Avicenna (Abbreviatio Avicennae de animalibus).96 Zudem übersetzte seit der Mitte des 13. Jahrhunderts der Dominikanermönch Wilhelm von Moerbeke (gest. 1286) Teile des aristotelischen Corpus direkt aus dem Griechischen ins Lateinische. Die Wiederentdeckung antiken naturkundlichen Wissens in Latein-Europa mithilfe arabischer Gelehrsamkeit veränderte das Weltbild der geistigen Eliten des 13. Jahrhunderts grundlegend. Dieser Umbruch bedingte die einflussreichen Naturkunden und Enzyklopädien jener Zeit.
Denn die erwähnten Naturkundler und Enzyklopädisten fassten nun das umfangreiche – lateinische, hebräische und arabische – Wissen der Antike und des früheren Mittelalters zusammen und ordneten es neu.97 Sie bilden eine eigene Gruppe an Gelehrten und repräsentieren eine neue Stufe des Nachdenkens über das Meer und seine Tiere im Mittelalter, weil sie zwar wie Isidor, Hrabanus Maurus, Hildegard von Bingen usw. vor ihnen die Tierwelt christlich ausdeuteten, aber dabei stärker als diese die antike und vor allem aristotelische Tradition der Naturbeobachtung aufgriffen. Sie nutzten Tiere weniger dazu, die Bibel auszulegen oder zu erklären, sondern illustrierten mithilfe aus der Natur abgeleiteter Bilder abstrakte Konzepte wie Güte, Nächstenliebe, Keuschheit, Verlogenheit etc., um (nicht zuletzt in Form der Predigt) moralisch auf ihre Mitmenschen einzuwirken. Die »unvernünftigen Tiere« dienten ihnen vorzugsweise als Sinnbilder für – negatives oder positives – menschliches Verhalten.98