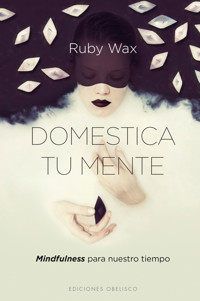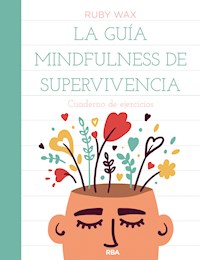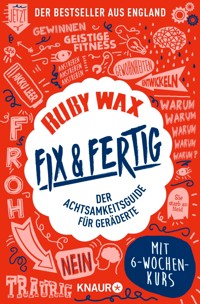
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur MensSana eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der Achtsamkeits-Ratgeber von der Comedian Ruby Wax für alle Gestressten, die eine Atempause brauchen. Ausgepowert, antriebslos, fix und fertig – vor 500 Jahren waren uns solche Gefühlszustände noch fremd, heute bestimmen sie den Alltag. Wir alle sind "gerädert". Bestsellerautorin Ruby Wax weiß, was es bedeutet, Depressionen und Stress bewältigen zu müssen. Doch sie kennt die Lösung dieser modernen Problematik: Achtsamkeit. Mit Witz und Charme erklärt sie in ihrem Ratgeber, dass Achtsamkeit nicht bedeutet, dass man sein Geschirr begrüßen muss, bevor man es abwäscht, oder lernen soll, seine Seife zu lieben, bevor man sie benutzt. Achtsamkeit bedeutet, Stress und Druck zu reduzieren, indem wir Kleinigkeiten in unserem Alltag verändern und Gefühle und Gedanken wirklich wahrnehmen. Selbst für Depressionen oder Burn-Out kann Achtsamkeit die Lösung oder zumindest eine Hilfe sein. Ein Sechs-Wochen-Kurs mit Achtsamkeits-Übungen führt Schritt für Schritt zu mehr Ruhe und Entspannung. Außerdem gibt Ruby Wax wertvolle Ratschläge, wie wir Achtsamkeit in alle Bereiche unseres Lebens einfließen lassen können: Arbeit, Beziehungen oder Erziehung. Für alle, die außer Stress nichts zu verlieren haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ruby Wax
Fix & fertig
Der Achtsamkeitsguide für Geräderte
Aus dem Amerikanischen von Gerd Bausch
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Achtsamkeit bedeutet nicht, dass wir unser Geschirr vor dem Abwasch begrüßen oder uns in unsere Seife verlieben, bevor wir sie benutzen.« Mit Witz und Charme erklärt die bekannte Comedian Ruby Wax, was Achtsamkeit tatsächlich ist und wie sie uns helfen kann, wenn wir uns gestresst, antriebslos oder einfach nur fix und fertig fühlen. Ob in der Arbeit, in unseren Beziehungen oder bei der Erziehung unserer Kinder – Ruby Wax gibt wertvolle Ratschläge, wie wir Achtsamkeit in alle Bereiche unseres Lebens einfließen lassen können.
Inhaltsübersicht
Widmung und Dank
Vorwort
Wer bin ich?
Fix & fertig. Der Achtsamkeitsguide für Geräderte
Eine persönliche Geschichte
Was findet sich zwischen den Klappendeckeln?
Kapitel 1: Warum fix & fertig?
Die Entwicklung unseres Gehirns
Die Evolution des Stresses
Das überladene Gehirn
Vergleichen
Wahlfreiheit
Autopilot
Situationen, in denen der Autopilot sinnvoll ist:
Situationen, in denen der Autopilot nicht sinnvoll ist:
Multitasking
Gedanken über Vergangenheit und Zukunft
Folgende Gedanken über Vergangenheit und Zukunft sind hingegen sicher sinnvoll:
Ganz im Gegensatz dazu sind Gedanken über Folgendes gewiss nicht hilfreich:
Einsamkeit
Die Suche nach Glück
Zufriedenheit
Die Zukunft der Menschheit
Schlussfolgerung
Kapitel 2: Achtsamkeit: Wer? Was? Warum?
Was es nicht ist
Was es ist
Annehmen
Das Gehirn trainieren
Mitgefühl – für manche kaum auszuhalten
Wie macht man das?
Aufmerksamkeit
Wer sind wir?
Vollkommen in einer Beschäftigung aufgehen
Noch einmal zurück zum Nutzen der Achtsamkeit
Im Gegenwärtigen präsent sein
Kapitel 3: Wie Ihr Gehirn funktioniert: Die wissenschaftliche Basis der Achtsamkeit
Das dreieinige Gehirn
Das Reptiliengehirn
Das limbische System
Der Neokortex
Alle drei Gehirnteile
Sympathikus oder Parasympathikus
Mehr über das Gehirn
Warum wir schnell etwas unternehmen müssen: Körperliche und geistige Krankheiten
Sucht
Typ-2-Diabetes
Fettleibigkeit
Unfruchtbarkeit
Krebs
Herzkrankheiten
Gedächtnisverlust und altersbedingte Krankheiten
Depression und andere psychische Krankheiten
Der Stress des Stresses
Was die Lage rettet: Neuroplastizität
Wie Achtsamkeit die Neuroplastizität fördert
Kapitel 4: Ein deprimierendes Zwischenspiel
10. Dezember 2014
19. Dezember 2014
21. Dezember 2014
25. Dezember 2014
Kapitel 5: Ein sechswöchiger Kurs in Achtsamkeit
Punkte, die man sich merken sollte
Erste Woche
Übung: Schmecken
Hausaufgaben
Zweite Woche
Übung: Der Bodyscan
Übung mit Geräuschen und dem Atem als Anker
Hausaufgaben
Die dreiminütige Atemübung
Dritte Woche
Übungen: Normale achtsame Bewegungen
Den Kopf beugen
Schulterrolle
Dehnung seitwärts
Körperstrecken
Die Katze
Nach vorne beugen
Hüftrollen
Übungen: Achtsame Bewegungen beim Fitnesstraining (für Menschen, die die achtsamen Bewegungen nicht ausstehen können)
Auf einem Trainingsfahrrad oder einem Laufband
Armdrehen mit Gewichten
Trizepstraining
Bauchpressen
Pomuskeltraining
Hausaufgaben
Übungen: Achtsame Bewegungen für unterwegs (für Leute, die nicht einmal achtsame Bewegungen beim Fitnesstraining leiden können)
Straßenrollen
Taschenstemmen
Einkaufswagenschieben
Dehnung mit dem Einkaufswagen
Training mit Gepäck
Aufzug
Dehnungen am Gepäckempfang – oder wo auch immer
Umhängetaschen-Dehnungen
Vierte Woche
Übung: Emotionen mit Achtsamkeit begegnen
Übung: Mit Schwierigem umgehen
Fünfte Woche: Gedanken mit Achtsamkeit begegnen
Seien Sie Ihr eigener Therapeut
Übung: Achtsames Denken
Sechste Woche
Ein Tag im Leben eines Berufstätigen
An der Bushaltestelle
In der Öffentlichkeit sprechen
Achtsamkeit am Morgen
Mein Traum
Kapitel 6: Der soziale Geist – achtsame Beziehungen
Eine kurze Geschichte der menschlichen Beziehungen
Achtsamkeit bei der Arbeit
Einige Vorschläge, wie Sie mit Beziehungen achtsam umgehen können
Was tun, wenn einem der Chef den Kopf abreißt?
Wie gehen wir mit jemandem um, den wir für einen Idioten halten?
Wie verhalten wir uns, wenn uns jemand keines Blickes würdigt?
Wie reagieren wir auf unseren Partner, wenn er uns den Kopf abreißt, es aber nicht unsere Schuld ist, sondern seine?
Kapitel 7: Achtsamkeit für Eltern, Kleinkinder und Kinder
Ein Tag im Leben von Eltern mit Kindern
Elternschaft ohne Tränen
Kennen Sie sich selbst
Ihr Baby ist nicht einfach Ihre Verlängerung
Achtsame Elternschaft
Bemerken
Benennen
Scannen
Nachdenken
Fünf Minuten jammern
Konzentrieren
Einen Schritt zurück machen
Babys und Kleinkinder
Das Gehirn von Babys und Kleinkindern
Lernen, aufmerksam zu sein
Übung: Sich auf das Kind einstimmen
Spiegelneuronen
Ein Potpourri der Gesichtsausdrücke und ihrer Auswirkungen
Achtsamkeit für Kinder
Übung: Seien Sie neugierig, aber horchen Sie Ihr Kind nicht aus
Mit den Emotionen umgehen
Übung: Mit Emotionen umgehen
Geschichten erzählen
Übung: Puppenzeit
Übung: Frühe Selbstregulierung
Übung: Sich wie eine Schneekugel fühlen
Übung: Eine Eule sein
Kapitel 8: Achtsamkeit für ältere Kinder und Teenager
Achtsamkeit in Schulen
Auszug aus der Rede, die ich beim Highschool-Abschluss meiner Tochter hielt
Ihren älteren Kindern Achtsamkeit beibringen
Das Gehirn eines wilden Welpen
Übung: Aufmerksam sein
Übung: Eine zweiminütige Herausforderung
Affengeist
Übung: FABHAS
Übung: Atmen
Wiederkäuen
Übung: Bettitation
Übung: Im Hier und Jetzt sein
Übung: Achtsam essen
Übung: Gedanken sind keine Tatsachen
Übung: Lernen, mit unangenehmen Dingen umzugehen
Die Schule ist aus
Ein Foto pro Tag
Eine andere Idee von Max: Sofortiger Totalentzug
Teenager, hört genau zu: »Es ist nicht eure Schuld«
Verstehen, was im Gehirn eines Teenagers vorgeht
Was passiert eigentlich im Teeniealter?
Unabhängigkeit
Kontakte mit ihresgleichen: Soziale Verbindungen
Kreatives Denken
Risiko in Kauf nehmen
Achtsame Elternschaft bei Teenagern
Seien Sie selbst achtsam
Gestehen Sie Ihre Fehler ein
Sich einfühlen
Machen Sie Kompromisse
Kommunizieren Sie mit ihm
Lernen Sie von Ihrem Teenager
Grenzen setzen
Helfen Sie ihm
Wie kann man Teenagern also Achtsamkeit beibringen?
Übung: Benennen, statt sich zu verrennen
Übung: Zeigen Sie, wie Ihr Gehirn und Sie selbst funktionieren
Übung: Es sich vorstellen
Kapitel 9: Achtsamkeit und ich
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Vierter Tag
Fünfter Tag
Sechster Tag
Anhang
Effekt der Übung der Achtsamkeit auf die Aufmerksamkeit und die emotionale Regulierung bei Heranwachsenden
Achtsamkeit bei Grundschülerinnen und -schülern
Danksagungen und Literatur
Ich möchte mich bei Maddy, Max, Marina Bye und mir selbst bedanken.
Oh, und bei meinem Mann, Ed, obwohl ich eine »Miss« bleiben wollte.
Und auch bei meiner Lektorin, Joanna Bowen (aber das ruiniert wirklich die Idee).
Vorwort
Wer bin ich?
Für diejenigen unter Ihnen, die noch nichts von mir gehört haben, möchte ich kurz ein paar Worte zu meinem bisherigen Leben schreiben: Auch wenn ich meine Eltern nicht für meine Depression verantwortlich machen möchte (die Debatte, ob Gene oder Umgebung die Persönlichkeit bestimmen, ist endlos), wird angesichts dessen, was sie erlebt haben, vielleicht deutlich, dass ich an sich keine Chance hatte. Meine Eltern flohen etwas übereilt aus Österreich. Hätten sie nicht einen Zahn zugelegt, hätte ich diese Zeilen nicht schreiben können, da es mich schlicht und ergreifend nicht gäbe. Die Seiten vor Ihnen wären weiß. Glücklicherweise stamme ich aus einer jüdischen Familie, die seit vielen Generationen ein Land nach dem anderen verlassen musste und dabei ihre Wohnzimmertische und Omas auf dem Rücken mitschleppten. Kaum hatten wir uns irgendwo niedergelassen, blieb ihnen nichts anderes übrig, als schon wieder zu fliehen. Von ihnen habe ich das Syndrom geerbt, ruhelos und auf der Suche nach Sicherheit und einem Zuhause weiterzuziehen, allerdings ohne je fündig zu werden.
Nachdem meine Eltern die amerikanische Küste erreicht hatten, etablierte mein Vater ein Wurstdarm-Imperium und machte sich als »Darmkönig« einen Namen. Er war bei allen gefürchtet – besonders bei den Schweinen. Man hatte mich als Erbin des Imperiums vorgesehen, doch ich lehnte dankend ab.
Meine Mutter hatte eine Schmutzphobie und verbrachte einen großen Teil ihres Lebens damit, auf den Knien rutschend Staubflusen zu jagen. Ihre Kindererziehung schien von einem grimmschen Märchen inspiriert gewesen zu sein, in dem Kinder in einem Kuchen gebacken werden, weil sie vergessen hatten, vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht ohne dass ihnen zuvor auch noch die Daumen abgeschnitten wurden (oder so ähnlich). Wenn Sie mehr über meine Eltern erfahren möchten, wie etwa über die Eigenheit meiner Mutter, auf riesigen Landmassen Krümeln hinterherzujagen, verweise ich Sie auf mein Buch How Do You Want Me?.
Meiner Eltern waren der festen Überzeugung, dass man ein Kind verzieht, wenn man mit der Rute spart. Ich führte darüber Buch: Nach jeder Bestrafung schrieb ich heimlich auf, wie viel ich ihnen für jede seelische Verletzung berechnete. Die Rechnung war enorm, aber natürlich wurde sie nie beglichen. Wenn sie mich allerdings in ein Sommerlager schickten oder mir das Richten der Zähne bezahlten, fand ich das nett von ihnen und erließ ihnen einen Teil ihrer Schuld.
Jeden Sommer verbrachte ich zwei glückliche Monate in einem solchen Sommerlager, lernte den Kampfgeist, vom Speerwerfen bis zum Extremsport des Kanufahrens. Man sagte uns, wir sollten uns nicht scheuen, von der Handfeuerwaffe Gebrauch zu machen, wenn wir dabei sind zu verlieren. Unser Camp hieß Agawak, was in der Sprache der Indianer so etwas wie »jemandem an die Kehle springen« bedeuten muss. Die Botschaft war unmissverständlich: Schlage deine Gegnerin, koste es, was es wolle. Siege! Siege! Siege!
In der Highschool hingegen wurde ich zum Gespött der ganzen Klasse. Man nannte mich charmant »Hasi«, da meine Schneidezähne an die des Langohrs erinnerten. Zehn Jahre lang musste ich eine Zahnspange tragen, um sie in dieselbe Zeitzone wie den Rest von mir zurückzubringen. Es erübrigt sich anzumerken, dass ich keine attraktive Teenagerin war – ich weiß, das ist schwer zu glauben, wenn man mich heute sieht.
Auch meine Karriere als Schauspielerin war kein sofortiger Erfolg. Abgesehen von einer nicht sonderlich wesentlichen Rolle als »Regenwurm« im Musical Hello, Dolly!, das wir mit unserer Schule aufführten, hatte ich nicht die geringste Erfahrung und auch kein besonderes Talent. Dennoch zog ich voller Illusionen nach London, um eine große Karriere als klassische Schauspielerin zu beginnen. Die ersten zehn Jahre wohnte ich in einem möblierten Zimmer, dessen Einrichtung den Eindruck vermittelte, jemand sei in ihm verblutet. Da es nicht einmal eine Heizung gab, musste ich meinen Föhn überstrapazieren, um die eisigen Winter zu überleben. Ich bewarb mich bei allen Theaterschulen, wurde jedoch von allen abgewiesen, und das, obwohl ich fest überzeugt war, mit meiner Nonnenhaube, die ich selbst aus Pappe gebastelt hatte, eine wirklich brillante Julia abzugeben. Ich kann Ihnen nur raten, nie eine solche zu tragen, da man mit ihr nicht einmal durch eine Tür kommt, ohne sich den Hals zu verrenken.
Zeitsprung … Schließlich schaffte ich es dank riesiger Anstrengung, in die Royal Shakespeare Company aufgenommen zu werden, dank riesiger Anstrengung machte ich eine Karriere im Fernsehen, die 25 Jahre anhielt, dank riesiger Anstrengung heiratete ich und gründete eine Familie. Da ich mich dank meiner riesigen Anstrengungen derart antrieb, erlitt ich vor sieben Jahren einen Zusammenbruch. Das Burn-out stürzte mich von den Klippen der Gesundheit. Kurz darauf fand ich mich in einer Psychiatrie wieder und verbrachte die folgenden Monate auf einem Stuhl – ich war so verstört und verängstigt, dass ich mich nicht einmal traute aufzustehen. Bereits mein gesamtes Leben hatte ich an Depressionen gelitten, aber dies war nun die Krönung des Ganzen.
Dann kam das große Aha-Erlebnis: Ich erkannte, dass meine gesamte steile Karriere dazu gedient hatte, das Chaos in mir zu verdecken. Ich hatte mir eine Scheinwelt geschaffen, die den lächelnden Showgirl-Pappfiguren in Las Vegas glich. Ich war wie die Fassade eines Hauses, in dem niemand wohnte. Mir wurde klar, dass Ruhm ein hervorragendes Gegenmittel für eine gestörte Kindheit und Jugend war. Wie auch immer, in den Abgründen der tiefsten Depression beschloss ich, mich aus dem Showbusiness zurückzuziehen und etwas Neues zu beginnen – was recht clever war, da meine Popularität ohnehin gerade nachließ. (Als ich mich dabei wiederfand, bei der Eröffnung eines Coffee Shops im Terminal drei des Londoner Flughafens Heathrow das goldene Band durchzuschneiden, wusste ich, dass die Dinge dabei waren, mir zu entgleiten.)
Ich dachte, dies sei genau der richtige Augenblick, um mich neu zu erfinden und zu erforschen, was all die Jahre mein Gehirn bewohnt hatte. Erneut ein Zeitsprung … Ich begann mit dem Studium der Achtsamkeitsbasierten Kognitiven Therapie. Ich mache keine halben Sachen, und so studierte ich an der Universität Oxford und schloss mit einem Master ab. Bevor ich es vergesse: Habe ich schon geschrieben, dass ich kürzlich zum Officer des Order of the British Empire ernannt wurde? Vielleicht war also meine Pein nicht umsonst gewesen – aber wahrscheinlich doch.
Fix & fertig. Der Achtsamkeitsguide für Geräderte
»Was meint sie mit dem Titel?«; »Warum beschäftigt sie sich mit diesem Thema?«; »Wie viel hat sie mit dem Buch verdient?«; »Glauben Sie, dass das irgendjemand kauft?«; »Wie alt gibt sie vor zu sein?«; »Ihre Shows haben mir nie gefallen!«
Das sind nur einige wenige der vielen Kommentare, die mir zu meinem Buch Sane New World zu Ohren kamen. Lassen Sie mich mit der Beantwortung der ersten Frage beginnen: Was meine ich mit dem Titel?
Wenn man »fix & fertig« und unter Dauerdruck ist, dann ist aus neurobiologischer Sicht das Nervensystem von Stress überlastet, und es werden permanent Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Alle Ihre Gedanken drehen sich kontinuierlich um Ihre Sorgen, weswegen Sie sich nicht auf die Arbeit konzentrieren können, die gerade konkret ansteht. Dies kann ein Burn-out zur Folge haben.
Zweite Frage: Warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht? Den größten Teil meiner wachen Zeit (und einen Teil meines Schlafes) habe ich im Reich der Geräderten verbracht, und daher glaube ich, dass ich – als qualifizierte Touristenführerin in diesem Moorland – Ihnen die Orte der wichtigsten Verwirrungen und Selbstzweifel zeigen kann. Seien Sie froh, in diesen Gegenden nicht alleine zu sein. Ich glaube inzwischen, dass wir alle sie bewohnen und einen Weg aus ihnen heraussuchen. Außerdem habe ich beschlossen, dass wir nicht länger unsere Zeit mit Klagen verlieren sollten. Statt mit dem Finger auf Probleme zu deuten und die äußere Welt dafür verantwortlich zu machen, dass wir derart aus dem Gleichgewicht geraten sind, ist es sinnvoller zu lernen, die gefährlichen Kliffe der Unsicherheit und der Verwirrung zu umschiffen. In diesem Buch stelle ich Ihnen einige der besten Urlaubsziele vor, an denen Sie sich erholen und neue Kräfte tanken können.
Eine persönliche Geschichte
Es ist November. Ich bin im Londoner Hotel Ritz. Ich fühle mich wie unter einer Dunstglocke, mein Geist ist von einem dicken grauen Nebel eingehüllt. Ich weiß selbst nicht genau, weswegen ich an dieser Veranstaltung teilnehme, und noch nicht einmal, wie ich hierhin gekommen bin. Ich frage jemanden, welchem guten Zweck die Sache dient. Eine hochgewachsene Frau mit Damenbart, die einen Pullover aus Katzenhaaren trägt, antwortet mir: Sie steht unter dem Motto: »Rettet die Papageientaucher«. Zufälligerweise ist sie die Sprecherin der Wohltätigkeitsorganisation, die die Sache veranstaltet, und wird später mit ihrem leichten schottischen Akzent in einer bewegenden Rede erklären, wie schwierig es für diese Vogelart ist, auf den Felsen der Orkneys zu landen, weil dort ein so heftiger Wind weht. Wenn sie es schließlich doch geschafft haben und ihr einziges Ei gelegt haben, müssen sie es davor bewahren, vom Wind davongetragen zu werden. Zu alldem kommt auch noch der Klimawandel, der dazu führen könnte, dass die Vögel dort vielleicht bald gar nicht mehr landen können. Während sich meine Welt auflöst, höre ich jemandem zu, der darüber doziert, wie schwer es der Papageientaucher hat, zu landen. Ich muss mich beherrschen, keinen Schreikrampf zu bekommen. Warum schicke ich sie nicht einfach selbst auf eine einsame Insel? Dann wäre das Problem gelöst!
Früher fing mich alle drei bis fünf Jahre dieser Nebel ein, und ich wurde vom Fluch einer Depression heimgesucht … Damals gab es noch keinen richtigen Ausdruck dafür, man nannte es »an der Reihe sein« oder sagte, dass einem »ein Missgeschick« unterlief, wie es meine Eltern gerne bezeichneten, wenn meine Mutter die Zimmerdecken mit einem Mopp abwischte. Ich wusste nie vorher, wann ich wieder abdriften würde, aber ein recht verlässlicher Anhaltspunkt war, dass es meist bei großen Veranstaltungen wie dem für die Papageientaucher geschah. Wahrscheinlich war ich deswegen so irrsinnig aktiv, weil ich der Welt und mir selbst beweisen wollte, dass bei mir alles in Ordnung und mein Verhalten völlig normal sei. So versuchte ich darüber hinwegzutäuschen, dass ich den Verstand verloren hatte. Es war, als würde ich ein Heftpflaster auf einen Tumor kleben.
Kurz nach der Papageientaucher-Veranstaltung fand ich mich im gleichen November dabei wieder, im Rahmen meiner Tauchprüfung in der Brighton Pier zu tauchen. Ich lief vor Kälte blau an, und meine Zähne klapperten jämmerlich. Man band mir Gewichte an den Bauchgurt, dann tauchte ich schnurstracks in zehn Meter Tiefe. Dort bekam ich nichts als ein paar alte Sandalen und einen versunkenen Einkaufswagen zu sehen. Wo waren die Riffs und Papageienfische? Mir war, als wären solche Dinge den anderen vorbehalten, während ich nur diesen Abfall zu Gesicht bekam.
Lassen Sie mich ein wenig erklären, wie ich dazu kam, Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie zu studieren. Der einzige Grund dafür war – und ich wiederhole: der wirklich einzige –, dass es überzeugende wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die belegen, dass sie die höchste Erfolgsquote bei der Behandlung einer ganzen Reihe von körperlichen sowie geistigen Beschwerden und Krankheiten aufweist.
Ich entschied mich zu diesem Studium, da ich bereits ein Vermögen für alle anderen nur denkbaren psychologischen Methoden ausgegeben hatte, die die Menschheit kennt: von der Plain-Vanilla-Therapie (wo ich so viel darüber sprach, wie meschugge meine Eltern waren, dass ich die Gruppe in eine Ein-Frau-Show verwandelte) bis hin zu therapeutischen Skurrilitäten wie zum Beispiel, drei Tage lang ein Kissen, das man Papi nennt, mit einer Keule zu schlagen, um es dann zeremoniell zu begraben und anschließend darum zu trauern. Mir ist es peinlich, aber ich muss bekennen, dass ich tatsächlich auch eine Sitzung Rebirthing machte, bei der sie mich mit einem Schnorchel in einer Badewanne untertauchen ließen, um mich anschließend an meinen Fersen wieder aus ihr herauszuziehen. (Immerhin war es nicht so schlimm wie eine wirkliche Geburt.) Lassen Sie mich nicht zu lange weitererzählen, aber ich war auch bei einer Frau, die mittelalterliche Kleider trug und behauptete, sie channele Merlin. Sie tat dies mit ihrem San Diegoer Akzent, den sie mit einigen altenglischen Vokabeln anreicherte. Ihr Mann, in Wams, Strumpfhosen und mit einem Krakenhut gekleidet, an dem Glocken hingen, tischte Fleisch auf. (Ich könnte endlos weitererzählen, aber vielleicht kommt das in ein anderes Buch.) Sie halten mich vielleicht für verrückt, aber all dies brachte mich zur Überzeugung, dass man mit wissenschaftlich fundierten Methoden die besten Fortschritte erzielt.
Nach meinem letzten Depressionsanfall versprach ich mir selbst, dass ich jetzt wirklich etwas unternehmen würde. Ich beschloss, meinen wilden Geist zu bändigen. Fast fanatisch schaltete ich in den Untersuchungsmodus, umherstreifend, wissenschaftliche Magazine und Schriften durchforstend. Und ich wurde fündig: Von allen Therapien, so Untersuchungen, böte die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie bei Depression mit sechzig Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit, einen Rückfall zu verhindern. Am meisten überzeugte mich die Tatsache, dass man dabei die Sache selbst in die Hand nimmt: Man musste nicht zu Seelenklempnern rennen, um sie anzubetteln, sie mögen einen wieder in Ordnung bringen. Und das Beste daran: Es war kostenlos (für eine Jüdin wie mich ist das bereits die halbe Miete). Anfangs dachte ich, Achtsamkeit bedeute, kerzengerade und mit gekreuzten Beinen auf einem kleinen Hügel zu sitzen und Mantras zu singen, die sich so anhörten, als lese man das Telefonbuch rückwärts. Dennoch war ich bereit, einen Versuch zu wagen.
Ich möchte gerne klarstellen, dass ich meine Depression weiterhin genauso medikamentös behandele, wie ich es auch bei jeder anderen rein körperlichen Krankheit tun würde. Doch wenn Antidepressiva allein wirklich wirkungsvoll und verlässlich wären, würde keiner mehr einen Rückfall erleben – in Wirklichkeit haben die meisten von uns genau dies, und sogar recht oft. Das ist der Grund, warum ich die Medikation mit der Meditation kombinierte. Man kann sich das wie zwei Kondome vorstellen: Es bietet doppelten Schutz.
Ich hoffe, das klingt nicht zu missionarisch. Meditation hilft bei mir, aber wir sind alle verschieden gestrickt, und Sie sollten daher das tun, was bei Ihnen wirkt. Wenn Sie sich besser fühlen, auf den Knien nach Lourdes zu pilgern, um die Füße Unserer Heiligen Mutter zu küssen, dann nichts wie hin!
Wie auch immer, irgendwie habe ich unlängst mein Studium in Achtsamkeitsbasierter Kognitiver Therapie (darf ich es von jetzt an MBCT nennen? Es ist mühsam, es dauernd auszuschreiben) mit einem Master abgeschlossen. Dies sind also die Gründe, warum ich ein Buch über MBCT schreibe.
Was findet sich zwischen den Klappendeckeln?
Kapitel 1: Warum fix & fertig? Nach all der menschlichen Evolution sind wir noch immer nicht perfekt. Auch wenn wir uns aufrecht fortbewegen und das Wunder vollbringen, selbst in Schuhen mit zwanzig Zentimeter hohen Absätzen nicht das Gleichgewicht zu verlieren, sind wir doch immer noch nicht ganz und gar gar.
In diesem Kapitel geht es um uns und die Frage, warum wir mit unserer Intelligenz noch immer nicht auf dem neuesten Stand sind.
Kapitel 2: Achtsamkeit: Wer? Was? Warum? Worum geht es eigentlich bei dieser sogenannten Achtsamkeit, und wozu soll sie gut sein? Was in unserem Kopf hält uns davon ab, den schwer definierbaren Zustand, den man »Glück« nennt, zu erleben.
Kapitel 3: Wie unser Gehirn funktioniert: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Achtsamkeit In diesem Kapitel gebe ich damit an, wie gescheit ich bin, und liefere die neurowissenschaftlichen Belege dafür, warum MBCT im Umgang mit Stress so wirkungsvoll ist. Unter Stress verstehe ich hierbei nicht, dass es Tage gibt, an denen bei uns alles schiefgeht, sondern eine dauerhafte Anspannung, die auf lange Sicht lebensverkürzend ist.
Kapitel 4: Ein deprimierendes Zwischenspiel Nachdem ich das dritte Kapitel verfasst hatte, bekam ich eine leichte Depression. Also pausierte ich erst einmal eine ganze Weile, bevor ich das nächste schrieb. Wenn Sie es lesen, werden Sie schon verstehen, was ich damit meine.
Kapitel 5: Ein sechswöchiger Kurs in Achtsamkeit MBCT wird normalerweise in einem achtwöchigen Ausbildungskurs unterrichtet. Danach ist jeder bei der Praxis auf sich selbst gestellt. Man rennt nicht mehr zu jemandem, um ihn zu bitten, die eigene zerbrochene Psyche wieder zusammenzuflicken: Jetzt sind Sie gefragt. Ich stelle Ihnen meinen einfachen und amüsanten sechswöchigen MBCT-Kurs vor. (Falls Ihnen dabei Zweifel kommen: Meine Auslegung des Kurses wurde von Mark Williams, Professor in Oxford sowie Mitbegründer der MBCT, geprüft und für gut befunden.) Ich habe ihn mir nicht in der Hoffnung, dass es niemand merkt, letzte Nacht einfach schnell mal so aus den Fingern gesaugt.
Kapitel 6: Der soziale Geist – achtsame Beziehungen Dieses Kapitel handelt davon, wie man Achtsamkeit nutzen kann, um die Beziehungen zu Freundinnen und Freunden, zur Familie, den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Ortes, des Landes und der ganzen Welt zu verbessern. Ohne die Hilfe der anderen könnten wir nicht überleben und aufblühen. Daher ist Achtsamkeit meiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die es zu entwickeln gibt, um gesunde Beziehungen zu knüpfen. In diesem Kapitel gebe ich Ihnen hauptsächlich meine erstklassigen Ratschläge zum Thema Einfühlungsvermögen.
Kapitel 7: Achtsamkeit für Eltern, Kleinkinder und Kinder Hier biete ich Ihnen einige Achtsamkeitsübungen an, die Eltern mit ihren Kindern und bei sich selbst anwenden können. (Noch bevor wir zu den Kindern kommen, müssen wir uns, die Eltern, in Ordnung bringen. Wenn wir uns unserer eigenen Themen nicht bewusst sind, haben die Kinder keine Chance.)
Kapitel 8: Achtsamkeit für ältere Kinder und Teenager Falls Sie versuchen, Ihrem Teenager einen Rat zu geben, sind Sie für ihn wie eine umherschwirrende Stechmücke, die einen einfach nicht in Frieden lassen will: Sie nerven. Nur wenn sie verstehen, dass es ihnen hilft, mit dem Examensdruck und anderer Anspannung, die die Pubertät und der Hagelsturm der Hormone mit sich bringen, richtig umzugehen, werden sich Teenager dazu herablassen, überhaupt erst darüber nachzudenken, ob es für sie nützlich sein könnte, sich auf den Geist zu fokussieren und das Maß an Stress zu senken. Ich streife darüber hinaus ein wenig das Thema der Achtsamkeit im schulischen Bereich und das erfolgreich angewandte dot-b-Programm des Mindfulness in Schools Project (Projekt Achtsamkeit in Schulen).
Kapitel 9: Achtsamkeit und ich Für dieses Kapitel habe ich Geld investiert, um mein Gehirn vor und nach einem intensiven Schweige-Retreat, bei dem ich sieben Stunden Achtsamkeit am Tag übte, scannen zu lassen. Ich werde während meiner Stille Tagebuch führen – sofern sie mir meinen Stift nicht aus der Hand nehmen.
Anhang: Einige wissenschaftliche Studien, die meine Thesen stützen. … und nicht zu vergessen: die Notizen einer verrückten Frau. In das ganze Buch habe ich Schilderungen persönlicher Erlebnisse einfließen lassen. Sie werden sie schon nicht übersehen, denn Sie erkennen sie an dieser Schrift.
1
Warum fix & fertig?
Wir alle kennen das Gefühl, fix und fertig zu sein, gerädert, mit den Nerven komplett am Ende … ich meine, die meisten von uns … oder zumindest einige von meinen Freunden. Wenn ich »wir alle« sage, meine ich damit jene, die in der freien Welt und relativ unbehelligt von Invasionen, Hunger, Epidemien und Froschregen leben – was ein Glück – und den Jackpot geknackt haben, zur rechten Zeit am rechten Ort geboren zu sein. Und dennoch beklagen wir, die Gewinner, uns, weil wir an Stress leiden. Warum können wir uns nicht einfach damit zufriedengeben, dass wir 109 Jahre alt werden können und selbst dann noch einige Zähne haben? Schon die einfache Tatsache, dass wir atmen, sollten wir mit Champagner feiern. Auch ich habe mich schuldig gemacht, mir selbst da Stress zu machen, wo es eigentlich nicht nötig war. Auch beim Schreiben dieses Buchs bin ich unglaublich angespannt: paranoid, dass ich mir nich richtik ausdrükke. Wenn ich panische Angst hätte, weil eine Bombe mir auf den Kopf zu fallen droht, wäre das verständlich, aber ich sorge mich, weil ich, nicht weiß wo, ich die Kommas zu setzen, habe und gegan allä Reschtschreibrägeln verstosse. Nicht das, was wir erleben, stresst uns am meisten, sondern das Grübeln über den Stress.
Der Ausnahmezustand, von dem ich schreibe, bezeichnet allerdings weder imaginären noch tatsächlichen Terror, also keinen Dritten Weltkrieg, der uns droht, weil irgendeiner der zahllosen Spinner, die Nordkorea oder andere Länder regieren, gänzlich den Kopf verliert. Nein, der Ausnahmezustand, den ich meine, hört erst auf, wenn wir aus unserem schlafwandlerischen Zustand erwachen. Bis dahin bleiben wir in dem selbst fabrizierten Dämmerzustand unseres Lebens. Vom Standpunkt der Evolution aus – und emotional gesehen sowieso – sind wir auf dem Weg zurück auf alle viere. Wir schicken Raketen ins All, um es zu erkunden, aber aus welchem Grund auch immer haben wir vergessen, uns selbst zu ergründen. Wir sind vollkommen damit beschäftigt, unsere Ziele zu erreichen und unsere täglichen Aufgaben zu bewältigen, rivalisieren mit den anderen und verlieren dabei komplett aus den Augen, warum wir es tun. Wir müssen einen Wecker stellen, um uns aufzurütteln und uns aus der Benommenheit, dem Geisteszustand, in dem wir grübeln und uns beunruhigen, befreien. Wir müssen – im wahrsten Sinne des Wortes – aufhören, von Sinnen zu sein. Es ist die einzige Art, das Leben zu erfahren: nicht durch Worte, sondern durch Sehen, Riechen, Hören, Tasten, Schmecken … Wie viel von dem, was Sie heute gegessen haben, haben Sie auch wirklich geschmeckt? Ich weiß nicht, wann in unserer Evolution wir sozusagen am Steuer eingeschlafen sind, denn wir begannen unsere Existenz fraglos im Wachzustand; als »primitive« Lebewesen waren wir uns jedes knackenden Zweigs und jedes Raschelns im Gebüsch bewusst. Heute jedoch bahnen wir uns im Tunnelblick des Autopiloten unseren Weg durch das Leben. Wir zielen darauf, unsere Aufgaben so schnell wie möglich auszuführen und sie dann fein säuberlich im »Erledigt«-Ordner abzulegen.
Stattdessen sollten wir uns bemühen, einen friedlichen Lebensstil zu entwickeln, und nicht einfach nur alles daransetzen, die nächste lästige Pflicht auf unserer Liste abzuarbeiten – im Glauben, dass danach endlich das echte Leben beginnt. Schieben Sie es nicht weiter auf, beginnen Sie, bevor es zu spät ist: Entweder wir lernen es jetzt, wachsam zu leben, oder wir schlafwandeln auf den Tod zu.
Die Entwicklung unseres Gehirns
Ob es Ihnen gefällt oder nicht: Wir alle stammen von winzigen kleinen Zellen ab. Wollen wir verstehen, wer wir heute sind, müssen wir uns unserer protoplasmatischen Vergangenheit zuwenden. Uns gibt es noch gar nicht so lange: Erst seit 200000 Jahren gehen wir aufrecht. Davor waren wir Fische, Eidechsen und eine ganze Palette an Menschenaffen (das ist nicht gerade ein sonderlich kultivierter Stammbaum). Die meisten von uns sind sich nicht im Geringsten bewusst, in welchem Ausmaß wir von diesen nicht besonders intelligenten Ursprüngen gefangen gehalten werden. In gewisser Hinsicht haben wir viel erreicht (und wissen beispielsweise, wie man russische Eier macht), aber was unsere emotionale Entwicklung angeht, schlingern wir noch immer im Morast der Teiche. Meiner Ansicht nach müssen wir den Einfluss der Ursprünge unserer prähistorischen Vergangenheit mehr in Betracht ziehen. Nach außen hin mögen wir vielleicht bei Tee und Gebäck zivilisierte Zeitgenossen mimen, aber unter der Oberfläche gibt unsere primitive Natur noch immer den Takt an.
Als Erstes entwickelten wir den Teil des Gehirns, der uns das Überleben ermöglichte – und den wir mit vielen anderen Wirbeltieren teilen. Das bedeutet, dass wir, wie viele unserer Vorfahren, beständig vor Gefahren auf der Hut sind. Auch wenn wir andauernd nach Glück streben, sind wir in Wirklichkeit – und ich nehme die Gefahr in Kauf, dass diese Ihnen den Tag verdirbt – von Geburt aus Pessimisten: Früher war es für das Überleben der Gattung unverzichtbar, für Gefahren gewappnet sein zu, und genau dies ist die Ursache unserer pessimistischen Grundhaltung. Irgendjemand hat einmal gesagt, dass bei uns auf fünf negative Gedanken nur ein positiver kommt. In unserer Kultur sind es allerdings nicht so sehr Naturkatastrophen wie etwa ein herabstürzender Meteorit, die alles über den Haufen werfen, sondern Abgabetermine und die Tilgung von Hypotheken. Auch vor dem nationalen Defizit kann man nicht davonlaufen.
Unser Problem besteht darin, dass Teile unseres Gehirns noch immer nach fünfhundert Millionen Jahre alten Regeln spielen und wir uns dessen nicht bewusst sind. Ich rede von der »Töte-und-begatte«-Strategie des Überlebens. Auch wenn wir glauben, unglaublich entwickelt zu sein, sind wir im Grunde noch immer Höhlenbewohner mit Steinzeitgehirnen. Gleichzeitig versuchen wir, mit dem komplizierten Leben des 21. Jahrhunderts klarzukommen. Das könnte der Grund sein, warum wir so viele Seelenklempner und Medikamente brauchen.
Dabei verlief zu Anfang alles recht glatt: Wir lebten mit unseren Familienmitgliedern in Stämmen, teilten die gleichen Gene und vertrauten und halfen einander, was unzählige inzestbedingte Mutationen verursachte: Einige unserer Cousinen und Cousins hatten mehr Finger, als sie brauchten, und andere wurden mit Füßen, die nach hinten zeigten, geboren. Die Probleme begannen, als die Stämme immer größer wurden, Städte wuchsen und Zivilisationen entstanden. Nun brauchten wir Gesetze, um unsere tieferen und dunkleren Triebe zu bändigen, wie etwa das Verlangen, mit unserer Schwester zu schlafen. Auch wenn Freud versuchte, uns zu helfen, das »Es« zu beherrschen, schlummert unser niederes, ursprünglicheres Selbst noch immer unter der Oberfläche. Es hilft nicht, es zu unterdrücken: Das wilde Innere lauert, stets bereit, voll auf die Tube zu drücken.
Die Evolution des Stresses
Auch wenn in früheren Tagen das Leben hart war, starb niemand an Stress. Todesursachen waren Krankheiten, das Alter (und das etwa mit zweiundzwanzigeinhalb), Unfälle, Kindesgeburt, schlechte Zähne … aber kein Stress. Es gab nicht einmal ein Wort für Stress, und niemand beklagte sich darüber.
Meine Theorie ist, dass Stress erst mit der Entwicklung der Sprache entstand. Wir warfen nicht länger einfach nur einen Speer, sondern hatten nun Gedanken, mit denen wir innerlich kommentierten, wie gut oder schlecht wir getroffen hatten. Natürlich meist schlecht.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Denken hat viel Gutes mit sich gebracht. Ich denke gerade und Sie wahrscheinlich auch – das ist gut so. Doch dieses neue Bewusstsein ermöglichte auch Stress.
Schließlich wurden die Schleusen geöffnet, denn wir benötigten mehr Platz in unseren Gehirnen, um all das Denken zu fassen, weswegen wir vor etwa 100000 Jahren (leider kann ich Ihnen kein genaues Datum nennen) wie aus heiterem Himmel feststellten, dass unser Gehirn auf die dreifache Größe angewachsen war. Keiner weiß, ob dies dem Wetter oder einer Schieflage der Achse des Planeten geschuldet war, aber unser Gehirn machte einen gewaltigen Sprung nach vorne. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir begannen, aufrecht zu gehen: Wir mussten die ganzen neuen grauen Zellen jetzt auf unseren Schultern balancieren. Kaum hatten wir unsere XL-Gehirne, begannen wir darüber nachzudenken, mit was wir sie wohl füllen könnten. Eine gute Sache an dem sprunghaften Anwachsen des Gehirns war, dass wir nicht mehr wie unser Cousin, der Primat, im Schlamm kriechen mussten, sondern anfangen konnten, wichtige Dinge wie etwa die Noppenfolie zu erfinden. Doch diese Erfindungen brachten Stress mit sich, denn nun mussten wir sie reparieren, versichern und ihre Batterien wechseln. Niemand anderes tat es für uns, und schon gar nicht unsere Freunde, die Menschenaffen (die noch immer vollkommen nutzlos sind, abgesehen davon, dass sie uns damit amüsieren, was sie alles mit Bananen anstellen können).
Unsere großen Gehirne trieben uns, neue Horizonte zu erobern, und wir pflasterten die Welt mit Einkaufszentren und Nagelstudios. Doch was dann? Wir wurden Pioniere des Denkens und nutzten statt der Pferdewagen nun die moderne Technik, um unsere Fahnen in neuen und fernen Ländern zu hissen. Wir verbreiteten unsere Meinungen, politischen Standpunkte, Vorlieben und Abneigungen nicht mehr zu Fuß, sondern im Internet. Wir wurden mit der Hoffnung eingelullt, dass uns durch den Computer (Danke, Bill G.) alle stupiden Arbeiten abgenommen würden und wir so mehr Zeit hätten, um Schmetterlingen hinterherzujagen oder Blumengestecke zu arrangieren. Doch bald schon stellte sich heraus, dass es nun wir selbst sind, die in den langweiligen Dingen feststecken, während die Computer eine gute Zeit haben, indem sie sich in die Weltbank einhacken oder Stephen Hawking einen amerikanischen Akzent geben. Ich wage die Vorhersage, dass uns irgendwann die Technologien ersetzen und wir zu deren Beiwerk degradiert werden.
Das überladene Gehirn
Obwohl es auf der Hand liegt, wendet sich keiner dem eigentlichen Problem zu: Warum erschweren wir uns selbst das Leben so sehr? Warum stopfen wir uns mit so vielen unnützen Dingen voll? Können wir diesen ganzen Müll nicht einfach ausleeren? Am Ende des Lebens müssen wir keine Prüfung bestehen, warum überladen wir es also so sehr? Ich weiß, ich bin an meinem Limit. Ich habe meine Erinnerungen auf eine Cloud hochgeladen, weiß aber nicht, wie ich sie wieder herunterbekomme. Mit unseren Fingerspitzen aktivieren wir Zigtausende von Bits an Informationen und holen sie auf die Bildschirme unserer Computer, die mehr verarbeiten können als das gesamte Kontrollzentrum der Apollomission. Die Informationen jagen über unsere Augen ins Gehirn. David Levitan schreibt: »Bei der Kommunikation mit unseren Freunden – und da ist die Arbeit noch nicht mitgerechnet – tippt jeder von uns im Schnitt 100000 Wörter am Tag. Es gibt 21274 Fernsehstationen, und selbst wenn künftige Generationen 158 Jahre leben könnten, würde es 17 Leben dauern, die ganzen Sender Ihres Fernsehers durchzuzappen.« Die meisten von ihnen produzieren Schrott. Wir nehmen die ganzen Informationen in uns auf – koste es, was es wolle. Es wäre ermüdend, herauszufinden, was uns wirklich interessiert und was für uns nicht von Belang ist. Wir sind mental so blockiert, dass es uns schwerfällt, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Sollte ich mich darüber sorgen, dass das Eis der Antarktis schmilzt, oder mir besser überlegen, welche Zahnpasta die richtige für mich ist? Unsere Gehirne sind keine Computer, man muss ihre Akkus nicht aufladen, aber sie brauchen Erholung, die wir ihnen allerdings nicht gönnen. Wer hat schon Zeit, sich auszuruhen? Ausruhen ist fast zu einem Schimpfwort geworden. Ausruhen darf man sich nur auf der Toilette. Jeder Tweet und jeder Facebook-Post laugt uns aus. Und das ist auch der Grund, warum wir immer vergessen, wo wir unseren Wagen geparkt haben.
Während wir uns beklagen, dass die Liste mit den Dingen, die wir zu erledigen haben, endlos ist, sollten wir nicht vergessen, dass wir sie uns selbst aufgehalst haben. Niemand aus den Tiefen des Weltalls hat sie uns, als wir gerade nicht aufpassten, ins Gehirn gepflanzt. Okay, natürlich ist es gut, sich ein paar Sachen zu notieren, damit wir nicht vergessen, Milch zu kaufen oder zum Termin für die Darmspiegelung zu gehen. Doch wenn es Hunderte Dinge sind, die wir glauben täglich tun zu müssen, sollte uns das zu denken geben. Vielleicht fügen wir der Liste deswegen immer neue Dinge zu, weil wir Angst haben, irgendwann zu ihrem Ende vorzudringen, und dann völlig ohne Ziel sind und keinen Grund mehr haben, den nächsten Schritt zu unternehmen. Würden Sie sich, wenn Sie plötzlich listenlos dastünden, eine Pause erlauben? Natürlich beschweren sich alle, sie hätten zu viel zu erledigen, doch was würden sie tun, wenn sie plötzlich nichts mehr machen müssten? Tun oder nicht tun, das ist hier die Frage! In unserer Gesellschaft gelten jene Menschen als erfolgreiche Spitzenkräfte, deren Terminpläne ihnen keine einzige dreiminütige Pause erlauben, da sie von Sitzungen zum Arbeitsessen, von dort zum Fitnesstraining, dann zu Verabredungen und weiter zu einer Cocktailparty rennen. Sie gelten als Vorbilder. Meiner Ansicht nach sollten sie aber – und ich sage dies aus Mitgefühl – am Marterpfahl den Flammentod erleiden, da sie es zu verantworten haben, dass viele von uns glauben, nicht zu genügen.
Andere Lebewesen wissen, was sie tun. Vögel beispielsweise fliegen Tausende von Kilometern, nur um ein Ei zu legen und es dann auszubrüten. Sie kommen anschließend zurück, um mit irgendeinem ihrer Artgenossen Sex zu haben. Darüber beschwert sich niemand. Wir hingegen müssen keine solchen Entfernungen schwimmend, fliegend oder galoppierend zurücklegen und stürzen dennoch von Erschöpfung zu Erschöpfung – und all das nur, weil wir mit der oder dem Nächsten weitermachen möchten … und so sind wir auf dem besten Weg zu einem totalen Nervenzusammenbruch. Aber eigentlich macht es unser Menschsein aus, Schwächen zu haben. Wir sollten aufstehen und zu ihnen stehen. Tun wir dies, werden die Menschen um uns mitfühlend und empathisch reagieren (Qualitäten, die sich selten genug zeigen) – und genau das ist es, was die Welt von Narzissmus und Gier heilt.
Es ist Zeit, aufzuwachen und auf die Zeichen zu achten, die uns unsere Seele und unser Körper geben, zu entschleunigen und uns unserer Umgebung und dem, was sich in unserem Inneren abspielt, bewusst zu werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir dies dauernd tun müssen: Es genügt, von Zeit zu Zeit zum Auftanken anzuhalten, bevor wir wieder in das Rennen gehen, das wir Leben nennen.
Ich kenne einen Neurologen, der kürzlich einen lebensbedrohlichen Herzinfarkt hatte. Man sollte denken, er kenne sich bezüglich der Funktionsweise des Gehirns aus und wisse, dass man nicht ewig mit nur zwei Stunden Schlaf und vierhundert Stunden Arbeit die Woche leben kann. Nach nur drei Tagen erklärte er, dass er sich keine weitere Ruhe gönnen wolle, sondern seine Vorlesungen vom Krankenbett aus geben würde. Wahrscheinlich verließ er dieses nur deswegen nicht, weil er noch an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen war und durch die Nase Infusionen bekam – womit er bewies, dass manchmal selbst Neurologen nicht vom Wahnsinn verschont bleiben.
Vergleichen
Wir vergleichen uns andauernd mit anderen, und auch das erschöpft. Fortwährend schnüffeln wir herum, um herauszubekommen, wer der Beste ist. In der Natur kann aus einer Bienenlarve sowohl eine Bienenkönigin als auch eine Arbeiterin werden. Dies hängt ausschließlich davon ab, welche Nahrung sie erhält. Bienenstöcke sind komplexe soziale Strukturen, in denen Arbeiterinnen mit verschiedenen Aufgaben leben: Es gibt unter ihnen zwar Erntearbeiterinnen, Krankenschwestern oder Reinigungskräfte, aber natürlich keine Gattinnen von Fußballern oder anderen Berühmtheiten. Die Reinigungskraft träumt nicht davon, Krankenschwester zu werden. Wir hingegen glauben, immer alles auf einmal tun und sein zu müssen: Königin sein, Eier legen, sie ausbrüten, sauber machen und gleichzeitig den Hula-Hoop-Reifen drehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir dann irgendwann Angstlöser schlucken und Bienen eben nicht. Wie auch immer. Bei Vergleichen kenne ich mich aus, sie sind eine Zutat meiner neurotischen Suppe.
Ich bin in Edinburgh. Mir geht es dreckig, und ich versuche herauszubekommen, warum. Oberflächlich betrachtet, läuft alles glatt – meine Show, mein Leben, meine Arbeit. Was also ist es, was nicht stimmt? Schließlich finde ich einen Grund.
Ich bin bei einem Dinner. Neben mir sitzt Brian Cox. Mir ist ganz übel, denn er ist Molekular-Genetiker, Astrophysiker, Forscher, Teilchenphysiker, der beim Großen Hadronen-Speicherring-Teilchenbeschleuniger arbeitet. Er ist wunderschön und sieht aus wie ein Zehnjähriger. Das löst eines meiner Themen aus: Vergleichen. Ich versuche, im leeren Raum, den man mein Gehirn nennt, etwas Intelligentes zu finden, und gebe mein Bestes. Meine Zunge klebt am Gaumen, und ich frage: »Wenn es zahllose Paralleluniversen gibt, was bedeutet, dass es Unmengen meiner selbst gibt, wie kann ich dann hier sitzen und mit meiner Gabel eine Kartoffel aufspießen?« Vielleicht denkt er, dass ich nicht ganz unrecht habe, weswegen er antwortet, dass es vor 600000 Jahren auf unserem Planeten endlich genug Sauerstoff gab, sodass eine Zelle, die mit Mitochondrien aus Pilzen gefüllt war (ich nicke, um vorzutäuschen, ich wisse, was das sei), erstmals Sauerstoff einatmen konnte, während eine andere Zelle Methan ausatmete. Ich habe keinen Trumpf, den ich ausspielen kann. Ich überlege, ob ich so tun soll, als würde mir schwindelig.
Als das Schweigen langsam peinlich wird, wendet er sich dem Gast gegenüber zu und erklärt, dass Wissenschaftler jetzt bestimmen können, von wo in Zentralafrika eine Zelle, die sie in Ägypten finden, migriert sei. Der Angesprochene reagiert nicht, weswegen ich zunächst glaube, er sei genauso dumm wie ich, eine Illusion, die mir Brian mit der Erklärung nimmt, dieser Gast sei der weltführende Kosmologe. Ich werde ganz klein: Es ist Carlos Frenk (suchen Sie ihn auf YouTube. Ich habe es gemacht, und prompt verschlug es mir den Atem). Der Abend endet nicht gut. Vielleicht habe ich zu viel getrunken.
Es sind immer die gleichen ollen Kamellen, die uns in den Wahnsinn treiben: Wir vergleichen uns mit anderen. Dabei soll es Menschen geben, die mit ihrem Los zufrieden sind. Ich habe zwar noch keinen von ihnen getroffen, weiß aber, dass sie irgendwo inmitten von Wäldern leben, ihre eigenen Hühner züchten, ihre Kühe melken und abends am Lagerfeuer Marshmallows braten. Den Rest von uns klären Botschaften aus dem Äther darüber auf, was uns fehlt und was wir dringend brauchen, um »cool« zu sein. Heute reicht es nicht mehr aus, mit dem Nachbarn mitzuhalten, sondern es geht darum, ihn zu übertrumpfen, bis er vor Missgunst brodelt.
Vergleiche gibt es schon lange: »Warum ist mein Höhlendress nicht so schön wie das von Fran?« Oder: »Warum bekomme ich keinen größeren Hosenlatz?« Es ist immer das gleiche »Warum-Warum-Warum?«. Wir mühen und mühen und mühen uns ab. Es war schon immer so. Wir sind eingebildet und leiden unter Illusionen, die uns zerreißen, sind wie Hungergeister, immer auf der Suche, im Wollen, haben Sehnsucht nach irgendetwas. Bald wird es Grabinschriften geben wie: »Sie starb an Eifersucht!« oder »Er biss ins Gras, weil sein Auto zu klein war«. Mein persönlicher Titelsong heißt: »Nie gut genug!« Wenn ich mich in Gesellschaft von Superhirnen befinde, werde ich zu einem dreizehnjährigen Dummerchen. Ich sitze plötzlich wieder ganz hinten in der Klasse, nutzlos und dumm, von meinem hervorstehenden Zahn gezeichnet. Je länger ich mit solchen Leuten zusammen bin, umso weniger bin ich fähig, auch nur irgendetwas von mir zu geben, und so bekomme ich das Gefühl, auf der Leiter der Intelligenz noch einige Stufen herabzusteigen. Für gewöhnlich lasse ich sie in solchen Situationen reden, damit sie nicht bemerken, dass ich keine Ahnung habe.