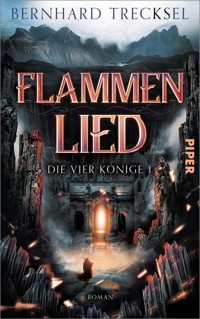
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Gruppe alter Bekannter trifft sich im Dorf Dunkelfall: der Paladin Bowden und der Feuermagier Kato, der Zwerg Gjalar und die Elfe Tanaqui. Bevor ihre nicht immer friedliche Vorgeschichte sie wieder entzweien kann, realisiert die Gruppe, dass die unnatürlich vielen Waldbrände, die sie beobachten, einen Grund haben: Die Feuer in den Schmieden der Zwerge brennen unkontrolliert, denn niemand bewacht sie mehr. Ein dunkles Rätsel liegt tief unter der Erde verborgen. Verfolgt von zahlreichen Feinden müssen die vier alles daransetzen, es zu lösen, bevor der gesamte Kontinent in Flammen aufgeht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Flammenlied« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur www.ava-international.de
Redaktion: Friedel Wahren
Karte und Vignetten: Timo Kümmel
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Kim Hoang, Guter Punkt München unter Verwendung von Motiven von iStock / Getty Images Plus
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Karte
Prolog
1
Vor dem Feuer
2
3
Vor dem Feuer
4
5
6
Wochen nach der Flucht. Nach dem Feuer.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Der Brief des Runenmeisters – Interludium
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Der Himmel hing so tief, als wolle er die Landmassen von Selachis verschlingen. Wie eine Walze über den Kontinent hinwegrollen. Alles zermalmen, was lebte. Die Sturmwolken tobten aufgebläht, schwanger vor Unheil. Entladungen in der Farbe entzündeten Fleisches tanzten darüber hinweg. Huschten wie gewaltige Spinnen in die Winkel. Wenn sie aufblitzten, verbrannte einem der grelle Schein das Gehirn.
Verkriech dich nach hinten! Erst bin ich am Zug. Du magst aufkratzen, was immer übrig bleibt. Die einsame Gestalt inmitten der Küstenfelsen wirkte verloren in ihrer Kleinheit, gemessen an den alles überragenden Landschafts- und Himmelsverwerfungen des Sturmwalls. Kein Zustand, den sie gewohnt war.
Klein.
Doch wer erreichte schon regelmäßig das Ende der bekannten Welt? Höhnisch verzog sie das wettergegerbte Gesicht. Bleckte vor der Schöpfung die Zähne. Unbeugsam wie eine Wölfin. Sie war zu weit gekommen, um sich vom Unwetter in die Flucht jagen zu lassen.
Der Sturm toste mit ungebrochener Wucht. Er tat es, seit die ersten Abkömmlinge aller Völker beim großen Auszug, der Diaspora, ihren Fuß auf den Archipel gesetzt hatten. Das Meer donnerte mit zeitloser Urgewalt gegen Kreidefelsen. Es leckte, fraß, trieb hinein und höhlte aus.
Poetisch, dachte die Gestalt. Der Sagas würdig. Hinter mir die Flammen der Vulkane, die einst Heimstatt meines Volkes waren. Vor mir der endlos hungrige Verschlinger, der niemals Ruhe geben wird. Wenn sie sich endlich begegnen, wird nichts mehr sein. Gerechtigkeit.
Mit ausladenden Bewegungen erklomm das Wesen die felsigen Ausläufer der Küste. Die Finger mit den derben Nägeln, gezeichnet von Jahrzehnten des Kampfes, fanden Halt im kleinsten Spalt. Gerade, starke Beine, die in Pelzstiefeln steckten, trieben den Körper unaufhaltsam vorwärts. Wenn die Blitze zuckten, warf ein meisterlich gearbeiteter Ringpanzer das Licht zurück.
Hüllte das Wetterspiel wohl die Landschaft in Gegensätze aus Hell und Dunkel, blieben die Augen und Zähne der wilden Besucherin dieses wüsten Landstrichs bei allen Lichtverhältnissen stets schwarz wie die Nacht.
Wäre der Blitz gewichen, so hätte wohl jeder Wanderer an diesem Ort nicht nur aufgrund tätowierter Augäpfel und von Pilzgift dunkelblauer Zähne der Hünin das Weite gesucht. Selbst der absonderlichen Haut, die vom Alabasterweißen ins milchige Blau überging, hätte es nicht bedurft. Ihre Gestalt allein schon war zu gewaltig und furchterregend.
Ihr Pelzumhang, zusammengefügt aus Fellen von einem halben Dutzend Bären und als Überwurf lässig über eine Schulter geschwungen, wogte so steif im Wind wie die dicken Zöpfe, die aus dem geflügelten Helm hervorragten. Die wehenden Gewänder gaben den Blick auf den kraftstrotzenden Körper frei, der sich sogar noch unter der Rüstung erahnen ließ. Aufrecht stand die Frau da, groß wie sechs Menschenkrieger, die Bartaxt am Gürtel hing lang wie ein junger Baum herab.
Kälte und erzürnte Elemente störten die Frostriesin nicht. Ihr unerbittlicher Blick suchte die Landschaft ab. Das Meer Hunderte Spann zu ihren Füßen. Hinter den Sehlöchern des Helms und dem Nasenschirm kniff sie die Augen zusammen. Höhe machte ihr nichts aus, wohl aber Wasser, das im Sturm wogte. Jarlin Velkha Whulfbodhir misstraute Dingen, die nicht gefroren waren.
Und sie misstraute auch fast allem anderen.
Unwillkürlich fuhr ihre Hand hinab zum Prachtgürtel aus gereihten Goldscheiben. Der Beutel hing an seinem Platz. Ebenso die Tasche mit den Runensteinen. Bei der bloßen Berührung wurden Velkha die Herzen schwer.
Ihre schlanken Finger fanden den Weg in das Innere der Tasche. Zitternd berührten sie die Steine, einen nach dem anderen. Es waren mehr als zehn Dutzend. Da war Connacht, jung und zu heißblütig, selbst nach den Maßstäben der kleinen Völker. Jäger hatte er werden wollen. Sweda, das Findelkind, weder Mann noch Frau – und somit Lehrling des Seidrmanns, ihres Sehers. Auch der Stein des Propheten Leifthrandr ruhte daneben. Angrboda. Hjild. Skarbrandr. Die Höhle. Das ganze Dorf.Der Clan.
Velkha war die Letzte.
Sie spie aus. Den Blick nach oben gerichtet, zu den kochenden Himmeln über der Gischt. Den Göttern zum Trotz. In den schwarzen Augen nichts als Hass auf jene dort oben. Auf die Ahnen. Auf die Götzen. Auf jeden, der sie, ihr Dorf, den Clan, das Volk, im Stich gelassen hatte.
Ebenso unbewusst fuhr ihre Hand zu einem anderen Beutel an ihren Lenden. Sie langte hinein. Dort, in diesem dritten Beutel, spürte sie die vertrauten Rundungen. Das Material unverkennbar. Es klickte vielfach beim Durchspielen, bevor der Sturm über den Wassern das Geräusch mit sich riss. Velkhas Klauen glitten kosend über die Totenschädel. Winzig wie Murmeln. Hunderte.
Nordmänner der Skraemar. Menschenkrieger. Zwerge.
Erzfeinde.
Narren, die nicht ahnten, was dieser Archipel wirklich war. Wie sehr sie alle betrogen worden waren. Das Feuer kam. Nichts würde ihm standhalten.
Was war dagegen das Ertrinken?
Mit grimmem Blick trat sie einen Schritt nach vorn – auf das tief unter ihr wütende Meer zu, über ihr der bis zur Grenze der Nebel tosende Sturm.
Sie näherte sich der Felskante, einen höhnischen Zug um die Lippen. Schnaubte, ausgeliefert den tödlichen Elementen. Weiter draußen, vor der Küste, brodelten die Wolken des endlosen Walls. Die Welt jenseits dieser Mauer aus uralter Magie war vor langer Zeit vom Hochmut der jungen Völker heimgesucht und dann von Erwählten auf einer Queste zurückgelassen worden. Es gab keinen Weg mehr, dieses Selachis, wie die Elfen das Inselreich nach ihrer Göttin Selachia benannten, zu verlassen.
Velkha scherte sich nicht darum. Sie war aus einem anderen Grund gekommen. Was jenseits der Welt war, zog sie nicht an. Nicht mehr. Nun ging es darum, der Gerechtigkeit Genüge zu tun.
Sie stand auf einem Felsüberhang und richtete nun den Blick nach unten. Auf die Fluten. Auf die Schemen der Bauten, die ihre an Granithöhlen, Schneestürme und das Hochgebirge gewohnten Augen in der endlosen Tiefe des Wassers zu erahnen vermochten.
Wieder führte Velkha Whulfbodhir die Hand zum Beutel. Sie erinnerte sich, wie der hochmütige Elf sie warnen und belehren wollte: »Nutzt du ihn, gibt es kein Zurück mehr, ist dir das bewusst?«
Wie gern hätte sie das dürre Gerippe des maskierten Elfleins damals gepackt und ihm das Leben mit der Faust herausgepresst, ihrer Sammlung an Schädeln aus den jungen und alten Völkern einen weiteren hinzugefügt. Doch sie hatte gute Miene zum Spiel des Unsterblichen gemacht. Niemand legte sich freiwillig mit Hochmagiern an.
Um des Clans willen.
Um des Plans willen.
»Als gäbe es für mich noch ein Zurück«, raunte die Frostriesin. Sie redete sich ein, es sei der eisige Höhenwind, der ihr die Kehle zuschnürte, was Unfug war. Der Weg hinter ihr war längst abgeschnitten. Der Weg nach Hause mit dem letzten Überfall der Nordmänner und götterverreckten Unterirdischen gegen ihren Clan für immer verstellt. Dort gab es nichts mehr. Sie hatten auch die Kinder nicht geschont, die Goldraffer und Walmörder.
Die Tränen in den Augenwinkeln der Riesin gerieten zu glänzenden Kunstwerken aus Kristall.
Ihre Hand legte sich entschlossen um den Beutel. Sie schnürte ihn auf. Griff hinein. Nahm, was der Elf ihr gegeben hatte. Wie winzig es auf ihrer Handfläche lag, wie ein Staubkorn. Doch konnten die Winde nicht daran rühren.
Velkha schloss die Augen und holte tief Luft.
Die andere Hand wanderte zu den Runensteinen ihrer Familie.
»Für den Clan!«
Die Jarlin Velkha Whulfbodhir sprang. Sie stürzte wie ein Senkblei lotrecht auf die Fluten zu und verschwand zwischen den Wellenkämmen.
Sie sank.
Der Untergang von Selachis war beschlossene Sache.
1
Vor dem Feuer
Der Wind strich über den Sand, versetzte ihn mit jedem Stoß, jedem Streicheln einer Bö in Bewegung. Der letzte Rest Abendwärme wurde zu einer Phase drückender Schwüle, welche, zumal in der Hitze der Glassande, nur schwer zu ertragen war. Die kalten Höhenwinde, die um diese Stunde aus den schroffen Bergen auf das Nomadenlager der Septe der Windspeere herabfielen, pressten die Wärme nach unten. Sie drückten sie gegen den Boden, bis die Knöchel und Unterschenkel sich anfühlten, als durchquerten sie kochenden Sirup.
Wer diesen Teil des südlichen Selachis nicht kannte und es in den gnadenlosen Glassanden vollbracht hatte, einen Tag bis zum Abend zu überleben, wurde dem nächsten Schrecken ausgesetzt. Die heiße Luft, am Boden zu einer qualvoll brodelnden Schicht verdichtet, stellte etwas mit den Kristallen der Wüste an. Etwas, das ihre eigentlich als ebenso hochgebildet wie kultiviert geltenden Einwohner nicht verstanden, mochten sie menschlich oder vom Alten Blut sein.
Elmsfeuer und Kugelblitze wanderten wie weiß-blaue Spinnen und Käfer die Dünen herab. Ihre unstet zuckenden Beine leckten unablässig über den Sand.
Wann immer dieses abendliche Schauspiel sich wiederholte, stießen sie darunter auch in metallische und kristalline Ablagerungen vor, was kleine Verpuffungen auslöste. Die wiederum versetzten mit den Abendwinden die Dünen in unberechenbare Bewegung.
Wann immer größere Sandwellen von den Dünen abgingen, glich das Geräusch dem feinen Raspeln, das die Deckflügel der gewaltigen Nashornkäfer verursachten, wenn sie während der Paarungszeit übereinanderschabten.
Bei dem Gedanken an die kolossalen Insekten, den metallenen Glanz ihres Panzers, besonders aber das saftige Muskelfleisch unter den Flügeln, antwortete der Magen einer anmutigen Nomadin mit einem Knurren. Sie hockte mit angezogenen Knien auf einer Zusammenballung mächtiger Kristalle am Rand der Zeltsiedlung auf einem Felsen.
Bogen und Speer hatte die zierliche Jägerin neben sich angelehnt. Trotz der friedlichen Abendstimmung und der Entspanntheit, welche ihre Umrisse ausstrahlten, verriet doch jede ihrer Bewegungen das Raubtier. Ihr Körper war verhüllt von Gewändern im Weiß sonnengebleichter Knochen.
Allem Anschein nach war ihr Magen nicht der einzige Bereich ihres Körpers, der sich vom Gedanken an eine mögliche Jagd und das köstliche Ergebnis angetan fühlte. Sie rieb sich die Haut am Übergang zwischen Schulter und Hals unter ihrem Burnus, just dort, wo sie die Tätowierung für ihre Sechzehnte der Vierundzwanzig Prüfungen der Alka’avir erhalten hatte.
Bevor sie überhaupt so recht eine Linderung des Juckens verspürte, hörte sie schon wieder auf, die Stelle abzutasten. Vielmehr zuckte sie zusammen, als es einem letzten, sich standhaft dem allabendlichen Tod verweigernden Strahl der untergehenden Sonne gelang, sich unter die Nomadengewänder zu tasten.
»Ich verstehe, dass du ungeduldig bist. Ich bin es auch. Doch wir wissen beide, dass ich nicht allein ausreiten werde«, wisperte die Nomadin.
Wie immer, wenn sie mit dem Großen Jäger sprach, blieb er der Nomadin Tanaqui eine Antwort schuldig. Er war zu Lebzeiten kein Mann der Worte gewesen, wenn man den Schriften der Waldelfen des Schwertwinds aus dem Mirvaali glauben wollte. Die Nomadin tat es. Sie war eine von ihnen gewesen. Der Große Jäger war stets nur der Meisterschaft seines Handwerks und der Erregung während der Jagd verhaftet geblieben.
Statt des Großen Jägers war es der Abendwind, der sich mit unnachahmlichem Heulen in den verkarsteten Felsen westlich des Lagers der Silberreiterelfen fing und ihr Antwort gab.
Tanaqui hob den Kopf und strich gleich mehrere ihrer zahllosen Zöpfe beiseite, die so hartnäckig darauf bestanden, aus ihrem Chalafkopfschal auszubrechen. Für den Moment eines Herzschlags legte er die Spitze ihres Ohrs frei. Da waren sie, Klang und Weise, mit denen der Wind sich jeden Abend in der Mesa verfing. So wie erwartet.
Ebenso war dort wieder der andere Ton zu hören. Jene verstohlene Stimme knapp unter dem Säuseln und Heulen des Naturschauspiels. Die Melodie. Die Schalmei. Wie auch immer man es nennen wollte. Eine fein gesponnene und für Tanaqui doch nicht zu überhörende Klangfolge, die ihr vor einigen Monden aufgefallen war, nachdem sie die Sechzehnte der Vierundzwanzig Prüfungen gemeistert hatte.
Das nahezu unhörbare Lied, das auf befremdende Weise wie glockenhelles Spiel aus Glasstäben in einem unhörbaren Wind klang. Es würde wie immer mit jeder Minute dunkler und volltönender werden, bevor der Wind abflachte, und mit dem Ersterben seines Tobens würde die Schalmei verstummen.
Danach setzte üblicherweise rasch der Sonnenuntergang ein, und der Nachtfrost ritt ihm dicht auf den Fersen. Das ewige Spiel der Wüste.
Tanaqui wunderte sich. Wie oft hatte sie abends hier draußen am Rand des Nomadenlagers gesessen. Die anderen Silberreiter dabei beobachtet, wie sie zwischen ihren prachtvoll geschmückten Rundzelten umherhuschten, Pferde und tödliche Reitkatzen auf die Nacht vorbereiteten.
Sie wandte den Kopf zum Lager hinüber. Besah sich das Treiben. Wie lange lebte sie schon bei ihnen? Wie lange war sie nun schon eine von ihnen?
Bin ich das?
»Grübelst du wieder über deine Stimmen im Wind nach?«
Haelthan war gut. Nicht so gut wie Tanaqui, aber gut genug, dass er sich bis auf einige Schritte an sie hatte heranschleichen können.
»Melodie«, sagte die Jägerin.
Der Wüstenelf zuckte mit den Achseln, wog mit beiden Händen ab. »Wo ist der Unterschied?«, fragte der Nomade, der wie Tanaqui von Kopf bis Fuß verhüllt war. Wie sie alle. Zumindest jene von ihnen, die den ersten Schritt zur Halbgöttlichkeit vollzogen hatten. »Darf ich?«, fragte Haelthan und wartete die Antwort der Fuchstochter gar nicht erst ab. Er hüpfte neben sie auf den Felsen, setzte sich. Zog die Beine an, wie sie es tat.
Er ist noch so jung.
Tanaqui Fuchstochter warf einen Seitenblick auf den Fährtensucher. Haelthan war der Sohn des Häuptlings. Bis auf die Augen von der Farbe ungeschliffener Opale lugte nichts von ihm hervor, wie alle Silberreiter war er gänzlich verhüllt. Wie sie alle achtete er tunlichst darauf, seine Haut niemals der Sonne preiszugeben, selbst jetzt noch, da diese bereits im Verschwinden begriffen war.
Sie schwiegen eine Weile. Genossen, wie der Wind und die Töne der Wüste sich veränderten. Tanaqui spitzte die Ohren. Mit dem schleichenden Erblühen erster kalter Sterne am Samtblau des Nachthimmels verlor sich das Lied einmal mehr.
»Wieso höre ich nichts von deinem Sie-rennen-Gesang?«, fragte der junge Jäger unvermittelt, fügte ein Lehnwort der Menschen in seinen Dialekt der Alten Sprache ein. Er riss die Jägerin aus Gedanken, denen vertraute Schwermut anhaftete.
»Du meinst Sirenengesang, Haelthan.«
»Wie auch immer.« Einmal mehr zuckte er mit den Achseln. Sie sah, wie er unter seinem Chalaf die Lippen schürzte. »Die Zunge der Schwertwindler ist barbarisch. Jede Silbe klebt vor Harz und stinkt nach Borke. Affenschmutz von den Menschlingen klebt daran. Du lernst besser noch rasch mehr von unserer Sprache, Fuchstochter.«
Es passt ihm nicht, dass ihn eine Frau belehrt. Noch dazu eine Ireni, eine Fremde. Die Silberreiter gaben sich alle Mühe, Tanaqui das Gefühl zu vermitteln, sie gehöre zum Stamm. Innerhalb ihrer Möglichkeiten.
Was nicht viel bedeutet.
Tanaqui seufzte unüberhörbar. Draußen zwischen den Dünen hob ein Fennek den Kopf und spitzte die mächtigen Ohren. Dann raste der Wüstenfuchs im ewigen Schauspiel des Überlebens unter den aufziehenden Sternen hinter einer Springmaus her.
Haelthan fühlte sich offenbar ebenfalls angegriffen. Augenblicklich ging er zur Verteidigung über. »Woher soll ich wissen, was eine Sirene ist? Hause ich am Meer? Schwinge ich mich durch die Bäume wie ein Lianenbrüller?«
Ergeben deutete die Jägerin mit ausholender Geste über den Sand, der sich von einem Ende des Horizonts zum anderen erstreckte. »Ich widerspreche dir.«
»Der Ozean der Glassande ähnelt einem Meer, ja. Aber es leben keine Chimaerae darin, die erst für einen Krieger singen und ihn dann fressen, bevor sie seine Überreste in lichtlose Düsternis zerren. Woher sollte ich Kunde von deinem riesigen Wasser haben? Ich habe es nie gesehen«, erklärte er mit einer störrischen Bestimmtheit, die selbst unbedarften Fremden längst verraten hätte, dass der Krieger, der dort sprach, fast noch ein halbes Kind war.
»Es ist nicht mein Wasser«, antwortete Tanaqui und rang um Geduld. »Wie oft soll ich noch erklären, dass der Teil des Mirvaali, dem ich entstamme, zwei Wochen entfernt von der Bucht der Leviathane liegt? Unser Prinz hat nie Ansprüche auf die Gefilde der Skraemar-Nordleute erhoben.«
Sie fröstelte. Das Einzige, wonach dieser Teufel nie seine Klauen ausstreckte.
»Du bist nie dorthin geritten? Hast nie auf das Wasser geblickt wie wir auf die Sande?« Er schüttelte den Kopf. »Ein Ort mit so viel Wasser, dass tausend Städte der Äffchen Platz darin finden. Gäbe es so etwas, ich ritte jeden Tag dorthin und tränke mich satt. Rund? Oder wie sagt man das bei Wasser in deinem kruden Dialekt?«
»Ich war oft dort. Sicher. Teils öfter, als mir lieb war. Trinken solltest du dort nichts, das Wasser ist salziger als der Trockensee von Eliaf’thar. Haelthan, welchen Grund sollte ich haben, einen solchen Ort zu erfinden? Öffne ein Buch. Lausch dem Gesang eures … unseres Stammesbewahrers. Das Meer ist so echt wie die Glut der Mittagsstunde.«
Das Meer. Rotes Wasser an den Stegen. Ein Mensch im Kettenhemd, den das Gewicht seines Stahlkleids in die Tiefe zog. Kreisende Haie, die das Wasser mit ihren Messerrücken durchpflügten.
Mit Grauen dachte sie an jene Nacht zurück, als der Überfall auf die Nordleute zum reinen Gemetzel ausartete. Die Skraemar hatten tapfer gekämpft. Viele von ihnen hatten gebrannt. Vergeltung für ihren Raubbau an den kostbaren Hölzern des Mirvaali. Ob die Fjordstädte wohl noch standen? Die schrecklichen Bilder verfolgten sie. Ein Teil ihres Selbst war dankbar, dass sie als entwurzelter Gast bei den Nomaden untergekommen war.
»Immer sitzt du hier und grübelst«, schmollte ihr eifriger Besucher, um sich seinen Mangel an Welterfahrung nicht einzugestehen.
»Wo sollte ich stattdessen sein? Ich habe gejagt, das Tagwerk verrichtet.« Sie entwand sich ihrem Chalaf, da die Sonne versunken war. Ließ es hinter dem Rücken baumeln. Legte spielerisch einen Finger an die Lippen. Neigte den Kopf auf neckische Weise, gab das Mädchen. »Lass mich raten! Ich sollte dein Lager teilen.«
»Wäre das so schlimm? Viele der Sammlerinnen und der Kriegerinnen rühmen sich dessen.« Er verblieb in seinem Taggewand. Reckte die Brust, um männlicher zu wirken. Verhüllte zugleich seine Furcht vor Beschämung.
Tanaqui hatte ins Schwarze getroffen. »Keine von ihnen ist eine Ireni. Keine von ihnen ist ich«, entgegnete sie.
»Du bist prüde wie eine der Rundohren. Du jagst und tötest wie wir, aber du paarst dich wie ein Menschling. Ihr habt zu lange Krieg geführt gegen sie am ewigen Wald, ihr seid träge und schwach geworden.« Er legte die Hände auf die Knie, wirkte damit noch mehr wie ein Junge. »Jene von euch, die noch da sind«, sagte er, um sie möglichst tief zu treffen.
Tanaqui ließ sich nicht darauf ein, schluckte hinunter, was ihr auf der Zunge lag. »Ich paare mich gar nicht«, entgegnete sie stattdessen. »Weder hier noch sonst wo. Nicht nach … damals.« Sie bezweifelte, dass er das gefährliche Beben in ihrer Stimme bemerkte. »Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass den meisten von euch … uns … das gut zupasskommt.«
»Du triffst mich«, murmelte er und deutete in der Geste für getroffenen Stolz auf sein linkes Hauptherz und umklammerte die Luft über der Brust, als wolle er es herausreißen.
»Was ich treffe, lebt nicht lange genug, um es zu bemerken«, sagte sie ohne Überheblichkeit. Nur wenige ihres Alters konnten mehr als zwölf der Vierundzwanzig Prüfungen vorweisen. Geschweige denn fünfzehn als eine der Ireni.
Der Große Jäger war mit ihr. Ein Blick auf Haelthans Schultern bestätigte alles, was sie empfand. Er wusste, mit welch tödlicher Kampfkraft durch die Jahre des Kriegs ausgestattet, sie bei der Septe angekommen war. Er musste begreifen, dass die Stufenleiter der Prüfungen sie mit jeder der Tätowierungen, die sie erlangt hatte, Welten von seinen Fähigkeiten entfernt hatte. »Bist du nur gekommen, um zu verhöhnen, was ich glasklar im Abendwind vernehme, du aber nicht hörst? Wähnst du, die beste Strategie, mich zu verführen, besteht darin, dich über mich lustig zu machen?«, ging sie ihn jetzt energisch an.
Abwehrend hob er die Hände, formte die Tagesgeste für friedliches Einvernehmen. Die Silberreiter hatten sich im Lauf der Jahrhunderte auf eine große Auswahl an verschlungenen Finger- und Handzeichen sowie Körperhaltungen verständigt. Einige der Krieger, die sie ersonnen hatten, lebten noch immer. Nur durch die Zeichensprache war gewährleistet, dass die wilden Wüstenelfen einander bei der Jagd auch verstanden. Dass kein unbedachtes Wort, keine falsch aufgenommene Handlung allzu schnell zu Blutvergießen führte. Es waren jedoch weniger sie, von denen die Gefahren ausgingen. Sondern ihre halb göttlichen Bewohner. Die Altvorderen legten höchsten Wert auf die Etikette.
Ihr allabendlicher Zaungast war jung, zudem recht ungeschliffen und unhöflich. Ein Verhalten, das Tanaqui vielleicht vergeben, in ihrer unmittelbaren Gegenwart jedoch nicht ohne Weiteres hinnehmen wollte. »Du dachtest wohl, du drängst dich mir auf diese Weise auf und teilst dann kurz meine Schenkel, noch dazu von oben herab. Und das, obwohl du weißt, was mir im Mirvaali einst widerfuhr. Warum ich meinem Volk entfliehen musste.« Sie zischte durch gebleckte Zähne. Der Schmerz loderte so frisch auf wie am ersten Tag. Der Nachteil des langen Lebens der alten Völker lag im guten Gedächtnis. Einmal mehr verfluchte sie es. »Entfliehen wollte.«
»Ich konnte doch nicht …«
»Du konntest. Doch du willst noch immer deinen Trieb stillen. Je mehr ich mich wehre, desto mehr wähnst du mich Wild, nicht Jägerin. Weil du jung bist. Weil du denkst, die Welt sei dein Spielhort. Weil du glaubst, dass jedes Weib nur nach einem Mann sucht.«
Sie spürte, wie bei diesen Worten der Alte Jäger in ihr aufwallte. Sie fühlte, wie die Tätowierungen in ihrer Haut zu brennendem, nagendem Leben erwachten, ihre Muskeln mit Hitze und Kampfeswillen füllten. Der Berserkerzorn des Ahnengeistes manifestierte sich. Mit der Ruhe schien es mit einem Mal vorbei.
Er ist aber kein Wild. Diese Leute sind mein Heim. Meine Heimat. Sie sind dein Volk, sagte sie, an den Jäger gewandt. Was hätten wir davon, wenn ich jetzt über ihn herfiele? Er ist uns nicht gewachsen. Du und ich, wir sind bald eins. Untrennbar.
Bei dem Gedanken daran, dass die Rituale der Silberreiter ihre unsterbliche Elfenseele dereinst mit der des Jägers zu einer Einheit reiner Bogen- und Speerkunst verschmelzen könne, erfasste sie ein Schauer. Niemand hatte alle Vierundzwanzig Prüfungen bislang vollendet und war zum Halbgott, zur Halbgöttin aufgestiegen.
Es wanderte ihren Rücken wie ein Zug Treiberameisen mit Beinen aus Eis herab. Ein Faszinosum, zu gleichen Teilen blankes Grauen und unbezähmbare Neugierde, was ihrem Bewusstsein widerführe, sollte sie es vollbringen, die letzte der Prüfungen zu meistern. Was geschah dann mit ihrem Seelenbaum, so er denn noch stand?
Der junge Elf bemerkte ihr Zögern. Versuchte abzulenken. »Wie ist sie? Die fünfzehnte, meine ich.«
Sie schenkte ihm ein geduldiges Lächeln, in dem alles geschrieben stand, was man ihr bei der Ankunft in der Septe eingegeben hatte. »Die Zunge vermag nicht zum Ausdruck zu bringen, des Reiters Ohr nicht zu hören, welcher Art Prüfungen unsere Vorväter uns auferlegten. Auch nur eine auszusprechen bedeutet die Sonnenpflöcke«, zitierte sie die Überlieferungen aller, die bereit waren, dem Ruf der Hautbilder zu folgen. »Du bist bei Nummer drei, du solltest es bereits seit einer Dekade besser wissen, als solche Fragen zu stellen.« Tadelnd wedelte sie mit dem Zeigefinger.
»Ich prüfe dich nur«, sagte er so aufrichtig, als würde er an seine Worte glauben. »Wir stellen dich auf die Probe. Du weißt, dass wir nur noch eines mehr verachten als einen schlechten Jäger, der zu viel von unserem Wasser nimmt.«
»Lügen und Verrat werden nicht geduldet«, zitierte Tanaqui eine der wenigen eisernen Regeln. Sie war eine Frau auf der Flucht gewesen, doch sie war eine Elfe. Eine der Ihren. Die Silberreiter legten größten Wert auf heilige Ordnungen, hatten ihre Familie aber niemals vergessen, auch nach Jahrhunderten nicht, nachdem sie den Mirvaali nach dem ersten der drei Unwerthkriege verlassen hatten.
Ruckartig erhob er sich neben ihr, sein erwartungsvoller Blick war für ihr scharfes Elfenauge im Dunkel der angebrochenen Nacht klar zu erkennen.
»Du wolltest also mehr von mir, als nur mein Lager zu teilen?«
Er zog seinen Chalaf beiseite und entblößte die Zähne zu einem wölfischen Grinsen.
»Die Kundschafter haben einen Fang gemacht«, entgegnete Haelthan. Er feixte und boxte Schatten, als hätte er ein neues Spielzeug erhalten. Was in gewisser Weise auch stimmte.
Sein Gesichtsausdruck verriet Tanaqui alles, was sie wissen musste. Einmal mehr waren ihnen in den Glassanden Menschen in die Klauen geraten. Bedauern regte sich in ihr.
Der junge Krieger missdeutete ihr finsteres Gesicht. »Keine Sorge, die Narren aus dem Emirat schicken immer wieder neue Patrouillen ihrer kurzlebigen Äffchen in die ewigen Glassande. Du bekommst schon noch Gelegenheit, rotes Affenblut zu vergießen. In der Haut von diesem einen hier bei uns will ich aber nicht stecken. Zumindest nicht, solange er sie noch hat.«
Tanaqui nickte bedächtig. Sie bedeutete Haelthan mit einer Geste, zum Lager vorzugehen.
Mit einem Achselzucken wandte er sich um, ließ sie in der aufziehenden Nachtkälte mit dem Zirpen der Zikaden allein. Sie blickte ihm hinterher, wie er mit der Vorfreude eines glücklichen Jungen aufbrach, um das Leben eines fühlenden, denkenden Wesens in eine Hölle aus Qualen zu verwandeln.
Ekel packte sie bei dem Gedanken, wie ähnlich er Prinz Vesshelin in diesem Moment war, seine wenige Jahrzehnte zählende Jugend befleckt von Hass unter den Völkern und Kriegsgelüsten.
Wahrlich, ihre Völker waren tief gefallen.
»Du entkommst deiner Vergangenheit nicht«, murmelte sie.
Der Nachtwind hatte keine Antwort. Er war zu beschäftigt damit, Tausende andere kleine und große Dramen in den Glassanden zu bezeugen. Was waren da ein Menschenleben und die Gefühle einer waldelfischen Vertriebenen?
2
»Es hat gebrannt. Die halbe Flur ist vernichtet«, sagte der Dorfvorsteher unnötigerweise. Er machte ein entschuldigendes Gesicht, so als wäre er persönlich für diesen Missstand verantwortlich.
»Was du nicht sagst«, nickte Kato Tamasine, seines Zeichens Lohenmagus der Armee Ihrer Majestät, der Königin Kyralia der Dritten von Emrick, und verengte die Augen. Die Sonne brannte vom Himmel auf das Dorf. Eine Million Zikaden verwandelte die flirrende Luft in eine Suppe aus Schall und schwärender Hitze, bei der der Kopf ins Schwimmen geriet. Die Bäume im Umkreis waren trockener als Katos Wortwitz.
Die Hitze selbst machte ihm nichts aus. Nicht seit dem Vorfall. Wie lange war es nun her, dass er nichts mehr von ihr spürte? Zwanzig Jahre? Dreißig?
Wie alt bin ich? Wann habe ich meinen Geburtstag zuletzt begangen?
Er runzelte die Stirn, um die unwillkommenen Gedanken zu vertreiben. Schüttelte mürrisch den Kopf unter der Kapuze. Der schwelende Grashalm zwischen den Lippen des Magiers wanderte von rechts nach links.
Was gäbe ich nicht für einen ordentlichen Zitronenschnaps.
»Oder zehn«, murmelte er zu sich eine eigene Antwort.
»Wie meinen?«, fragte der Landmann.
»Nichts, nichts.« Huldvoll neigte Tamasine das Haupt, blickte dabei über die Schulter des Bauern und rümpfte die Nase. Schnaubte. Sog die Luft ein, den Geruch von Holzkohle. Was überflüssig war, überlagerte er doch alles im Umkreis von zehn Meilen. Kato stellte sich halb spielerisch auf die Zehenspitzen, so als müsse er in die Ferne spähen, um das Unübersehbare hinter dem Mann zu bemerken. Kato schwankte. Hielt sich am Stab fest. Vielleicht doch genug Schnaps für heute? Ein dummes Manöver, alles in allem, in körperlicher Hinsicht unnötig, der Magier war von gewöhnlicher Größe für einen Mann aus Emrick – und der Dorfvorsteher reichte ihm nicht einmal bis zur Kehle.
Tamasine betrachtete das Bild der Verwüstung. Schaute dorthin, wo der Waldrand nun fehlte. Wo sich schwarze Baumstümpfe und sacht im Hitzeflimmern tanzende Asche trauernd über ein Stück Land erstreckten, groß wie mehrere Austragungsstätten. Überall Glutstellen im Grau. Rauchfähnchen hingen über der Aschebrache, flossen wie Seide über das Land, wenn der niemals Erlösung vor der Glutsonne versprechende Windhauch ihren Tanz störte.
Das Gleiche wie in den letzten beiden Weilern. Keine Überraschungen. Warum zur Grube der neuen Höllen hatten sie ihn Hunderte Meilen aus der Hauptstadt hierhergeschickt? Für ein paar Sommerfeuer?
Er kannte die Antwort. Gedankenverloren rieb er an der Brandnarbe auf der Wange. Das Schandmal.
»Ein Waldbrand, ein Funke irgendwo. Und ist der Zunder des Trockengrases einmal entfacht, gibt’s gar keinen Einhalt mehr, bis alles in Asche versinkt«, wusste der Dorfvorsteher, der damit ein unerwartetes Talent bewies, auf nutzlose Weise das Offenkundige in Worte zu fassen und dabei hintergründiger zu klingen als die Poeten, mit denen Tamasine an der Akademie getrunken hatte. Reclaw. Verhoeven. Salazaar. Mehr unerwünschte Bilder aus der Vergangenheit. Götter, Kato brauchte wirklich einen Schnaps. Oder etwa nicht?
»Was du nicht sagst, beredter Freund«, höhnte der Magier. Er ertappte sich jedoch dabei, dass er dem Mann beinahe vertraulich die Hand auf die Schulter gelegt hätte, zuckte erschrocken zurück und strich stattdessen seine Gewänder glatt.
Falls der Bauer die Geste wahrgenommen hatte, ließ er es sich nicht anmerken. Der Dorfvorsteher griente unter seinem schweißfleckigen Strohhut hervor und entblößte einen Friedhof fauliger Zähne, von denen einige entweder Grünspan oder Grünkohl angesetzt hatten. »Wie wir dem Magistrat sagten, Herr. Das kommt im Sommer vor. Kein Grund, die Schule zu verständigen.«
»Akademie«, berichtigte Kato den Mann. »Der Turm ist eine Akademie, keine reine Schule.«
»Wo liegt der Unterschied?«, fragte der Dorfvorsteher.
»Semantik«, antwortete der Lohenmagus gedankenverloren.
»Sagt mein Weib auch immer«, gab der Mann mit einem Achselzucken zurück. »Sie wünscht sich mehr Semantik von mir oder so was.«
»Niemals gehst du dorthin. Sie saugen dich aus und schicken dich ins Verderben. Du weißt, wohin sie dich aussenden werden. Gegen wen? Gegen was?« Kato zuckte zusammen, die Stimme seiner Mutter erwachte in seinen Erinnerungen so deutlich, dass ihm der Blick verschwamm. Er sah sich hastig um, doch seine längst verblichene Muse, die ihm das Leben geschenkt hatte, suchte götterlob nur seine Gedanken heim.
Sie war wahrhaftig eine kluge Frau gewesen, seine Mutter. Bevor sie verbrannt war wie die anderen.
»Sehr aufschlussreich, mein guter Mann. Wie meinen?«, fragte Tamasine.
»Ach, nicht so wichtig, mein Herr.« Der Bauer zog die Nase hoch und spuckte ein Gemisch aus Rotz und Asche auf zundertrockenes Gras. »Wollt Ihr den Wald in Augenschein nehmen? Wüsste zwar nicht, was das erbringen sollte, aber Ihr seid schließlich vom Fach.«
Kato musste sich zwingen, bei dem Wort nicht in höhnisches Wiehern auszubrechen. Das Verlangen nach einem Gerstenbrand, eiskalt aus dem Keller, wurde übermächtig. Und danach den ganzen Krug leeren.
Was soll der Geiz, wir sind ja schon dabei.
»Schöner Fachmann«, murmelte Kato und betastete wieder das Schandmal des Verrats im Gesicht.
»Wie meinen?«, fragte der Dorfvorsteher, und Kato konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Bauer ihn nachäffte.
»Sicher.« Kato rollte mit den Augen, seine Stimme troff vor Sarkasmus. »Lass mich also den unglaublich unvertrauten Anblick des Nachspiels einer rasenden Feuersbrunst in Augenschein nehmen. Ich bin sicher, ich werde etwas gänzlich Neues entdecken, das die Bahnen meines Lebens in unvertraute Gemarkungen führt.«
Der Dörfler überging die beißende Bemerkung. Er spie ein weiteres Mal aus, wobei er tunlichst darauf achtete, nicht in Katos Richtung zu blicken.
Wieder einer, der Furcht vor ihm hatte. Dies war ermüdend und vertraut, wie ein schlechter Geruch, der einem überallhin folgte. Kein fremdartiges Befinden für einen Feuerzauberer also, als Lohenmagus war er es vielmehr gewohnt. Die Menschen fürchteten ihn, wie sie Henkersschwerter, Gift oder Hexenjäger fürchteten. Er war eine Waffe der Königin, und an jedem Zoll von ihm klebte Blut. Die Leute spürten so etwas. Abgesehen davon, wie Kato seit frühester Jugend aussah, verstand sich. Diese Sache.
Sie schritten eine Zeit lang schweigend über die Weiden, braunes Gras knisterte, und Kapseln platzten unter jedem ihrer Schritte. Katos Stab aus geschwärztem Eisenholz mit Mondsilberzeichen wühlte heftige kleine Staubwolken auf, wo er sich in den ausgedörrten Grund bohrte.
Eigentlich sollte hier eine Mischung aus Wohlgeruch von Wildblumen, Harzduft, dem Summen unzähliger Insekten und dem unverwechselbaren Aroma trockener Erde seine Sinne beleben. Der Brandgeruch war jedoch so machtvoll, dass er alles überlagerte. Bis auf den endlosen Unterton des Zikadenkonzerts und das Hitzeflirren der Sonne gab es schlicht nichts an Eindrücken, die gegen den Gestank ankamen.
Kato hasste den Geruch leidenschaftlich. Er holte derart viele Erinnerungen aus der Tiefe hervor, dass sich der Lohenmagus nichts sehnlicher wünschte, als diesem Ort zu entfliehen.
Der Bauer schien einfühlsamer als angenommen, er warf dem größeren Mann in den seltsamen Gewändern in Dunkelrot und Orange beunruhigte Seitenblicke zu.
»Nun denn, los! Frag schon!«, versetzte Kato gereizt in jenem Tonfall, der sonst den Marschällen nobelster Speisehäuser beim Anblick eines Vagabunden vorbehalten war. »Alle wollen es wissen. Das Feuer. Die Augen. Die Haut. Wartet, lasst mich Euch zuvorkommen. Die Zauberzeichen im Fleisch! Sind die echt? Wieso habt Ihr die, mein Herr? Tut es weh?«
Nun musste Kato dem Drang widerstehen, schwer zu ächzen, als der Bauer seinerseits zurückfragte, und das mit einer Stimme, die unschuldig wie die eines Lämmchens klang. »Werdet Ihr das denn öfter gefragt, mein Herr?«
Der unüberwindliche Drang breitete sich nun in dem Magier aus, nach der Melodie des Kosmos zu greifen und einige Töne über die Lippen zu den Fingern wandern zu lassen. Dorthin, wo die Tätowierungen aus Mondsilber zu beständig lodernden arkanen Zeichen zusammenflossen. Den Willen zu ballen, die Laute in Misstöne zu verwandeln und dann drei rasche Gesten auszuführen.
Exitus. Schlacke. Kein Bauer, keine Fragen mehr. Ein Feuerball. Et Tabula rasa.
Es war so einfach geworden, nicht wahr? So verdammt leicht. Ein Schnippen und ein Singsang. Mehr bedurfte es nicht.
Er sah die Lohe strömen, hörte den Mann kurz und überrascht aufschreien. Allzu kurz, weil die Lunge in Flammen stand, dann brach der Körper zu einem Häuflein Asche zusammen.
»Oh«, holte der Bauer Kato aus seinen Tagträumen, immer noch mit seiner Novizenstimme, dem wohl aufging, dass der Mann neben ihm gerade sein scheußliches Ableben erwog. Dann erfuhr der Landmann eine Überraschung, weil der fremde Magier sich unvermittelt freundlich zeigte, statt ihn zu verdampfen.
Tamasines Tagtraum von Unbehelligtsein und Frieden sowie Schnaps endete so plötzlich, wie er über ihn gekommen war. »Deine Hartnäckigkeit zeichnet dich aus. Ich will dir entgegenkommen. Ja, man wird dauernd gefragt, ob es wehtut, ob die glühenden Male echt sind und woher man sie hat. Aber meinethalben: Mein Haar und meine Augen brennen beständig, weil die arkanen Muster in meiner Haut die Idiosynkrasien des göttlichen Willens lenken, der dereinst unsere Schöpfung hervorbrachte und sich dann von seinen Trägern löste, wie uns die Philosophen Thaalbach und Samarkanth lehrten. Weil die göttliche Melodie, die seitdem die Weiten des Kosmos erfüllt, von jenen wenigen angezapft werden kann, die die nötige Hellhörigkeit dazu besitzen, findet sich dann noch ein Erwählter …«
»Verzeiht, Herr. Ich wollte Euch nicht unterbrechen.« Er tat es indessen.
»Ah«, machte Kato. »Dann meinst du wohl das hier?« Er deutete auf das Brandmal auf seiner Wange. Vernarbt, aber noch frisch genug, dass es juckte, wenn Schweiß darüberrann. Was gerade die ganze Zeit über geschah. »Frag nur. Äußere deine Vorwürfe, Bauer, ich weiß schon, was du sagen willst. Ich weiß, was ihr alle sagen wollt. Ein dreckiger Deserteur. Gezeichnet!« Nun stieg echter Zorn in dem Magier auf.
»Ich meinte das da, Herr. Ich war bloß verwundert, wo Ihr doch brennen tut und all das, Haare und Augen und was sonst noch … Da sehe ich die Röte dazu in Eurem Gesicht und wollte Euch eine Salbe anbieten. Und meinen Hut? Herr? Ich weiß, wie weh die Dinger tun. Hab die dauernd im Nacken, von der Feldarbeit und all dem, ne.«
Katos Hand folgte dem Fingerzeig des Dorfvorstehers, der tunlichst darauf achtete, nicht anklagend zu wirken, als er auf die Wange ohne das Mal der Schande deutete. Kato betastete die Stelle. Sie war erhitzt. Organisch heiß, nicht von der Magie.
»Autsch«, stöhnte der Magier und kam sich plötzlich sehr, sehr dumm vor.
»Hatte mich halt gewundert, dass Ihr einen Sonnenbrand bekommen könnt«, entschuldigte sich der Bauer und ging weiter. Er fand wohl, er hätte genug Zorn für einen Tag auf sich gezogen. Dabei streckte er im Vorauseilen den Hut nach hinten.
Kato betrachtete das vor Schweißflecken starrende Stroh und bemühte sich um einen versöhnlichen Ton, als er ablehnte. Er zog die Kapuze tiefer übers Gesicht, spürte die Kühle der eingewobenen Fäden aus Mondsilber. Zog den Kopf in das Dunkel des kostbaren Stoffs zurück. Die Verzauberungen, die vereitelten, dass die Robe des Lohenmagus aufgrund von Katos einmaligem Zustand in Flammen aufging, kühlten die Haut. Sie hielten die Sonne fern. Eigentlich. Falls man keinen Kater und die Grundlagen nicht versoffen hatte, zudem auch nicht dauernd das Gesicht aus dem Schutz heraus vorstreckte.
Feuer tat ihm nichts. Sonnenlicht peinigte ihn hingegen.
Da sag noch einer, ein Mann mit meinem Hautton, dessen Vorfahren Reisfelder bearbeitet und wilde Pferde unter dem Himmel des Wolfsgottes geritten haben, sei gefeit vor Sonnenbrand. Nur Nordleute und Emrickaner kommen auf so etwas.
»Also gut, wer von euch Witzbolden war das? Wer von euch hat die Kapuze verschoben, als ich abgelenkt war?«, flüsterte Kato den unsichtbaren Begleitern zu. Sie schwiegen beharrlich.
Die kamen nur, wenn er sie nicht brauchte.
Der Dorfvorsteher und der Magier erreichten den Waldrand.
Hier war der Brandgeruch keine dauerhafte Überlagerung mehr. Er war alles, drohte jeden mit seiner stumpfen Bitterkeit zu ersticken, setzte sich in der Nase fest, drang in alles ein, tränkte die Kleidung. Kato Tamasine wusste gut, wie lange der Geruch haften blieb, einen Mann begleiten konnte. Er stank an manchen Tagen schlimmer als ein Köhlerdorf.
Wenigstens hier bewies der Bauer Scharfsinn und schwieg. Sie standen nebeneinander auf einer Ebene aus qualmender schwarzer Verwüstung. Am Horizont, im Osten, ragte das endlose Smaragdgrün der westlichen Ausläufer des Mirvaali auf. Unangetastet von den Flammen, heilig und Leben spendend. Das Schrillen der Zikadenkonzerte war ohrenbetäubend.
»Kann mir denken, was Ihr als Nächstes fragen werdet«, sagte der Bauer, als er Katos Blick zum heiligen Wald der Messerohren bemerkte. »Hab ein paar Dorffeuer mitbekommen in meinen Jahren. So nach dem letzten Unwerthkrieg. Aber nein, keiner von den Feenblütigen hat Vergeltung geübt. Kein Pfeil, kein Botschafter, keine Holzfäller ohne Kopf mit Mais im Ar… Leib. Nichts vom Üblichen.« Der Dörfler spie aus, ein Glutaschenest verpuffte, als zäher Speichel landete. Der Wind trug die Flocken davon, und Kato blickte ihnen nach. Er beneidete sie.
»Dann hat der Schwertwind euch auch nicht auf dem Kieker«, meinte Kato und nickte dem Dorfvorsteher zu. Der mühte sich, dem lodernden Blick unter der Kapuze auszuweichen.
»Ist schon mal beruhigend, dass die Elfen nicht auf ihrem Viehzeug aus dem Wald kommen und uns jagen. Ich hab mal mitbekommen, wie das aussieht. Da war ich gerade mal so groß.« Der Bauer deutete mit der Hand eine Geste irgendwo in Hüfthöhe an. Er fing an, von den Schrecken zu erzählen, die die Elfen über die Menschen am Waldrand brachten.
Kato hörte weg, ging an dem Mann vorbei, tiefer hinein in die heißeren Gebiete des Ödlandes. Reiner Selbstschutz. Er wollte keine Geschichten über Elfen hören. Er wusste, wozu sie fähig waren.
Ich weiß doch, wozu sie mich getrieben haben.
Ohne darauf zu achten, dass der Bauer noch redete, sagte Tamasine: »Wenn die letzten Messerohren annähmen, dass euer Kaff einen Brand solcher Größe im Mirvaali gelegt oder auch nur mitzuverantworten hätte, würdet ihr alle ohne Haut und mit Tannenzapfen in den Augenhöhlen von euren Dachfirsten baumeln.«
»Jap«, machte der Bauer. Eine Tatsache des Daseins im Osten von Emrick.
Der Magier konnte die Hitze nun mit seinem Sinn für Flammen wahrnehmen, doch im Gegensatz zu dem Licht der Sonne fühlte er davon hier nichts, was Schmerzen betraf. Wie auch, seit dem Unfall in der Kindheit. Er hätte mitten in dem Inferno stehen können, das hier noch vor Stunden getobt hatte, und es wäre ihm nicht anders vorgekommen als jeder andere Wind.
»Was werdet Ihr nun tun, Herr?«, hallte es zu Kato herüber.
Das Gleiche wie immer. Meine Arbeit. Oder das, was von ihr noch übrig ist.
Er antwortete: »Da du es so gern wüsstest: Ich durchforste im nächsten Schritt die chronophasischen Strömungen in den tieferen Akkorden der Melodie der Schöpfung nach Zeitmagie, einer Invokation der Niederungen und Tieftöne, nach elementaren Tremolos, Alchemagie, nach Diskordanzen und Misstönen, die auf eine Evokation der fünf Elemente hindeuten. Oder nach der Goetia, der Verderbnis der Linkshand. Chimaerae, Dämonen, Untote.«
Mit verblüffendem Scharfsinn – Bauernschläue – folgerte der Dorfvorsteher: »Ihr wollt gucken, wie wo einer vielleicht gezaubert hat, dass es gebrannt hat oder so was.«
Ehrliche Verblüffung erwischte Kato wie ein Eiswind. Er wandte mit solcher Langsamkeit den Kopf, dass er seinen Nacken förmlich knarren hörte, und blickte den Dörfler an. Der stand einfach da in seiner Hose, deren Schadhaftigkeit nur von der Anzahl der Flecken wettgemacht wurde, und griente übers ganze Gesicht.
»In etwa«, sagte Kato Tamasine und fühlte sich für einen Moment entwaffnet. Jetzt kam er sich beinahe schäbig vor, so verächtlich mit dem Mann umgegangen zu sein.
In wen haben die mich verwandelt?
»Kann ich Euch sonst noch helfen, Herr?«, wollte der Bauer wissen.
»Ja«, hörte Kato sich zur eigenen Überraschung sagen. Der Mann war nun weniger ängstlich, was Kato für ihn einnahm. »Du kannst mir zeigen, wo nach den Schilderungen deiner Leute das Feuer den Anfang nahm. Wenn ich mir das so anschaue, würde ich auf Blitzschlag tippen. Damit müsste das Feuer so oder so angefangen haben, auch für den Fall, dass jemand Magie anwandte. Wovon ich aber nicht ausgehe …«
»… weil die Spitzohren ja nicht auf Rache aus sind und keiner so blöd sein wird, Ihrer Majestät die Wälder und Äcker anzuzünden. Im Sommer noch dazu«, folgerte der Landmann, der sich in Bewegung setzte.
»Hm…hm«, nickte Kato und folgte dem Vorsteher. Dessen Gesellschaft und sein alles andere als angenehmer Leibesgeruch, den ihm laue Lüftchen entgegentrugen, waren ihm nun willkommener als noch gerade eben. Für einen Augenblick sah er sich in diesem Dorf leben. Wasser aus dem Brunnen holen, Mehl mahlen, Felder bestellen. Kinder?
Das einfache Dasein.
»Da vorn war’s«, sagte der Bauer und deutete in eine ungefähre Richtung. »Verbrennt der sich nicht die Pfoten?«
Kato folgte dem Fingerzeig des Mannes. Er deutete auf einen massigen Hund, der tollpatschig am Waldrand herumstromerte. Das Tier war beleibt, sein Fell für diese Breiten zu dicht. Es glänzte im Sonnenlicht so golden wie die neugierig und klug wirkenden Augen dieses Hütehunds.
Seine rosafarbene Zunge flatterte allerdings wie ein nasses Banner in der brütenden Sommerluft und versprühte Schaum, was den aufgeweckten ersten Eindruck des Tiers Lügen strafte.
»Der liebenswerte Schwachkopf dort drüben?« Kato zuckte mit den Achseln. »Das ist bloß Kincaid«, erklärte er und setzte seinen Weg zum Ursprung des Brandherds fort. »Komm, du Schwachkopf!«
Als er seinen Namen hörte, vollführte Kincaid einen Satz nach vorn und prallte mit dem Kopf gegen einen verkohlten Zaunpfahl, der barst. Erbost schnappte der Hund nach dem Kohlestaub, der für sein Ungemach verantwortlich gewesen war, bekam jedoch bloß den eigenen Schweif zu packen. Kincaid rotierte wie ein Kreisel.
»Ein bisschen dumm ist er schon. Zwar tut er, was man ihm sagt, wird in diesem Leben aber nicht mehr klüger.« Kato verzog das Gesicht unter der Kapuze zu einem freundlichen Lächeln, auch wenn der Bauer es gar nicht zu sehen bekam. Der Feuermagier war sich nämlich nicht sicher, ob er nur von seinem Hund sprach oder sich am Ende selbst meinte.
3
Vor dem Feuer
Es waren haargenau hundert Herzschläge gewesen, die vergehen sollten, bis sie zur Verräterin wurde. Sie wusste es, weil sie sie gezählt hatte. Es waren hundert Herzschläge gewesen, mit denen sie die Heimat hintergehen würde, die sie in den Wüsten des Südens nach Jahren der Flucht gefunden hatte.
Es war nicht der Puls eines Menschen, der diese Schläge vorgab. Tanaqui Fuchstochter entstammte den Tiefen des Mirvaali, jenes Waldes im Norden, der den Elfen des Schwertwindes die Heimat bot. Wie bei allen Mitgliedern der Alten Völker des Alten Kontinents schlugen zwei Herzen in ihrer Brust.
Doch fragte man Tanaqui – was gemeinhin niemand tat –, so schlugen in ihrer Brust vier Herzen: die beiden ihres Leibes und gleich zwei weitere für ihre Seelen. Die einer Silberreiterin des Südens, die bei den Wüstenelfen Obdach und Geborgenheit fand – und diese nun zugunsten ihrer alten Waldheimat fortwarf. Dort, wo ihre Seele als Waldelfe geblieben war, an jenem Tag, als ihre große Liebe starb, unter jenem gnadenlosen Blätterdach, das ihr stets Heim und Schutz gewesen war.
Irgendwo jenseits des Lagers gellte ein zweiter Hornstoß dieser Nacht über den gnadenlosen Glassand der südlichen Gefilde. Der Klang des Jagdhorns hallte von den schier endlos weiten Bögen der an Raubtierzähne gemahnenden Bergen wider, die die Wüste umfingen und bargen. Eine Wüste, die bei Tag Fleisch siedete und es nachts zu Kristallen gefrieren ließ.
»Zumindest jenes, das nicht entsprechend geschützt ist«, murmelte die elfische Jägerin und betastete die Tätowierungen auf der marmorweißen Haut ihres Unterarms unter der Dschellaba. Sie hockte im Schneidersitz an einem der vielen Feuer im Lager der Septe der Windspeere. Stets abseits, stets von den Silberreitern mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Misstrauen begutachtet.
Tanaqui, aus dem Mirvaali, geküsst von Waldschatten, die in den Süden gekommen war.
Tanaqui, die ihre Eltern und ihre Sippe lange vor dem dritten Unwerthkrieg verlor, großgezogen von Füchsen.
Tanaqui, die binnen weniger Augenblicke ihre neue Heimat verlieren würde.
Der erste Hornstoß dieser Nacht hatte den Ausschlag gegeben. Vor wenigen Minuten hatten die Jagdkader den von Haelthan erwähnten Menschen in das Lager der Silberreiter-Nomaden gebracht. Es war einer der Boten des Emirs, jenes Herrschers des jungen Volkes, der meinte, es gebe so etwas wie Land, das sich den Elfen entreißen und besitzen ließe.
Nun hallte ein zweiter Hornstoß über den Ozean endloser Dünen und verlor sich unter unendlich vielen glimmenden Nadelstichen im Samt des ewigen Sternenozeans im Wind. Er sagte den Nomaden, dass sich keine weiteren Menschen in der Nähe aufhielten. Keine weiteren Anmaßungen des Emirs, Boten durch die Lande der Silberreiter zu schicken.
Tanaqui war das einerlei. Sie und die Menschen hatten ihre eigene Vergangenheit. Für sie blieb das junge Volk stets Feind, aber auch ein Buch voller Rätsel und mit unzähligen Siegeln. Die Schande und die Neugierde waren beide in jener Nacht über sie gekommen, als sie das Kontor des Alchemisten verbrannt hatten.
Doch im Augenblick verband sie nur zwei Vorstellungen mit dem Gefangenen.
Erstens würden bald seine Schreie anheben, wenn die Silberreiter zugunsten der Götter von Bogen und Sichel, von Jagd und Ernte seinen Leib als Opfer darbringen und die Wasser seines Inneren als Vergeltung für seine Frevel der Wüste schenken würden. Trotz seiner ohnehin bemitleidenswert kurzen natürlichen Lebensspanne schnürte sich Tanaqui bei dem Gedanken die Kehle zu. Dieser Bote war nicht mehr als ein Junge, ein törichtes Kind, das man auf eine zum Scheitern verdammte Mission geschickt hatte.
Er würde qualvoll sterben, bevor er zum Mann erblüht war, und davon hielt die Elfe nichts. Was sie betraf, gehörte sie in der Tat einem Volk von Raubtieren an. Allerdings von solchen, die nicht mit der Beute spielten.
Viel wichtiger für sie war in diesem Moment aber der Siegelbrief, den die Speerkader zusammen mit der Tasche voll weiterer Schriftstücke unbeachtet beiseitegeworfen hatten.
Tanaqui beherrschte die geistesschwache Sprache der Menschen aus den Tagen ihrer Jugend, als sie im Krieg mit diesen Äffchen Missionen begleitet und sie zum Wohl des Schwertwindes gejagt hatte.
Sie fröstelte. Die Erinnerungen an die Kämpfe, die Schreie und das Feuer durchzogen das Wirbeln des Nachtwindes. Er peitschte die Flammen des Lagerfeuers, blies in den lodernden Tierdung. Eine Unzahl von Funken stieg wie ein Schwarm Glühwürmchen zum Himmel empor, zog die Gedanken der Elfe mit sich. Jäh fiel sie in die Wirklichkeit zurück, als ihr das Gewicht der vor ihr liegenden Entscheidung bewusst wurde.
Der Kampf zwischen dem Boten und den elfischen Kriegern hatte die Tasche beschädigt. Als sie den Burschen zwischen die Nomadenzelte vor die Klauen ihrer Raskeer geschleudert hatten, war die Tasche aufgerissen und hatte ihren Inhalt verstreut.
Unter dem melodischen Lachen der Nomadenkrieger hatten die Reitkatzen nach dem winselnden, um sein Leben flehenden blutigen Boten geschnappt, sich die Krallen im hart gebackenen Sand gewetzt und ihre Säbelfänge gefletscht. Doch ein solch schnelles Ende wie in ihren Fängen blieb dem jungen Mann verwehrt.
Der eisige Nachtwind hatte einige der Dokumente durch das Lager geweht, und für kostbare Herzschläge hatte Tanaqui auf geheime Anweisungen des Emirs an einen Menschenspion im Norden blicken können. Befehle, bei denen ihre Herzen aus dem Takt geraten waren.
Es waren nicht mehr als drei Worte gewesen, die ihr auf dem Brief ins Auge gefallen waren. Dann hatte ihn einer der Krieger aufgehoben und zusammen mit dem anderen Besitz des Boten ins Zelt des Stammesführers gebracht.
Nur drei Worte.
Sie hatten Erinnerungen geweckt. Erinnerungen an geflüsterte Liebesschwüre. An den würzigen Duft von Moos, Nadeln und Harz. Erinnerungen an die Versprechen, die im Zwielicht zwischen Farnen und Unterholz den Erscheinungen des Waldes und der Baumgeister gegeben wurden.
»Sahar«, flüsterte Tanaqui. Der Schmerz war nach Jahren frisch wie in jener Nacht. Der Name hallte in ihrem Gemüt nach.
Die Jägerin verzog das Gesicht zu einer Maske reiner Entschlossenheit, die sie ganz und gar nicht verspürte. Unwillkürlich erhob sie sich aus dem Schneidersitz, ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen. Eigentlich war dies eine Übung ihrer geheimen Zunft, mit der die Jägerinnen der Silberreiter ihre Körper stählten. Sie auf die Qual der Tätowierungen vorbereiteten, die bei der vierundzwanzigsten Hautzeichnung immer noch so schlimm schmerzten wie bei der allerersten.
Doch diesmal war Tanaquis Leib dermaßen angespannt, dass sie der athletischen Meisterleistung gar nicht gewahr wurde. Sie blickte ein letztes Mal zu den mitleidlosen Sternen in ihrer Heimat aus blauschwarzem Samt hinauf. Dorthin, wo vielfarbige Nebel Bänder und Schlieren über den Himmel der Inseln von Selachis zogen.
Dann senkte sie den Blick, mitten hinein in das Glosen der Flammen, dorthin, wo das Feuer wie eine halb flüssige Masse über den brennenden Dung ausgegossen schien, so heiß, dass die Augen tränten.
Der Anblick der Flammen gab den Ausschlag.
Mit einem Ruck, in dem alle übermenschliche Behändigkeit und Feinnervigkeit des Elfenvolkes lag, einer Bewegung, die mehr von einer Pantherin auf der Jagd als einer Frau hatte, zog Tanaqui beim Umdrehen ihren Jagdspeer aus dem Boden. Sie wandte sich dem Zelt des Ältesten zu.
Hingestreut wie lose Edelsteine lagen die Zelte der Silberreiter da. Ihre hohen, schlanken Formen drängten sich dem Himmel entgegen. Sie bildeten einen Ring um das Hauptzelt. Seit jeher beanspruchte der Älteste es für sich. In einer Gemeinschaft von Geschöpfen, die sich ungeschützt bald eines gewaltsamen Todes sterben sahen oder ein Scheitern bei den Riten der Göttlichwerdung mit dem Leben bezahlen würden, bedeutete dieses Wort einiges. Ältester.
Tanaqui war auf der Hut. Nach den Maßstäben ihres Volkes war sie erst seit einem Lidschlag Teil der Septengemeinschaft, und was die Jägerin plante, grenzte an Hochverrat.
Es war Hochverrat.
Jeder Schritt, mit dem sie sich dem Eingang näherte, verursachte eine immer größere Anspannung in ihrem Körper, die sich bis in die Zehenspitzen übertrug. Sie spürte den grobkörnigen Sand der Wüste unter den Füßen. Vermochte jedes Korn zu empfinden, wie es sich unter dem Druck ihres Gewichts verlagerte.
Wenig überraschend war der Eingang unbewacht, die Silberreiter vertrauten einander blind. In der Wüste hatte man keine andere Wahl. Sie hätte einfach eintreten können. Dennoch entschied sie sich anders.
Tanaqui tauchte nach links ab, hinein in die Schatten zwischen den Behausungen der mächtigsten Stammeskrieger, die das Zelt des Ältesten umgaben. Fort von den Feuern der Gemeinschaft, vom Lachen, von den Zeichen des Lebens, aber auch von Grausamkeit und Unbedachtheit, eingehend in weise Abgewandtheit.
Dorthin, wo er sich wohlfühlte. Als eine der wenigen unter den Auserwählten der Septe der Windspeere hatte Tanaqui, ehedem selbst Kind der Wälder, sich den Ersten Jäger als Patron für ihre halbgöttlichen Tätowierungen erwählt. Die Nacht, Wölfe und die Dunkelheit tiefer Schatten waren die Domäne dieses Ahnengeistes. Allesamt Erscheinungsformen, welche die Elfen der Wüsten fürchteten.
Doch Tanaqui Fuchstochter hatte sich diesen Seiten ihres Daseins gestellt, hatte ein Leben lang mit diesen Phantomen zu kämpfen gehabt und umarmte sie nicht nur mithilfe der Zaubertätowierungen auf ihrer Haut. Sie waren Teil ihrer selbst gewesen, lange bevor sie Asyl im Süden gefunden hatte.
Doch erst als das Dunkel zwischen den verschiedenen Zelten sich um sie schmiegte wie mattes Samt, als sogar die Augen einer ehedem waldelfischen Jägerin nichts mehr zu sehen vermochten, gab sich der Patron in ihrer Seele mit der Deckung zufrieden.
Mit einem grimmigen Nicken zückte die Jägerin ihr Messer.
Zwei Schnitte mit dem Stahl benötigten ihre Zeit. Das Leder von Kamelen und anderen Wüstenbewohnern war zäh und belastbar. Die Jägerin ließ sich Zeit. Alles andere konnte bedeuten, sich durch ein noch so schwaches Geräusch zu verraten. Es war zu gefährlich.
Endlich war der Kreuzschnitt so groß, dass sie die Schultern hindurchzwängen konnte.
Tanaqui wand sich durch die Öffnung und stellte erleichtert fest, dass es im Zeltinneren genauso dunkel war wie draußen. Sofort nahm sie durch die feinfühligen Fußsohlen den veränderten Untergrund wahr. Kostbare, geraubte Teppiche statt blanken Sandbodens.
Das einzige Licht spendete ein uralter, oftmals vererbter Metallkorb, in dem Reste eines Dungfeuers glommen. Der Rauch zog nach oben ab. Die Glut genügte den Augen Tanaqui Fuchstochters, um im Innenraum Umrisse und Schemen zu erahnen.
Augenblicklich sah sie den kunstreich geflochtenen Korbsessel neben dem ausladenden Diwan, den der Älteste sich bei einem der Raubzüge der letzten Monate als Beute erwählt hatte. Sie machte die Schriftstücke neben der Ledertasche aus, die man auf dem Sitzkissen abgelegt hatte.
Erst jetzt spürte sie, wie ihr trotz der Eiseskälte der Schweiß in den Nacken rann. Wie ihre Hände klamm wurden. Zu ihrer Verwunderung stellte sie fest, dass es nicht der Einbruch war, nicht der begangene Verrat an ihren Wohltätern, der ihren Puls in die Höhe trieb. Es war die Erwartung, ob sich bestätigen mochte, was sie erblickt zu haben glaubte. Beim bloßen Gedanken, der Brief könne die Wahrheit enthalten, die sie fürchtete, pochten ihre Herzen bis zum Hals.
Nun war es ohnehin zu spät. Das Zelt des Ältesten war beschädigt, ein Einbruch hatte unleugbar stattgefunden.
Sie warf einen raschen Blick nach oben. Jenseits der farbschimmernden Dunkelheit zeichnete sich ein erstes schwaches Licht ab. Es würde bald dämmern, und damit wäre jeder Vorteil dahin, welchen die Nacht ihr bislang verschafft hatte.
Sie huschte zu dem breiten Sitz hinüber und zog die Tasche an sich. Einen Herzschlag später hatten ihre Finger das Dokument erhascht. Damit trat sie unter den Rauchabzug und gewann genug Licht, damit ihre Blicke über das Pergament schweifen konnten.
Ein fürchterlicher Laut störte ihre Versunkenheit in die Schrift, und sie stellte mit Erschrecken fest, dass sie selbst mit den Zähnen geknirscht und dabei wie ein Raubtier gegrollt hatte. Ungläubig, unwillig schüttelte sie den Kopf, bis ihre Zöpfe umherwippten.
Was sie dort las, was sie dort schwarz auf weiß geschrieben sah, konnte nicht stimmen. Durfte nicht stimmen.
Sie ließ die Hand abermals in die Tasche gleiten und beförderte den zweiten und so wichtigen Teil der Botschaft zutage. Auf ihrem Handteller ruhte ein Stein von schmeichelnder Glätte, makellos und ohne Kratzer. In seine Oberfläche geschnitten mäanderte ein Symbol, bei dem sich die verschiedenen geometrischen Linien alle in der Mitte an einem Kreuzungspunkt berührten. Eine Rune.
In ihrer Tiefe funkelte es metallen und so vielfarben und bezaubernd, als vermählten sich Wetterleuchten und Perlmutt in dem Stein.
Der Anblick hatte etwas Hypnotisches. So fesselnd, dass die scharfen Sinne der Waldelfin wie auch die Zaubermacht des Großen Jägers sie nicht warnen konnten, bevor es zu spät war.
»Diebin! Verräterin!« In dem Zischen lag eiskalter Hass.
Tanaqui warf sich herum. Im Eingang stand ein junger Elfenkrieger, sein Gesicht ohne Burnus, die Haut so makellos wie die ihre. Seine Kiefer mahlten, die Wangenmuskeln arbeiteten. Das strenge Gesicht mit den zurückgebundenen Haaren sprühte vor Zorn. »Ich wusste vom ersten Tag an, als mein Vater dich zu uns ließ, dass dir nicht zu trauen ist.«
»Haelthan.« Tanaqui hob beschwichtigend die Hände. »Lass es mich erklären! Du wirst alles verstehen.«
Silberreiter waren von allen Elfenvölkern dem Wesen ihrer eigenen Herkunft am meisten entfremdet, waren wie ihre Reitkatzen. Ein einziger Fehler, eine einzige unbedachte Bewegung, und sie schlugen zu. Mit betonter Langsamkeit, die waffenlosen Hände darbietend, legte die Elfe daher die Dokumente beiseite. »In diesen Schriften stehen Fakten, die den Schwertwind betreffen. Meine Heimat ist in Gefahr. Ich muss …«
»Heimat! Ha!« Mit einer geschmeidigen Bewegung zog der junge Krieger seinen Reitersäbel aus der Pelzscheide. Er trat einen Schritt auf die Jägerin zu. »Du hättest hier eine Heimat finden können. Bei uns. Denkst du wirklich, Vater vertraute dir? Nein, Tanaqui, seit du bei uns lebst, folge ich seiner Order, dich im Auge zu behalten. Eingelullt habe ich dich.«
Tanaquis Blick heftete sich an die Säbelspitze wie an den pendelnden Kopf einer Wüstenkobra. Sie spürte das Jucken in ihren Tätowierungen, jene noch immer unvertraute Macht, durch die ihr Schutzpatron bald handeln würde, bevor er ihr die Wahl ließ. Der letzte, der endgültige Preis, den es bedeuten konnte, Silberreiter zu sein. »Bitte, Haelthan! Gewähr mir die Gelegenheit, mich deinem Vater zu erklären. Die Dokumente wurden mir draußen entwunden, sie …«
»… sind Teil des Beuterechts. Sie wurden nicht verteilt. Du hättest warten sollen, bis du an der Reihe bist. Gib mir deine Waffe, Verräterin!«, fiel ihr der Elf ins Wort. »Deine Waffen. Auf der Stelle!«
»Haelthan! Ein letztes Mal, vertrau mir! Ich werde mich unterwerfen und jeder Strafe beugen. Aber du musst mir den Versuch gewähren, alles darzulegen.« Tanaqui hasste den Ton der Verzweiflung, der ihre Stimme färbte. »Du bist doch meine neue Heimat, du …«
»Ruhe! Prinz Vesshelin hat uns vor dir gewarnt. Waldelf hin oder her – er hat den Ältesten ermahnt, dich niemals aus dem Blick zu lassen. Was dich betrifft, hat Vesshelin von den Türmen wahr gesprochen. Vater war klug genug, diese Pflicht auf mich zu übertragen.«
Alles, was sie vorbringen wollte, alles, was ihr noch soeben auf der Zunge lag … der Name des Herren aller Elfen zerschnitt jeden Gedanken. Ihre Herzen stolperten, hüllten jeden Versuch milder Rechtfertigung und sanfter Worte in eisige Kälte.
»Vesshelin weiß, dass ich hier bin?«, entfuhr es Tanaqui wider Willen. Das Erschrecken in ihrer Stimme ließ sie selbst zusammenzucken. Eine kampfbereite Hand krallte sich da in ihren Oberschenkel, die andere fuhr ohne ihr Zutun zu ihrem Speer.
Die Bewegung genügte, um Haelthan weiter herauszufordern. Er deutete mit der Säbelspitze auf Tanaquis Gesicht und gab damit den Ausschlag.
»Droh mir nicht!«, zischte die elfische Jägerin wie zur letzten Warnung. Haelthan aber gab keinerlei Anzeichen, ob er merkte, dass der Grundton ihrer Worte dunkler, vollklingender war als sonst.
Dass jemand anders mit Tanaquis Stimme sprach.
Er steigerte sich stattdessen in den schneidenden Hochmut der Jugend hinein, das Gesicht verzerrt vor Überheblichkeit und dem falschen Glauben, unsterblich zu sein. »Steck den Speer lieber ins Moos, Jägerin, bevor du dir noch selbst wehtust! Und hüte dein Mundwerk! Du sprichst mit dem Sohn des Häuptlings. Du hättest bei deinen Eulen und Wölfen im Wald bleiben sollen.« Abermals reckte er die Klinge vor.
»Nein!«, flehte Tanaqui, nicht an den Jungen gewandt.
»Doch. Stirb, Vesshelin!«, zischte etwas in ihrer Stimme, und sie kam sich zugleich vor, als schlafwandele sie. Die Tätowierungen schienen über ihrem ganzen Körper hinweg in Flammen zu stehen. Irgendwo, weit am Rande ihrer Wahrnehmung, vernahm sie einen Ton, eine Melodie. Sphärisch singend wie der Ton eines Fingers auf dem nassen Rand eines Weinglases.
Als hilflose Spielfigur musste sie dabei zusehen, wie ihr eigener Körper den Speer in Anschlag brachte. Kunstgerecht.
Haelthan wappnete sich.
Ein kurzer, harter Aufprall, da hatte der Jagdspeer den Säbel auch schon beiseitegefegt wie Herbstlaub. Ein zweiter Ruck, ein Schnauben, Kälte, die sich in einem Körper ausbreitete. Dann war es vorbei. Sie prallten auf dem Boden auf.





























