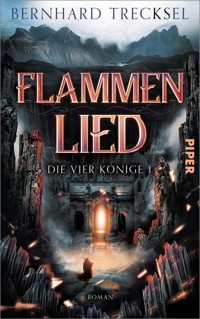9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Totenkaiser
- Sprache: Deutsch
Der Nebel bringt den Tod
Der Assassine Clach ist die letzte Waffe im Kampf gegen die Titanen. Diese finsteren Götter verfolgen kein geringeres Ziel als die Vernichtung der Welt. Clachs besondere Fähigkeit, nicht nur den Körper zu töten, sondern auch die Seele zu vernichten, ist das einzige, was sie fürchten. Doch er hat kaum Hoffnung auf Erfolg, denn die Pläne der Titanen sind bereits zu weit fortgeschritten, als dass er sie alleine aufhalten könnte. Clach muss sich mit seinen alten Widersachern verbünden – doch denen scheint die Rache an ihm wichtiger als die Rettung der Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Der Assassine Clach ist die letzte Waffe im Kampf gegen die Titanen. Diese finsteren Götter verfolgen kein geringeres Ziel als die Vernichtung der Welt. Clachs besondere Fähigkeit, nicht nur den Körper zu töten, sondern auch die Seele zu vernichten, ist das Einzige, was sie fürchten. Doch er hat kaum Hoffnung auf Erfolg, denn die Pläne der Titanen sind bereits zu weit fortgeschritten, als dass er sie alleine aufhalten könnte. Clach muss sich mit seinen alten Widersachern verbünden – doch denen scheint die Rache an ihm wichtiger als die Rettung der Welt.
Autor
Bernhard Trecksel, geb. 1980 in Papenburg an der Ems, bezeichnet sich selbst als leidenschaftlichen Eskapisten und absoluten Geek. Die Kunst des Erzählens lernte und verbesserte er während unzähliger Stunden, die er mit Fantasy-Rollenspielen verbrachte. Seine Inspiration als Autor findet er in den alltäglichsten Dingen wie dem Lesen der Morgenzeitung, doch seine schriftstellerischen Idole sind die alten Meister wie H. P. Lovecraft, Robert E. Howard und J. R. R. Tolkien. In seiner Freizeit spielt er Videospiele, Brettspiele und (auch als Erwachsener immer noch) Rollenspiele oder liest Fantasy- und Horrorromane. Seit seinem Universitätsabschluss in Archäologie und Skandinavistik lebt er in Münster und arbeitet als Übersetzer, Rezensent und – seit seinem Debüt Nebelmacher – als Autor.
Bernhard Trecksel
Nebelgänger
Roman
Originalausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.1. Auflage
Oktober 2016 bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Blanvalet Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft,
unter Verwendung einer Fotografie von Nico Fung
Karten: Jürgen Speh
Redaktion: Peter Thannisch
Lektorat: Holger Kappel
Herstellung: kw
Satz: Mediengestaltung Vornehm GmbH, München
ISBN: 978-3-641-17157-5V001
www.blanvalet.de
Der Generalmajor (schaudernd):
Hört das Beben
der Häuser Grundfesten,
sie geben ächzend nach!
Vorbei ist alles Wimmeln,
alles Streben!
Da entsteiget er der Grub’,
endlos unsere Furcht,
endlos unser Ungemach!
Größer noch als er sind sie.
Er wachset höher, schreitet gar!
Dort geht er.
Alle (klagend):
Der Gottries’! Der Titan! Der Titan!
Der Rittmeister:
Was sollen wir, Archont, nun tun?
Meister unser, einzig Herr?
Der Archont (hauchend):
Was bleibet uns?
Die Waffen zu erheben?
Wo Götter schreiten,
vom Tod gehetzt, der
ohne Rast?
Krauchen, betteln, sterben
wollen wir(?)
Keine Schulter trägt diese
unsere letzte Last.
(Vorhang, Akt 2)
Aus: Des Archonten Niedergang – Theaterstück aus der Feder des Dramaturgen Thaen Sirrus, hingerichtet wegen volksverhetzender Reden, 520 adis Pentae
1. Der Archont
Ein weiser Mann hatte angeblich behauptet, dass ein einziger Moment ein Universum beinhalten könne. Vielleicht war es aber auch ein Narr gewesen, je nachdem, wen man fragte. Tam Adair jedenfalls hätte über solche Worte in seinem anderen, seinem früheren Leben gelacht. Vor Stunden, die ihm vorkamen wie ein Damals. Leider lag dieses andere Dasein nun hinter Tam – und Tam wiederum auf dem Tisch von Brogan Cairbre, dem eifrigsten unter den vielen Foltermeistern des Archonten. Und seine Momente waren zu einer Vielzahl von eigenen abgeschlossenen Universen geworden, die aus nichts bestanden als Qualen.
In seiner Zeit hier unten hatte Tam einen Bruchteil von ihnen kennengelernt: jene unterschiedlichen Haken, Ahlen, Klingen, die auf einem steinernen Kubus direkt neben dem Holz ruhten, auf dem er mit Schellen fixiert worden war. O ja, er kannte nun ihre Namen wie auch ihren Zweck, dafür hatte Cairbre Sorge getragen. Seit dem Beginn der kurzen Ewigkeit seines Aufenthaltes hier unten wusste Tam mehr über sie alle, als ihm lieb war.
Cairbre hatte ihm gezeigt, welche Verwendungsmöglichkeiten für Feuer es für einen Mann mit kreativen Visionen gab. Für einen Mann, der Tams Ansichten von Moral und Gnade nicht nur nicht teilte, sondern sie regelrecht zu verabscheuen schien.
Hier also lag Tam, um einige Erfahrungen reicher, auf die er gern verzichtet hätte – und dafür umso ärmer an Dentalmasse und Fingernägeln. Kein Quadratzoll seines Körpers, der nicht hämmerte, pochte, biss oder nagte. Keine Faser geschundenes Fleisch, die nicht aufbegehrte, herumkrakeelte oder wimmerte. Es hätte schnell vorbei sein können, schließlich war die Frage immer dieselbe gewesen. Das erste Problem war: Tam kannte die Antwort nicht, weil er aufrichtig unschuldig war.
Das zweite Problem war weitaus gravierender: Brogan Cairbre war es gleich, ob sein Opfer Schuld traf. Er wurde nur für die Antwort bezahlt. Bekam er sie nicht, machte er weiter. (Wie er auch manchmal weitermachte, selbst wenn er die Antwort erhielt, das wusste Tam.) Und Tam stand vor dem Dilemma, eine Antwort geben zu müssen, die ihm unbekannt war.
In der Dunkelheit waren das Tröpfeln des Wassers, das an kupfergrünen Moosen herabrann, und das Knacken der Kohlen in den Becken, in denen Cairbre seine Spielzeuge auf Rotglut erhitzte, seine einzige Gesellschaft. Tam hatte längst jede Vorstellung verloren, wie oft sein erbarmungsloser Gesellschafter seit dem Beginn von Tams Martyrium den Folterkeller verlassen hatte. Nur um entweder kurzfristig oder nach langer Wartezeit zurückzukehren – und Tam konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Rhythmik aus An- und Abwesenheit ebenfalls nur Teil der Marter war.
Denn während er hier so dalag und sein mit Qualen ausgekleideter Mund bittere, pochende Lamenti ausstieß, horchte sein Herz bang und still auf einen bestimmten Augenblick. Auf den Moment, wenn der Schlüssel in seinem Schloss kreischte. Wenn die massive Tür aus aufgequollenen Bohlen gegen die bauchige Steinmauer knallte und sich der blakende Schatten von Cairbres Wanst mit Schürze und Werkzeuggürtel im Kohlenfeuer in Tams Gesichtsfeld schob.
Als hätte er durch diese Gedanken etwas ausgelöst – durch jene grausamste und direkteste Form der Telepathie, die stets das eintreffen lässt, was der Mensch anfleht, es möge ihm fernbleiben –, war plötzlich das Klacken des Schlosses zu vernehmen. Die Tür flog auf, krachte gegen die Wand. Tams Herz tat einen Satz. Er versuchte, den Kopf zu drehen, doch dieser war ebenso mit Eisenbändern an die Gestade seiner neuen Heimstatt fixiert wie der Rest seines geschundenen Körpers. Er konnte nur hilflos mit den Augen rollen.
Ein Schatten legte sich über ihn, gefolgt von einem zweiten. Sie überlagerten sich, wurden auf diese Weise nahezu massiv, sodass es Tam schwerfiel, noch etwas zu erkennen. Dann riss die Dunkelheit unvermittelt auf – das Licht einer Fackel legte sich ohne Vorwarnung auf Tams Gesicht. Er wimmerte, als die ungewohnte Helligkeit ihn blendete.
»Das ist er also?«, fragte eine seidige, volltönende Stimme, die Tam nur allzu gut kannte. Es war ein befehlsgewohntes Organ, das mit einem Ja oder Nein über das Schicksal Tausender befinden konnte – und dies auch regelmäßig tat. Das, was noch an Hoffnung und Zuversicht in Tams Herzen verblieben war, löste sich in nichts auf. Jede Chance auf Gnade oder Verständnis war dahin, wenn dieser Mann sich dazu herabließ, persönlich in die Verliese herabzusteigen.
»Ja, Eure Majestät.«
Tam hörte, dass auch Cairbres Stimme vor Furcht, einen Fehler zu machen, erzitterte. Und er hatte auch jeden Grund dazu.
»Lasst ihn Uns ansehen«, sagte die Stimme. Das Licht der Fackel wurde augenblicklich heller. Miniaturexplosionen aus Rot und Gold erblühten hinter Tams Lidern. Eine behandschuhte Linke fasste sein Kinn. Sein Kopf wurde in dem wenigen Spiel, das die Fixierung zuließ, von rechts nach links und wieder zurück bewegt. Neuerlicher Schmerz entflammte in seiner Stirn, als die gereizte Haut gegen derbes Eisen scheuerte. Der Neuankömmling betrachtete ihn. Mit der gleichen Sorgfalt, mit der ein Bauer vor den Toren Fomors den Gaul eines Mannes prüfte, den er für einen Rosstäuscher hielt.
»Blicke er Uns an!«, befahl die Stimme, und Tam verstand ohne hinzusehen, dass nur er gemeint sein konnte. Langsam öffnete er die Augen und wimmerte. Mit einem unwirschen Kommentar brachte die Stimme Cairbre dazu, sich mit der Fackel zurückzuziehen. Tam blinzelte das Stechen und die tanzenden Funken auf ein erträgliches Maß herunter. Durch einen Schleier Tränenflüssigkeit (wenig, viel zu wenig) stierte er zu dem schattenhaften Umriss empor – und was der Klang der Stimme Tam verraten hatte, wurde absolute Gewissheit. Der falkengesichtige Mann in den kostbaren Gewändern, der auf ihn herabsah, war niemand anderes als der Archont von Fomor, der mächtigste Potentat in einer Welt, die fünf solcher Scheusale beherbergte.
»Hat er eine Vorstellung, was sein Versagen angerichtet hat?« Die Stimme des Archonten war wie Eis. »Ist er sich der Tragweite dessen bewusst, was seine Unachtsamkeit zu verantworten hat?«
Tam hatte mehr als nur eine Vorstellung, worauf der Archont hinauswollte. Doch bevor der rationale Teil seiner Persönlichkeit Tam bremsen konnte, hatte sich sein Mund zu einer Antwort entschlossen. Ein oblatenbrüchiges »In etwa …« entrang sich seiner Kehle.
Augenblicklich zuckte Tam zusammen – wegen der Schmerzen in seinem vertrockneten Sprechapparat und weil er erschrak, dass er den mächtigsten Mann der gesamten Dämmerwelt mit einem flapsigen Kommentar bedacht hatte. Doch statt der erwarteten Folterqualen war das einzige Resultat lediglich ein Schnauben, das ob dieser Dreistigkeit geradezu erfrischt, ja amüsiert klang.
»Erleuchte er Uns«, sagte der Archont und verschränkte die Arme. Augen wie erfrorene Sterne, die das auf ihnen tanzende Fackellicht in Zorn zu ertränken schienen, nagelten Tam so sicher fest, dass es keiner bindenden Eisen mehr bedurfte.
»Mein …« Tam leckte sich die schrundigen Lippen mit einer Zunge, die sich wie eine sterbende Nacktschnecke in seinem ausgedörrten Mund wälzte. »Mein Versagen als Wächter hat Euch und Eurem Ansehen Schaden zugefügt, Majestät.« Tam war erstaunt, wie einfach es plötzlich war, mit einem so mächtigen Herrn zu reden, als wäre er nicht mehr als der Sergeant der Abendschicht.
Alle Leute scheißen am Ende in einen Topf – und jeder aus einem Arsch, der ist wie der andere.
Das hatte Tams Vater stets gesagt, wenn das Thema zur Sprache kam, ob ein Adeliger ein besserer Mensch sei als seine Untergebenen. Tam hatte seinen Vater immer für einen klugen Mann gehalten. Aber andererseits: Der Vater war friedlich in einem Bett entschlafen, während sich sein Sohn auf einer Folterbank wand und in den letzten Stunden einiger erstklassiger, liebevoll gepflegter Backenzähne verlustig gegangen war.
»Er hat wirklich keine Ahnung, nicht wahr?«, fragte der Archont, und auf seinem Falkengesicht lag so etwas wie ehrliches Erstaunen. »Er weiß nicht, was er angerichtet hat?«
»Man hat Euch bestohlen, Majestät. Das, wovor man uns bei unserer Einstellung in den Dienst in Eurer Garde gewarnt hat, ist passiert. Und nun zahle ich den Preis.«
»Er? Er zahlt den Preis?« Die Seide in der Stimme des Archonten von Fomor härtete augenblicklich zu einem Panzerhandschuh aus. »Er denkt, es ginge hier um einen Gesichtsverlust, weil Unsere Wächter Unsere Kostbarkeiten nicht behüten können? Er ist ernsthaft der Meinung, der Verlust eines einzigen Kleinods könnte Uns so aus dem Gleichgewicht bringen?«
Der Archont stapfte knapp außerhalb von Tams Gesichtsfeld durch die Folterkammer. Der Gepeinigte warf einen Blick auf Cairbre und sah, dass sich der ungeschlachte Foltermeister alle Mühe gab, zu schrumpfen und sich unsichtbar zu machen. Auf eine Weise sah er ängstlicher aus als Tam, der mehr und mehr spürte, dass sich eine gewisse stoische Akzeptanz seines Schicksals in seine Gedankenwelt zu stehlen begann.
Plötzlich war das Gesicht des Archonten ganz dicht über dem von Tam, sodass der Wächter den sauren Geruch des Atems und das kostbare Rasierwasser seines Herrschers wittern konnte.
»Erkläre er es. Erkläre er Uns, was passiert ist. Wie es passieren konnte. Dieser Mann dort«, der Archont wies auf Cairbre, den kein Armbrustbolzen hätte härter treffen können als der Fingerzeig auf seine Person, »sagt Uns, dass er auch unter der Folter deine Mittäterschaft nicht gesteht. Dieser Mann sagt uns, dass er es gewohnt ist, Männer zu brechen, bis sie ihre eigene Brut dem Feuer überantworten würden, nur um seinen kundigen Fingern zu entgehen.«
Die Hand des Archonten ergriff Tams Stirn und bog schmerzhaft seinen Kopf zur Seite.
»Er sehe ihn an! Sehe er ihn sich an! Unser Foltermeister sagt Uns, dass er überzeugt ist, dass dieser hier nichts, aber auch gar nichts weiß. Dass er verdammt noch mal unschuldig sei!«
Tam blickte in Cairbres Gesicht, der bemüht war, eifrig zu nicken und nicht zur Zielscheibe für den Zorn des Potentaten zu werden.
»Wenn das also stimmt«, fuhr der Archont fort, »dann erweise er Uns – und sich selbst – einen Dienst und sage Uns, was er denkt. Sage er Uns, wer den Stab genommen hat! Und vor allem: wie! Erleuchte er Uns!«
Das wenige, was noch an Feuchtigkeit in Tams Mund war, verschwand mit einem einzigen Schlucken in seiner Kehle. Das war es also. Die ganze Zeit, die er hier auf diesem Tisch verbracht hatte, zermarterte er sich das Hirn, was genau die Diebe, die für sein Schicksal verantwortlich waren, erbeutet hatten. Nun hatte er seine Antwort.
Von all den wertvollen Dingen, die in den uneinnehmbaren Schatzkammern des Archonten dämmerten, wie sich Tam und seine Kollegen stets ausgemalt hatten, war es also ausgerechnet ein Stab gewesen, den man gestohlen hatte. Irgendein goldverziertes, schnörkeliges Ding aus Holz und edlen Metallen zweifelsohne.
Etwas, das der Adel höchstwahrscheinlich nur einmal alle zwanzig Jahre benötigte, wenn ein anderer hochedler Hintern auf dem Thron des Archonten Platz nahm. Da wurde das Ding vom Katechisten des Lichtfürsten oder irgendeiner anderen offiziösen Mumie mit einer nuscheligen Segensformel auf jeder Schulter des zukünftigen Herrschers abgelegt, bevor es in seiner Kammer verschwand. Genau wie Tam verschwinden würde. Und das nur, weil ein nebelverfluchter Hurensohn den drecksteuren Stock auf unerklärliche Weise aus dem absolut sicheren Gelass geraubt hatte, das Tam und seine Kameraden bewachen sollten!
Es gab für alles ein erstes Mal, und dies also war das erste Mal, dass die Obhut der Schatzkammern kompromittiert worden war. Dabei wusste Tam, so wie jeder, den man dorthin abgestellt hatte, dass dies unmöglich war. Vollkommen undenkbar.
Die Kammer war nicht nur uneinnehmbar, ja man kam ja nicht einmal bis dort. Immerhin erforderte ein Einbruch, dass jemand verrückt genug war, in die Zitadelle, in den Palast des Archonten einzudringen. Derjenige musste sich in den verschlungenen Korridoren der einstigen Hauptfeste des Tyrannen von Khael zurechtfinden. Ein Netz obsidianschwarzer Kammern durchstreifen, die selbst jenen, die in der Zitadelle lebten, unbekannt waren. Dutzende gut ausgebildete, bestbewaffnete Wächter umgehen.
Um schließlich in den Kavernen unter der Zitadelle, dort, wo die Schatzkammern lagen, jene zu finden, die gefüllt waren. Denn es gab Hunderte, und einige davon waren nicht mehr als gähnende schwarze Gruben. Schlünde, die in die nachtschwarze Tiefe unter der Stadt abfielen, wo Legenden zufolge noch immer der zerstörte Körper des Titanen und Namenspatrons der Penta ruhte. Uralte Menagerien, in denen noch immer Albträume aus grauer Vorzeit umgingen. Jagten.
Hatte jemand so viel Glück, die Kammer aufzuspüren, so musste er den jeweils vor ihr liegenden Korridor unbeschadet passieren – ein Ding der Unmöglichkeit, schließlich …
»Wir sehen, du kommst zu denselben Schlüssen wie Wir!«, bellte der Archont, der seine Façon schon lange auf dem Weg in den Kerker zurückgelassen hatte. Er war über Stände und Titel hinaus – sogar in dem Maß, dass er auch gleich den Majestätsplural missachtete. Wie Cairbre hatten sich die Höflichkeitsformen an diesem Ort in eine dunkle Ecke verzogen und hofften, der Aufmerksamkeit zu entgehen, so schien es.
Der Mann vor Tam war zwar noch immer der Archont, aber – und das fand Tam schlimmer – er war ein sehr, sehr wütender Mann am Rande seiner Fassung. Und Tam und sein ganzes Leben waren diesem vor unterdrücktem Zorn mit den Zähnen knirschenden Mann ausgeliefert. Er fasste sich ein Herz. Wenn er hier herauswollte – und das wollte er mehr als alles andere –, musste Tam ehrlich sein und um seine Freiheit kämpfen.
»Euer … Euer Majestät. Ich schwöre Euch, ich habe mit der Sache nichts zu tun! Ihr zeiht mich der Pflichtvergessenheit – das ist ungerecht. Ich bin nicht fehlgegangen in meiner Aufgabe.«
»Nicht fehlgegangen …«, raunte der Archont. »Du widersprichst also den Anschuldigungen? Du bekennst dich unschuldig?«
»Wie mir auferlegt, habe ich stündlich meinen Rundgang gemacht, Eure Majestät. Dabei habe ich größte Aufmerksamkeit walten lassen.«
»Hast du?« Die Augen des Archonten verengten sich zu Schlitzen. Seine mit Zobelpelz besetzten Handschuhe aus feinstem Leder spannten sich. Die Finger ballten sich zur Faust, das Leder glich in Tams Augen der zum Bersten gespannten Haut zerkochter Würste. Der Potentat stand kurz davor, sein gefesseltes Gegenüber besinnungslos zu dreschen.
»Ja, Eure Majestät. Die Sigillen des Arkanums waren intakt. Kein Mensch, kein Tier, nichts Lebendes, noch etwas anderes hat den Korridor passiert. Weder der Alarm noch die Schutzmaßnahmen wurden aktiviert.« Tam setzte alles auf eine Karte. »Wissen Eure Majestät, wie die Sigillen funktionieren? Was demjenigen blüht, der sie unterbricht?«
Der Archont hielt in der Bewegung inne. Öffnete und schloss die Faust. Er starrte Tam einige lange Sekunden fragend an, suchte nach Spott, Häme oder Herablassung in seinen Augen. Er fand dort aber nichts, Tam hatte die Frage bewusst kalkuliert.
»Sprich«, befahl der Archont.
»Nun, Eure Majestät: Die Sigillen erkennen, wenn jemand den Korridor passiert, der nicht Ihr seid oder dies mit Eurem ausdrücklichen Segen tut. So hat man es mir erklärt. Es ist Arkanistik. Irgendwie spürt das Liniengitter, das unsichtbar unter dem Marmor des ganzen Korridors liegt, wer durch den Gang geht. Unerheblich, wer – oder was – er sein mag. Wenn es nicht Ihr selbst seid oder jemand, der in Eurem Auftrag handelt, so entfesselt das System verheerende Energien, verbrennt den Eindringling und röstet dabei sein Fleisch mit der Macht eines Gewitters.«
Langsam, bedrohlich kam der Archont näher. Er sah mehr denn je wie ein Falke aus, der seine Beute im Unterholz erspäht hatte und die Klauen vorstreckte, um zuzuschlagen.
»Und deine Worte bedeuten … was? Dass das System versagt hat?« Sein Tonfall wurde noch eine Nuance lauernder. »Oder gar, dass Wir es selbst waren? Dass Wir jemanden entsandt haben, nur um euch alle mundtot zu machen? Ebenso amüsant wie sinnfrei, denkt er nicht?«
Tam schluckte – aber da war nichts mehr außer seiner pelzigen und viel zu schweren Zunge in seinem Mund. Ein Hustenanfall schüttelte ihn. Der Archont gab Cairbre einen Wink. Dieser schüttete Tam einen Krug Wasser ins Gesicht. Die Kälte raubte ihm einen Pulsschlag lang schier den Atem. Er schluckte gierig, beruhigte seine geschundene Kehle. Das Nass schmeckte köstlich. Ambrosia.
»Was also willst du mit deiner Aussage implizieren, Wächter? Erheitere Uns. Füge der Kakofonie eines katastrophalen Tages die letzte Dissonanz hinzu.«
Tam schüttelte den Kopf. »Ich will nichts unterstellen, Majestät. Im Gegenteil. Habt Ihr bereits mit Euren Arkanisten gesprochen?«
»Hält er Uns für töricht? Natürlich hatten Wir sie als Erstes in Verdacht. Tatsächlich teilen sich einige von ihnen hier unten mit ihm eine Heimstatt. Beantworten andere Fragen. Sie sind ebenso überzeugt von ihrer Arkanistik. Niemand außer Uns oder jemand, der in Unserem Auftrag gehandelt hat, kann es gewesen sein – sagen sie. Die zumindest, die ihre vorlaute Zunge noch im Munde tragen.«
»Aber genau das meine ich ja, Majestät. Darauf will ich hinaus. Es gibt eben doch eine dritte Option. Eine, die niemand zu äußern wagt, weil sie entweder zu fantastisch oder zu erschreckend ist.«
Tam machte eine bedeutungsschwere Pause. An seinen nächsten Worten hing sein Leben.
»Fahre fort.«
»Wenn Eure Majestät den Auftrag nicht gegeben haben und es auch selbst nicht waren, wie Eure Majestät sagen … Wenn es kein Mensch und kein Tier gewesen sein kann, weil die Sigillen intakt und der Korridor vor der Kammer nicht voller Leichen ist … Wenn jede Art des Einbruchs durch Lebende ebenso ausgeschlossen ist wie ein Einbruch durch Arkanisten oder ihre Zaubergeschöpfe und Apparaturen … Wenn weder ein Lebender noch ein … Untoter eingedrungen ist, bleibt nur eine Erklärung!« Tam hatte sich so in Rage geredet, dass er ein verschämtes »Euer Majestät« ergänzen musste.
»Wir sind gespannt«, schnurrte der Archont und sah auf verstörende Weise hungrig aus.
»Es war etwas, auf das keine dieser Kategorien zutrifft«, sagte Tam. »Das erklärt auch, warum es ungesehen in den Palast eindringen konnte.«
Das Gesicht des Archonten legte sich in Falten, als er Tams These erwog. »Willst du Uns etwa sagen, dass etwas anderes – eine Kreatur, ein Monster, was auch immer – in unsere Zitadelle eindringt und den Stab von Nathair gestohlen hat? Etwas, das nicht lebt, aber auch nicht nekromantischer Natur ist? Und was sollte dies deiner Meinung nach sein?«
Eine Faust wummerte gegen die Kerkertür und unterbrach die Assoziationskette des Potentaten. Cairbre warf dem Meister von Fomor einen fragenden Blick zu.
»Nun mache er schon auf!«, knurrte der Archont. Er warf einen letzten Blick auf Tam und drehte sich in Richtung der Tür. Einer der Myrmidonen, der Elitewächter des Archonten, die sich draußen zu seinem Schutz aufgebaut hatten, steckte seinen mit einem ostentativen Drachenflügelschaller gewappneten Kopf zur Tür herein. Die untere Hälfte des vernarbten Gesichts musterte Tam für einen Herzschlag mit einem Blick aus dem Zwielicht zwischen Schadenfreude und echter Empathie. Dann trat der Leibwächter ein, fiel vor dem Archonten auf ein Knie.
»Majestät! Verzeiht, auf der Mauer der Zitadelle hat man Kunde für Euch, die keinen Aufschub duldet.«
»Worum geht es?«, fragte der Archont, und Tam konnte sehen, wie der Myrmidone erbleichte. Was immer die Nachrichten sein mochten, sie waren nicht gut. Tam konnte das nur recht sein. Ihm war alles recht, was den Archonten davon ablenkte, den guten alten Tam martern zu lassen. Er hoffte nur, dass der Herrscher über diese Neuigkeiten Tams Theorie nicht vergaß.
»Eure Tochter, Majestät. Sie scheint vor den Mauern zu sein, soweit ich den Boten verstanden habe.«
»Das ist alles?«
»Sie … sie ist scheinbar nicht … allein, Majestät.« Der Mann trat auf eine Distanz an den Archonten heran, die für jeden anderen Menschen in Fomor den sicheren Tod bedeutet hätte. Er lehnte sich vor und flüsterte dem Potentaten etwas ins Ohr. Tam verstand nicht alles, nur dass Morven, die einzige Tochter des Archonten, wohl in Begleitung eines Mannes vor der Zitadelle aufgetaucht war.
Was auch immer es gewesen war, die Miene des Archonten verfinsterte sich schlagartig noch weiter, wenn so etwas möglich war. Mit einem Akt reiner Willenskraft, der dem Herrscher anzusehen war, wandte sich der Meister von Fomor zu Tam, der sein Geschick mit einer eigentümlichen Mischung aus nackter Furcht und unerträglicher Neugier erwartete.
»Er hat Glück, dass seine Theorie Uns überzeugt. Wir werden sie prüfen und über sein Schicksal befinden. Vorerst hat er es überstanden.«
Der Archont gab Cairbre einen Wink, der sich – sichtlich enttäuscht – daranmachte, Tam von seinen Fesseln zu befreien. Langsam setzte der Wächter sich auf, rieb seine geschundenen Hand- und Fußgelenke und betastete sich zögerlich.
Der Archont wandte sich zum Gehen.
»Majestät?« Tam machte einen schwankenden Schritt auf den Potentaten zu. Sofort schoben sich Cairbre und der schwer gepanzerte Myrmidone zwischen ihn und den Herrscher von Fomor. Der Elitewächter hielt wie durch Zauberhand ein Breitschwert in der Rechten, dessen Spitze auf Tams Herz zeigte. Tam wiegelte ab, hob die Hände und blickte den Archonten unverwandt an.
Der drehte sich an der Tür um und erwiderte seinen Blick. »Was will er noch?«
»Der Stab, Majestät. Der Stab von … Nathair? Warum wurde nur er gestohlen und nichts anderes? Was macht das Ding so wichtig? Und was wollen der oder die Täter damit?«
Der Archont schüttelte langsam den Kopf. Plötzlich sah er nicht mehr wie ein Raubvogel aus. Nur wie ein unendlich müder Mann, der dem Titanen und Namenspatron der Penta gleich das Gewicht, die Verantwortung der gesamten Stadt schultern musste, wie Fomor einst die Festung des Tyrannen von Khael getragen hatte. Tam wollte um kein Geld der Welt mit diesem Herrn den Platz tauschen, selbst in seiner momentanen misslichen Lage nicht. Vielleicht hatte Tams Vater sich ja geirrt? Vielleicht waren doch nicht alle Leute gleich beschaffen?
»Bete, Wächter. Bete er zum Lichtfürsten, zu den Heiligen der Penta und zu seinen Ahnen«, sagte der Archont. »Bete wegen Unser zur Herrin des Todes. Nur bete um eine einzige Sache: dass du es nie erfahren mögest. Denn wenn offenbar wird, was der Stab vermag, sind wir alle verdammt!«
Und mit diesen Worten verließ der Archont von Fomor die Folterkammer, ließ Tam und Cairbre zurück. Der Myrmidone folgte ihm. Der Foltermeister und sein befreites Opfer tauschten einen Blick – und beide Männer erkannten, dass sie nun gern an einem anderen Ort wären. Nur waren die Orte, an die ein Mann fliehen konnte, in der Dämmerwelt ein rares Gut. Und Tam hatte das untrügliche Gefühl, dass sie in Zukunft noch rarer werden würden.
Aus den Chroniken des Kataklysmus der Erzmagi, verfasst dreihundert Jahresläufe nach dem Titanensturm, Anonymus:
Gänzlich unsicher sind wir uns, wie Hunger und Fraß des Nebels beschaffen sind. Denn wo er den einen mit geißelnder Pein in die Knie zwingt und Vitriol oder Beize gleich das Fleisch von den Knochen und das Blut aus den Adern ätzt, sich daran labet, geißelt er andere mit Geschwüren und Auswüchsen, bis das Opfer das Übermaß der Wucherungen nicht mehr zu ertragen vermag. Dritte erstickt der Nebel, so als habe eine unsichtbare Kordel gewirkt.
Auch ist nicht geklärt, wo der Brodem Gnade walten lässt und wo sein Hunger kein Maß kennt. Denn jeder aufrechte Mann, der den Schutz von Kuppel und Stein hinter sich lässt, erleidet ein grässlich Schicksal.
Die Almharach, die Riesenvölker des Amboss, atmen den Dunst, ohne dass er ihnen schadet, wiewohl er nur Luft sei. Ist es, weil sie die Gunst der Titanen genossen, an ihrer Seite fochten gegen die zivilisierten Völker? Wir wissen es nicht.
Bei den Tieren der Erde und des Himmels ist es noch schwerer, eine Systematik zu erkennen: Wo Ziege, Hund, Pferd und Ochs verenden, gedeihen Wolf und Berglöw. Den stolzen Bären im Tann treibt der Nebel zu beträchtlicher Größe und irrzorniger Raserei. Die Tiere des Himmels, heißen sie nun Spatz, Specht oder Rabe, lässt er unberührt, Bienenvölker, Ameisen und anderes Gezücht vernichtet er an einer Stelle, wo sie anderswo gar prächtig in ihm gedeihen, wiewohl auch alle Pflanzen dieser Welt in ihmwachsen.
Wahrlich, es ist ein Mysterium.
Hora des Lichtfürsten, 301 adis Pentae
2. Greskegard
Während Fennek Greskegard die Allee des Triumphs hinunterwankte, kam er sich ausgeliefert und dumm vor. Zum einen war die Straße aus nachtschwarzen Quadern, die von monumentalen Statuen des Dutzends der vergangenen Archonten flankiert wurde, extrem einschüchternd. Die gestrengen, kantigen Visagen der früheren Gewaltherrscher hatten etwas Ehrfurchtgebietendes, wie sie so aus der Höhe durch den Niederschlag auf jeden Narren herabsahen, der sich anmaßte, den Hauptweg zur Zitadelle von Fomor zu gehen, um bei den Vertretern des Archonten vorstellig zu werden. Stumme Götter aus der Vorzeit, Richter, deren Blicke das Urteil fällten, bevor die Anklage ausgesprochen war.
Regennass und schwarz schimmerten die Straße und die Standbilder wie die Schuppen einer Otter aus den Ambossmooren. Fennek konnte die Spitzen von über einhundert Armbrustbolzen förmlich spüren. Sie starrten seinen Nacken und sein Herz an, schienen sich mit ungesehenen Blicken hineinzubohren. Sprungbereit und tödlich. Es musste nur einer der Wächter auf der Wehrmauer, die hinter den Standbildern die Straße flankierte, einen übermütigen Zeigefinger haben. Auf das Schnalzen seiner Sehne würde ein Trommelfeuer aus Bolzen folgen, das den Inquisitor und seine Last in Fleischfetzen verwandeln würde.
Und dann war da noch diese Fracht.
Ich hätte Sanftleben niemals wegschicken dürfen, schalt sich Fennek Greskegard. Wofür hat man Personal, wenn man selbst die Drecksarbeit machen muss?!
Und eine Drecksarbeit war es. Die Leiche in Fenneks Armen rutschte immer wieder von links nach rechts, verlagerte ihr Gewicht in den unpassendsten Momenten und brachte ihn aus dem Tritt. Die Leiche in Fenneks Armen war schwerer, als der Inquisitor angenommen hatte. Die Leiche in Fenneks Armen war vor einer Woche noch seine Nichte gewesen. Und während er sie auf den Palast ihres Vaters und sein Schicksal zutrug, klaffte der Schnitt an der Kehle der Frau und schloss sich, wenn ihr Kopf hin und her wippte.
Es sah aus, als würde dieser Mund stumme Anklagen erheben. Fennek mochte es dem Mädchen nicht verdenken. Was hatte er sich nur dabei gedacht, seiner Nichte die Kehle zu durchtrennen? Was bei den kalten Zitzen der Mutter der Toten und dem flammenden Zorn des Lichtfürsten war in ihn gefahren?
Ein unwirsches »Bah!« entfuhr Fenneks Mund und hob sich so klar wie der Kopf eines Schmiedehammers auf dem Amboss vom monotonen Geräusch des Regens auf der Allee ab. Er schüttelte den Kopf, um die unerwünschten Gedanken an Schuld und Missetaten zu vertreiben. Das durchtränkte Vogelnest seiner Haare versprühte Tropfen in alle Richtungen. Während der Mann, der vor einigen Jahren noch der Oheim der Templerin gewesen war – in den Zeiten, als jene Streiterin des Glaubens noch ein Kind gewesen war –, angestrengt ob seiner morbiden Last durch die Zähne knurrte.
»Hätte mir nicht in den Weg kommen sollen, das Gör!«
Aber stimmte das? Wäre es ihm nicht ein Leichtes gewesen, das Artefakt zu nutzen? Den Skarabäus, den er für die vor ihm liegende Mission in Sanftlebens Obhut zurückgelassen hatte? Damit hätte er Morven zwingen können, ihm alles zu sagen, was er wissen wollte – nur um sie ihr Treffen vergessen zu lassen. Und der vergreiste Ambosskrieger, der bei ihr war, dieser Ormgair? Wieso hatte er die Befragung des Riesen abgetan und Sanftlebens warnende Hinweise ignoriert? Damit hatte sich Fennek definitiv einen Feind gemacht.
Der Kopf der Templerin stieß schmerzhaft gegen sein Knie, riss Greskegard aus seinen unwillkommenen Gedanken.
Hast du sie nicht viel eher getötet, um ihm etwas zu nehmen? So wie er dir den Titel genommen hat? So wie er dir die Schwester genommen hat?
Gegen jede Vernunft zwang sich Fennek, nach unten zu blicken. In die götterlob geschlossenen Augen des Mädchens, das er als ein anderer Mann noch auf seinen Knien geschaukelt hatte. Einer Eingebung folgend, hob er sie höher, auch wenn das anstrengend war. Ihre Haare schleiften über die schmutzstarrende Straße. Aus irgendeinem Grund, einem letzten Aufschrei seiner Moral, die er zum Großteil dem Inferno seiner Vergeltung in den feurigen Rachen geworfen hatte, wollte ein Teil von Fennek nicht, dass Morven schmutzig wurde. Er fühlte sich besudelt genug.
Schweigend und mit unstetem Tempo wankte der Inquisitor mit der stummen Begleitung in seinen Armen die Allee hinunter, während ihn die Bewaffneten nicht aus den Augen ließen. Ebenso wenig wie die granitenen Blicke all der Vorgänger des Archonten, deren selbstgefällige Gesichter den Inquisitor mehr und mehr erzürnten. Seine Arme standen in Flammen, protestierten bei jedem Schritt, den er machte.
Sobald ich am Ziel bin, dieser götterverfluchte Thron fest unter meinem Hintern verankert ist, reiße ich als Erstes dieses Spalier blasierter Arschgesichter ab.
Fennek wankte weiter, den Blick auf das Ziel seines Marsches gerichtet. Das Herz schlug ihm bis zum Hals – und der Grund war weniger die körperliche Belastung als vielmehr das Wissen, wie entscheidend die nächsten Minuten sein würden. Das, was ihn in der Zitadelle erwartete, ließ sich nicht in komplexe Kreise einteilen, hatte keine Grauzonen. Es war eine Alles-oder-nichts-Situation.
Es wurde noch dunkler, als der Schatten der klingenbewehrten schwarzen Zinnen der Zitadelle auf Greskegard und seine Fracht fiel. Wie das vergessene Zepter eines Gottes, der die Dämmerwelt längst verlassen hatte, ragte der gigantische Wehrturm vor dem simulierten Himmel der Nebelkuppel auf.
Fennek befand, dass dieser Vergleich nicht so weit hergeholt war. Einst war der Turm der Punkt auf dem Rücken des Titanen Fomor gewesen, der die Zwingfeste des Mächtigsten aller Erzmagier hatte tragen müssen. Von diesen Zinnen aus hatte Vortigern, der Tyrann von Kael, über das Schlachtfeld des Titanensturms geblickt und mit einem einzigen Befehl die Welt zum ewigen Zwielicht des Nebels verdammt. Nun lebten die Nachfahren jener hier, die nach dem Weltenbrand die Überreste einer verängstigten Bevölkerung zur Penta Fomor geschmiedet und seitdem mit eiserner Faust unterjocht hatten.
Das zyklopische, zweiflügelige Eingangstor schälte sich aus dem morgendlichen Zwielicht und dem Dunst des Nieselregens. Es ragte so hoch auf wie zehn Männer, war ebenso breit und ähnlich monumental und Ehrfurcht gebietend wie die Statuen der Archonten. Es bestand in Gänze aus einem obsidianschwarzen Metall, auf das sich die Arkanisten dieses an Magie armen Zeitalters keinen Reim zu machen wussten.
In menschengroßen Runen prangte das Credo der Penta Fomor über den Torflügeln, auf ewig in den Granit der Feste geätzt und bei besserem Wetter weithin sichtbar. Es war in keiner der Sprachen der Pentae verfasst, sondern in der Sprache der Almharach. Jener Vorläufer der heutigen, riesenhaften Ambosskrieger, die sich vor mehr als einem halben Jahrtausend bereitwillig den Erzmagi unterworfen und ihre Armeen gebildet hatten. Sie waren die Adressaten dieser Botschaft, ihnen galt der Zorn der Archonten und der wenigen zivilisierten Menschen, die die Dämmerwelt noch kannte.
Zumindest in der Theorie.
»Arithist chubraidh!« stand dort.
»Niemals wieder!« Fennek war über den verbrauchten Klang seiner eigenen Stimme erschrocken. Wann hatte er das letzte Mal etwas getrunken? Sein Mund war trockener als die Wüsten Bai’t Manoons.
»Hat ja gut funktioniert, wenn ein Hüne aus dem Amboss tagelang unter euresgleichen lustwandeln kann, ohne dass ihm ein anständiger Mensch ein Schwert in die Rippen jagt«, murrte er.
Fast so, als habe die mit arkanen Runen und uralten dämonischen Fratzen verzierte Pforte seine Worte vernommen und sie als Affront gewertet, lief ein Rumpeln durch das Metall. Zahnräder und Gestänge bewegten sich, eine Ausfalltür im Torflügel schwang auf. Im Dunst des Morgens war die Helligkeit dahinter gleißend. Das Licht projizierte eine Raute, einen Keil auf die Allee.
Da nach einigen Herzschlägen immer noch niemand heraustrat, fasste sich Fennek ein Herz und schritt auf das erhellte Rechteck zu, das wie mit einem Lineal gezogen vor ihm gähnte. Er lugte an seiner Stirn vorbei nach oben, wo das monströse Fallgatter vor dem Portal hing. Fiele es herab, von Fennek Greskegard würde wohl nicht mehr als ein Schmierfilm bleiben. Er schritt aus dem Zwielicht des vernieselten Morgens durch die Tür, hinein in das Licht der Zitadelle.
Die erste Überraschung für den Inquisitor war, dass der Archont persönlich zugegen war – jemand musste dem Potentaten mitgeteilt haben, dass der Bruder seines Weibes hier war. Und das, obwohl ihm das Betreten der Zitadelle, ja das Nähern bei Todesstrafe untersagt war. Die zweite Überraschung war der Archont. Der Mann war deutlich kleiner, als Fennek ihn seit ihrer letzten Begegnung vor Jahrzehnten in Erinnerung hatte.
Der Vorhof zu den unteren Stockwerken der Zitadelle war eine rechtwinklige Kammer mit den Ausmaßen eines kleinen Stadions. Eine der vielen magischen Besonderheiten des Gebäudes, dem Charakter des Tyrannen von Khael geschuldet. Der Fuß der Zitadelle war mächtig, es war ein gigantisches Gebäude. Aber es war bei Weitem nicht mächtig genug, um solch eine Halle zu beherbergen. Magick.
Der Archont stand an einer Balustrade, vier Mannshöhen über dem schwarz-weiß geschachten Boden des Vestibüls. Er vollbrachte das Kunststück, zwischen den wappenbedeckten Gobelins und den pompösen, scheunentorgroßen Gemälden seiner Vorgänger nicht zu verschwinden.
Ein Spalier aus schwer gepanzerten Myrmidonen umstellte den Inquisitor, bevor er mehr als drei Schritte in die Vorhalle machen konnte. Obsidianschwarze Plattenpanzer aus überlappenden Lamellen, meisterlich gearbeitet. Nach hinten zulaufende Schaller, aus deren Oberseite die vorderen Körperhälften heraldischer Golddrachen ihre Tatzen nach vorn reckten und an deren Seiten Flügelverzierungen thronten. Die Rücken verziert mit pelzverbrämten Umhängen aus Purpur und Gold, nahtlos übergehend in die ausgehöhlten Köpfe von Karstlöwen oder Greifen. Auf dem linken Schulterschutz jedes Ritters starrten sie aus Glasaugen in die Welt.
Massive Bidenhänder und andere Zweihandwaffen bildeten, einander überlagernd, ein tödliches Geflecht in der Luft vor dem Inquisitor, die Spitzen und Schneiden auf seinen Adamsapfel gerichtet. Fennek blieb stehen, sich seiner Lage bewusst. Auf einen Wink des Potentaten auf der Balustrade würden diese Männer ihn mit diesen überlegenen Waffen niederhauen und in Stück hacken, noch bevor er nur zu fliehen versucht hatte.
Diese Myrmidonen waren die Elite der Penta, handverlesene Schlächter aus den Diadochenreichen der Flüsternden Küste, der Svartbucht. Es hieß, dass ihre Väter sie noch im Knabenalter dem Seewyrm, einer mythischen Bestie aus den Tiefen des Ozeans, vorwarfen. Dass sie sich, nur mit einem Messer bewaffnet, aus dem Schlund des Monstrums kämpften. Oder vergingen. Die Überlebenden wurden weiter gedrillt und ihre Dienste verkauft. So erhielten diese Diadochen sich trotz ihrer angreifbaren Position ihre Unabhängigkeit. So hieß es.
Der Inquisitor hatte diese Gerüchte stets ins Reich der Legenden verbannt. Aber ein Blick in die Augen hinter den Schlitzen ihrer Schaller und seine eigene Erfahrung mit Dingen, die den Verstand eines Mannes überstiegen, waren ihm Hinweis genug. Ein kluger Mensch wusste, dass in jeder Legende mehr als nur ein Körnchen Wahrheit steckte. Er blickte an den Elitekämpfern vorbei, zur Balustrade hinauf. Bemühte sich, kontrolliert zu atmen – was kam, würde entscheiden, ob er lebte. Worauf hatte er sich hier nur eingelassen? Egal, kein Zweifel jetzt!
»Schwager!«
Die Stimme des Archonten war geölte Seide, die zärtlich die Schneide eines Giftdolches liebkoste. »Wir dachten eigentlich, Wir hätten uns unmissverständlich ausgedrückt, als Wir Euer armseliges Dasein schonten und Euch mit Eurem Amte zugleich reichen Lohn zuteilwerden ließen.«
Der Archont verließ seine Position auf der Galerie und kam eine wie einen Schwanenhals geschwungene Treppe herab. Wobei »kommen« das falsche Wort war. Er vollbrachte das Kunststück, wie ein Raubtier zu pirschen. Und das, obwohl er eine noch ostentativer verzierte Rüstung mit unzähligen verschnörkelten Goldätzungen trug als seine Leibgardisten. Beide Schultern wurden von den zur Seite glotzenden Schädeln von Karstlöwen und den Fängen ihrer Oberkiefer eingerahmt. Über seinem Haupt diente der Kopf einer der kapitalen Raubkatzen als prunkvolle Kapuze, die den Status eines der fünf mächtigsten Männer der Dämmerwelt unterstrich.
Er hat sich die Rüstung anlegen lassen, als er von meinem Kommen gehört hat, dachte Fennek nicht ohne Befriedigung. Auch nach all den Jahren fürchtest du mich noch. Gut für dich. Schauen wir, ob es dir etwas nützt.
Die Panzerstiefel des Archonten hallten auf dem Marmor der Halle wider, während der Potentat gemessen auf Fennek zuschritt. Sein Raubvogelgesicht wurde von feinen Koteletten eingerahmt, ein stattlicher schwarzer Schnurrbart ragte gezwirbelt und gewichst an beiden Seiten über die Wangen hinaus. Augen, in denen keine Spur von Gnade lag, wanderten über Fennek hinweg … und erreichten das Bündel, das er trug. Fünf Schritte vor Fennek Greskegard blieb der Herr über Fomor stehen und sah für den Bruchteil einer Sekunde aus wie ein gewöhnlicher Mann, der in eine unsichtbare Mauer gelaufen war.
Es wurde Zeit für den nächsten Schritt der Scharade. Fennek fiel das verblüffend leicht. Er zapfte seine Schande über die Untat an, die er begangen hatte – und die Tränen schossen wie von selbst aus seinen Augen. Eine Mischung aus Scham und aufrichtig empfundener Reue ließ ihn mit Morven in seinen Armen in die Knie brechen.
»Majestät! Ich …!«
»Was hat er getan?! Was hast du meinem Kind angetan?!«
Die Stimme des Archonten überschlug sich. Er stürzte auf Greskegard – nein, auf Morven – zu, riss sich von den Händen seiner Leibgarde, die ihn davon abzuhalten versuchte, los und sank auf die Knie. Er streckte die Hände vor, so als trügen sie eine unsichtbare Last – und Fennek folgte der stummen Aufforderung. Er ließ Morvens nur mit einer fleckigen Toga bekleideten Körper in die Arme ihres Vaters gleiten.
Ungläubig starrte der Archont auf sein Kind, seine einzige Tochter, der Blick seiner Eisaugen schwamm. Mit unendlicher Zärtlichkeit, so als habe er Angst, sie könne in seinen Händen zerbrechen, streichelte er Morvens regennasses Gesicht. Er strich ihr ein paar widerspenstige Haarsträhnen aus der erkalteten Stirn, wiegte sie und summte ein Lied.
Dann hielt der Herrscher inne – und sein Blick richtete sich auf Greskegard, der sich in diesem einen, kostbaren Moment so nahe bei seiner Familie fühlte, wie es nur ging. Und der sich zugleich unendlich klein und schmutzig vorkam. Er wandelte Scham und Selbstekel zu Tränen, die sich den Weg durch die Stoppeln seiner Wangen suchten.
»Warum fühlt sie sich so … falsch an, Fennek?«, fragte der Archont.
»Ihre Mörder haben einen Nebelmacher benutzt, Majestät«, sagte Greskegard und war überrascht, wie leicht ihm die Lüge über die Lippen kam.
Weil man eine Lüge immer mit mehr als nur einem Stück Wahrheit verkauft, dachte er. Und immerhin stimmte das. Ihr Mörder hatte einen – mittlerweile bedauerlicherweise verstorbenen – Nebelmacher damit betraut, den psychischen Abdruck der grausamen Tat und jeden Rest der Seele zu entfernen. Der Mann war Fennek noch einen Gefallen schuldig gewesen – und hatte sich überrascht gezeigt, dass Morvens Leib angeblich Spuren eines ähnlichen Ritus zeigte. Nur wie? War dies der Wirkung des Zauberschwertes zuzuschreiben, das Greskegard für seine Tat benutzt hatte? Eine Frage für einen anderen Tag. Falls es je einen anderen Tag für Fennek Greskegard geben würde. Der Blick des Archonten sprach Bände.
»Ihre Mörder? Wer? Wann?«
»Majestät, ich werde all Eure Fragen beantworten, aber …«
Der Archont hob gebieterisch eine Hand und brachte den Inquisitor damit zum Schweigen. Seine Stimme troff nun vor Wut, vor Hass über den Tod seiner Tochter. Und diese Emotion hatte ihr Ziel gefunden, sah es vor sich. »Das wird er. O ja, und wie er das wird. Und auch der Tempel. Wir hatten sie dem Tempel des Lichtfürsten anvertraut.«
Bevor Fennek noch etwas sagen konnte, stand der Archont mit Morven in seinen gepanzerten Armen auf. Er gab seinen Myrmidonen ein Zeichen mit einer Bewegung seines Kopfes. Ehe Fennek sich versah, traf ihn ein brutaler Tritt in die Kniekehle. Ungebremst raste ihm sein eigenes, halb durchsichtiges Gesicht im schwarzen Marmor entgegen, begrüßte ihn Stirn an Stirn – ein scharfes Knacken ließ Blüten hinter den Lidern des Inquisitors erblühen. Ihnen folgte dunkle, dumpfe Stille. Vorbei.
Die Besinnung, zu der Fennek zurückfand, war kein begrüßenswerter Zustand. Seine Nase pulsierte in einem Schmerz von derart intensiver Färbung, dass sie Fennek wie ein zum Bersten gefüllter Flaschenkürbis vorkam, der nur darauf wartete zu explodieren. Auch seiner Zunge ging es nur unwesentlich besser. Greskegard war sich sicher, dass er sich bei seinem unfreiwilligen Techtelmechtel mit dem Steinboden ein Stück davon abgebissen hatte. Das wenige, was er zu riechen vermochte, hatte den schweren, nur allzu bekannten Hautgout von heißen Kohlen, warmem Urin und kalter Angst. So stark, dass er Fenneks gemartertes Riechorgan noch zu passieren vermochte. Übervorsichtig und mit einem gequälten Stöhnen schlug Greskegard die Augen auf und erblickte erwartungsgemäß nur eine Decke aus Steinplatten.
Ein Blick auf seine Arme und Beine – im Übrigen unbekleidet – offenbarte ihm alles, was er befürchtet hatte. Er war mit schweren Schellen an einem Tisch der Sorte fixiert worden, die der Inquisitor sein halbes Dasein lang zur zeitweiligen Heimstatt von Nekromanten und anderem Gelichter gemacht hatte. Dies waren die Kerker der Zitadelle. Und sein Leben war verwirkt.
Er würde die Verfehlungen jener ausbaden, denen Morvens Leben vor Jahren anvertraut worden war. Offenbar hatte es der Tempel bislang nicht über sich gebracht, den Archonten von Morvens Verschwinden zu unterrichten.
Eine rundliche Visage schob sich in sein Gesichtsfeld. Aus der stoppeligen Larve des Mannes, der auf ihn herabsah, brach die Strahlkraft unverfälschter Bosheit hervor wie das Licht eines neugeborenen Sterns. Schweinsaugen von einer Tücke, die selbst zögerliche Mutterliebe nicht hatte zähmen können, trieben verloren in der Fettmasse der Fratze des Foltermeisters. Das Speckgebirge seines Antlitzes riss auf, gebar einen Schlitz, in dem schwarzgrüne Zahnstummel standen. Wolken von Mundgeruch zwängten sich feuchtwarm in Greskegards Atemwege, sodass ihm die Galle den Hals heraufstieg.
»Wir werden viel Spaß haben, Ihr und ich, Mylord!«, keckerte die aufgedunsene Monstrosität. »Hab noch jeden zum Reden gebracht.«
Greskegard zweifelte nicht daran. Er hatte es in der Kunst der Folter nie zu höheren Weihen gebracht – solche Tätigkeiten überließ er Sanftleben. Er war sich bewusst, dass er einiges an Leid ertragen konnte. Echte hochnotpeinliche Befragung in den Händen eines geübten Foltermeisters, das war etwas anderes.
»Vielleicht kommt es gar nicht erst so weit, Schwager!«
Greskegard wandte beim Klang der Stimme den Blick und konnte kaum glauben, was er sah.
»Ich sehe dich verwundert, Fennek«, sagte der Archont, der sich, gewandet in schwarze Seidenroben, aus dem Schatten schälte. »Glaub mir, du bist in dieser Woche nicht der erste Mann, der so empfindet. Von mir selbst abgesehen. Es wird langsam zu einer schlechten Angewohnheit, mich dauernd hier herabzubegeben.«
»Ist so etwas nicht deutlich unter deiner Würde, Baltus?«, fragte Fennek, den der Anblick des Mannes in dieser Kammer aufrichtig überraschte. »Solltest du nicht um deine Tochter trauern und meine Marter unwürdigeren Händen als den deinen überlassen?«
»Was fällt dir ein, so mit dem Archonten zu reden, du Hund?!«
Der brutale Fausthieb des Folterknechts kam prompt und wenig überraschend. Fennek hatte das Gefühl, das ein Streitross auf seinen Solarplexus getreten war. Greskegard wandte den Kopf und erbrach Galle und blutigen Speichel. Auf einen tadelnden Wink des Archonten trat der Wärter zurück und verneigte sich.
»Nicht doch, Meister, lasse er ihn. Fennek gehört zur Familie. Irgendwie zumindest …«
»Baltus, ich beschwöre dich – ich hatte nichts mit Morvens Tod zu tun!«, hustete der Inquisitor. »Ich sah es als meine Pflicht, dir dein Kind zurückzubringen!«
»Mein Kind.« Das Gesicht des Archonten verzog sich im schwachen Fackelschein schmerzvoll. Flammen tanzten auf der Feuchtigkeit, die seine Augen schwimmen ließ.
»Wir waren nie einer Meinung, du und ich, nicht wahr, Fennek? Du hast mich schon immer verachtet! Ist es nicht so?«
Greskegard nickte, soweit es seine Fesseln zuließen.
»Wie könnte ich auch nicht, Baltus! Du hast mir alles genommen. Mein Reich. Meine Familie. Selbst vor meiner Schwester hast du nicht haltgemacht!«
»Nur der Ruchlose gewinnt in diesem Spiel. Ist das der Grund, warum du mir deinerseits mein Kind geraubt hast? Plumpe Rache?« Der Archont schüttelte den Kopf, und Fennek fand, dass er aufrichtig betroffen aussah. Doch der Inquisitor wusste es besser. Der Archont war – egal, wie es in ihm aussah – wie eines der baumstammartigen Reptilien, die in den südlichen Sümpfen der Geisterländer hausten. Sie konnten Wochen im brackigen Wasser liegen, bis sich ihre Beute an ihren Anblick gewöhnt hatte, um unvermittelt und mit brutaler Härte zuzuschlagen.
»Hätte ich das je gewollt, Baltus – ich hätte in zwei Dekaden jede Chance gehabt, mich an ihr oder deinen Söhnen zu vergreifen. Denk nach, was hätte ich davon außer dem Vergnügen kurzer Rache? Nur um genau in derselben Lage zu enden wie jetzt? Hältst du mich für solch einen Narren? Und selbst wenn? Warum jetzt?«
Der Archont nickte bedächtig und legte einen Finger an die Lippen.
»Tja, welchen Nutzen hättest du davon, hmm? Sag du es mir.«
»Angesichts meiner Situation hier würde ich freiheraus sagen: keinen. Dein Vasall dort wird sich einige Tage mit mir vergnügen, danach bin ich entweder des Todes oder verrotte in irgendeinem Loch.«
»Aber nicht, wenn du unschuldig bist, Schwager«, tönte der Archont. »Wenn du nichts zu verbergen hast, wird die Befragung doch nichts erbringen.«
Greskegard schnaubte: »Bist du dir da sicher, Baltus? Wir wissen doch beide, dass die Marter am Ende genau die Aussagen erbringt, die man hören will. Und nicht notwendigerweise die Wahrheit. Die bleibt meist unter all dem Blut, dem Schweiß und den Tränen verborgen und wird umso tiefer begraben.«
»Soso. Und welche Wahrheit wäre das? Bitte, erleuchte mich. Du musst wissen, so oft komme ich nicht hier herunter, dass ich mit all diesen Vorgängen vertraut wäre. Das Foltern überlasse ich – wie dir klar sein dürfte – meinen Untergebenen. Männern deines Schlages.«
Greskegard konnte kaum verhindern, dass sich ein Seufzer über seine Lippen stahl. Seine nächsten Worte würden entscheiden, ob er als gemartertes Wrack für immer hier unten verfaulen musste.
»Ich sagte ja, dass deine Tochter das Opfer einer Verschwörung wurde.« Er tat einen bedeutungsschweren Atemzug. »Die, die dahinterstehen, schicken dir auf diese Weise ein Signal. Sie haben … sie haben den Totenkaiser benutzt.«
In der Kammer blieb es still. Nur das bedächtige Knistern der Pechfackeln und des Kohlebeckens war zu vernehmen, während der Archont den Bruder seiner verstorbenen Frau musterte. Fennek hielt seiner Betrachtung stand.
»Der Tempel der Sharis würde sich niemals gegen mich wenden«, stellte der Archont fest. »Nur meine säkulare Herrschaft, der Thron des Archonten, hat all die Jahrhunderte vereitelt, dass der Orden des Lichtfürsten die Mörder ausradiert hat. Nur weil sich der Adel ihrer bedient hat, gehen die Diener der Todesgöttin noch ihren Geschäften nach.«
»Und füllen ihre Säckel, ich weiß, Baltus. Aber es gibt eine neue Macht in der Stadt. Ich bin bei meinen Ermittlungen auf sie gestoßen. Und dabei habe ich Morven gefunden.«
»Clach mag vieles sein, aber an seiner Integrität gab es nie einen Zweifel. Niemand sollte das besser wissen als du.«
Der Kommentar versetzte Fennek Greskegard einen Stich. Er bemühte sich, es sich nicht anmerken zu lassen. Der Archont hatte Clach einst angeheuert, um Fenneks gesamte Familie töten zu lassen – und er ließ es ihn erneut spüren.
Um mich zu testen?
Der Potentat betrachtete Fenneks Gesicht, forschte nach einer Reaktion, nach dem Hass, den er einst in den Augen seines in dieses Amt des Inquisitors verbannten Schwagers gesehen hatte. Greskegard erwies ihm diesen Gefallen nicht. Es war zu wichtig, jetzt nicht die Beherrschung zu verlieren. Fenneks Zeit würde kommen.
»Und was für eine neue Macht sollte das wohl sein?«, fragte der Herrscher von Fomor.
»Das weiß ich nicht. Noch nicht. Aber ich bin bei meinen Ermittlungen weit genug vorgedrungen, um zu erfahren, dass sie die Titanen verehren. Und dass sie Nebelmacher anheuern.«
»Und Morven?«
»Sie war ihre Gefangene.« Fennek schluckte. »Sie haben sie vor einer Versammlung geopfert. Dein favorisierter Nebelmacher hat den Schnitt geführt. Ich flehe dich an, Baltus. Diese Sache ist größer als unser Zwist. Es ist Jahrzehnte her. Ich werde dir nie verzeihen, aber ich habe die Aufgabe, mit der du mich verhöhnt hast, umarmt. Ich bin Inquisitor. Ich diene den Pentae und dem Licht, was immer sonst vorgefallen sein mag. Daran gibt es keinen Zweifel.«
Der Archont tigerte durch den Raum, während neuer Zorn, neue Zweifel in ihm aufloderten. Es war ersichtlich, dass er ein Ventil suchte.
»Und wo sind deine Beweise, Schwager? Damit ich sicher sein kann, dass deine Worte nicht nur der geschickte Versuch sind, mich zu verhöhnen, indem ich den Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes auf freien Fuß setze?!«
»Ich habe Beweise, Baltus. Schick ein paar deiner Männer – vertrauenswürdige Männer – in die Katakomben. Viele der Siegel der Zugänge sind gebrochen. Schicke sie in den Titanen. Direkt in Fomors Herz. Dann wirst du sehen, dass ich die Wahrheit spreche …«
Der Archont betrachtete Fennek eine Weile lang abschätzig. Greskegard hatte das Gefühl, dass jede Sekunde etwas in ihm zerreißen würde. Gegen seinen Willen, gegen jede Kontrolle raste sein Herz. Er zwang sich zur Ruhe.
Schließlich nickte Baltus von Fomor, der mächtigste Mann der Welt. »Ihm wird kein Haar gekrümmt.«
Der Foltermeister schluckte, sein krötenartiger Hals wabbelte, als er nickte. Schweißperlen funkelten auf seiner pockennarbigen Stirn.
»Wenn ich zurück bin und du gelogen hast, Schwager, wirst du dir wünschen, dass die Nachtmutter dich in ihrem Streitwagen hier herausholt. Dein Tod wird dir wie die ultimative Erlösung erscheinen, du wirst ihn herbeisehnen. Aber er wird nicht kommen. Und wenn ich einen Nekromanten hinzuziehen muss! Verstehen wir einander?«
Fennek nickte erneut, so es ihm sein begrenzter Spielraum gestattete. »Jedes Wort ist wahr!«
Es dauerte Stunden, bis der Archont zurückkehrte. Bange, endlose Stunden, in denen Fennek darüber nachdachte, ob es den Kultisten gelungen war, ihre Banner und Kunstwerke sowie all die anderen Beweise aus dem Herzen des Titanen zu entfernen. Der Inquisitor rief sich zur Ordnung.
Da unten liegen Dutzende Tote. Die Roben, die riesigen Gobelins mit den Motiven. Das kann unmöglich alles weg sein.
Aber wenn doch? Ihre Gegner schienen Zugang zu Wahrer Magick zu haben, Fennek und Sanftleben hatten gegen einen von ihnen gekämpft. Der Lichttempler war unsterblich gewesen. In der wahren Bedeutung des Wortes. Kopftreffer mit einem Kriegshammer hatten das Monstrum nicht zu stoppen vermocht. Was, wenn diese Kräfte dabei halfen, einen riesigen Tatort auf die Schnelle zu reinigen und sämtliche Beweise zu vernichten?
Dann hast du immer noch deinen zweiten Plan. Sanftleben wird kommen. Er wird sich als Wärter anheuern lassen und dich hier herausholen. Auf ihn kannst du zählen.
Konnte er das? In letzter Zeit war der Ambossbarbar aufmüpfig geworden, hatte Fenneks Entscheidungen unablässig hinterfragt. Doch andererseits: Der Mann hatte einen Eid geleistet. Und jeder wusste, wie versessen die Giganten der Nebelbrachen darauf waren, ihre Ehrbarkeit dauerhaft und stets aufs Neue unter Beweis zu stellen.
Fenneks Zweifel wurden jäh unterbrochen, als die Tür aufgestoßen wurde. Einer der Myrmidonen trat ein, sein Gesicht bis auf das Kinn hinter der Drachenfratze seines Schallers verborgen.
»Dieser Mann kommt mit mir«, befahl er. Ein Befehl, der keinen Widerspruch zuließ. Der Folterknecht sah betroffen aus. Widerstrebend schnallte er Fennek los.
ENDE DER LESEPROBE