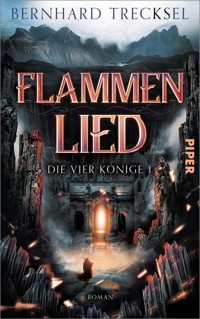9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Totenkaiser
- Sprache: Deutsch
Rasante Action, spannende Wendungen und düstere Intrigen – das Finale der Totenkaiser-Trilogie.
Fennek Greskegard hat scheinbar alles erreicht: Als Archont herrscht er über eine der fünf letzten Städte der Menschheit, und der Mörder seiner Familie ist tot. Und doch kann er nicht zufrieden sein, denn er weiß, dass er die ganze Zeit manipuliert wurde. Als Fennek Greskegard herausfindet, wer dahinter steckt, sieht er nur eine Möglichkeit, sich aus dem Netz der Spinne zu befreien. Er muss sich mit seinem ältesten Feind verbünden – mit Clach, dem Totenkaiser!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Fennek Greskegard hat scheinbar alles erreicht: Als Archont herrscht er über eine der fünf letzten Städte der Menschheit, und der Mörder seiner Familie ist tot. Und doch kann er nicht zufrieden sein, denn er weiß, dass er die ganze Zeit manipuliert wurde. Als Fennek Greskegard herausfindet, wer dahintersteckt, sieht er nur eine Möglichkeit, sich aus dem Netz der Spinne zu befreien. Er muss sich mit seinem ältesten Feind verbünden – mit Clach, dem Totenkaiser!
Autor
Bernhard Trecksel, geb. 1980 in Papenburg an der Ems, bezeichnet sich selbst als leidenschaftlichen Eskapisten und absoluten Geek. Die Kunst des Erzählens lernte und verbesserte er während unzähliger Stunden, die er mit Fantasy-Rollenspielen verbrachte. Seine Inspiration als Autor findet er in den alltäglichsten Dingen wie dem Lesen der Morgenzeitung, doch seine schriftstellerischen Idole sind die alten Meister wie H.P. Lovecraft, Robert E. Howard und J.R.R. Tolkien. In seiner Freizeit spielt er Videospiele, Brettspiele und (auch als Erwachsener immer noch) Rollenspiele oder liest Fantasy- und Horrorromane. Seit seinem Universitätsabschluss in Archäologie und Skandinavistik lebt er in Münster und arbeitet als Übersetzer, Rezensent und – seit seinem Debüt Nebelmacher – als Autor.
Die Totenkaiser-Trilogie bei Blanvalet
1. Nebelmacher
2. Nebelgänger
3. Nebeljäger
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Bernhard Trecksel
Nebeljäger
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.1. Auflage
Copyright © 2018 by Bernhard Trecksel
Copyright © 2018 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München.
www.ava-international.de
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -illustration: Isabelle Hirtz, Inkcraft
Karte: © Jürgen Speh
HK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltng GmbH, MünchenISBN 978-3-641-19874-9V002www.blanvalet.de
Karte
1. Fennek
Der Archont war nicht in Panik, weil sie ihn verfolgen konnte, obschon sie tot war. Es war nicht die Tatsache, dass sich der Boden unter seinen Füßen wie ein endloses Band verhielt, gegen das er anrannte. Oder dass ihr Kopf auf den Schultern pendelte, der schlanke Hals nicht mehr als ein klaffender Schlitz.
Die Furcht lag auch nicht darin begründet, dass sie noch zu rennen vermochte, während er nicht vorankam. Immerhin war sie ermordet worden, und er lebte. Nein, die Panik rührte daher, dass sie seinen Namen rief.
Dass sie noch sprechen konnte, war ebenso unmöglich wie der Rest dieses Irrgartens aus endloser Dunkelheit. Denn sie war mausetot. Er musste es wissen. Mehr als dreißig Zoll geschärften, nackten Stahls hatten diese Wirkung, zog man sie einem Menschen durch die Kehle. Die Erinnerung an das Geräusch, mit dem sich das Fleisch geteilt hatte, das Kratzen der Schneide an ihren Nackenwirbeln – sie war zu frisch.
Und doch waren es nicht diese Sachverhalte, die ihn so hart trafen. Es war die Tatsache, dass sie gegen jede Logik noch hinter ihm seinen Namen rief, und das mit diesem zerschnittenen, weit aufklaffenden Hals.
»Onkel! Onkel! Bleib doch stehen!«
Es waren lockende, gedehnte Worte von einer unwirklichen Qualität. Er blieb nicht stehen. Das hatte er bislang nicht getan, und auch diesmal hatte er es nicht vor.
Auf einer Ebene seines Bewusstseins war ihm absolut klar, dass das unmöglich war – diese Ebene wusste, dass er träumte. Nacht für Nacht den gleichen Traum. Aber es half nichts. Sie würde noch zweimal nach ihm rufen, dann wäre der andere da. Absolut zuverlässig.
Es kam, wie es in den letzten Nächten gekommen war. Die massige Gestalt verstellte ihm den Weg. Er tauchte ab, wurde im Nacken gepackt, schrie und zappelte, schlug um sich. Es half nichts.
»Ich war dein Freund!«, brüllte Fennek dem Riesen ins Gesicht.
»Du warst mein Freund!«, sagte der Riese völlig unberührt.
»Warum habe ich dich getötet?« Greskegard schrie es.
»Warum hast du mich getötet?«, wollte der Riese wissen.
»Das hast du nicht verdient«, sagte Fennek. Ruhiger, gefasster. Das Schlimmste lag hinter ihm. Gleich würden sie ihn ermorden. Sie würde hinter ihm auftauchen. Morven, seine Nichte. Sie würden es gemeinsam zu Ende bringen. Und er würde erwachen. So war es immer. So würde es wieder sein. Er hoffte, dass es so sein würde.
»Das hatte ich nicht verdient!«, klagte der Riese.
Sie war jetzt hinter ihm. Er spürte ihre Hände an seinem Hals, ihren Atem im Nacken. Hörte das Blubbern, mit dem die Luft aus dem Schnitt in ihrer Kehle entwich.
»Es tut mir leid!«, rief Fennek. Er wusste, dass es nichts bringen würde.
Es würde passieren. Ihre Finger würden sich um seinen Hals legen. Erst Morvens lange, schlanke Hände, danach Sanftlebens Pranken. Vier Hände, die seine Gurgel umklammern würden. Die Luft würde ihm knapp werden, dann kämen der Schmerz, die Todesangst – und das Erwachen.
Es geschah nicht. Sie trat hinter Fennek hervor und neben Sanftleben. Der Riese und die junge Frau blickten beide mit einem Hohnlächeln auf ihn herab, ihre Augen polierte Murmeln. Sanftleben ließ Greskegard fallen. Hart kam er auf. Wie auf ein vereinbartes Signal hin drehten sich beide um. Stierten in die Finsternis. Und gingen …
Der Archont von Fomor schreckte hoch, das Herz in seiner Brust ein frenetisches Hämmern gegen seine Rippen. Wie in jeder Nacht brauchte er einen Moment, um sich zu orientieren. Wie in jeder Nacht seit dem zweiten Fall des Titanen Fomor war er schweißgebadet.
In der Zitadelle war es ganz still. Seitdem Fomor, der Gottriese des Erdelements, seinem Gefängnis in den Tiefen unter der Penta entstiegen war, empfand Fennek so gut wie jede durchschnittliche Geräuschbelastung als Stille. Er hörte nicht mehr so gut wie früher. Die Wenigsten in der Penta Fomor taten das.
Langsam erhob sich der Archont, schwang die Beine über den Rand seiner prunkvollen Bettstatt. Seine nackten Füße fühlten den kalten Marmor unter den Karstlöwenpelzen, die den Boden bedeckten. Im Palast war es so kühl, dass Fenneks Atem Wölkchen bildete. Die Kälte ließ seinen erhitzten Körper zittern. Der Eisenwinter hatte begonnen.
Es war so dunkel, dass Greskegard kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Er kam schwankend auf die Beine, eine Hand an das eiskalte Mauerwerk gestützt, die andere im Dunkel nach dem Klingelzug tastend. Er fand ihn. Zog daran. Nichts. Kein Geräusch.
Verwirrt und immer noch im Limbus von Schlaftrunkenheit und den Nachwehen seines Albtraums gefangen, zog Fennek mehrfach an der Kordel. Nichts geschah. Niemand kam, niemand antwortete.
Fast hätte Greskegard nach Sanftleben gerufen.
Aber Sanftleben war tot.
Auch dies musste Fennek von allen am besten wissen – er war es gewesen, der dem Riesen das Schwert in den Hals gestoßen hatte. Er war es gewesen, der Sanftleben ermordet hatte. Seinen einzigen Vertrauten.
Vielleicht sogar den einzigen echten Freund, den er je gehabt hatte.
Ein Kloß bildete sich in seinem Hals, verwandelte Fenneks Kehle in ein eisernes Band, das sich zusammenzuziehen schien. Wieso antwortete das Gesinde nicht? Er schluckte den Kloß aus aufkeimender Trauer und Scham hinunter. Er hatte andere Sorgen.
Hatte das Volk plötzlich die Nase voll von seinem Erlöser? Dem Mann, der vermeintlich den Titanen gestürzt hatte? Dem Inquisitor der nahezu ausgetilgten Kirche des Lichtfürsten, deren Illuminarium, die Kathedrale des Ordens, unter der Leiche des Titanen begraben lag? Waren gedungene Meuchler der anderen Archonten in die Zitadelle eingedrungen? Vorbei an den Myrmidonen? Unmöglich! Oder nicht?
Im Dunkel tastete der Archont nach seinem Nachttisch, bis seine Finger den kalten Widerstand spürten. Fennek nahm die Pistolenarmbrust an sich, wollte sie aufziehen, noch bevor er nach einem Talglicht suchte. Verstört registrierte er, wie die Feuerwaffe in seinen Händen zerbröselte, als er den Lademechanismus aufdrehte. Es rieselte, als rinne feinster Sand durch seine Finger auf den Marmor.
Was geschah hier?
Erst da ging dem einstigen Inquisitor auf, dass die Kommode, die ihm als Nachttisch diente, nach Fäulnis stank, ebenso wie der Rest seines Schlafgemachs. Er berührte das Schränkchen und schrak zurück, als eine schwammige, pilzartige Masse unter seinen Fingern nachgab.
Greskegard kniff sich, um zu prüfen, ob er wach war. Der Schmerz kam dumpf bei ihm an, das Pochen einer betäubten Wunde.
»Was bei den Fünfen geht hier vor?«, raunte er. Der Rest der Pistolenarmbrust brach auseinander, Und die Fragmente fielen auf den Boden. Fennek wich vor dem Geräusch sowie der Masse, die seinen Nachtschrank bedeckte, zurück.
Er durchmaß den Raum, so schnell er sich in der Dunkelheit traute, zog an den Vorhängen, die das Rundbogenfenster bedeckten. Sie gaben mühelos nach, sanken zu Boden. Doch auch außerhalb der Zitadelle, dort, wo der künstliche Nachthimmel der Schildkuppen, die Lichter der Stadt sein sollten, war nichts. Die klamme Pranke der Panik legte sich um sein Herz, das schmerzhaft pochte.
Er träumte doch nicht nach wie vor? Davon hatte er sich doch überzeugt. War er gestorben? Hatte sein Herz im Schlaf den letzten Schlag getan? War seine Seele in dieses Unterreich aus fauliger Schwärze eingegangen? Zur Strafe für seine Taten?
Ist dies der Tod?
War dies der Ort, von dem Clach zurückgekehrt war?
»Mumpitz!«, schalt er sich. »Irgendjemand treibt seine Spielchen mit mir. Jemand, der begreifen wird, dass das ein Fehler ist, den man nur einmal begeht!«
Und wenn es doch Sanftleben ist? Er ist gekommen, um dich zu holen. Weil du ein Mörder bist. Weil du ein …
»Genug davon!«
Greskegard wandte sich mit einer Bestimmtheit, zu der er sich zwingen musste, von den Fenstern ab. Er stapfte regelrecht auf die Tür seines Schlafgemachs zu, wobei er versuchte, die modrige Nachgiebigkeit zwischen seinen Zehen zu ignorieren.
Er war nicht verwundert, als er nach der Klinke griff und statt des erhofften Widerstands nur das Zwieback-Gefühl unter seinen Fingerspitzen spürte. Ein Ruck, und er hielt die rieselnden Reste der Türklinke in der Hand.
Bevor er das Erlebte verarbeiten konnte, ächzten die Angeln. Er spürte einen Lufthauch, vernahm ein merkwürdig ersticktes Krachen, und im nächsten Moment lag die Tür als undeutlicher Umriss vor ihm auf dem Boden im Korridor vor dem Schlafgemach. Wo Myrmidonen hätten Wache stehen sollen. Was sie aber nicht taten. Staub und Sporen tanzten in der Luft.
Fennek trat in den düsteren Korridor, spürte, wie sich die flirrenden Partikel aus Fäulnis auf seine Schleimhäute legten. Auch hier war niemand. Keine Leibwächter. Kein Gesinde. Keiner seiner Ratgeber.
Er hatte genug. Fennek Greskegard hatte nicht derart viele Hindernisse überwunden, so viel verloren – ob geopfert oder ermordet –, um so eine Posse über sich ergehen zu lassen.
»Genug Eurer Spielchen, wer immer Ihr auch sein mögt! Ihr wollt meine Aufmerksamkeit? Ihr habt sie! Gratulation! Was jetzt?«
Die Antwort erfolgte prompt. Knarrend und quälend langsam tat sich die Tür zu Fenneks Schreibstube auf. Dann riss sie aus den Angeln, fiel zu Boden.
Was immer das für eine Vision war – sie war extrem akkurat. Nach dem grausamen Ableben des Balthus von Fomor und seiner Söhne hatte Fennek andere Räume für sich beansprucht. Nur zu gern hätte er die prunkvollen Thronsäle und Schreibstuben des früheren Archonten übernommen, zumal Greskegard es als sein Recht ansah. Doch er hatte davon Abstand genommen. Der Knecht des Erdtitanen, ein Heimkehrer namens Ashavar, hatte die Menschen und den Stein auf lästerlich-grausame Weise miteinander verschmolzen. Es hatte Tage gedauert, bis sie schließlich gestorben waren. Es war den besten Arkanisten bislang nicht gelungen, die Leichen der Bedauernswerten aus den Wänden der Zitadelle zu lösen.
Fennek empfand keine Freude bei der Vorstellung, Dekrete zu erlassen oder Mahlzeiten zu genießen, während die schmerzverzerrten Fratzen der Männer wie Jagdtrophäen von den Wänden herabstierten.
Lediglich den Leichnam Balthus von Fomors hatten die Arkanisten entfernen und so herrichten können, dass ein Staatsbegräbnis machbar gewesen war.
Anonyme Tote in verschlossenen Särgen hatten bei der Aufbahrung seine Söhne verkörpert. Der Flügel, in dem sie sich tatsächlich befanden und aus dem Stein glotzten oder ihre Glieder aus den Wänden streckten, war für jeden außer Fennek gesperrt.
Die Tür zu seinem selbstgewählten Arbeitszimmer war es, die dort im Korridor lag. Dahinter ertönten Geräusche. Verstohlene Geräusche. Das Knarzen eines uralten Lehnstuhls, der unter der Last der Jahre und einer menschlichen Fracht ächzte. Wenn es denn eine menschliche Fracht war und nichts anderes.
Greskegards Puls raste, schien mit jedem Schlag gegen sein Brustbein nach oben entweichen zu wollen.
Er wollte fliehen.
Ein essigsaurer Geschmack füllte seinen Mundraum. Alles in ihm sträubte sich dagegen, sich dem zu stellen, was in dieser Sphäre von Verfall und Tod in seine Zitadelle eingedrungen war.
Oder eher: in die Zitadelle, wie sie Jahrzehnte, ja, Jahrhunderte nach Fennek Greskegard sein würde?
Es half nichts, er musste sich Gewissheit verschaffen. Tastend und darauf bedacht, in keine unangenehmen Dinge zu greifen oder zu treten, arbeitete sich der frühere Inquisitor bis zu seinem Skriptorium vor. Am Türrahmen angekommen, fasste er sich ein Herz. Er tat einen tiefen Atemzug und ignorierte all das Dreckzeug, das er dabei mit der Luft durch die Nase sog. Dann streckte er sich, nahm eine würdevolle Haltung ein und trat in den Raum.
Im Arbeitszimmer war es kaum heller als im Korridor. Doch dass er hier nicht allein war, konnte Fennek deutlich erkennen.
Wie erwartet war sein verzierter Stuhl ebenso verfault, aber auch besetzt. Eine Imitation von Mondlicht blinzelte durch Intarsien und Schnitzarbeiten in der Rückenlehne. Darunter saß eine mit einem Kapuzenumhang verhüllte drahtige Gestalt.
»Du?«, fragte Greskegard. »Das ist unmöglich! Du liegst im Kerker! Sauber fixiert!«
Die Gestalt hob den Kopf, sodass ihr Gesicht zu erkennen war. Greskegard hatte sich getäuscht. Der Fremde ähnelte dem Totenkaiser zwar, doch er sah zugleich auf subtile Weise anders aus. Es war offenkundig, dass dies ein Versuch war, wie der Nebelmacher zu erscheinen.
»Wer bei den Schlünden aller Höllen bist du?«
Der Fremde lächelte, entblößte eine knochenweiße Zahnsichel, so als hätte Fennek einen erstklassigen Witz erzählt, allerdings einen von der Sorte, bei der man breit grinste, statt laut loszuwiehern.
»Die Frage ist nicht, wer ich bin«, sagte der Mann. »Die Frage, die Ihr Euch stellen müsst, ist vielmehr, wer Ihr seid. Und was Ihr wollt.« Seine Stimme hatte etwas von einem Dolch, der durch ein kostbares Seidentuch fährt.
»Du weißt also, wer ich bin?«, fragte Greskegard und pfiff auf alle Höflichkeitsform. »Dann solltest du wissen, dass eine lange Karriere hinter mir liegt, bei der ich Freunden von kryptischem Geschwätz den Wert kurzer, prägnanter Informationen verdeutlicht habe.«
Er machte eine Drehbewegung mit der rechten Hand über seiner Linken. Die Flügelmuttern von Daumenschrauben. Irgendetwas sagte ihm, dass der mysteriöse Eindringling im Dunkeln blendend sah.
»Es gibt keinen Grund für Drohungen, Fennek Greskegard.« Der Besucher hob abwehrend die Hände. »Ich bin nicht hier, um Euch zu schaden. Ganz im Gegenteil. Ich möchte Euch ein Angebot unterbreiten.«
Das Wesen – von dem Gedanken, einen Menschen vor sich zu haben, hatte sich Greskegard bei dem Sichelgrinsen verabschiedet – legte die Fingerspitzen gegeneinander.
»Du weißt, wer ich bin«, sagte er. »Du kannst irgendetwas mit der Wirklichkeit meiner Gemächer anstellen. Und wie es der Zufall so will, hast du ein Angebot für mich.«
Das Geschöpf nickte. Noch immer hatte es nicht aufgehört, auf verstörende Weise die Zähne zu blecken. Es war nicht der Totenkaiser, sondern eher eine Parodie des Attentäters. Ein Zerrbild.
»Was bist du? Welche Sphäre der Älteren Dunkelheit hat dich ausgespien? Bist du ein Dämon? Oder gar Fae?«
»Nichts von alledem«, kam die Antwort ebenso amüsiert wie umgehend.
»Dann beweise mir, dass du zumindest halbwegs vertrauenswürdig bist. Ich sehe gern, mit wem ich spreche. Beseitige diese Finsternis. Sprechen wir in meiner Schreibstube. Der echten!«
»Ich bedauere, Archont Greskegard, ich kann Eurem Wunsch nicht nachkommen. Es liegt nicht daran, dass es mir an Höflichkeit mangelt, davon dürft Ihr ausgehen. Aber nehmt mich beim Wort: Euch droht hier keine Gefahr. Ich wünsche nur, mit Euch zu sprechen.«
»Wie ist dein Name, Kreatur? Da du meinen ja kennst, wäre es nur gerecht, wenn ich deinen erfahre.«
»Namen sind Schall und Rauch, Archont.«
Fennek stieß ein Schnauben aus. Seine Neugier war geweckt. Ein Wesen solch beträchtlicher Macht wandte sich an ihn. Der Gedanke lag nahe, dass es wegen seiner erwachten Geisteskräfte war. Wegen jener Macht, über die Fennek vom Templer Solus Terbast aufgeklärt worden war, als der Inquisitor in den Zellen des früheren Archonten geschmachtet hatte.
Ebenjene Kräfte, die ihm später den Weg in die Freiheit und auf den Thron geebnet hatten.
»Ich höre«, sagte Fennek. Er beschloss, sich diese Sache durch den Kopf gehen zu lassen. Welche Wahl hatte er auch? Wenn dieses Geschöpf sein Domizil auf solch verstörende Weise verwandeln konnte, zu was mochte es noch in der Lage sein?
»Ihr seid ein Mann, der nicht nur die Bedeutung, sondern auch den Wert der Macht versteht.«
»Es hat mich viel Zeit und Mühe gekostet, diesen Thron zu erringen, falls du darauf anspielst«, entgegnete Greskegard.
Das Geschöpf neigte leicht den Kopf.
»Doch falls du annimmst, dass Macht ein Selbstzweck ist, dem ich mich unterworfen habe, muss ich dich enttäuschen«, fuhr Greskegard fort. »Ich habe nur mein rechtmäßiges Erbe angetreten.«
»Dennoch, würdet Ihr nicht zustimmen, dass es kaum einen Ersatz für wahre Macht gibt? In gewisser Weise ist es mit ihr wie mit der Nachkommenschaft. Am Anfang ist man regelrecht voll Ehrfurcht, dann mag man das Gefühl ihrer Gegenwart nicht mehr missen, und nur die Wenigsten verlangt es nicht nach mehr.«
»Wirst du mich noch länger mit deinem Fundus an Allegorien langweilen, oder kommst du zum Punkt?«
»Gewiss. Wie würde es Euch gefallen, Eure Macht nicht nur zu bewahren, sondern sie immens zu steigern?« Der Besucher neigte das Haupt. Bewusst oder unbewusst, die Geste troff vor Spott.
»Lass mich raten, Kreatur: Du kannst mir diese Dinge bieten«, sagte Fennek. »Aber – welche Überraschung – sie haben ihren Preis. Doch bin ich bereit, ihn zu zahlen? Das ist die Frage.« Fennek stieß ein höhnisches Lachen aus. »Hast du irgendeine Vorstellung, wie oft ich derartige Phrasen in meinem Leben gehört habe? Mal abgesehen davon, dass du meine Vermutung, du seist dämonischen Ursprungs, damit nicht eben abmilderst?«
Der Besucher stand langsam auf. Er legte in einer gekünstelten Geste beide Handflächen auf den Schreibtisch. Sie ruhten dort wie die Kadaver öliger Spinnen.
Fennek musste dem Drang widerstehen, sich den nächstbesten schweren Gegenstand zu greifen und darauf einzuschlagen. Sie waren nicht unansehnlich, aber aus einem ihm unbekannten Grund erwachte in dem Archonten ein Ekel, den er kaum zu bändigen vermochte. Er musste an Morvens Hände denken, wie sie sich um seinen Hals legten …
»Ihr seid ein kluger, ein vorsichtiger Mann, Archont Greskegard. Ich bin überzeugt, Ihr werdet die richtige Entscheidung treffen, wenn Ihr das Angebot vernommen habt.«
Fennek schenkte sich eine Antwort. Nach außen hin zeigte er eine Mischung aus Erbostheit und abgeklärter Langeweile, doch in seinem Inneren rumorte es. Was war dieser Besucher? War er auf eigenen Wunsch hier? Oder auf das Geheiß eines anderen? Und wenn ja, auf wessen?
Solus Terbast hatte ihn gewarnt, dass hinter den Heimkehrern ohne deren Wissen noch eine andere Macht stand. War dies einer ihrer Vertreter?
Er ließ die Rechte ungeduldig kreisen, ein Mann in einer Machtposition, für den Zeit etwas ungeheuer Kostbares war. »Fahr schon fort!«
Der Besucher deutete eine süffisante Verbeugung an. »Wie Ihr wünscht, Archont Greskegard. Es geht um das, was in Euren Zellen schmachtet. Das Geschöpf, das einst den Namen Clach trug.«
»Der Totenkaiser.« Das also war es. »Was, beim Lichtfürsten und den Ränken der Sharis, willst du mit ihm?«
»Ihr haltet das Wesen gefangen, verstümmelt und fixiert. Es nützt Euch nichts mehr, Ihr seid am Ziel Eurer Wünsche und Träume. Ihr könnt es ebenso gut aufgeben.«
»Woher weißt du davon? Nicht einmal meine Myrmidonen sind eingeweiht, wer in den Tiefen meines privaten Kerkers schmachtet. Wer … was bist du?«
Das Wesen grinste erneut. Die verstörende, bleiche Sichel eines Mondes, aus der Dunkelheit unter der Kapuze gestanzt. »Nun beleidigt Ihr meine Intelligenz, Archont. Lasst mich nur so viel preisgeben: Jene, die ich repräsentiere, werden Euch und Euren neu gewonnenen Status nicht nur sichern, sondern Euch zudem sukzessive mit mehr Macht ausstatten. Mehr Einfluss und Befehlsgewalt, als Ihr Euch zu träumen wagt, darauf habt Ihr mein Wort.«
»Dein Wort.« Fennek ließ die Phrase noch einmal stumm über seine Zunge wandern. »Was sollte mir das Wort eines Geschöpfes wert sein, das meine Seele in ein solches Albtraumreich entführt? Eines Wesens, das ich nicht kenne? Geschweige denn, ihm vertraue?«
»Vertrauen«, höhnte der Besucher. »Sollte ein Mann in Eurer Position nicht über solch kruden emotionalen Konzepten stehen?«
»Würdest du mir dein Wort geben, wenn ich über diese Begriffe erhaben wäre?«, konterte Fennek.
»Gut gegeben. Also was sagt Ihr? Haben wir einen Handel?«
»Denkst du nicht, dass ein solches Unterfangen unter weniger makabren Umständen glaubwürdiger wäre?«, fragte der Archont. »Erfolgversprechender? Warum kommst du nicht bei Tag in meine Zitadelle? Ich halte nach dem alten Brauchtum jede Woche eine Audienz am Markttag ab. Warum bringst du keine Verträge? Besiegelungen irgendeiner Art?«
Der Besucher nahm wieder Platz und legte die überlangen Fingerspitzen erneut aneinander. Die Aura von spöttischem Humor durchzog nun ein Unterton der Geschäftsmäßigkeit.
»Du wirst zugeben müssen, dass solch ein Angebot wie deins selbst unter den besten Umständen fischig wirkt«, fuhr Fennek fort und brach zur Untermauerung seiner Worte ein Stück aus seinem Schreibtisch, ohne sich auch nur im Mindesten anstrengen zu müssen. Die Platte aus kostbarem Hartholz zerbröselte zwischen seinen Fingern zu dicken Flocken. »Und dies hier sind – sollte ich das tatsächlich noch sagen müssen – wohl kaum ideale Umstände. Ich weiß gern, mit wem ich einen Handel abschließe. Und ich lasse mich dafür ungern aus dem Bett reißen, nur um in … wo immer das hier auch sein mag, zu erwachen.«
»Ihr lehnt ab, Archont?«, fragte der Besucher. Unter der Frage harrte ein solch lauernder Unterton, dass ein Frösteln Greskegard so schlagartig überkam wie bei einem Sprung in ein Eisbad.
»Ablehnen würde nahelegen, dass ich über den Charakter und den Inhalt deiner Aussage bewusst nachgedacht hätte, Kreatur. Was nicht der Fall ist.«
»Was soll das heißen?«
»Ich habe mich kaum mit der inhaltlichen Ebene deiner Aussagen befasst, denn diese Vision von Verfall und Verdammnis ist mir Warnung genug. Sei ehrlich: Hältst du diese Fäulnis, die hier alles durchdringt, für eine gute Verhandlungsbasis?«
»Ihr begeht einen Fehler, Archont Greskegard«, zischte der Besucher. »Einen, dessen Tragweite Ihr nicht im Ansatz ermessen könnt. Wir sind keine Macht, die Ihr gegen Euch wissen wollt.« Seine Fassade höflichen Amüsements bröckelte nicht mehr – sie fiel mit einem Mal von ihm ab und gab die Dunkelheit darunter preis.
»Der Verfall, der uns umgibt …«, begann Fennek.
»Nicht mehr als ein Versprechen des Kommenden, dessen seid Euch gewiss. Ist diese Absage Euer letztes Wort?«
»Das ist sie. Ich habe mir den Weg zur Spitze nicht erkämpft, damit mir Dienstherren irgendwelche Brosamen hinwerfen, solange ich nur den artigen Köter gebe. Diese Zeiten sind vorbei.«
»Ihr seid ein Narr. Ein Wort von uns, und Ihr werdet …«
»Nichts werde ich!« Fennek erfüllte seine Worte mit dem Donner seiner vor einigen Monaten zum Leben erwachten Talente. Den Skarabäus, den er genutzt hatte, brauchte er nicht mehr, um seinen Willen zu fokussieren.
Jedes Wort, jede nuancierte Silbe traf den Fremden und die Vision mit der Kraft von Hammerschlägen. Putz und Schimmel rieselten von der Decke.
»Das war ein Fehler«, keuchte der Besucher.
»Ein Fehler deiner Meister war es, nicht um eine Audienz bei mir zu ersuchen, sondern mich an diesen Ort zu entführen. Und noch dazu einen Lakaien zu schicken, der eine Reaktion wie diese ja erzwingen muss! Wer immer deine Hintermänner sind, Kreatur, sie verstehen nicht viel davon, wie wir Menschen denken oder empfinden.«
»Ihr …«
Fennek hob gebieterisch die Hand und brachte das Wesen zum Schweigen. »Aber ihr größter Lapsus war es, in mir jemanden zu sehen, der sich erpressen und bedrohen lässt. Du gaukelst mir vor, ich hätte eine Entscheidungsgewalt in diesem Gespräch. Doch kaum folge ich meinem Instinkt und lehne ab, macht der Honig in deinen Worten Drohungen Platz. Ein schwerwiegender Fehler, Kreatur.«
»Du wirst von diesem Ort niemals entkommen, du anmaßender Wurm«, krächzte das Geschöpf.
»Oh, im Gegenteil«, sagte Fennek. »Ich werde diesen Ort kraft meines Willens vernichten, wenn mir der Sinn danach steht. Das hat mein Ausbruch eben unter Beweis gestellt.«
Er erwachte. Es gab keinen Übergang, alles geschah nahtlos. Fennek fühlte sich wie gerädert, als er sich unter einem Stöhnen erhob und den Blick durch das Schlafgemach schweifen ließ.
Seidene Kordelzüge, intakter Marmor. Vor drei Herzschlägen hatte er noch in einer fauligen Version seiner Heimstatt gestanden. Hier befand er sich wieder umgeben von all dem Luxus, an den er sich nur allzu rasch gewöhnt hatte.
»Was bei allen Höllen …?«, raunte er.
»Ich hoffe, Majestät haben wohl geruht?«, erklang die Stimme seines Leibdieners, der in diesem Moment eintrat.
»Könnte ich nicht behaupten, Atkins.« Mit einer hastigen Bewegung befreite sich Fennek von dem mittelgroßen Ozean aus Decken, Kissen und Überwürfen, mit denen seine Schlafstätte bedeckt war. Er sprang auf, hastete an dem überraschten Domestiken vorbei und steckte den Kopf zur Tür hinaus.
Zwei überraschte Augenpaare musterten ihn durch die Sichtschlitze zweier schwarzer Schaller. Die schwergerüsteten Myrmidonen verneigten sich so ruckhaft und synchron, dass es beinahe komisch wirkte. Zumal Greskegard lediglich ein Nachtgewand aus dünner Seide trug.
»Habe ich mein Schlafgemach heute Nacht verlassen?«, fragte der Archont.
»Nein, Eure Majestät«, sagte der Ranghöhere der Elitesoldaten. »Zu keinem Moment.« Seine Züge auf der unteren Hälfte seines Gesichts, die unter dem Helm hervorlugten, verhärteten sich. Wachsam spähte er in alle Richtungen. Zufrieden damit, dass Fennek keiner direkten Gefahr ausgesetzt war, wandte er sich seinem Potentaten wieder zu. »Ist etwas vorgefallen, Eure Majestät? Benötigen Majestät unsere Unterstützung?«
»Ich war nicht hier draußen? Nicht ein einziges Mal?«
»Eure Majestät haben Sein Gemach nach Beginn Seiner Nachtruhe nicht ein einziges Mal verlassen.«
Greskegard ließ seine verwirrten Leibgardisten stehen. Zurück im Schlafzimmer wusch er sich, bevor er sich von Atkins ankleiden ließ.
»Was liegt für heute an?«, fragte Greskegard beiläufig und ohne Interesse, um der nagenden Stille im Raum etwas entgegenzusetzen. Innerlich raste er, vermochte die Fülle seiner Gedanken kaum zu ordnen. Wer steckte hinter dieser Vision – wenn es denn eine gewesen war? Warum dieses Angebot?
Sicher, weil man ihn fürchtete, doch konnte das der einzige Grund sein? Fomor war zwar keineswegs in einem desolaten Zustand, doch voll verteidigungsfähig war die Penta längst noch nicht. Wenn man ihn fürchtete, warum versuchte man kein Attentat auf sein Leben?
»Vielleicht, weil man mich noch braucht. Mich und meine Kräfte«, raunte Fennek. Er hatte nicht vergessen, was Solus Terbast ihm damals gesagt hatte, als er in der Zelle geschmachtet hatte.
»Wie meinen Eure Majestät?«, fragte Atkins, der Fenneks Kommentar auf sich bezog.
»Audienztag. Wunderbar.« Fennek rollte mit den Augen. »Ich kann es kaum erwarten …«
Falls Atkins den Ton bitterer Ironie in Greskegards Worten vernahm, so war er weise genug, nicht darauf zu reagieren.
Der Weg von den Gemächern in den Thronsaal der Zitadelle war labyrinthisch und kostete einige Minuten. In den letzten Monaten, als das, was von der Kirche des Lichtordens übrig war, seine Ansprüche geprüft hatte, war kein Tag vergangen, an dem er nicht dort hatte sitzen müssen.
Jetzt zog es ihn nur noch bei Audienzen dorthin – oder besser: Andere nötigten ihn dazu, sich dort aufzuhalten.
Es waren schweigsame Minuten. Die meisterhaft ausgebildeten Myrmidonen der Svartbucht und der flüsternden Küste waren für viele unangenehme Talente berüchtigt. Das Führen erbaulicher oder zumindest halbwegs erträglicher Konversation war allerdings nicht ihre Stärke.
Etwas, das Fennek seit Sanftlebens unrühmlichem Ableben (Mord. Ich habe ihn ermordet.) mehr als alles andere fehlte.
Der barbarische Folterknecht war keine Leuchte der verfeinerten Konversation gewesen – das Bild, wie der Koloss mit abgespreiztem Finger zwischen adeligen Vetteln Tee schlürfte, stahl sich zwischen Greskegards Gedanken, und ein Kichern entfuhr ihm. Jedoch war Sanftleben ein formidabler Zuhörer gewesen, der sich selbst nur dann mitgeteilt hatte, wenn es etwas Bedeutsames zu sagen gab.
Was hatte ihn nur geritten? Er hatte in seinem Leben dermaßen viele abscheuliche Taten begangen, dass es ein Dutzend Mal für den Scheiterhaufen langte. Bereut hatte er nur drei davon: die traumatisierte Frau eines unbedeutenden Adeligen, den er selbst unter Drogeneinfluss regelrecht geschlachtet hatte, in den Kerker geschickt zu haben … dass er seine Nichte Morven ermordet hatte … und dass er Sanftleben das Schwert in den Hals gestoßen hatte.
Die Landadelige hatte der Archont mittlerweile begnadigt.
Für Morven hatte er nichts mehr tun können.
Und Sanftleben? Fennek hatte bestattet, was nach den Kämpfen in der Zitadelle von dem Koloss übrig gewesen war. Er hatte ihn nach der Sitte der Stämme, die den feisten Folterknecht einst verstoßen hatten, verbrennen und in alle Winde verstreuen lassen.
Der Hals wurde Greskegard eng, wenn er nur daran dachte, welches Opfer sein Zorn gefordert hatte. Die Reue legte einen Kragen aus Stahlseilen um sein Herz.
Der einzige echte Freund, den er je gehabt hatte, gestorben durch seine Hand. Sanftleben mochte eine abstoßende, plumpe Kreatur gewesen sein. Doch er war auch stets loyal gewesen, hatte es nie, nicht ein einziges Mal, schlecht mit dem letzten Spross der ermordeten Greskegards gemeint.
Für diese hündische Treue hatte der Koloss den ultimativen Preis bezahlt. Den Tod durch die verräterische Hand eines Mannes, den er verehrt hatte. Durch die Klinge seines Lebensretters.
Fennek konnte den schweren Stoßseufzer nicht unterdrücken, der sich aus seiner Brust stahl. Er spürte die Blicke seiner hinter und neben ihm schreitenden Myrmidonen. Sie waren voll Sorge um seinen Zustand, denn das gehörte zu ihren Aufgaben. Sie versuchten zu erkennen, ob der Laut von einer Vergiftung oder der Einflussnahme irgendeines Feindes auf ihren Schutzbefohlenen herrührte.
Bevor einer von ihnen fragen konnte, winkte Greskegard unwirsch ab. Er war regelrecht froh, als sie den kleinen Audienzsaal erreichten.
»Es mag nur ein Schwein sein, Eure Majestät, doch es ist alles, was uns geblieben ist«, sagte der Bauer mit so viel Inbrunst, wie er sich angesichts der einschüchternden Umgebung getraute.
Umringt von schwer bewaffneten Wächtern, teuren Wandteppichen und derartigen Unmengen an sonstigem Prunk wirkte der Bursche in seinem ungewaschenen Kittel nicht nur äußerst fehlplatziert, er beschmutzte den Ort regelrecht mit seiner Anwesenheit. Er war die Kakerlake auf der festlich gedeckten Tafel. Unwürdig kroch er auf einer Matte vor dem Thron aus halbblindem Marmor.
»Nur ein Schwein«, murmelte Fennek.
In seinem Handgelenk spürte er den dumpfen Schlag, als die Spitze seines Schwerts durch Sanftlebens Doppelkinn stieß. Die Augen des geprellten Bittstellers zu seinen Füßen waren Spiegelbilder jener verblüfften Überraschung, mit der Sanftleben auf das Schwert in seinem Hals reagiert hatte.
»Ein Schwein hat er verloren«, sagte der Archont. »Wir werden sehen, dass er zwei neue erhält.« Ohne weitere Erklärungen stand er auf und verließ den Saal.
2. Clach
Die Dunkelheit kam und ging. Ein stetiger Rhythmus ohne erkennbare Kadenz oder System. Der Wechsel hatte nichts mit dem sich wiederholenden Tanz von Nacht und Tag zu tun. Er war eher wie die Gezeiten, das Spiel von Ebbe und Flut – nur ohne deren Vorhersehbarkeit.
Und wie jemand, der ertrunken war, dümpelte der Totenkaiser auf der Oberfläche und versank immer wieder darin.
Die Phasen des Erwachens wurden von Desorientierung und einer unvertrauten Angst begleitet. Die Phasen der Dunkelheit und des Vergessens begrüßte Clach.
Sie erinnerten ihn an den Schlaf, den er schon seit – wie lange? Monaten? – nicht mehr gebraucht hatte. Lange bevor er hier gelandet war. Immer wenn ihn die Finsternis mitriss und an ihren schattigen Busen presste, spürte er Frieden, fühlte Ruhe einkehren.
Erwachte der Totenkaiser und dämmerte aus den Gestaden dieses seligen Vergessens empor, erwartete ihn die Realität. Kälter, unnahbarer und von mehr Schmerzen beherrscht, als es sein Dasein zu Lebzeiten je gewesen war. Der Totenkaiser war ein Gefangener.
Es hatte damit begonnen, dass er gestorben war. Nicht allegorisch, nicht metaphysisch, sondern wahrhaftig gestorben. Das Problem war, dass in der Dämmerwelt nicht alle Toten tot blieben. Einige kamen zurück.
Sie nannten sich Heimkehrer, waren die Kinder der Erzmagi. Zaubermächtige Halbgötter eines besseren Zeitalters, vor den Tagen des Nebels. Und sie dürsteten nach Rache. Ursprünglich war Clach zurückgekehrt, um diese Verschwörung aus dem Jenseits zu verfolgen und ihre Meister, die Titanen, zu vernichten.
Beim Kampf um die Zitadelle der Penta Fomor war er verwundet worden. Er hatte die Essenz des vierarmigen Giganten attackiert, den Wirtskörper der Titanenseele tief im Inneren des Gottriesen. Clach hatte Ashavar, den Sohn des Erzmagiers Vortigern, verschlungen – und damit die Essenz des Titanen. Der Gottriese war zusammengebrochen und hatte einen Teil der Penta unter sich begraben.
Doch die Anwandlungen des Totenkaisers von Altruismus und Heldenmut blieben nicht unbestraft. Die Überflutung mit der Macht eines Gottriesen hatte ihn in die Besinnungslosigkeit gestürzt. In ein Koma, das sich sein alter Feind Fennek Greskegard zunutze gemacht hatte.
Der Inquisitor hatte Clach Arme und Beine abgetrennt und ihn mit den magischen Nadeln des Zauberers Dirth gelähmt. Danach hatte er den Attentäter in die Tiefen der Kerker unter der Zitadelle von Fomor verfrachtet.
Fennek war jetzt Archont der Penta, so viel hatte Clach seinen Äußerungen entnehmen können. Anfangs war der frischgebackene Potentat noch im Kerker des Attentäters aufgetaucht. Er hatte den Totenkaiser verhöhnt, das Ende ihres Katz-und-Maus-Spiels gefeiert.
Jetzt, da Fennek Greskegard auf dem Thron einer der Pentae, der letzten fünf Großstädte der Dämmerwelt, saß, schien sein Interesse an Tändeleien merklich abgenommen zu haben. Clach hatte keine Vorstellung davon, wann Seine Majestät das letzte Mal hier unten gewesen war.
So blieb Clach, der sich sein Leben lang – und im Tode – nur auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen hatte, allein mit seinen Gedanken. Es war keine angenehme Erfahrung für den Meisterattentäter.
Zwar war er an das lange Warten gewöhnt wie kaum ein Zweiter. Ein Assassine musste Monate, manchmal Jahre aufwenden, um den entscheidenden Schlag gegen eine Zielperson zu führen. Diese Untätigkeit war jedoch etwas anderes. Sie ging nicht nur mit einer nie gekannten Hilflosigkeit einher, sondern ließ jemandem, der es gewohnt war zu handeln, unerwünscht viel Zeit zum Nachdenken.
Es machte einen Unterschied, ob man ein Opfer beschlich, sich monatelang als Mitglied des Gesindes ausgab, nur um unvermittelt zuzuschlagen, oder ob man von magischen Nadeln durchbohrt wie ein exotischer Schmetterling auf einem Marmorquader verschimmelte. Noch dazu durch Pochen und Phantomschmerzen in den Stümpfen fehlender Gliedmaßen daran erinnert, dass man verkrüppelt, in einen Rumpf verwandelt worden war.
In seinem Zustand konnte Clach diese Wunden unmöglich regenerieren. Sein Körper war zu erstaunlichen Dingen fähig. Vor allem seit die Seele eines Gottriesen in seiner Brust röhrte wie ein nie abkühlender Schmelzofen. Aber eine Handvoll verzauberter Nägel und der Allmachtsanspruch eines Autokraten schoben auch solchen Gewalten einen Riegel vor.
Clach hätte geschnaubt, wäre er in der Lage gewesen, auch nur einen Laut von sich zu geben. Fennek war auf Nummer sicher gegangen und hatte eine der Nadeln in der Kehle des Totenkaisers verankert. So war an Sprechen nicht zu denken. Sollte Clach den Verstand verlieren, wäre er nicht einmal zu Selbstgesprächen fähig. So blieb ihm nur abzuwarten, zu grübeln und wegzudämmern. Nur um dann immer wieder zu warten. Ein Teufelskreis.
Als er diesmal an die Oberfläche zurücktrieb, war etwas anders, das spürte er. Da war ein äußerer Impuls. Etwas, das ihn geweckt hatte.
Die Finsternis barg für die Augen eines Heimkehrers keine Geheimnisse. Wo die Augen der Menschen versagten, sah der Totenkaiser blendendes Weiß und Abstufungen von Grau. Die Farben waren schon lange einem Prisma monochromer Abstufungen gewichen.
Clach sondierte die Kerkerwände, das glühende Leben des Mooses an der Decke, die Auren der Asseln und Hundertfüßer, die darin hausten. Die Präsenz des Totenkaisers zog alles an, was in der Dunkelheit wimmelte.
Er blickte unverwandt auf den nackten Fels, der schon viel zu lange die einzige Form von Himmel war, die den Attentäter überspannte. Doch in Clachs Augenwinkel erstrahlte ein machtvolles Leuchten. Dort verharrte jemand, dessen Seele vor unterdrückter Kraft loderte. Fennek Greskegard.
Wie lange steht er schon dort und beobachtet mich?
»Wir sind weit gekommen, du und ich«, sagte Greskegard.
Spürte er, dass Clach erwacht war? Der frischgebackene Potentat erhielt keine Antwort. Das hielt den einstigen Inquisitor nicht davon ab fortzufahren.
»Ich wette, du sinnst auf Rache. Stell dich hinten an.«
Was willst du hier, altes Reptil? Du hast doch, wonach es dich verlangte.
»Die anderen sitzen mir im Genick. Wusstest du das? Das Gefüge der Pentae und so weiter. Alles war bis zu Fomors Erwachen im Gleichgewicht. Damit hat es sich nun. Unser Export von Leder und Häuten leidet unter Engpässen. Die anderen Archonten halten mich für einen Emporkömmling.«
Ein Stoßseufzer. Zähneknirschen. Das Auflodern unterdrückter Wut ließ Fennek noch heller erstrahlen.
Clach hätte den Blick des Archonten gern erwidert, ihn spüren lassen, wie wenig ihn das Thema interessierte. Doch er bezweifelte, dass der ehemalige Inquisitor im Dunkeln sehen konnte, auch wenn er im Kampf auf Fomors Rücken übernatürliche Fähigkeiten offenbart hatte. Und zwar ganz ohne seinen arkanistischen Skarabäus.
Clach hegte keinen Zweifel daran, dass der Archont mittlerweile begriffen hatte, dass er ein Magier war. Doch Fenneks magische Kraft schien auf Befehlserteilung und das Brechen des Willens seiner Gegner beschränkt.
»Ja, einen Emporkömmling schimpfen sie mich! Mich! Den Mann, dem dieser Thron zusteht. Es scheint, wir mussten beide unsere Lektion lernen, Totenkaiser. Manchmal ist ein Thron nur ein Stuhl, und die Verpflichtungen hören nicht auf, wenn man ihn innehat, sie nehmen urplötzlich zu. Und manchmal ist der Tod eben nicht die ultimative Grenze. So wie in deinem Fall.«
Fennek trat näher, bis die Spitzen seiner Schuhe an den Steinblock stießen, auf dem der Totenkaiser lag. Sein Gesicht schwebte direkt über dem von Clach. Hätte er zumindest das Haupt bewegen können, es wäre dem Attentäter ein Leichtes gewesen, Fennek den Kehlkopf mit den Zähnen herauszureißen.
Doch auch wenn der Totenkaiser es vermocht hätte, es hätte wenig Sinn gehabt, solange er nicht frei war, keinen Weg gefunden hatte, sich seiner Fesseln zu entledigen.
»Es würde dir in dieser Lage nichts nützen, mich zu töten, nicht wahr?«, sagte Greskegard, als hätte er Clachs Gedanken gelesen. Sie kannten einander zu lange. Zu gut. »Wir sind tief unter der Zitadelle, in Bereichen noch unter den Kerkern für Ketzer und magiebegabte Gefangene. Ein Ort, den nur das Blut eines Archonten öffnen kann. Das behaupten zumindest meine Arkanisten. Wenn ich hier sterbe, wenn mein Herz an Altersschwäche versagt, ich auf den Stufen ausrutsche und mir den Hals breche oder du mich tötest, wirst du auf ewig hier festsitzen, gefangen mit deinen Gedanken. Und glaub mir, ich weiß, wie schlimm das ist.«
Er strich im Dunkeln über die Brust seines prunkvollen Brokatmantels. Clach sah, dass Fennek unbewusst an Fusseln zupfte, auf einen Punkt in der Finsternis neben sich starrte.
Er sucht Sanftleben. Deine Reue kommt etwas spät, alter Fuchs. Hättest ihm kein Schwert in die Strosse rammen sollen. Töten hat es so an sich, dass es unumkehrbare Konsequenzen zeitigt. Meistens jedenfalls, dachte der Totenkaiser grimmig.
Fennek wandte sich ab, ging mit hängenden Schultern davon, bis nur noch ein schwacher Glanz seiner Macht von der Tür an die Augen des Totenkaisers herandrang. Clach konnte hören, wie die Schuhsohlen des Inquisitors über massive Steinplatten schlurften, bis er sich im Türrahmen ein letztes Mal umdrehte.
»Wenn sie weiter in diesem anmaßenden Ton zu mir sprechen – zu mir, nicht mit mir –, werde ich Verwendung für dich haben. Ich habe jetzt, was ich brauche. Und du alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Du könntest mich vernichten, wenn ich dich freiließe. Es wäre dir ein Leichtes, das weiß ich. Aber was bist du noch ohne mich? Die Welt hat sich verändert, Totenkaiser! Die Dienerin deiner Göttin ist fort, die Kirche des Lichtfürsten hat einen Schlag erlitten, nun, da ihr Hochtempel nur Asche und Staub und der Glaube der Menschen in allen Pentae schwer erschüttert ist. Gemeinsam könnten wir mehr erreichen denn als Feinde.«
Er ging – und mit ihm Clachs Bewusstsein.
Als der Totenkaiser dieses Mal erwachte, überkam ihn eine erneute Phase der Furcht und der Verwirrung. Gefühle, die er zu Lebzeiten nicht gekannt hatte. Seit Clach ein Heimkehrer war, hatten diese Befindlichkeiten mehr und mehr Raum beansprucht. Er wusste noch nicht zu sagen, ob ihm dieses fremdartige Empfinden unrecht war. Doch in Ludhov hatte es ihn in arge Bedrängnis gebracht.
Er hatte einem wehrlosen Kind gegen die kannibalischen Krieger eines Diadochen zur Seite gestanden. Und sich damit erst dem Zauberer Dirth und der Gefangenschaft ausgeliefert. Clach war nur mit knapper Mühe und Not entkommen.
Anatomie und Giftmord waren zwei Kerndisziplinen seiner Zunft. So wusste der Totenkaiser, dass Gefühle und Emotionen auf dem Gefüge von Säften und Dünsten im Körper beruhten. Im Tod hatte Clachs Körper jedoch die Fähigkeit verloren, Blut und Säfte zu transportieren. In seinen Adern stockte eine schwarze, teerartige Masse. Die Essenz der Titanenmagie. Vom Ungleichgewicht der Vorgänge in einem menschlichen Gehirn befreit, entwickelte der Totenkaiser jedoch als Nicht-Toter schleichend jene Gefühle, die ihm von Kindesbeinen an versagt und stets ein solches Geheimnis für ihn gewesen waren.
In den Phasen seiner Desorientierung überkamen ihn Furcht und Selbstzweifel. Wäre er in dieser Lage gewesen, hätte er sich anders entschieden? Hätte er Fahlsangs Drängen, als Heimkehrer in die Dämmerwelt zurückzukehren, nicht stattgegeben?
Er schalt sich einen Narren. In der Unterwelt von Scathach wäre Clach auf der Strecke geblieben und von den ewig hungernden Titanen auf die gleiche Weise verschlungen worden wie jeder, der das Pech hatte zu sterben. Er war auf eine pervertierte und ganz und gar unmenschliche Weise noch am Leben. Ein Heimkehrer. Nicht-tot. Alles, was er tun musste, war, sich zusammenzureißen und durchzuhalten.
Kontrolle. Disziplin.
Er würde einen Weg aus diesem Kerker finden. Er hatte sich sein Leben lang – und darüber hinaus – auf seine Fähigkeiten, seine Ausbildung und sein Geschick verlassen können. Warum sollte es diesmal anders sein? Alles, was er tun musste, war durchzuhalten.
Ich habe mich Ormgair Steinviper anvertraut, habe mich geöffnet, einem anderen Menschen erlaubt, mir zur Seite zu stehen. Hat mich ja weit gebracht …
Aber es war nicht Ormgairs Schuld, dass der Totenkaiser gefangen worden war, das musste Clach sich eingestehen. Nach dem, was er sich aus Fenneks machttrunkenen Monologen bei dessen Besuchen bei ihr unten zusammenreimen konnte, war der Ambossbarbar Geschichte, beim Kampf gegen Ashavars Marmorgestalt und dem Kollaps des Gottriesen tödlich verletzt und in die Tiefe gestürzt.
Ihn hat unsere Zusammenarbeit ebenfalls weit gebracht, dachte Clach und spürte den Stich der Verbitterung.
War es nicht der Totenkaiser gewesen, der den alten Wolf im Stich gelassen hatte, um Pavosa Moreno in Argas zu stellen? Es war stets so gewesen, dass er allein am besten arbeitete. In diesem Fall, gegen eine solche Übermacht, wäre eine Allianz nicht das Schlechteste gewesen. Ormgair hatte das erkannt. Doch Clachs Zaudern, sein Misstrauen gegenüber den Menschen hatte diesen Verbündeten, diesen aufrichtigen Mann, das Leben gekostet. Ein seltsames Gefühl von Reue stahl sich zu Clachs widersprüchlichen Empfindungen.
Den Totenkaiser hatte sein Vorgehen hierhergebracht. Hätten sie Fennek angegriffen, wie Ormgair es vorgehabt hatte, sie hätten sich gemeinsam Ashavar und seiner nicht-toten Brut zuwenden können. Stattdessen hatte Clach auf seinem Alleingang bestanden – und wie Fennek ihm mitgeteilt hatte, war er nun zum ersten Mal absolut auf sich gestellt. Früher hatte es zumindest den Tempel gegeben. Damit war es vorbei.
Die Todesbotin war fort, der Tempel durch Greskegard und dessen Spießgesellen geschleift, Clach bewegungsunfähig und zur Tatenlosigkeit verdammt in einem arkanistisch abgeschirmten Kerker gefangen.
Er wollte flüchten. In seiner Brust brauste eine unstoffliche Macht, die das Vorstellungsvermögen überstieg. Doch er konnte sie nicht einsetzen, und so verrottete er hier.
Sicher kannst du hier liegen und in Rückschau mit deinem Schicksal hadern. Du hast nicht nur allen Grund dazu, sondern dafür alle Zeit der Welt. Zumindest so lange, bis die überlebenden Heimkehrer dich hier aufspüren – oder die Totenhand. Es wird ein schönes Wiedersehen für deinen alten Freund Òrdag und dich. Wenn auch ziemlich einseitig. Nach dem, was du mit ihnen gemacht hast, werden sie sich Zeit mit dir lassen. Aber davon hast du hier unten ja genug …
Clach kämpfte gegen die aufkeimende Panik an, die Verzweiflung, und suchte den Strom der ihm unbekannten Gefühle niederzukämpfen. Er griff nach Fomors Reserven, bündelte seine Willenskraft. Wenn die Heimkehrer – und somit er – die Erben der Magick der Erzmagi waren, musste es einen Weg geben, diese Kräfte zu lenken. Eine Möglichkeit, Dirths Nadeln zu neutralisieren.
Clach versenkte sich in sich selbst, tauchte in die Dunkelheit in seinem Inneren ein. Er verband sich mit ihrer Essenz, wie er es getan hatte, als er sein Pferd Stille erweckt und sich aus Dirths Gefangenschaft in Ludhovs Kerkern befreit hatte.
Es half nichts. Gegen die Macht einer Nadel war er angekommen, doch ein Dutzend davon in seinem Leib hielt ihn komplett immobil. Mehr noch. Als die arkane Magie der Artefakte seine Versuche registrierte, steigerte sie den Druckschmerz ins Unerträgliche. Er kam sich vor wie ein neugeborenes Kätzchen, das mit einem Mühlstein zu Tode gequetscht und gleichzeitig dabei ertränkt wurde.
Als der Totenkaiser spürte, dass es nicht mehr ging, beendete er seine Anstrengungen. Doch Aufgeben kam nicht infrage. Nicht mehr. Nicht hier. Wenn er sich schon nicht befreien konnte, so musste er für die Eventualität gerüstet sein, dass jemand anders den Fehler begehen würde, seine Fesseln zu lösen. Früher oder später.
Clach begann damit, Konzentrationsübungen durchzuführen, mit denen er seit den ersten Tagen der Ausbildung gelernt hatte, seinen Geist zu klären. Wie er selbst gesagt hatte: Er hatte alle Zeit der Welt. Er würde diese Zeitspanne und seine Unsterblichkeit nutzen, um das zu tun, was er am besten konnte: Pläne schmieden und sich mit der ererbten Geduld des geborenen Killers vorbereiten. Auf den Zeitpunkt, wenn der Sirenengesang seines Handwerks, seiner Berufung, erklang. Sobald er freikam, würde das Töten beginnen.
3. Ormgair
Er hatte die Steppe anders in Erinnerung. Die Heide, das nasse Gras, die Form der Felsen, die Art und Weise, wie sich der Tau in glitzernden Facetten auf alles legte. Es mutete unwirklich an. Die Gerüche schenkten ihm einen Frieden, den er aus Geschichten kannte. Empfunden hatte er ihn nie, doch er wusste instinktiv, was dieser Frieden bedeutete.
»Das ist es«, sagte Ormgair Steinviper. »Ich bin tot.«
Er hatte keine Vorstellung, wie er hierhergelangt war, wann der Übergang stattgefunden hatte. War er im Sturz gestorben? Den Wunden erlegen, die Ashavar ihm beigebracht hatte? Oder war es der Aufschlag gewesen?
Er erinnerte sich dunkel an die Kopfsteine der Stadtling-Enklave Fomor. Wie sie auf ihn zugerast waren.
Dann war da der Acair gewesen, der Vaterfluss der Steppen, von den Wassern des Sees Saoghal gespeist. Er floss an dieser Stelle durch die Penta. War Ormgair hineingestürzt? Ertrunken? Oder lebte er doch noch?
Wie er so dastand, den milden Wind auf der Haut, der ihm die Bartzöpfe zauste, ging Ormgair auf, was anders war. Auf den ersten Blick sah er aus wie immer, wenn er sich so betrachtete. Doch das stimmte nicht. Seine Hände waren makellos, die Haut nicht runzelig. Sie war frei von Altersflecken.
Er ging einige Schritte zu einer Pfütze stehenden Wassers. Studierte seine unscharfe Reflexion. Er war jung, stand in der Blüte seiner Kraft. Der Mann, der er gewesen war, bevor die beißende Krankheit seine Knochen verdreht und seinen Körper gekrümmt, bevor das Alter sich seiner bemächtigt hatte.
Bei dem Anblick musste Ormgair unwillkürlich grinsen. Er hatte vergessen, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der auch er stattlich ausgesehen hatte. Oder hatte es diese Zeit nie gegeben? War er im Tode zu einem Idealbild seiner selbst geworden?
Langsam wandte er sich zum Gehen, blickte über die Heide, in deren Zentrum er stand. Eine endlose Weite fliederfarbenen Idylls, das vom Wind in sanfte Schwingungen und hypnotische Muster versetzt wurde.
Die Heide flüsterte, rauschte unentwegt. Ormgair schloss die Augen, sog das Gefühl dieses Friedens ein. Er erinnerte sich verschwommen der Dinge, die ihn an diesen Ort gebracht hatten – wenn es denn ein Ort war. Doch sie bedeuteten nichts. Nicht mehr.
Gemächlichen Schrittes begann er zu gehen, verfiel in einen leichten Trab, um letztendlich zu rennen. Er genoss das Gefühl, wie seine Lunge brannte, wie das Leben durch seine Adern rauschte, der Schweiß auf seiner Stirn im kühlenden Gegenwind verdunstend, der seinen Körper erquickte.
Diese Ausdauer! Diese Kraft!
Er machte erst halt, als er ausgepumpt war. Er musste Meilen gelaufen sein, ohne es gemerkt zu haben. Er war nicht einfach nur jünger, er schien eine Inkarnation von Jugend und Stärke geworden zu sein. Wie eines der Wappentiere der Stadtlinge, wie ein Hirsch oder Wolf, mit einem Vorrat nie versiegender Ausdauer gesegnet, die sich nach einer kurzen Pause regenerierte.
Es erinnerte an den Effekt der Waffe. Des Schwertes. Morvens. Wo war sein Schwert?
Als er sich umblickte, ging ihm auf, dass er einen Hügel erklommen hatte. Aus einigen Mannshöhen blickte er auf das ihn umgebende Idyll.
Erst da wurde ihm das Offenkundige bewusst. Es gab keinen Nebel, kein Zwielicht. Der Himmel war von einem satten Blau, das ihn an die Geschichten seines Großvaters erinnerte. Von einem Ort, den dieser »Meer« genannt hatte.
Stattdessen schien der Nebel dort oben zu hängen, am Firmament. In Zusammenballungen, die etwas vom Inhalt geplatzter Röhrichtkolben hatten, trieb das, was Ormgair für den Nebel hielt, vor der azurblauen Endlosigkeit dahin.
Sahen Wolken ohne den Nebel so aus? Sie überquerten Berge und Täler am Horizont im Osten. Die strahlende Sonne, die nichts von der bleichen Münze an sich hatte, die der Dämmerwelt nur einen Abglanz von Licht spendete, ließ diese Wolken Schatten werfen. Gemächlich wanderten sie über die endlose Heide.
In diesem Moment sah er die Gestalt. Sie hob sich trotz der unfassbaren Entfernung deutlich von der sie umgebenden Landschaft ab. Es war eine Frau. Ihr Körper war massig und doch von einer kämpferischen Ausstrahlung, die das Fett Lügen strafte. Ormgairs Herz tat einen Satz. Er kannte diese Frau. Mehr noch, er hatte sie geliebt – bevor Fennek Greskegard und sein Knecht, der verräterische Ambosskrieger Sanftleben, sie in ihrer Taverne getötet hatten. Um ihn, Ormgair Steinviper, zu bestrafen.
Es kam kein Zorn in ihm auf. Nicht mehr. Nicht hier. In diesem Seinszustand waren Leben und Tod unbedeutend geworden. Sie wartete dort am Horizont auf ihn. Die Wirtin, die ihn in seiner elenden Stunde aufgebaut hatte. Damals, nachdem der Totenkaiser ihn im Stich gelassen hatte. Die ihm seinen Zweck gezeigt hatte.
»Branka«, raunte Ormgair.
Trotz der Entfernung hatte die Gestalt ihn gehört. Sie winkte ihm einladend zu. Wartend. Sie würde ihn mit sich nehmen in dieses Land, in dem nichts als Frieden und Glückseligkeit auf ihn wartete. Dinge, die er früher verabscheut und verlacht hätte, nach denen er sich aber nun stärker sehnte denn je. Ein unerklärliches Gefühl, eine Mischung aus unerträglicher, den Bauch kitzelnder Freude und der Wehmut eines letzten Abschieds, schäumte in ihm über.
»Das ist sie nicht, das weißt du, oder?«
Die Stimme war ihm fast ebenso vertraut wie Branka, auch wenn er ihre Besitzerin weitaus weniger lange gekannt hatte.
»Bist du es wirklich?«, fragte Ormgair.
»Ich bin mir ziemlich sicher«, sagte Morven. »Sicherer noch, als ich es zu Lebzeiten war. Mittlerweile weiß ich, wer ich bin. Was ich bin.«
Langsam drehte sich Ormgair um. So als könnte eine zu hastige Bewegung die Seifenblase, den Traum, dass sie lebte, zerplatzen lassen.
Morven lächelte ihn an. Ein strenges Gesicht mit hohen Wangenknochen, ein etwas zu dünner Mund, blitzende Augen eingerahmt von Haaren mit der Schwärze von Rabenfedern. Sie schien in einem sachten Licht zu glimmen, die Strahlen der Sonne glitzerten auf ihrer Plattenrüstung, tanzten auf dem polierten Stahl wie auf der Oberfläche der sommerlichen Seen, die sie beide umgaben. Ihr Waffenrock war so blendend weiß, dass ihm der Anblick Tränen in die Augen trieb.
»Hat das Schwert dich freigegeben?«, fragte Ormgair. »Konntest du deinen Kerker verlassen?«
»Das alles hier ist nicht wirklich, ist dir das klar?«, wiederholte sie. Morven machte ein betrübtes Gesicht. »Es ist, was sie uns sehen lassen, damit wir uns ohne Widerstand in ihren Schlund stürzen.«
Ormgair stutzte. »Wen meinst du damit?«
»Die Titanen. Oder wie immer diese Wesen heißen mögen. Bevor das Schwert mich rief, als Onkel Fennek meine Kehle durchschnitt, stürzte ich ihnen ebenso entgegen wie du jetzt. Mein Großvater stand dort, wo du Branka siehst. Nicht in dieser Steppe, aber an einem Ort, der mir etwas bedeutet hat. Er rief mich. Verkündete, wie stolz er auf mich sei, und streckte mir die Hand entgegen. Ich wollte nach ihr greifen. Alles in mir schrie danach. Doch eine andere Macht zog an mir, zog mich so sicher zu Fennek Greskegard zurück, als wäre ich eine Ertrinkende und er der Strudel. Es war schrecklich.«
»Da hat die Klinge dich fortgerissen und in sich eingesperrt …«, hauchte Ormgair.
Der elegische Frieden in ihm, das Gefühl, nach all den Qualen und all dem Leid endlich zu Hause angekommen zu sein, wich einer Vorahnung. Blankes Grauen breitete sich in ihm aus. Es kroch auf Klauenhänden aus seinem Unterbewusstsein hervor und bahnte sich mit Macht den Weg in sein Denken.
»Das alles ist eine Lüge?«, fragte der alte Wolf schließlich. Seine Stimme drohte zu brechen.
Morven nickte. Der trauervolle Ausdruck auf ihrer Miene sprach Bände. Ormgair fand ihn unerträglich. »Nichts davon ist echt. Es dient nur dem Zweck, dich einzulullen, deine letzten Skrupel, deine unbewussten Ängste vor dem Tod zu lindern, damit du freiwillig weitergehst. Eine perfide Illusion.«
»Was bedeutet, dass ich noch lebe. Wie kann das sein? Ich bin gestürzt. Und ich weiß noch genau, dass ich deine Klinge – dass ich dich! – oben auf der Spitze der Zitadelle fallen ließ, als Ashavar meinen Körper verheert hat.«
»Das hält mich nicht davon ab, dich an diesem Ort aufzusuchen. Im Moment sind wir uns ähnlich. Ich bin einst gestorben und in einer Zwischenwelt im Inneren des Schwertes geblieben. Du treibst ebenso in einer Zwischenwelt. Die Entscheidung, was mit dir geschieht, obliegt am Ende dir – ich bin nur hier, um dich zu warnen.«
Sie deutete zum Horizont.
»Das dahinten ist nicht die Branka, die wir beide kennen. Und dort wartet nicht das Firmament auf dich, an das du dein Leben lang geglaubt hast. Dort gibt es nichts als ewige Dunkelheit und Vergessen.«
Morven schlang die Hände um den Körper, und Ormgair fröstelte. Es kam nicht oft vor, dass man einer Toten dabei zusah, wie sie sich fürchtete.
»Ich kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben«, sagte er. »Ich weiß, dass ich in den Tod gefallen bin.«
»Genau genommen«, sagte die junge Frau, »bist du in den Acair gestürzt. Du hast dir bei dieser Höhe auf der Wasseroberfläche etliche Knochen gebrochen. Weil du auf mich verzichten musst, brauchen deine Verletzungen Wochen zum Heilen. Keiner deiner Leute weiß, ob du überleben wirst oder nicht.«
»Wieso bin ich nicht schon längst tot?«, fragte Ormgair.
»Aus zwei Gründen«, sagte Morven. »Erstens bist du zäher als die meisten Menschen. Das liegt nicht nur an deiner Art oder dem Volk, dem du entstammst. Du trägst seit vielen Wochen das Schwert. Es hat uns auf eine Weise verändert, die wir beide nicht einmal im Ansatz begreifen. Dich und mich.«
Ormgair antwortete nicht. Er kehrte Morven den Rücken, ließ seinen Blick über die Landschaft schweifen und richtete ihn dann auf den Punkt am Horizont, an dem Branka stand. Oder was immer es war, was sich dort aufhielt.
Sie schwiegen.
Der Wind rauschte, die Heide flüsterte. Der Geruch der Brache, der sachte Hauch des sterbenden Sommers, erfüllte ihn auf einmal mit einer sehnsüchtigen Wehmut. Als er sich zu Morven umdrehte, ging ihm auf, woran ihn ihr Anblick erinnerte. Die Haare im Wind, der Wappenrock und der blitzende Stahl.
»Wie eine der Baen’sidhe«, sagte er.
»Hmm?«, fragte Morven.
»Du siehst wie eine der Maiden aus, die die Titanen senden, um die Krieger nach dem Schlachtentod an das Firmament zu führen. Dorthin, wo glorreiche Kämpfer ewig leben.«
»Das ist, woran ihr Ambosskrieger glaubt? Für so etwas zieht ihr in die Schlacht? Werft euer Leben, die Zeit mit euren Familien weg?«, fragte sie.
Trotz des Unglaubens, des Abscheus, der deutlich darauf zu lesen stand, fand er ihr Gesicht berückend. Es hatte etwas von der Landschaft, die sie beide umgab. Morven war keine klassische Schönheit, doch wie sie so dastand, spiegelte sie alles wider, wofür er gelebt hatte.
Sie war Zoll für Zoll ein Huskarl der Titanen, der noblen Götter des Krieges, so wie er sie sich zeitlebens vorgestellt hatte.
Eine Erwählerin der Toten.
So dachte er, obwohl sie ihm gerade aufgezeigt hatte, für welch hohle Phrasen er sein Leben lang gekämpft hatte. Und wie absurd es war. Er hatte sein Dasein geführt, um schließlich eines gewaltsamen Todes zu sterben.
»Dieses Denken hat lange mein Leben bestimmt«, sagte Ormgair. »Es hat mich zusammengehalten, mich durch die schwersten Zeiten getragen. Das – und mein Verlangen nach Rache an den Mördern meines Stammes.«
»Du bist noch nicht fertig, noch nicht am Ende«, erwiderte sie.
»Du hast es selbst gesagt: Ich liege im Sterben.«
Ormgair ging in die Hocke. Er riss etwas Heidekraut aus, bis er Boden sehen konnte. Er wühlte die Erde auf, zerrieb sie zwischen den Fingern und roch daran wie schon Tausende Male zuvor. Der alte Barbar studierte die Krume, die unter seinen Fingern zerbrach, spürte die feinen Wurzeln. »Was ist das zweite?« Er hob den Blick, blinzelte in die Sonne und betrachtete Morvens Gesicht.
Sie zog eine Augenbraue hoch, und er fügte hinzu: »Du hast gesagt, dass mich zwei Dinge am Leben halten. Was ist das zweite?«
Sie blieb ihm die Antwort schuldig. Nun war sie es, die den Blick auf den Horizont richtete. Ormgair erhob sich, kniff die Augen zusammen und folgte ihrem Beispiel. Er konnte sehen, dass etwas mit dem Horizont geschah. Die Welt begann sich aufzulösen, zu zerfasern. Schwerelose Flocken stiegen auf.
»Sie wissen, dass ich hier bin«, sagte Morven. »Sie verlieren die Geduld mit dir, weil ihnen aufgeht, dass du dich nicht entschieden hast. Sie wollen dir den Rückweg abschneiden.«
Sie hob den Finger und deutete auf die Stelle des Horizonts, die intakt war. Branka stand nicht länger dort, sondern kam auf den Hügel zu.
»Du wirst bald von ihnen vor eine Wahl gestellt. Ich mache das schon jetzt. Willst du leben? Oder gehen?«, fragte Morven.
Wehmütig blickte der alte Karstlöwe in Richtung der sich nähernden Gestalt. Ein dumpfer Druck erfüllte seine Brust, die Melancholie war kaum zu ertragen.
»Ich glaube nicht, dass ich ihr abschlagen kann, sie zu begleiten«, sagte er. »Ich war zu lange allein …«
Morven lächelte. »Nicht mehr. Du hast mich, und das nicht erst, seit ich die Welt der Lebenden verlassen habe. Und mehr Verbündete, als du denkst. Aber du musst dich entscheiden.« Mit einem besorgten Seitenblick auf die sich nähernde Gestalt fügte sie ein »Und zwar rasch!« hinzu.
Das Wesen, das wie Branka aussah, hatte den Hügel beinahe erreicht. Es ging nicht mehr, es flackerte. Es setzte aus, und wenn es auftauchte, war es mehrere Schritte näher an die Anhöhe herangekommen.
Ormgair versuchte den Blick abzuwenden, sich wachzurufen, was Morven gesagt hatte. Dass es nur eine Illusion war. Es gelang ihm nicht. Branka war inzwischen nur noch einen Steinwurf entfernt, lächelte ihn an. Auf ihren Schultern ruhte ein Mantel aus blendendem Weiß.
»Du musst aufwachen, Ormgair«, sagte Morven. Ihre Stimme klang unendlich fern.
Hinter Branka brach die Welt ab, trieb in Schollen auseinander. Sie fingen Feuer, verschmolzen mit der endlosen Ebene aus Licht, die die Gladiatorin wie einen Krönungsmantel trug. Sie streckte ihm die Hand entgegen, öffnete flehentlich die Lippen.
»Folge mir, Nebeljäger«, sagte das Geschöpf. Ein seltsam entrückter Ausdruck glomm in den Augen der Gladiatorin. Verzückt – und ganz und gar friedlich. Ormgair wollte ihr die Hand entgegenstrecken, sie war nur noch Schritte entfernt. Etwas hielt ihn zurück.
Mit einer Willensanstrengung riss er den Blick von ihr und sah Morven an. Sie sprach nicht mehr, schüttelte nur traurig den Kopf.
Das ist sie nicht, dachte der Nebeljäger. Sie war eine Kriegerin bis zu ihrem Tode. Was immer das auch ist, es ist nicht Branka.
Ormgair sah, dass Morven ebenso zu verblassen begann wie die sie umgebende Landschaft. Sie war hierhergekommen, um ihn zu warnen. Helfen musste er sich allein. Es war nie anders gewesen.
»Du bist nicht echt«, sagte er zu dem Geschöpf, das wie Branka aussah. »Nichts von all dem hier ist echt!«
»Folge mir«, wiederholte das Geschöpf. »Begleite mich. Immerwährender Frieden wartet auf uns.«
Ormgair antwortete nicht. Zumindest nicht mit Worten.
Er schlug ihr mitten ins Gesicht. Mit der Faust. Dafür bedurfte es einer ungemeinen Willensanstrengung, denn er musste sich selbst überwinden. Seine Faust verschwand bis zum Ellenbogen in der teigigen Nachgiebigkeit ihres Kopfes.
Als er den Arm herausriss, klebte halbflüssiger Schatten daran. Der Sirup rann zu Boden, die Frau mit dem klaffenden Loch im Gesicht begann zu schmelzen. Das sie umgebende Licht wurde schlagartig zu absoluter Schwärze, ins Negativ verkehrt.
Jetzt war Ormgair es, der in einem winzigen Lichtkreis stand, während die Dunkelheit von allen Seiten auf ihn zukroch.