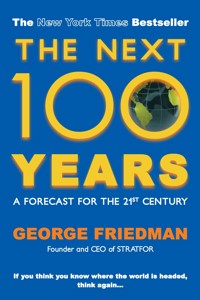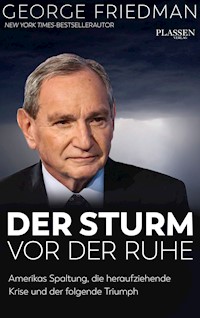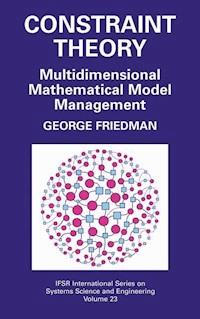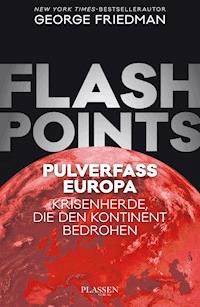
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Plassen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wird Europa wieder brennen? Politologe und Bestsellerautor George Friedman (Die nächsten 100 Jahre) mit kühnen und teilweise beängstigenden Thesen zur Zukunft Europas. George Friedman stellt drei Fragen. 1. Wie erreichte Europa seine globale Dominanz in politischer, militärischer, wirtschaftlicher und intellektueller Hinsicht? 2. Was lief schief, sodass Europa diese Dominanz zwischen 1914 und 1945 wegwarf? 3. Wird Europa in Zukunft so aussehen wie in der Friedensperiode, die sich an 1945 anschloss, oder wird es zu seinen historischen Fehlern zurückkehren? Friedman gibt kluge Antworten auf alle drei Fragen - und liefert spannende Denkanstöße zur Sicherung der Zukunft unseres Kontinents.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
George FriedmanFlashpoints – Pulverfass Europa
NEW YORK TIMES-BESTSELLERAUTOR
GEORGE FRIEDMAN
FLASH POINTS
PULVERFASSEUROPA
KRISENHERDE,DIE DEN KONTINENTBEDROHEN
Copyright © 2015 by George Friedman. All rights reserved. Published in the United States by Doubleday, a division of Random House LLC, New York, and distributed in Canada by Random House of Canada Limited, Toronto, Penguin Random House companies.
This translation published by arrangement with Doubleday, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Penguin Random House LLC.
Copyright der deutschen Ausgabe 2015:© Börsenmedien AG, Kulmbach
Gestaltung, Cover und Satz: Franziska IglerHerstellung: Daniela FreitagLektorat: Karla SeedorfÜbersetzung: Matthias Schulz
ISBN 978-3-86470-312-6
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks,der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbankenoder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 • 95305 KulmbachTel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444E-Mail: [email protected]/plassenverlag
Dieses Buch ist meiner Schwester Agi gewidmet.
ANTHEM FOR DOOMED YOUTH
What passing-bells for these who die as cattle?
Only the monstrous anger of the guns.
Only the stuttering rifles’ rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries now for them; no prayers nor bells;
Nor any voice of mourning save the choirs,
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.
What candles may be held to speed them all?
Not in the hands of boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of good-byes.
The pallor girls’ brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of patient minds,
And each slow dusk a drawing-down of blinds.
– Wilfred Owen, gefallen an der Sambre, 4. November 1918
HYMNE FÜR DIE VERDAMMTE JUGEND
Welch Grabgeläute denen, die wie Schlachtvieh sterben?
– Die ungeheure Wut nur der Kanonen.
Das schnelle Schnacken nur von stotternden Gewehren
Kann ihre Stoßgebete übertönen.
Jetzt weder Glocken noch Gebete, die sie verhöhnen;
Noch Stimmen sonst der Klage ihnen; nur Gesänge, –
Die schrillen Wahngesänge der Granaten, ihr Stöhnen,
Und fern aus trauervollen Gauen rufend, Hörnerklänge.
Wird Beistand ihnen und von welcher Kerzen Schein?
Nicht in den Händen von Knaben, in ihren Augen immer
Soll glänzen allen Abschieds heiliger Schimmer;
Blässe von Mädchenstirnen soll ihr Bahrtuch sein;
Die Zärtlichkeit geduldiger Seelen ihr Blumenflor.
Und jede müde Dämmerung zieht abends die Läden vor.
(dt. Übersetzung: Joachim Utz)
Inhalt
Verzeichnis der Abbildungen
Vorwort
Teil 1:EUROPAS EINZIGARTIGKEIT
1. Ein europäisches Leben
2. Europa überfällt die Welt
3. Die Zersplitterung des europäischen Geists
Teil 2:31 JAHRE
4. Gemetzel
5. Erschöpfung
6. Die amerikanischen Ursprünge der europäischen Integration
7. Krise und Teilung
Teil 3:FLASHPOINTS
8. Die Kriege von Maastricht
9. Wieder einmal die Deutschland-Frage
10. Festland und Halbinsel
11. Russland und seine Grenzgebiete
12. Frankreich, Deutschland und ihre traditionellen Grenzgebiete
13. Das mediterrane Europa zwischen Islam und Deutschland
14. Türkei am Rand
15. Großbritannien
16. Schlussfolgerung
Danksagung
Anmerkungen
Verzeichnis der Abbildungen
Sagres
Die Ausbreitung des Islams
Verlauf der Seidenstraße
Portugal erforscht Westafrika
Europas Weltreich 1914
Wirtschaftswachstum in Westeuropa 1820-1913
Europa nach dem Ersten Weltkrieg
Europa im Kalten Krieg
Geschichte der europäischen Integration
Länder der Eurozone
Arbeitslosigkeit in Europa 2013
Der Balkan
Der Kaukasus
Grenze zwischen Russland und europäischer Halbinsel
Grenzgebiet Festland-Halbinsel: Vor dem Ersten Weltkrieg
Grenzgebiet Festland-Halbinsel: Kalter Krieg
Grenzgebiet Festland-Halbinsel: Nach dem Kalten Krieg
Wichtige eurasische Pipelines
Benelux-Länder (Belgien, Luxemburg, Niederlande)
Römisches Reich im Jahr 117
Das Osmanische Reich
Türkei
Vorwort
Rund 100 Millionen Menschen starben zwischen 1914 und 1945 aus politischen Gründen – als Folge von Krieg, Völkermord und „Säuberungen“, weil man sie vorsätzlich verhungern ließ und so weiter. Egal, zu welcher Zeit und an welchem Ort, wäre das eine atemberaubende Zahl, aber in Europa gilt das umso mehr, denn der Kontinent hatte in den vier vorangegangenen Jahrhunderten praktisch die gesamte Welt erobert und das Selbstbild der Menschheit grundlegend verändert.
Mit der Eroberung der Welt ging eine Wandlung im alltäglichen Leben einher. Musik beispielsweise bekam man in früheren Zeiten nur dann zu hören, wenn man selbst dabei war. Lesen zu können, war über weite Strecken der Menschheitsgeschichte eine eher nutzlose Fähigkeit, denn es gab nur sehr wenige Bücher und die waren in alle Welt verstreut. Der Mensch hatte sich inzwischen die Dunkelheit untertan gemacht. Männer wurden doppelt so alt wie früher und für Frauen war es durchaus keine Selbstverständlichkeit mehr, bei der Entbindung zu sterben. Bis 1914 hatte Europa das Leben verändert, nicht nur in Europa, sondern auch im Rest der Welt. Wie umwälzend diese Veränderungen waren, lässt sich heutzutage kaum nachvollziehen.
Stellen Sie sich vor, Sie besuchen im Jahr 1913 in einer europäischen Hauptstadt ein Konzert. Mozart und Beethoven stehen auf dem Programm. Es ist ein kalter Winterabend, aber die Konzerthalle ist gut beleuchtet und beheizt. Entsprechend leicht und elegant sind die Frauen gekleidet. In diesem Saal ist nichts davon zu spüren, dass draußen Winter herrscht. Einer der Männer hat gerade telegrafisch Seidenstoffe in Tokio bestellt, die Lieferung soll in einem Monat erfolgen. Daneben steht ein Paar, das eigentlich über 150 Kilometer entfernt lebt, sich aber für das Konzert extra auf die dreistündige Zugfahrt eingelassen hat. Als Europas Abenteuer 1492 begann, wäre nichts von alledem möglich gewesen.
Ein großes europäisches Sinfonieorchester Mozart oder Beethoven spielen zu hören, ist ein unvergleichliches Erlebnis. Bei Mozart hört man Töne überirdischer Natur, während bei Beethoven jeder Ton mit einem Augenblick im Leben verknüpft ist. Wer Beethovens Neunte hört, muss an Revolution denken, an Republikanismus, an Vernunft und ehrlich gesagt auch an den Menschen als Gott. Europas Kunst, immanent und transzendent, seine Philosophie und seine Politik haben die Menschheit an einen völlig neuen Ort geführt – einen Ort, der für viele dem Tor zum Paradies gleichkam. Hätte ich damals schon gelebt, wäre es mir vermutlich ganz genauso ergangen.
Wer hätte ahnen können, dass es in Wahrheit das Tor zur Hölle war. In den folgenden 31 Jahren zerfleischte Europa sich selbst. Technologie, Philosophie, Politik – all die Dinge, die Europa bis dahin zu seiner Größe verholfen hatten, wandten sich nun gegen Europa. Oder genauer gesagt: Die Europäer wandten sie gegen sich und gegeneinander. Am Ende dieser 31 Jahre war Europa ein Friedhof. Städte und Existenzen lagen gleichermaßen in Trümmern. Die Kontrolle über die Welt war Europa aus den Fingern gerutscht. Die Ode an die Freude aus Beethovens Neunter Sinfonie feierte nicht länger das Leben in Europa, sondern klang wie ein ironischer Abgesang auf die Überheblichkeit Europas.
Europa ist kein Einzelfall, auch andere Zivilisationen haben Umwälzungen, Kriege und Brutalität erdulden müssen. Besonders wird es durch den Überraschungsmoment, durch die Intensität, die Schnelligkeit und die globalen Folgen. Und ganz besonders wird es dadurch, weil es so verblüffend war, dass gerade diese Zivilisation zu einer derartigen Selbstzerstörung imstande war. Vielleicht hätte man es erahnen können: Europa war ein brutaler Kolonialherr, Europa war ein Ort, an dem krasse soziale Ungerechtigkeit herrschte, Europa war in viele kleine Teile zersplittert. Und dennoch: Wie kurz der Weg von europäischer Hochkultur zu den Todeslagern war, überrascht doch sehr.
Europa unterjochte die Welt und führte gleichzeitig über Jahrhunderte hinweg einen inneren Konflikt, einen Bürgerkrieg. Das Fundament des europäischen Imperiums war auf Treibsand gebaut, insofern ist das eigentlich Geheimnisvolle, warum eine europäische Einheit derart schwer zu fassen war. Europas Einheit wird durch seine Geografie erschwert: Europa besteht nicht aus einer einzigen, einheitlichen Landmasse. Es gibt Inseln, Halbinseln und Halbinseln auf Halbinseln – und Berge, die die Halbinseln blockieren. Es gibt Meere und Meeresengen, hohe Gebirge, tiefe Täler und endlose Ebenen. Anders als in Amerika münden Europas Flüsse nicht in ein einziges, alles verbindendes System. Sie fließen jeder für sich und trennen eher, als dass sie verbinden.
Kein anderer Kontinent ist derart klein und zersplittert wie Europa. Nur Australien ist kleiner, aber das heutige Europa besteht aus 50 souveränen Staaten (zu denen ich aus später erklärten Gründen die Türkei und die Kaukasusnationen zähle). Es gibt nicht nur viele Nationen, sondern auch viele Menschen. In Europa beträgt die Bevölkerungsdichte 72,5 Menschen pro Quadratkilometer. Innerhalb der Europäischen Union liegt der Wert sogar bei 112 pro Quadratkilometer. In Asien sind es 86 pro Quadratkilometer. Europa ist voll und zersplittert.
Die geografischen Gegebenheiten Europas führen dazu, dass sich der Kontinent nicht durch Eroberung vereinigen lässt. Sie führen dazu, dass kleine Nationen sehr lange überleben können. Die politische Landkarte Europas aus dem Jahr 1000 ähnelt der aus dem Jahr 2000. Nationen existieren neben anderen Nationen über einen sehr langen Zeitraum hinweg und häufen in dieser Zeit Erinnerungen an, die Vertrauen und Verzeihen unmöglich machen. Infolgedessen war Europa ein Ort, an dem sich Kriege endlos wiederholen. Die Kriege des 20. Jahrhunderts waren nur insofern anders, als technischer Fortschritt und die Ideologie dieses Mal den gesamten Kontinent in eine Katastrophe stürzten.
Europa ist in Grenzgebiete unterteilt, in denen Nationen, Religionen und Kulturen aufeinandertreffen und sich vermischen. Oftmals verläuft in diesen Gebieten auch eine politische Grenze, aber das eigentliche Grenzgebiet ist größer und in vielerlei Hinsicht auch sehr viel wichtiger. Die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten beispielsweise ist eine sehr klare Linie. Aber der Einfluss Mexikos, seiner Sprache und seiner Menschen ist noch weit nördlich der Grenze zu spüren, ebenso wie sich Amerikas Kultur und Wirtschaft über die Grenze hinaus südwärts ausbreiten. Nahe der Grenze lebende Mexikaner gelten als Menschen, die die amerikanische Kultur in sich aufgesogen haben, und das entfremdet sie vom Rest des Landes. Genauso hat sich nördlich der Grenze das Leben weg vom Angelsächsischen hin zu einer ungewöhnlichen Mischung mit Spanglish als eigener Sprache entwickelt. In diesem Grenzgebiet lebt ein einzigartiger Menschenschlag, der oftmals mehr miteinander teilt als mit den jeweiligen „Landsleuten“.
Ich lebe südlich von Austin im Bundesstaat Texas und die Städtenamen hier sind angelsächsisch oder deutsch. Viele deutsche Siedler hatten sich in der Region westlich von Austin niedergelassen. Fahre ich auf der I-35 Richtung Süden, tragen die Städte deutsche Namen wie New Braunfels. Nähere ich mich San Antonio, werden sie spanisch und manchmal habe ich das Gefühl, mich in Mexiko aufzuhalten. Auf gewisse Weise tue ich das auch, aber die eigentliche Grenze liegt über 150 Kilometer weiter südlich, also nicht gerade um die Ecke.
Europa ist voller derartiger Grenzgebiete, aber das wichtigste von allen trennt die europäische Halbinsel vom europäischen Festland ab, den Westen von Russland.1
Es ist ein riesiges Gebiet und umspannt komplette Länder wie die Ukraine, Weißrussland und Litauen. Die politische Grenze hat sich im Laufe der vergangenen 100 Jahre sehr weit Richtung Westen verschoben, wobei das Grenzgebiet von Russland aufgesogen wurde, und wieder weit zurück Richtung Osten, was zur Entstehung eigenständiger Nationen führte. Unabhängig davon, wo die Grenze gerade verlaufen mag, handelt es sich hier um eine Region, in der die Menschen mehr miteinander gemein haben als mit Russland oder dem Westen. Tatsächlich bedeutet das Wort ukraina auch „Grenzgebiet“.
Es ist beileibe nicht das einzige Grenzgebiet, aber es definiert die europäische Geschichte. Eine Grenzregion verläuft auch zwischen der französischen und der deutschen Welt, sie erstreckt sich von der Nordsee bis zu den Alpen. Der Balkan ist das Grenzgebiet zwischen Mitteleuropa und der Türkei. Die Pyrenäen sind das Grenzgebiet zwischen den Iberern und dem Rest Europas. Es gibt auch noch kleinere Grenzgebiete, etwa rund um Ungarn, wo Ungarn unter rumänischer und slowakischer Herrschaft leben. Wenn man so will, gibt es sogar eine Wassergrenze – den Ärmelkanal, der Großbritannien vom Festland trennt. Auf so kleinem Gebiet, so dicht bewohnt und so voll uraltem Groll, wird es immer Grenzgebiete geben. Kein Ort zeigt dies deutlicher als Europa.
Es sind die Grenzgebiete, wo sich Kulturen vermischen und wo der Schmuggel ein angesehener Broterwerb sein kann. Sie sind aber auch die Orte, an denen Kriege ausgefochten werden. Sie sind die Flashpoints, die Brandherde. Die Rheinlande sind heutzutage ein ruhiger Ort, aber das war nicht immer so. Drei Mal ist seit 1870 in den Gebieten links und rechts des Rheins Krieg ausgebrochen. Die Region war damals ein Pulverfass, denn ernste und weitreichende Themen trennten Frankreich und Deutschland. Ein einziger Funke reichte aus, schon stand die Region in Flammen. Heute ist das Grenzgebiet westlich von Russland so ein Flashpoint. Hier und da sind bereits die ersten Brände ausgebrochen, doch noch steht nicht alles in Flammen.
Während des Ersten Weltkriegs und auch während des Zweiten Weltkriegs waren sämtliche europäischen Grenzgebiete Flashpoints. Sie schlugen Funken und sie lösten Brände aus, die sich mit wachsender Intensität ausbreiteten. Einen Feuersturm wie den, der 1914 losbrach und der nach kurzer Atempause 1939 erneut aufflammte, hat die Welt nur selten erlebt, wenn überhaupt. Die Menschen waren erfüllt von furchtbaren Erinnerungen und Ängsten und als diese Gefühle mit ihnen durchgingen, erfassten die Flammen die Grenzregionen. Alle Brände vereinigten sich zu einem einzigen Holocaust.
Unter großen Mühen trieb Europa seinen Wiederaufbau voran und dank der Bemühungen Außenstehender gewann es seine Souveränität zurück. Aus diesem wüsten Chaos erwuchs ein einzelner Satz: „Nie wieder.“ Dieser Satz steht für die Entschlossenheit der Juden, dafür zu sorgen, dass sie nie wieder so abgeschlachtet werden. Die Europäer insgesamt arbeiten nicht mit diesem Satz, aber der Grundgedanke steht hinter allem, was sie tun. Wer die 31 Jahre durchlebt hatte, musste als Nächstes den Kalten Krieg durchleben. Es war eine Zeit, in der einzig Moskau und Washington darüber bestimmten, ob die Menschen leben oder sterben würden, denn nur dort wurde über Krieg und Frieden entschieden. Dass es keinen Krieg in Europa gab, ist ein Aspekt, der es wert ist, später noch einmal betrachtet zu werden, aber als sich die Gefahr eines Kriegs zwischen den Supermächten legte, war Europa entschlossen, eine Wiederholung dieser 31 Jahre nicht zuzulassen. Europa gab seine Imperien auf, seine Macht, in mancherlei Hinsicht auch seine Bedeutung – alles, weil man nie wieder den Schrecken dieser Jahre erleben will oder auch nur, weil man, wie während des Kalten Kriegs, nicht am Rande des Abgrunds leben will.
Um ihre Albträume zu verbannen, entwickelten die Europäer etwas Neues – die Europäische Union. Ihre Aufgabe war es, Europas Nationen so eng miteinander zu verzahnen und so erfolgreich zu machen, dass künftig niemand mehr einen Anlass haben sollte, den Frieden zu brechen oder seinen Nachbarn zu fürchten. Es ist schon ironisch: Jahrhundertelang hat Europa darum gerungen, Nationen vor der Unterdrückung durch andere Nationen zu retten und nationale Souveränität und nationale Selbstbestimmung zu ermöglichen. Diesen moralischen Imperativ aufzugeben war man nicht bereit, wiewohl man miterlebt hatte, wohin die Reductio ad absurdum führen konnte. Die Souveränität aller solle bestehen bleiben, aber gleichzeitig so weit eingeschränkt werden, dass niemand den Nationen ihre Souveränität würde rauben können. Beethovens Ode an die Freude ist, von ihrer Ironie befreit, zur Europahymne geworden.
Gehören Konflikte und Kriege tatsächlich der Vergangenheit an? Oder erleben wir nur ein Zwischenspiel, eine trügerische Illusion? Das ist die wohl wichtigste Frage überhaupt zurzeit. Europa ist die reichste Region der Welt. Sein Bruttoinlandsprodukt ist größer als das der Vereinigten Staaten. Europa grenzt an Asien, den Nahen Osten und Afrika. Eine neue Reihe europäischer Kriege würde nicht nur Europa verändern, sondern die Welt. Wann immer Gedanken über die Zukunft angestellt werden, steht dabei im Mittelpunkt die Frage, ob es Europa gelungen ist, nicht nur seine 31 Jahre zu überwinden, sondern auch die konfliktreichen Jahrtausende davor.
Und das war mein Antrieb, dieses Buch zu schreiben. Es ist ein Thema, das auf vielen Ebenen mein Leben und meine Gedanken geprägt hat. Ich kam 1949 in Ungarn zur Welt, meine Eltern wurden 1912 und 1914 geboren. Schrecken und Terror haben meine Familie geprägt, nicht nur während der 31 Jahre, sondern auch danach. Aus der Überzeugung heraus, dass die europäische Seele zutiefst verdorben sei und dass sich dieser Zustand eine Zeitlang verbergen ließe, sich früher oder später aber seinen Weg bahnen würde, verließ meine Familie Europa. Als Amerikaner lebte ich in einer Welt, in der alles durch Entscheidungen geprägt ist. Als Europäer dagegen lebte ich in einer Welt, in der Entscheidungen gar nichts bedeuten, wenn einen die Lawine der Geschichte hinfortspült. Als Amerikaner lernte ich, mich der Welt zu stellen. Als Europäer lernte ich, ihr aus dem Weg zu gehen.
Meine Suche nach der Antwort auf das Rätsel Europa ist die konsequente Fortsetzung der Gespräche, die meine Eltern während des Abendbrots führten, und der Geräusche, die sie in ihren nächtlichen Albträumen von sich gaben. Ursache für meine Identitätskrise (schon dieser Begriff zeigt Ihnen, wie durch und durch amerikanisch ich mittlerweile bin) war der Umstand, dass ein Europäer völlig anders an das Leben herangeht als ein Amerikaner. Ich war beides, also wer war ich? Ich habe das ganze Thema auf eine einzige Frage heruntergebrochen: Hat sich Europa tatsächlich verändert oder ist es Europa bestimmt, sich immer wieder von der „Ode an die Freude“ verspotten zu lassen?
Weil ich mich auf der höchstmöglichen Ebene mit dieser Frage auseinandersetzen wollte, entschloss ich mich als junger Mann, politische Philosophie zu studieren. Für mich sind die grundlegendsten Fragen des menschlichen Zustands letztlich politische Fragen. Bei der Politik geht es um Gemeinschaft und um die Verpflichtungen, die Rechte, die Gegner und die Freunde, die eine Gemeinschaft mit sich bringt. Und bei der Philosophie werden die natürlichsten Dinge analysiert. Sie zwingt einen, sich mit dem Vertrauten auseinanderzusetzen und festzustellen, dass es sich um etwas Fremdes handelt. Für mich war dies der Weg zur Erkenntnis.
Doch so einfach, wie ich es mir gedacht hatte, ist das Leben nie. In der Graduate School konzentrierte ich mich auf deutsche Philosophie. Als Jude wollte ich begreifen, woher Menschen stammten, die im Rahmen ihrer Landespolitik vorsätzlich Kinder abschlachteten. Aber damals herrschte der Kalte Krieg und mir war klar, dass die „europäische Frage“ gerade die „sowjetische Frage“ war. Die Sowjets hatten mein Leben fast genauso stark beeinflusst wie die Deutschen. Insofern schien Karl Marx der perfekte Einstieg. Und da sich die sogenannte Neue Linke (Kommunisten, die Stalin hassten) gerade auf dem Höhepunkt befand, beschloss ich, sie zu studieren.
Im Rahmen meines Studiums kehrte ich wiederholt nach Europa zurück und gewann enge Freunde in der europäischen Neuen Linken. Ich wollte ihre Philosophen verstehen, wollte Althusser, Gramsci und Marcuse begreifen, aber ich konnte nicht still in einer Bibliothek herumhocken, dafür war in der Welt viel zu viel los. Viele engagierten sich in der Neuen Linken, weil sie auf der Jagd nach Verabredungen waren und die Neue Linke eine angesagte gesellschaftliche Bewegung war. Für eine andere, kleinere Gruppe stellte die Bewegung den absolut ernst gemeinten Versuch dar, die Welt zu verstehen und den besten Ansatz zu finden, wie man sie verändert. Eine ganz kleine Handvoll sah das Ganze als Vorwand und als Pflicht an, Gewalttaten zu begehen.
Auch wenn es inzwischen wieder etwas in Vergessenheit geraten ist: In den 1970er- und 1980er-Jahren nahm die Gewalt in Europa zu. Es war ein Terrorismus, der weit vor Al-Kaida Schlagzeilen machte. In vielen europäischen Ländern bildeten sich Terrorzellen, die Attentate verübten, Menschen kidnappten, Sprengstoffanschläge durchführten. Auch in den USA gab es eine terroristische Linke, aber sie spielte nur eine kleine Rolle. Diese kleinen Gruppierungen faszinierten mich: Sie standen für das Wiederauftauchen politischer Gewalt in Europa im Kontext einer Bewegung, die zwar gelegentlich den Begriff „Klassenkampf“ benutzte, aber eigentlich gar keinen wollte.
Eine Methode, die wieder in Mode kam, war es, Gegnern die Kniescheiben zu zerschießen. Ich konnte mich nie recht entscheiden: War es als Akt der Gnade gemeint oder als Akt der Brutalität, wenn man jemanden nicht tötete, sondern ihn „nur“ zum Krüppel machte? Menschen, die so etwas taten, waren für mich Menschen, die man im Blick behalten sollte. Sie waren meiner Auffassung nach die Erben der 31 Jahre. Sie nahmen ihre moralischen Verpflichtungen ernst und lehnten das Wertesystem der Gemeinschaft ab. Das befreite sie, nun konnten sie furchtbare Taten anrichten. Ich lernte einige von ihnen kennen und stellte fest, dass sie im Grunde genommen gar nicht damit rechneten, etwas zu verändern. Antrieb für ihre Taten war nackter Hass auf die Welt, in die sie geboren worden waren, und Verachtung für diejenigen Menschen, die ein ganz gewöhnliches Leben lebten. Das waren ihrer Meinung nach die wirklich Bösen, während die Terroristen sich als selbst ernannte Rächer gerierten.
Während sich in Europa mehr und mehr das Gefühl breit machte, man habe die dunklen Seiten der Vergangenheit hinter sich gelassen, weckte meine Zeit mit diesen Menschen Zweifel an der allgemeinen Einschätzung. Es war doch eher wie bei einer Krebserkrankung: Übersah der Arzt einige Zellen, kann die Krankheit unter den richtigen Umständen zurückkehren. In den 1990er-Jahren brachen im Balkan und im Kaukasus wieder Kriege aus. „Nicht aussagekräftig“, winkten die Europäer ab. Terror von links? Nicht aussagekräftig. Heute tauchen am rechten Rand immer mehr zwielichtige Gestalten auf. Nicht aussagekräftig. Diese Haltung mag für den Stolz und das Selbstvertrauen Europas stehen und sie mag korrekt sein, aber offensichtlich ist das nicht.
Europa durchläuft eine Phase der Prüfung. Wie alle menschlichen Institutionen irgendwann erlebt die Europäische Union derzeit eine Phase intensiver Probleme, die sich für den Augenblick vor allem auf wirtschaftliche Aspekte beschränken. Die Europäische Union wurde „für Frieden und Wohlstand“ gegründet. Wenn der Wohlstand schwindet, ganz oder zumindest in einigen Ländern, was geschieht dann mit dem Frieden? In einigen südeuropäischen Staaten ist die Arbeitslosigkeit inzwischen so hoch wie in den USA während der Weltwirtschaftskrise oder sogar noch höher. Was hat das für Folgen?
Das ist das Thema dieses Buchs. Es geht um das Gefühl der europäischen Einzigartigkeit, um die Vorstellung, dass sie im Gegensatz zum Rest der Welt die Probleme von Frieden und Wohlstand gelöst haben. Das mag stimmen, aber es muss erörtert werden. Wenn Europa nicht einzigartig ist und jetzt in Schwierigkeiten steckt, wie wird es dann weitergehen?
Diese Frage wird in drei Blöcken beantwortet. Erstens: Warum war Europa der Ort, an dem sich die Welt selbst entdeckt und sich verwandelt hat? Wie kam das zustande? Zweitens: Europas Zivilisation war derartig weit entwickelt, welcher Defekt Europas konnte da zu den 31 Jahren führen? Wie kam dieser Defekt zustande? Und nachdem wir diese Aspekte abgewogen haben, können wir nicht nur über Europas Zukunft nachdenken, sondern auch darüber, wo die künftigen Brandherde liegen.
Hat Europa sein Erbe des Blutvergießens hinter sich gelassen, ist das eine wichtige Neuigkeit. Hat es das nicht, ist das eine noch wichtigere Neuigkeit. Gehen wir der Frage nach. Lassen Sie uns zunächst einmal erörtern, was es in den vergangenen 500 Jahren bedeutete, ein Europäer zu sein.
Teil 1
EUROPAS EINZIGARTIGKEIT
1
Ein europäisches Leben
In der Nacht des 13. August 1949 kletterte meine Familie am ungarischen Donauufer in ein Schlauchboot. Wir waren auf der Flucht vor den Kommunisten und unser Ziel war Wien. Wir waren zu viert: Mein Vater Emil, 37 Jahre alt, meine Mutter Friderika, genannt „Dusi“, 35 Jahre alt, meine elfjährige Schwester Agnes und ich, sechs Monate alt. Dann war da noch ein Schmuggler, dessen Name und Herkunft inzwischen verloren gegangen sind – vorsätzlich, glaube ich, denn unsere Eltern hielten derartiges Wissen für gefährlich und unternahmen deshalb auch alles, um derartiges Wissen von uns fernzuhalten.
Wir waren in Budapest in den Zug gestiegen und bis nach Almasfuzito gefahren, einem Dorf nordwestlich der ungarischen Hauptstadt. In Budapest waren meine Schwester und ich zur Welt gekommen. Meine Eltern waren mit ihren Familien dorthin gezogen, hatten sich dort kennengelernt, hatten sich dort ineinander verliebt und waren dort in den Abgrund gesogen worden, der sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ganz Europa auftat. Meine Mutter kam 1914 in der Nähe von Bratislava zur Welt, das damals als Teil Ungarns Pozsony und als Teil Österreich-Ungarns Pressburg hieß. Mein Vater wurde 1912 im Osten Ungarns in der Stadt Nyírbátor geboren.
Meine Eltern kamen also kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs zur Welt. 1918 endete der Krieg und Europas Fundament trug als Folge dieses Konflikts tiefe Risse davon. Vier Kaiserhäuser stürzten – die Osmanen, die Habsburger, die Hohenzollern und die Romanows – und alles, was zwischen Ostsee und Schwarzem Meer an festen Strukturen existiert hatte, befand sich auf einmal in Fluss. Kriege, Revolutionen und Diplomatie gestalteten die Landkarte der Region völlig neu. Einige Länder wurden neu geschaffen, andere wurden unterdrückt. Die Stadt Munkatsch (heute: Mukatschewe), in der mein Vater aufgewachsen war, gehörte nun zur Ukraine und war damit Teil der Sowjetunion. Pozsony hieß nun Bratislava und war Teil eines neu geschaffenen Staatengebildes, das Tschechen und Slowaken vereinte.
Meine Eltern waren Juden und für sie waren Änderungen des Grenzverlaufs so etwas wie Wetterumschwünge – egal, was man davon hielt, es war jederzeit damit zu rechnen. Ungarische Juden wiesen eine Besonderheit auf: Sie sprachen Ungarisch. Die anderen Juden im Osten Europas sprachen Jiddisch, eine Verschmelzung aus Deutsch und mehreren weiteren Sprachen. Um die Dinge zusätzlich zu verkomplizieren, verwendete Jiddisch die hebräische Schrift. Jiddisch sprechende Juden sahen sich meistens nicht als Teil des Landes, in dem sie gerade lebten – eine Einschätzung, die ihre Gastgeber oftmals nachdrücklich teilten. Geografie war insofern für die Juden etwas, was von Vorteil sein konnte, aber nichts, was sie definierte. Indem sie als erste Sprache Jiddisch verwendeten, zeigten sie, wie wenig sie sich der Gesellschaft „ihres“ Landes verbunden fühlten – ein Gefühl, das ihnen die Menschen, mit denen sie lebten, übelnahmen, wobei sie aber auch wenig dafür taten, die Juden willkommen zu heißen.
Anders die ungarischen Juden. Sie sprachen grundsätzlich Ungarisch als einzige Sprache. Für meine Schwester und mich war Ungarisch unsere erste Sprache. Manche, mein Vater zum Beispiel, hatten Jiddisch als zweite Sprache gelernt, aber meine Mutter sprach überhaupt kein Jiddisch. Ihre Muttersprache war Ungarisch und als sich die Grenzen verschoben, zog die zwölfköpfige Familie um den Vater, einen Schneider, südwärts nach Budapest. Zu dieser Zeit zog die Familie meines Vaters Richtung Westen, fort aus dem Land, das nun zu der Ukraine gehörte, und in das Territorium, das nach Kriegsende von Ungarn übrig geblieben war. Was ich damit ausdrücken möchte: Auch in Ungarn blühte der ganz normale europäische Antisemitismus, aber dennoch war das Verhältnis zwischen Ungarn und seinen Juden enger. Nicht einfach, nicht frei von Problemen, aber es war vorhanden.
In den Jahren zwischen den Weltkriegen war Ungarn nicht der schlechteste Ort zum Leben – nachdem sich das Chaos erst einmal gelegt hatte, das es mit sich brachte, als ein kommunistisches Regime von einem antikommunistischen Regime abgelöst wurde. Wie in Europa üblich, ging ein derartiger Wechsel nicht ohne Gemetzel ab. Erstmals seit Jahrhunderten war Ungarn wieder unabhängig und an der Spitze der Regierung stand der Admiral einer nicht mehr existierenden Marine, ein Regent anstelle eines nicht mehr existierenden Königs. Vielleicht hätte sich Miklós Horthy „Wir schwimmen mit dem Strom“ als Familienmotto zulegen sollen. In den 1920er- und 1930er-Jahren bedeutete „mit dem Strom“ in Ungarn liberal, aber nicht übertrieben liberal. Für meinen Vater, einen Jungen vom Land, hieß das, dass er nach Budapest ziehen, Drucker lernen und eine Druckerei eröffnen konnte, bevor er 21 Jahre alt war. Für die damalige Zeit und den damaligen Ort war das außergewöhnlich, aber es waren auch außergewöhnliche Zeiten. Bis weit in die 1930er-Jahre konnte man glauben, der Erste Weltkrieg sei Europa eine heilsame Lektion gewesen und die dunkleren Instinkte seien verbannt worden.
Doch so schnell lassen sich Dämonen nicht vertreiben. Nichts, rein gar nichts hatte der Erste Weltkrieg geklärt. Bei jenem Krieg war es um den Status des Deutschen Reichs gegangen. Seit seiner Gründung 1871 hatte Deutschland Europa aus dem Gleichgewicht gebracht und die Stabilität gefährdet. Mit dem Deutschen Reich war eine mächtige und wohlhabende Nation entstanden, aber gleichzeitig war es auch eine verzweifelt unsichere Nation. Deutschland war eingekeilt zwischen Frankreich und Russland und wusste, einen gleichzeitigen Angriff von zwei Seiten würde man nicht überstehen. Und im Hintergrund agierte Großbritannien und manipulierte alle. Frankreich und Russland wiederum hatten so viel Angst vor Deutschland, dass sich das Szenario eines Simultanangriffs nicht ausschließen ließ. Das wusste Deutschland und richtete seine Strategie entsprechend aus: Zunächst den einen besiegen und dann den anderen Widersacher mit geballter Kraft niederwerfen. 1914 hatte Deutschland versucht, diese Strategie umzusetzen, hatte jedoch verloren.
Mein Großvater kämpfte im Ersten Weltkrieg für Österreich-Ungarn. Er kämpfte in Russland und verließ sein Zuhause, als mein Vater zwei Jahre alt war. Zwar kehrte er aus dem Krieg zurück, aber wie so viele andere Veteranen war auch mein Großvater körperlich und psychisch gebrochen. Viele Männer fielen im Kampf und von denen, die es nach Hause schafften, hatten nur noch wenige etwas mit der Person gemein, die damals ins Feld gezogen war. Kurz nach seiner Rückkehr starb mein Großvater, möglicherweise an Tuberkulose.
Der Erste Weltkrieg trug keineswegs dazu bei, den Status des Deutschen Reichs zu klären. Stattdessen wurde geopolitische Angst mit ideologischer Wüterei verbunden. Deutschland habe den Krieg verloren, weil man verraten worden sei, hieß es. Verrat setzt einen Verräter voraus. Es war eine komplexe Gemengelage, aber in Deutschland legte man sich auf die Juden als Sündenböcke fest. Sie waren die bösartigen Verschwörer. Es war eine Entscheidung, die sich auf meine Familie ganz besonders stark auswirken sollte.
Hitlers Wunsch, die deutschen Interessen zu sichern, bedeutete geopolitisch, dass der „Strom“, mit dem Horthy künftig zu „schwimmen“ hatte, aus Berlin kam. Meine Eltern waren ideologisch zur größten Bedrohung der deutschen Nation aufgestiegen. Für einen Juden in Ungarn war das Leben bis dahin so schlecht nicht gewesen. Nun wurde es furchtbar. Meine Eltern mussten sich einer Frage stellen, die seit über einem Jahrhundert zahllose Europäer umgetrieben hatte: „Bleiben wir oder gehen wir nach Amerika?“ In New York lebte die Schwester meiner Mutter. Ich habe keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, aber 1938 gelang es meinen Eltern irgendwie, an ein Visum für die Vereinigten Staaten zu kommen. So ein Visum war mehr wert als Gold. Wer ahnte, wohin sich die Dinge entwickeln würden, für den bedeutete das Visum das Leben selbst.
Mein Vater war ein kluger Kopf, aber er sah nicht vorher, wie es weitergehen würde. Er war mit Antisemiten aufgewachsen, er kannte die Prügel und die Beschimpfungen, die damit einhergingen. 1938 hatte er sich eine gewinnträchtige Druckerei in Budapest aufgebaut. Das sollte er nun aufgeben und völlig neu in einem Land anfangen, dessen Sprache er nicht beherrschte? Verständlich, dass er mit der Entscheidung zögerte. Die geopolitischen Realitäten verlangten es, dass er einen Ausweg aus dem europäischen Irrenhaus suchte, seine persönlichen Bedürfnisse erforderten es, zu bleiben und die Dinge auszusitzen. Als klar wurde, dass man es nicht mehr mit dem gewohnten Maß an Antisemitismus zu tun hatte, war es zu spät.
Für meine Familie waren die Folgen katastrophal. In Ungarn schützte Horthy die Nation, indem er sich dem Willen der Deutschen beugte. Ungarn blieb frei, so lange es die deutschen Abenteuer mitmachte. Nachdem Frankreich innerhalb von sechs Wochen besiegt worden war, richtete das Deutsche Reich seine Aufmerksamkeit auf die Sowjetunion, insgeheim von der Hoffnung auf einen raschen Sieg erfüllt. Horthy schwamm mit dem Strom und stellte ungarische Truppen zur Verfügung. Im Gegenzug erhoffte er sich, dass die Gebiete, aus denen meine Familie nach dem Ersten Weltkrieg fliehen musste, zurück an Ungarn fallen würden. Doch um den Lohn zu besiegeln, musste Blut fließen. Horthy begriff das.
Mein Vater wurde zur ungarischen Armee eingezogen. Zunächst war er ein gemeiner Soldat, aber es wurde rasch klar: Sollten die Ungarn Seite an Seite mit den Deutschen kämpfen, konnten Juden keine einfachen Soldaten sein. Mein Vater und die anderen Juden wurden also zu Arbeitsbataillonen abkommandiert. Zu ihren Aufgaben gehörte beispielsweise das Räumen von Minenfeldern auf die altmodische Art und Weise – man ließ die Männer durch das Feld laufen. Bei Soldaten erwartete man, dass sie zu sterben bereit seien. Von den Männern in den Arbeitsbataillonen erwartete man, dass sie sterben. Horthy war gerade so antisemitisch, wie es Sitte und Anstand von ihm erwarteten, und vermutlich hätte er so etwas gar nicht gewollt, aber er hatte eine andere Pflicht zu erfüllen: Er musste Ungarns Unabhängigkeit bewahren. Wenn das bedeutete, Juden in Arbeitsbataillone zu stecken, dann würde er das halt tun.
Für meinen Vater und viele weitere männliche Mitglieder meiner Familie bedeutete dies einen Marsch von der ungarischen Ostküste durch die Karpaten in Richtung Kursk und Kiew, weiter bis zum Don und an einen Ort namens Woronesch. Die meisten Männer meiner Familie waren zu diesem Zeitpunkt bereits tot, ebenso wie viele normale Soldaten. Es hatte nur gewirkt, als wäre die Sowjetunion schwach. Wie stark sie tatsächlich war, erfuhr die Welt im Herbst 1942, als die Sowjets zunächst ein gewaltiges Truppenkontingent östlich des Dons auffuhren und dann zum Gegenschlag gegen die 6. Armee der Wehrmacht ausholten. Diese stand zu dem Zeitpunkt in großen Teilen Stalingrads. Deutschland wollte die Zugänge zum Kaukasus abriegeln, denn auf der anderen Seite der Gebirgskette lag Baku, wo die Gebrüder Nobel aus Schweden Ende des 19. Jahrhunderts einen gewaltigen Ölsee entdeckt und kommerziell erschlossen hatten. Noch immer kam der Großteil des sowjetischen Öls aus Baku und Hitler wollte dieses Öl unbedingt in seine Hände bekommen. Die Deutschen wussten: Wenn Stalingrad fiel und sie das Land zwischen Don und Wolga eroberten, würde ihnen auch Baku gehören. Dann wäre der Krieg gewonnen.
Die Sowjets griffen jedoch nicht in Stalingrad selbst an, sondern nördlich und südlich davon. So gelang es ihnen, die 6. Armee einzuschließen und aufzureiben, bis die hungernden Überlebenden schließlich die Waffen streckten. Mein Vater hatte das Problem, dass die nördliche Speerspitze des sowjetischen Angriffs direkt auf ihn zeigte – die Sowjets wussten sehr wohl, dass die Verbündeten der Deutschen das schwache Glied der Kette waren. Als der Winter 1942 einbrach, mussten sich die Deutschen stark auf Italiener, Rumänen, Ungarn und andere Verbündete verlassen, doch diese wollten nicht für Hitlers Vision von einem Großdeutschen Reich sterben. Als die Sowjets also mit einem gewaltigen Trommelfeuer den Gegenangriff einleiteten, zerfielen die ungarischen Einheiten rasch. Mein Vater erzählte mir von der gefürchteten „Stalinorgel“, einem Raketenwerfer, der ein Dutzend Raketen abfeuerte, die mit wenigen Sekunden Abstand zueinander einschlugen. Diese Raketen sollten ihn das Rest seines Lebens heimsuchen.
Und so begann der lange Rückzug der Ungarn von Woronesch bis Budapest, über 1800 Kilometer durch den russischen Winter 1942/43. Die Verluste waren enorm und unter den Juden nahezu vollständig. Mein Vater stapfte ohne Winterkleidung durch den Schnee, ohne Essen, sofern er nicht irgendwo etwas organisieren konnte, und in dem sicheren Wissen, dass es sein Tod sein würde, sollte er hinter den Linien auf deutsche SS-Einheiten stoßen. Er nannte drei Gründe für sein Überleben. Erstens stellte er sich vor, wie seine Tochter, meine Schwester, wenige Schritte vor ihm lief. Die ganze Zeit war er kurz davor, sie zu greifen und hochzuheben. Zweitens: Die Jungs aus der Stadt waren weich. Er war ein Junge vom Land und von Natur aus hart. Und drittens: Glück. Einfach riesiges Glück.
Hitler brauchte Baku. Um die Sowjets zu besiegen, war es geopolitisch unablässig, Baku zu erobern. Es war kein Zufall, dass die Deutschen Stalingrad erobern mussten, und kein Zufall, dass die Sowjets das nicht zulassen durften. Es war kein Zufall, dass Deutschlands Verbündete an den Flanken standen und nicht im Zentrum, und es war auch kein Zufall, dass die sowjetische Offensive dort erfolgte, wo sie erfolgte. Es war kein Zufall, dass mein Vater genau im Nullpunkt stand, denn wo immer die Ungarn postiert waren, war Ground Zero. Und wo immer die Ungarn waren, waren die Juden am exponiertesten. Zufall war einzig, dass mein Vater überlebte. Die größeren Geschichtsbewegungen werden von unpersönlichen Kräften definiert. Es sind die kleinen Dinge, die kostbaren Dinge, die durch Willen, Charakter und pures Glück geformt werden.
1943 war mein Vater endlich wieder zu Hause in Budapest. Ungarn war zum damaligen Zeitpunkt immer noch unabhängig von Deutschland. Souveränität ist wichtig, denn es bedeutete, dass Deutschlands Macht zwar die Grundausrichtung der ungarischen Außenpolitik vorgab, aber es gab ein wenig Freiraum, ein kleines, immer weiter schrumpfendes Stück Unabhängigkeit, im Rahmen dessen Ungarn eigene Entscheidungen fällen konnte. Ungarns Juden lebten unter extrem harten Bedingungen, viel härter noch als beim Rest der Bevölkerung, der ebenfalls unter enormen Problemen litt. Das letzte bisschen Freiraum bedeutete für die Juden jedoch, dass sie nicht den ungezügelten Zorn des deutschen Judenhasses zu spüren bekamen. Meine Mutter und meine Schwester lebten noch und sogar die Druckerei funktionierte noch irgendwie. Sie hatten ein Dach über dem Kopf und Essen. Das zumindest hatte Horthy ihnen bewahren können. Vielleicht hätte er auch noch mehr erreicht, vielleicht hätten derartige Versuche aber auch viel früher dazu geführt, dass die Wut der Nazis völlig ungebremst über die Juden hereinbrach. Dass es Horthy gelang, einen letzten kleinen Schutzraum für Juden zu bewahren, in dem sie überleben konnten, war für die in Europa zum damaligen Zeitpunkt herrschenden Verhältnisse keine geringe Leistung und auch keine triviale Angelegenheit für meine Familie. Das Leben im souveränen Ungarn war ganz anders als im besetzten Polen. Ob der Nationalstaat souverän war, konnte den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen und tat es in diesem Fall auch. Einen Mann wie Horthy bewerte ich nicht nach dem Guten, das er vielleicht hätte tun können, sondern nach dem Bösen, das er im Gegensatz zu anderen nicht beging. Die Dinge hätten in Ungarn noch viel schlimmer verlaufen können, und zwar schon viel früher. Andere fällen ein härteres Urteil über ihn, mein Vater und meine Mutter hingegen ganz und gar nicht. Die Debatten sind noch nicht abgeschlossen, aber eines steht in jedem Fall fest: Seine Handlungen entschieden über Leben und Tod. Wie der Rest der Menschen war auch er gefangen im Griff einer europäischen Geschichte, die durchgedreht war und der man bis auf ganz wenige Ausnahmen nichts Positives abgewinnen konnte.
Das zeigte sich 1944. Gemäß seiner Politik, mit dem Strom zu schwimmen, nahm Horthy Geheimverhandlungen mit den Sowjets auf. Deutschland würde den Krieg verlieren, das war abzusehen, nun konnte man darüber reden, die Seiten zu wechseln. Doch der deutsche Geheimdienst fand heraus, dass verhandelt wurde, und Hitler bestellte Horthy ein. Er drohte damit, Ungarn zu besetzen, und verlangte die Deportation der fast eine Million ungarischen Juden. Horthy stimmte zu, 100.000 zu deportieren. Zum damaligen Zeitpunkt lief das in Europa schon unter „humanitärem Handeln“. Wer bei der Ermordung von nur 100.000 mithalf und 800.000 andere dafür vielleicht ein wenig länger am Leben erhielt, tat das Beste, was man von ihm erwarten konnte. Schließlich besetzten die Deutschen jedoch Ungarn doch noch und selbst dieses wenige wurde unmöglich. Horthy war mit dem Strom der Geschichte geschwommen, jetzt überflutete dieser Strom Ungarn. Horthy war am Ende, so viel war klar. Jetzt würden Hitler und die ungarischen Faschisten das Schicksal Ungarns bestimmen. Ebenso wie für Horthy auch war für meine Familie die Uhr abgelaufen.
Um die „Endlösung“ für die größte verbliebene jüdische Gemeinde Europas zu organisieren, entsandte man Adolf Eichmann nach Ungarn. Deutschland steckte mitten in einem Krieg und stemmte sich voller Verzweiflung gegen die drohende Niederlage, aber dennoch wurde vom knappen Personal und den knappen Transportmöglichkeiten ausreichend abgestellt, um Hunderttausende Juden nach Norden zu transportieren, nach Auschwitz und in die anderen Lager, und sie dort auszulöschen.
Staaten unternehmen manchmal Handlungen, die sich ab einem gewissen Punkt logisch überhaupt nicht mehr erklären lassen. Ich habe versucht, Hitlers Haltung gegenüber den Juden zu begreifen und zu verstehen, was er gedacht haben mag. Wie wir später sehen werden, folgt die Entscheidung, die Juden zu töten, einer gewissen Logik, egal, wie bizarr sie auch sein mag. Anders bei der Entscheidung, die ungarischen Juden zu töten. Zu dem Zeitpunkt trieben die Alliierten ganz offensichtlich die Vorbereitungen für eine Invasion in Frankreich voran, die Rote Armee rückte Richtung Westen vor und Deutschland musste dringend alle Kräfte bündeln. Die Entscheidung, die ungarischen Juden zu töten, ist extrem schwer nachzuvollziehen. Hier greift keinerlei Logik.
Aber das ist letztlich nicht mein Problem. Ich habe zwei Söhne und als die noch klein waren, sah ich ihnen, wie wohl jeder Vater, beim Einschlafen zu und dachte über ihre Zukunft nach. Gelegentlich erfassten mich dabei auch dunklere Gedanken. Ich schweifte in eine Zeit ab, die noch nicht allzu weit zurücklag. Hätten sie gelebt, als ich geboren wurde, wäre es offizielle Staatspolitik einer zivilisierten Großmacht gewesen, meine Jungs aufzuspüren und zu töten. Welche Logik ich auf einer abstrakten Ebene dahinter auch zu erkennen meinte, das Bild der beiden schlafenden Kinder ließ diese Logik verpuffen. Dass mein Vater überlebt hat, war reines Glück, er hat dazu nichts beigetragen. Genauso hätte reine, von keiner Logik gezügelte Boshaftigkeit dazu führen können, dass sich Männer auf die Suche nach Kleinkindern machen und diese abschlachteten – nicht als Beiwerk eines Kriegs, sondern als Hauptziel.
In der Geopolitik heißt es, dass die Menschen tun, was sie tun müssen, stets im brutalen Griff der Realität gefangen. Die Richtung, in die sich eine Nation entwickelt, lässt sich demnach zum Teil durch die Realität vorhersagen, in der sich die Menschen befinden. Deutschlands Realität kann, ganz generell gesprochen, als Erklärung dafür dienen, warum Hitler auf das Mittel des Antisemitismus zurückgriff. Langt man jedoch auf der Mikroebene des Lebens an, bei zwei kleinen schlafenden Jungen, zerfällt diese Logik. Es herrscht ein Bruch zwischen der Geschichte und dem Leben. Vielleicht ist es aber auch so, dass die Geschichte zu ihrem logischen Ende getrieben furchtbare Schrecken erschafft – Schrecken, die das menschliche Verständnis bis zum Äußersten strapazieren.
Meiner Familie erging es besser als den meisten. Mein Vater war ein kluger Mann, aber in der Hölle reicht es nicht aus, clever zu sein. Er glaubte (vielleicht sagte es ihm auch jemand), dass die Deutschen in Budapest damit beginnen würden, die Juden zusammenzutreiben. Also sandte er seine Mutter und seine Schwester zurück in das Dorf im Osten, aus dem er stammte. Vielleicht würden sie dort sicherer sein. Doch die Deutschen fingen keineswegs in Budapest an, sondern im Osten Ungarns. Und so gehörten seine Mutter und seine Schwester zu den ersten, die nach Auschwitz kamen. Seine Mutter wurde sofort in die Gaskammern geschickt, aber Vaters Schwester überlebte. In Budapest wurden die Juden erst später und eher nach dem Zufallsprinzip zusammengetrieben. Im Juni 1944 wurden meine Mutter und drei ihrer Schwestern nach Österreich geschickt. Dort sollten sie Straßen und Fabriken bauen. Zwei der Schwestern überlebten nicht, zwei, darunter meine Mutter, schafften es. Als meine Mutter nach dem Krieg nach Budapest zurückkehrte, wog sie gerade 40 Kilogramm und hatte sich kaum von ihrer Typhus-Erkrankung erholt.
Wie mein Vater meine Schwester und einen Cousin rettete, habe ich nie ganz begriffen. Die Sowjets rückten nach Budapest vor und der deutsche Verwaltungsapparat lief auf Hochtouren in seinen Bemühungen, rasch die verbliebenen Juden abzutransportieren und zu töten. Man führte meine Schwester und den Cousin, fünf und sechs Jahre alt, auf die Straße, wo sie auf den Laster warten sollten, der sie wegbringen würde. Meine Schwester erinnert sich nur noch, dass ein großer, blonder Mann in einem Ledermantel auftauchte und sie aus der Warteschlange herausholte. Meine Schwester mag erst fünf Jahre alt gewesen sein, aber auch ihr war klar, dass so eine Art Mann an diesem Ort fehl am Platz war und dort nichts zu suchen hatte. Der Mann erklärte den Kindern, mein Vater habe ihn geschickt und er solle sie an einen sicheren Ort bringen. Der Mann lieferte die Kinder in einem Haus ab, das unter dem Schutz des Schweizer Roten Kreuzes stand. Mein Vater brachte ihnen täglich etwas zu essen, wobei er sich seinen Weg durch eine belagerte Stadt bahnen musste. Er selbst war inzwischen wieder zu dem Arbeitsbataillon abkommandiert, mit dem er zuvor tief nach Russland marschiert war.
Wie konnte er die Kinder retten? Niemand weiß es. Weder meine Schwester noch sonst jemand aus der Familie weiß, um wen es sich bei dem Mann in dem Ledermantel gehandelt hat. Offensichtlich hatte mein Vater einigen Einfluss, aber wieso und warum, konnte meiner Schwester oder mir nie jemand erklären. Alle Geschichten der damaligen Zeit, die vom Überleben handeln, haben entweder mit extrem viel Glück oder extrem viel Cleverness zu tun. Wem es an beidem mangelte, der überlebte nicht. Aber mein Vater wollte nie darüber sprechen, was damals passiert ist. Er hat es nie erklärt und nahm das Geheimnis mit ins Grab. Sein ganzes Leben lang fühlte er sich schuldig, weil er den Fehler begangen hatte, seine Mutter und seine Schwester zurück in den Osten zu schicken, und weil er meine Mutter nicht hatte schützen können. Das verzieh er sich niemals und dass er meine Schwester retten konnte, reichte als Ausgleich nicht. Ich würde gerne glauben, dass dies der Grund für sein Schweigen war, aber zur damaligen Zeit und am damaligen Ort führte Gerissenheit rasch an dunklere Orte.
Schließlich landete auch mein Vater in einem Konzentrationslager, und zwar in Mauthausen. Und dennoch: Meine Schwester überlebte den Krieg und sowohl meine Mutter wie auch mein Vater kehrten heim. Eine intakte Familie kam einem Wunder gleich. Ungarn war sowjetisch besetzt. Aus sowjetischer Sicht waren die Ungarn auch nicht besser als die Deutschen: Beides waren feindliche Nationen, die in die Sowjetunion eingefallen waren und dort gemordet hatten. Der Einmarsch der Sowjettruppen in Ungarn verlief nicht so rachsüchtig wie der in Deutschland, aber brutal war es allemal. Sechs Wochen lang versteckte sich meine Schwester während der Schlacht um Budapest in einem Keller, während die Rote Armee die Stadt rund um die Uhr mit Artillerie eindeckte und amerikanische Flieger ihre Bomben abwarfen.
Die Deutschen hielten durch, so lange sie konnten. Budapest und die Donau blockierten eine flache Ebene, die direkt nach Wien und damit ins Deutsche Reich führte. Selbst nachdem Budapest komplett eingeschlossen war, lieferten die Deutschen fanatisch Widerstand. Entsprechend erbarmungslos griffen die Alliierten an. Mittendrin lebten ein fünfjähriges Mädchen und sein sechsjähriger Cousin unter Umständen, an denen erwachsene Männer zerbrochen wären. Für sie dagegen war es Alltag, wie meine Schwester einmal sagte. Dass einen im nächsten Moment ein Artilleriegeschoss oder eine Bombe töten könnte, gehörte schlichtweg zum Leben dazu. So war die Welt halt.
Entlässt einen der Teufel aus seinem Würgegriff, lebt man sein Leben weiter. Im Falle meines Vaters bedeutete das, die Druckerei wieder zu eröffnen und genügend Geld zum Überleben zu verdienen. Meine Mutter erholte sich und nahm auch wieder etwas zu, denn mein Vater konnte – zweifelsohne über den Schwarzmarkt – etwas zu essen heranschaffen. Meine Eltern aßen koscher. Einmal kam mein Vater mit Schweinefleisch nach Hause und man debattierte darüber, ob es richtig sei, Schwein zu essen. Als ich Jahre später diese Geschichte hörte, interpretierte ich das als Hinweis, dass das Leben da schon wieder halbwegs normal verlaufen war: Ein Jahr zuvor hätte doch gewiss niemand darüber diskutiert, ob man Schwein essen könne.
Es war ein hartes Leben unter Sowjetherrschaft. Die Russen hatten während des Kriegs gewaltig leiden müssen und sie hatten weder die Mittel noch die Neigung, Nachsicht an den Tag zu legen. Sie hatten Ungarn im Verlauf eines Kriegs erobert und waren nun zu ihrem eigenen Vorteil hier, nicht zu dem der Ungarn. Aber die geopolitische Realität der Besetzung wurde erst 1949 zu einer formellen politischen Realität. Die Sowjets nahmen es ungewöhnlich genau mit ihrem Wunsch, gerechte und klare Wahlen durchzuführen und eine echte kommunistische Regierung wählen zu lassen. 1945 hielten sie eine Wahl ab, doch die Kommunisten verloren. Wenn nicht auf die eine, dann halt auf die andere Weise, dachten sich die Sowjets wohl und hielten 1949 eine weitere Wahl ab. Wenig überraschend setzte sich dieses Mal die Kommunistische Partei durch. Daraus erwuchs die Volksrepublik Ungarn, ein völlig souveräner Staat, der zufälligerweise kommunistisch und prosowjetisch war.
Der gesamte Wahlvorgang war in fast jeder Hinsicht eine Farce. Die Rote Armee verfügte über die Waffen und Ungarn würde tun wie geheißen. So sah nun mal die geopolitische Realität aus. Und wieder einmal erwies sich die geopolitische Lage als Problem für meine Familie. Mein Vater war vor dem Krieg Sozialdemokrat gewesen und stand noch in den Parteilisten. Wenn der eigene Name damals besser irgendwo nicht auftauchen sollte, dann auf einer Liste. Die Kommunisten hassten die Sozialdemokraten sogar noch mehr als die Konservativen, denn die Sozialdemokraten konnten ihnen die Stimmen der Arbeiterschaft streitig machen. Vor den Wahlen von 1949 waren die Kommunisten und die Sozialdemokraten zur „Partei der Ungarischen Werktätigen“ verschmolzen worden – anders gesagt: Die Sozialdemokraten gab es nicht mehr. Für meinen Vater (und vermutlich auch meine Mutter) bedeutete das: Tod oder Gefängnis. Ungarn hatte schon einmal falsch gewählt, nun wollte Stalin nichts mehr dem Zufall überlassen.
Mein Vater war Anfang 20, als er in den 1930er-Jahren in die Sozialdemokratische Partei eintrat. Damals war jeder politisch aktiv und Juden tendierten zur Linken, weil die sie weniger hasste als die Rechte, so zumindest die These meines Vaters. Der Mensch, der in den 1930er-Jahren in die Partei eingetreten war, war ein völlig anderer Mensch als derjenige, der mein Vater in den 1940er-Jahren geworden war. Er hatte aus allernächster Nähe und am eigenen Leib erfahren, was Politik ist und was sie für Folgen haben kann. Für ihn war Politik inzwischen etwas, das man um jeden Preis vermeiden sollte. Geopolitik zermalmte einen. Politik band einem die Hände, während man ums Überleben kämpfte. Sein politisches Interesse hatte mein Vater inzwischen vollständig eingebüßt.
Aber das war letztlich egal. Der ungarische Staatsschutz AVH wurde von Moskau gesteuert. Die AVH war auf der Jagd nach Verrätern und sie besaß eine Liste – alt zwar, aber es war eine Liste. Mein Onkel, der Halbbruder meines Vaters, war Kommunist und hatte Zugang zu Informationen. Die Politik und zahlreiche andere Gründe hatten dazu geführt, dass die beiden Männer sich seit Jahren inbrünstig hassten, aber mein Onkel informierte meinen Vater, dass es eine Liste gab und er darauf stand. Allein das Wort „Liste“ reichte damals aus, um den Menschen eine Heidenangst zu machen.
Es war eine ziemlich verzweifelte Lage, in der meine Eltern steckten. Anfang 1949 war ich geboren worden, nur wenige Tage später informierte mein Onkel meinen Vater. Meine Mutter war mit der Schwangerschaft ein großes gesundheitliches Risiko eingegangen, schließlich hatte sie erst wenige Jahre zuvor größte körperliche Strapazen erlitten. Meine Schwester war damals elf Jahre alt und hatte ihre eigene Zeit in der Hölle hinter sich. Jetzt standen sie vor dem nächsten geopolitischen Desaster: Sie konnten in Ungarn bleiben, wo sie die AVH möglicherweise in eine weitere Katastrophe stürzen würde, oder sie konnten einen Fluchtversuch unternehmen und dabei womöglich an der Seite ihrer Kinder ums Leben kommen. Ihre Beweggründe haben mir meine Eltern nie erklärt. Ich glaube, wenn die Nazis sie eines gelehrt hatten, dann die Erwartung, dass das Verbrechen des Einzelnen zur Vernichtung aller führt – was nicht unbedingt einer zu naiven Einschätzung des Kommunismus gleichkommt. Meine Eltern entschieden sich für die Flucht. Es war eine verzweifelte Entscheidung, aber der einzige Ausweg, den sie damals sahen.
Ungarn zu verlassen, war kein Kinderspiel. Seitdem aus Ungarn eine Volksrepublik geworden war, achteten die Sowjets sehr penibel darauf, dass das Volk auch schön im Land blieb. Die ungarische Grenze war hermetisch abgeriegelt. Entlang von Minenfeldern patrouillierten Grenzschützer mit Hunden, Soldaten besetzten Wachtürme mit Maschinengewehren und Suchscheinwerfern. Nördlich von Ungarn lag die Tschechoslowakei, wo die Sowjets ganz genauso das Sagen hatten. Insofern wurde diese Grenze nicht ganz so streng überwacht wie die nach Österreich. Auch die Tschechoslowakei grenzte an Österreich. Nach Österreich zu gelangen war die einzige Hoffnung meiner Eltern, aber auf direktem Weg von Ungarn aus war das unmöglich. Es blieb nur der Umweg über die Tschechoslowakei.
Dass die tschechisch-österreichische Grenze damals vergleichsweise durchlässig war, hängt mit der Gründung Israels im Jahr 1948 zusammen. Israel entstand auf Gebiet, das zum British Empire gehörte, und wenn etwas die Briten schwächte, fand es Stalins Zustimmung. Er ging davon aus, dass die Briten künftig Israels Feind sein würden, und spekulierte auf ein Bündnis mit Israel. Seit jeher träumten die Sowjets von einem Zugang zum Mittelmeer. Um in dieser Sache einen Durchbruch zu erzwingen, finanzierten sie Volksaufstände in Griechenland und der Türkei. Doch die Revolten waren zum Scheitern verurteilt, denn die Truman-Doktrin verpflichtete Amerika, alle zu unterstützen, die den Kommunismus bekämpften, auch in Griechenland und der Türkei. Stalins Werben um Israel war einerseits zwar eher aussichtslos, barg andererseits aber auch wenig Risiken. 1949 brauchte Israel vor allem zwei Dinge – Waffen und Juden. Stalin hatte beides. Aber wie sollte er beides nach Israel bekommen? Stalin gab grünes Licht für Waffenverkäufe der Tschechen an Israel, ein Geschäft, das von 1947 bis Ende 1949 andauerte. Für Israel war das ein hervorragender Deal: Sie erhielten Waffen und Juden, ihr geopolitisches Problem war damit zunächst gelöst. Um das große Ganze konnte man sich später immer noch kümmern.
Es gab eine feste Route, entlang der Waffen und Juden aus der Tschechoslowakei über Österreich zu italienischen Häfen gelangten. Die Waffengeschäfte der beiden Länder waren durchaus bekannt. Wie meine Eltern Jahre später beim Abendessen nebenbei einfließen ließen, wurden auch Juden über diese Pipeline verschifft. Meine Eltern waren entschlossen, es bis nach Bratislava zu schaffen, wenige Kilometer vom Geburtsort meiner Mutter entfernt und – was viel wichtiger war – wenige Kilometer von Wien entfernt. Mein Vater hatte aus vermeintlich sicheren Quellen erfahren, dass sich in Bratislava Juden aus dem gesamten Sowjetimperium sammelten und dann weiter nach Österreich und Israel verschifft wurden. Doch zunächst musste man es überhaupt erst einmal nach Bratislava schaffen.
Die Mittelmeerpolitik der Sowjets und die politischen Umstände in Prag hatten meiner Familie eine Möglichkeit eröffnet. Jetzt waren drei Hürden zu nehmen. Als Erstes musste man Budapest verlassen, ohne dass es die AVH merkte, und es an einen Ort schaffen, von wo aus man die Donau in die Tschechoslowakei verlassen konnte. Im zweiten Schritt musste man nach Bratislava gelangen und die Israelis kontaktieren. Und schließlich musste man nach Österreich gelangen und sich dort von den Israelis absetzen.
Unbemerkt Budapest zu verlassen, war schon mal keine einfache Aufgabe – und wurde durch meine Eltern auch nicht einfacher gemacht. Ein warmer Mantel war damals ein kostbares Gut und sie wollten ihre Mäntel nicht zurücklassen, denn schon in wenigen Monaten würde es wieder kalt werden. Jetzt jedoch war es August und da wirkte der Anblick einer Familie, die in Wintermänteln die Straße entlangspazierte, schon etwas befremdlich. Zusätzlich mussten sie so viele Lebensmittel mitnehmen, dass vier Menschen mehrere Tage zu essen hatten. Wer ein Flüchtling ist, sieht nun mal aus wie ein Flüchtling, das lässt sich leider nicht ändern. Genauso wichtig war es, jemanden zu finden, der sie über die Donau nach Bratislava bringen würde.
Glücklicherweise ist in dieser Region der Schmuggel ein Geschäftszweig, der schon zu Zeiten der alten Römer beliebt war. Irgendwas findet sich immer, das auf der einen Seite der Grenze mehr wert ist als auf der anderen Seite, und irgendjemand ist auch immer auf der Flucht vor etwas oder jemandem. Es gab Schmuggler, die sich ihren Lebensunterhalt damit verdienten, Menschen über die Donau zu bringen. Naturgemäß waren das harte Kerle. Sie ließen sich dafür bezahlen, Verzweifelte aus gefährlichen Orten wegzubringen, da blieb für Gefühle kaum Platz, denn jede Überfahrt konnte mit dem Tod enden. Solche Männer sind gnadenlos und alle Grenzgänger wissen, dass es gefährlich ist, ihnen sein Leben anzuvertrauen. Andererseits ist der Menschenschmuggel ein Geschäft, das auf Empfehlungen beruht, und wer seine Kunden beraubt und tötet, bekommt keine guten Referenzen. Einmal oder zweimal kommt man damit vielleicht durch, aber irgendwann bleiben die Kunden aus.
Sie wollen etwas – oder jemanden – über die Grenze schmuggeln? Der Schlüssel zum Erfolg ist immer ein Name. Jemand kennt jemanden, der von jemandem gehört hat, der vielleicht etwas tun könnte … Mein Vater war ein Mann, der immer jemanden kannte, der jemanden kannte, und so gelangte er an eine Empfehlung. Jemand verwies ihn an einen Mann, der uns gegen eine gewisse Summe dorthin bringen könnte, wo wir hinwollten. Selbstverständlich kam nur Barzahlung infrage, und zwar im Voraus. Ich weiß nicht, woher mein Vater das Geld hatte und er hat auch nie darüber gesprochen, aber da wir zu viert waren, muss es sich um einen hübschen Batzen gehandelt haben.
Nahe der Stadt Almasfuzito sollten wir die Schleuser in der Nacht des 13. August 1949 am Donauufer treffen, und zwar an der Stelle, wo die Eisenbahnstrecke nach Budapest dem Ufer am nächsten kam. Die Donau selbst floss an dieser Stelle breit und langsam und mitten im Fluss tauchte im Sommer eine Insel auf – ein hervorragendes Versteck, sollten einem die Suchscheinwerfer einmal zu nahe kommen oder die Sonne überraschend früh aufgehen. Und so kam es, dass wir uns in einem Schlauchboot auf der Donau befanden.
Wir gingen ein gewaltiges Risiko ein. Der größte Unsicherheitsfaktor bei der ganzen Aktion war ich – Babygeschrei in der Nacht würde den sicheren Tod bedeuten. Unser Hausarzt in Budapest war Dr. Ungar und in den Geschichten unserer Familie nimmt er einen überlebensgroßen Platz ein. Er wurde in die Sache eingeweiht und verschrieb meinen Eltern ein Schlafpulver, mit dem ich ruhiggestellt werden sollte. Es hat mich immer sehr beeindruckt, dass meine gerade einmal elfjährige Schwester die ganze Zeit über wach und involviert war, aber andererseits kämpfte sie um ihr Leben, seit sie fünf Jahre alt war. Glücklicherweise verlief dieser Teil der Reise problemlos. Wir trafen die Schleuser zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort. Bei Einbruch der Nacht stiegen wir in die Boote und paddelten über den Fluss zur tschechischen Grenze. Von dort gelangten wir einige Kilometer weiter westlich in die ehemals ungarische Stadt Komárom (deutsch: Komorn), die mittlerweile als Teil der Slowakei Komárno heißt.
Nun mussten wir weiter nach Bratislava, in die Hauptstadt des slowakischen Teils der CSSR. Die Tschechoslowakei war ein Gebilde, das erst nach dem Ersten Weltkrieg durch den Vertrag von Trianon entstanden war. Im Rahmen des Vertrags wurde Österreich-Ungarn aufgeteilt. Es entstanden Nationalstaaten, zu denen merkwürdige Konstrukte gehörten: Jugoslawien, eine Föderation von Nationen, die sich gegenseitig hassten, oder eben auch die Tschechoslowakei, eine Verschmelzung der Tschechischen Republik mit der Slowakei, zweier Völker also, die sich gegenseitig nicht so recht mochten. Um das Ganze noch zu verschlimmern, wurden Ungarns Grenzen neu gezogen. Der südöstliche Teil des Landes, Transsilvanien, fiel an Rumänien, während der nördliche Teil in den slowakischen Teil der Tschechoslowakei eingegliedert wurde. Für unsere Geschichte ist das insofern wichtig, als der Zug von Komárno nach Bratislava durch ungarischsprachiges Gebiet fuhr. Für meine Eltern bedeutete dies, dass wir weniger auffallen würden.
Wir stiegen in den Frühzug und richteten uns für die Fahrt nach Bratislava ein. Meine Mutter holte eine Salami heraus und begann, meine Schwester mit Wurstscheiben zu füttern. Da beugte sich ein Mitreisender herüber und flüsterte ihr zu: „Stecken Sie das weg, das ist eine ungarische Salami!“ Bei einer Fahrt durch eine Region, in der man Slowakisch spricht, wären wir vermutlich sofort verhaftet worden. Ungarische Salami war in der Slowakei nicht zu bekommen, aber das hier war der ungarische Landesteil. Der Mitreisende hatte uns als Flüchtlinge erkannt und brachte uns Sympathie entgegen, sodass wir gewarnt waren und gerettet waren. Diese Geschichte hat mir die geopolitische Bedeutung einer Salami gezeigt.
Unsere Schmuggler waren Spezialisten – die einen arbeiteten nur mit Booten, die anderen nur mit Zügen. Die nächsten Schleuser sollten wir im Zug treffen, sie würden uns dann nach Bratislava bringen. Die Familie teilte sich auf: Mutter und die Kinder saßen zusammen, mein Vater – als Hauptziel – reiste allein. Er sollte den Schleuser erkennen und mit ihm Kontakt aufnehmen, aber leider gab es keine eindeutige Absprache, wie man sich erkennen würde, oder mein Vater hatte sie vergessen. Wie er da so alleine im Zug sah, entdeckte er jemanden, der wie ein Schleuser aussah. Mithilfe einer Reihe von Gesichtsausdrücken, Schulterzucken und vagen Gesten stellte mein Vater eine Frage, die der vermeintliche Schleuser beantwortete, wobei wohl nur Gott weiß, wie seiner Meinung nach die Frage lautete. Mit einem Kopfzucken signalisierte mein Vater, dass er nun aussteigen würde. Der Schleuser nickte leicht und stand auf, meinen Vater im Schlepptau. Unterdessen hatte meine Mutter am anderen Ende des Waggons den echten Kontakt ausgemacht. Zu spät erkannte sie, was mein Vater vorhatte: Als sie sich umdrehte, sah sie meinen Vater noch aus dem Zug steigen und erkennen, dass er es mit einem ganz gewöhnlichen Passagier zu tun hatte. Der Zug fuhr ab, mein Vater stand auf dem nördlichen Ufer der Donau, mitten in der Slowakei, allein. Nicht gut. Nur im Film laufen verdeckte Operationen völlig reibungslos ab.
Wie mein Vater uns wiedergefunden hat, habe ich nie ganz begriffen, aber letztlich schafften wir es alle nach Bratislava und schlossen uns im Keller einer jüdischen Schule anderen jüdischen Flüchtlingen an. Wochenlang hockten wir dort, während unsere israelischen Kontakte weitere jüdische Flüchtlinge einsammelten. Der tschechischen Geheimpolizei wird klar gewesen sein, dass wir dort waren, denn das Gebäude stand mitten in der Stadt und immer wieder gingen dort Menschen hinein, die nicht wieder auftauchten. Ganz offensichtlich hatte Stalins Abmachung mit David Ben-Gurion noch Bestand, insofern waren wir für den Moment sicher.