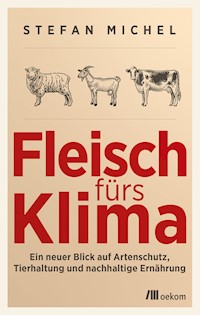Stefan Michel
Fleischfürs Klima
Ein neuer Blick auf Artenschutz,Tierhaltung undnachhaltige Ernährung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2023 oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Waltherstraße 29, 80337 München
Lektorat: Maike BraunKorrektorat: Petra KienleUmschlaggestaltung: Stefan Hilden, hildendesign.deUmschlagabbildung: © HildenDesign unter Verwendung eines Motives von Shutterstock.com/Irina TrusovaFolgende Bilder sind © Deutsches Tierschutzbüro e.V.: Sau im Kastenstand; Putenmast; Kaninchenmast
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-98726-218-0
Inhalt
Verschiedene Vorworte
Kapitel 1 Was soll das sein: Nachhaltiger Fleischkonsum?
Kapitel 2 War früher alles besser?
Kapitel 3 Grünland ist kostbar – aber warum?
Kapitel 4 Ist der Mensch von Natur aus Veganer?
Kapitel 5 Wie viel Fleisch verträgt der Mensch?
Kapitel 6 Wie viel Fleisch verträgt der Planet?
Kapitel 7 Einfach Bio – alles gut?
Kapitel 8 Dann eben Fisch?
Kapitel 9 Das ganze Tier muss es sein
Kapitel 10 Für die Katz (und den Hund)
Kapitel 11 Einkaufszettel für ungeduldige Leser*innen
Kapitel 12 Das Schandmal der EU: Agrarpolitik
Kapitel 13 Ekelhaft: Fleisch aus der Mastfabrik
Kapitel 14 Die Agrarlobby – organisierte Kriminalität?
Kapitel 15 Vom Wald auf den Teller: Wild
Kapitel 16 Glückliche Hühner und kleine Grasfresser
Kapitel 17 Schwein gehabt
Kapitel 18 Grünland ist kostbar – aber welches?
Kapitel 19 Methan rülpsende Klimaschützer: Rinder
Kapitel 20 Stiefkinder der Agrarlobby: Schäfer*innen
Kapitel 21 Und jetzt: Die Agrarwende!
Nur ein Schlusswort
Quellen und Anmerkungen
Über den Autor
Verschiedene Vorworte
»Fleisch ist ein Stück Lebenskraft.«
Werbeslogan der Centralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft, CMA; inzwischen aufgelöst
»Wenn Fleisch produziert wird, ohne die Gesundheit der Bevölkerung und der Beschäftigten zu gefährden, also ohne flächendeckende Antibiotika und ohne Sklavenarbeit – dann wird es teurer werden.«
Jürgen Trittin, Ex-Bundesumweltminister, 2020
»Kühe gehören auf die Weide.«
Bärbel Höhn, Ex-Landesumweltministerin, 2015
»Auf dem schönsten Fleisch sitzen gerne Schmeißfliegen.«
Redewendung
»Alles Fleisch ist Gras, all seine Pracht wie die Blume der Flur.«
Bibel, Jesaja 40, Vers 6
»Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf Dauer nur krank werden.«
Uli Hoeneß, Fußballmanager und Wurstfabrikant, 2021
»Wenn da vor zehntausend Jahren, als sie die Mammuts gejagt haben, auch die veganen Cevapcici zum Aufreißen herumgelegen wären, gäbe es Mammuts vielleicht heute noch.«
Thomas Müller, Fußballer und Vegankostförderer, 2022
»Verboten ist euch Fleisch von verendeten Tieren, Blut, Schweinefleisch und Fleisch, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen wurde …«
Koran, Sure 5, Vers 3
»Fleisch ist mein Gemüse«
Filmtitel, Christian Görlitz, 2008
»Wenn wir die Rinder abschaffen, dann haben wir klimatechnisch nichts gewonnen.«
Martin Schulz, Landwirt, 2021
»Vegetarier essen keine Tiere, aber sie fressen ihnen das Futter weg.«
Robert Lemke, Fernsehunterhalter, 1974
»Ohne Kurswechsel wächst die Fleischproduktion bis zum Jahr 2029 noch einmal um 40 Millionen Tonnen auf dann insgesamt 360 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr. Die Folgen kann man sich kaum vorstellen, weil bereits jetzt die ökologischen Grenzen unseres Planeten überschritten werden …«
Fleischatlas 2021
»Antibiotika-Einsatz und industrielle Tierhaltung sind zwei Seiten einer Medaille.«
Rupert Ebner, Tierarzt, 2021
»Reden auf Vegetarierbanketten sind erfreulich kurz, weil man Angst hat, dass sonst das Essen verwelkt.«
Mario Adorf, Schauspieler, 1993
»Wer eine Tierquälerei begeht, wird bestraft, wer sie tausendfach begeht, bleibt straflos und kann sogar mit staatlicher Subventionierung rechnen.«
Jens Bülte, Strafrechtler, 2018
Ich habe in ungezählten Gesprächen über das Thema Fleisch noch Hunderte andere Argumente und Polemiken gehört. Diese habe ich in vier Bündeln zusammengepackt und vier fiktiven Personen zugeordnet. Horst, Nadine, Patrick und Ellen gibt es nicht. Aber die meisten ihrer Aussagen sind tatsächlich so gefallen.
Der Fleischesser
Horst: »Endlich spricht mal einer aus, dass man was Anständiges zwischen den Zähnen braucht, wenn man anständige Arbeit leisten will. Man kommt sich ja inzwischen vor wie ein Sittenstrolch, wenn man sich in der Kantine seinen Teller Gulasch holt. Diese ganzen ältlichen, verhärmten, dürren Veganerinnen glotzen einen an, als hätte man ihrem depressiven Dackel auf den Schwanz getreten. Von diesem ganzen Salatkram mit Böhnchen hier und Radieschen dort oder Blumenköhlchen frittiert, Möhrchen vom Grill – wer soll denn davon satt werden? Auf den Grill gehören Würste, Steaks, Koteletts, von mir aus auch Forellen. Man verheizt doch keine Holzkohle, um darauf Möhrchen und Zucchini-Viertelchen schwarz werden zu lassen. Was ist das denn für eine Energieverschwendung? Jetzt bieten sie in der Kantine auch noch vegane Fritten an, so als hätten sie die Fritten vorher aus dem Schweinebauch geschnitzt. Und vegan belegte Brötchen, mit einer undefinierbaren Schmiermasse zwischen Salatblatt und Tomatenscheibe, wahlweise grau oder rötlich. Wer will denn so was freiwillig essen? Auf ein Pausenbrot gehören ein paar Lagen Wurst oder Schinken oder eine anständige Scheibe Käse.«
Lieber Horst, ich fürchte, dieses Buch wird dir wenig Freude bereiten. Denn an deinem Fleischkonsum kann ich kein gutes Haar lassen. Du schadest damit wahrscheinlich deiner Gesundheit – gut, deine Sache. Vor allem aber ist dein Fleischhunger absolut ruinös für unseren Planeten. Es hört sich so an, als läge dein Fleischkonsum noch weit über dem deutschen Pro-Kopf-Konsum von rund 55 Kilogramm pro Jahr. Und der ist schon irrwitzig. Wenn man da noch Säuglinge und Veganer*innen herausrechnet, liegt er zwischen 56 und 57 Kilogramm. Und du isst fast jeden Tag zwei Fleischportionen, mittags und abends? Plus reichlich Wurst, Schinken, Käse auf den Pausenbroten? Dann liegst du wohl eher bei 110 Kilogramm pro Jahr. Übrigens: Die »ältlichen, verhärmten, dürren Veganerinnen« gibt es sicherlich auch. Aber die meisten Veganerinnen und Veganer sind junge, lebensfrohe, wohl genährte Menschen. Die bekommst du vielleicht nicht zu Gesicht, weil sie in deiner Kantine gar nicht erst auftauchen.
Die Gesundheitsbewusste
Nadine: »Wurst, Leberkäse, Frikadellen und so etwas kommt bei uns gar nicht auf den Tisch. Wenn Fleisch, dann nur Hühner- oder Putenbrust, auch mal Schweinemedaillons oder Rinderfilet. Und wir haben nicht nur einen, sondern meistens zwei Veggiedays pro Woche.«
Liebe Nadine, zwei Veggiedays, das ist ja schon mal ein ganz gutes Signal für die Umwelt und das Klima. Obwohl – anders herum, also mit ein bis zwei Meatdays pro Woche, würde es eher passen. Ansonsten habe ich aber den Eindruck, dass Klima-, Arten- und Tierschutz bei dir auf der Strecke bleiben.
Dein Rinderfilet macht gerade einmal 1,3 Prozent vom Gewicht des Tieres aus und 2,2 Prozent von seinem Fleisch. Und mit dem Filet für deine Schweinemedaillons interessierst du dich nur für 1,3 Prozent des Schweinefleisches. Deine Hühnerbrust macht auch nur ein Fünftel des Tieres aus. Ich finde, das geht nicht, nicht den Tieren und nicht der Umwelt gegenüber. Tiere lässt man doch nicht nur für einige wenige Prozent ihres Körpergewichts töten und verschmäht den Großteil dann! Frei nach dem Motto: Sollen doch Typen wie der Horst den Rest essen? Oder die in den armen Ländern, die haben doch so oft Hunger?
Ein ganzes im Backofen gebratenes Huhn ist auch als Ganzes eine Köstlichkeit, einschließlich der kross gebratenen Haut. (Ich werde Hühner trotzdem nicht als nachhaltig empfehlen, doch dazu später.) Ebenso lecker ist eine mit Wurzelgemüsen geschmorte, durchwachsene Beinscheibe vom Rind oder eine Pastete aus verschiedenen Innereien. Schmeckt besser als ein schnell mal in die Pfanne geworfenes mageres Filet oder eine Geflügelbrust, denn das Fett ist Aromaträger. Zugegeben: Dafür braucht man mehr Zeit und mehr Kochkenntnis.
Ach ja, die Gesundheit: Tatsächlich wird bei verschiedenen Krankheiten geraten, tierisches Körperfett ganz zu meiden. Aber Nadine, wenn du gesund bist, dann kannst du das völlig vernachlässigen, denn die Menge an Fleisch, die ich als nachhaltig empfehle, die kann dich weder krank noch dick machen.
Der Vegetarier
Patrick: »Ich esse überhaupt kein Fleisch, auch keine Hähnchen und keinen Fisch. Denn ich finde, dass wir kein Recht haben, Tiere zu töten, nur damit wir etwas zu essen haben, das wir für unsere Ernährung gar nicht brauchen. Gemüse und Obst sind sowieso gesünder als Fleisch. Und das nötige Eiweiß kann man doch auch als Milch, Quark, Käse, Eier und so weiter zu sich nehmen, dafür braucht man keine Tiere zu töten.«
Lieber Patrick, was passiert mit der Kuh, wenn sie (zumindest in der agrarindustriellen Haltung) nach vier Lebensjahren ausrangiert wird? Sie wird getötet, zu Hackfleisch, Wurst und Tierfutter verarbeitet. Und was geschieht mit dem Huhn, wenn es nach einem Jahr weniger Eier legt als von ihm erwartet wird? Es wird getötet und kommt im günstigsten Falle als Suppenhuhn auf den Markt. Deine Kuh, die dir Milch, Quark und Käse liefert, warf vor ihrer Schlachtung ein bis zwei männliche Kälber, die in einen Maststall verfrachtet wurden, bis sie dann geschlachtet und als Kalb- oder Rindfleisch vermarktet worden sind. In jedem zweiten Ei wartet ein männliches Embryo darauf, ein Hahn zu werden. Die männlichen Küken wurden bis Anfang 2022 in den allermeisten Fällen am selben Tag vergast und geschreddert. Seither werden die Eier mit den männlichen Embryonen schon vor dem Schlüpfen aussortiert. Du wirkst also am Töten von Tieren genauso mit wie jeder Fleischesser. Und – jetzt werde ich etwas zynisch: Du weigerst dich aber um deines guten Gewissens willen das Fleisch zu essen, das du selbst erzeugt hast. Das überlässt du dann Fleischessern wie Horst und mir.
Es gibt sicherlich Gründe, kein Fleisch zu essen. Zum Beispiel religiöse Gründe. Oder weil einem Fleisch einfach nicht schmeckt. Oder weil man findet, wir Menschen dürften keine Tiere töten. Wer aus diesen oder noch anderen Gründen Fleisch ablehnt, der möge aber dann konsequenterweise bitte auch auf Milch, Quark, Käse, Eier und so weiter verzichten, sonst ergibt der Verzicht auf Fleisch überhaupt keinen Sinn – nicht fürs Tierwohl, nicht für die Umwelt und nicht für unseren Planeten.
Die Veganerin
Ellen: »Als Kind habe ich ständig Fleisch bekommen. Bratwurst, Hähnchen, Rollbraten, Gulasch, fast jeden Tag. Und ich fand es total lecker. Als ich dann erfahren habe, was sie mit den Tieren machen und welchen Schaden das in unserer Umwelt anrichtet, habe ich beschlossen, auf Fleisch ganz zu verzichten. Ich habe mich dann mit vegetarischer Küche beschäftigt und dabei die vegane Küche entdeckt. Seit fünf Jahren verzichte ich vollständig auf alles Tierische, auch bei der Bekleidung. Und ich muss sagen: Mir fehlt gar nichts. Ich koche gerne, liebe gutes Essen und fühle mich pudelwohl.«
Liebe Ellen, großartig! Umweltbewusster kann man sich kaum ernähren – zumal du vermutlich auch die drei ehernen Grundsätze des umweltbewussten Lebensmitteleinkaufs beachtest: Bio, regional (also keine weiten Transportwege) und saisonal (also möglichst jenes Gemüse und Obst, das zu der Jahreszeit gerade bei uns draußen wächst). Folglich wirst du auch keinen Fleischersatz aus genmanipuliertem brasilianischen Soja kaufen, für das Regenwald vernichtet wurde. Danke! Besser geht es kaum. Kaum? Aber ja, ein kleines bisschen besser als komplett vegan zu leben geht es meiner Meinung nach doch noch: durch den Verzehr einer sehr bescheidenen Menge an Fleisch ausschließlich von solchen Tieren, deren Haltungsweise dem Artensterben und der Klimaerwärmung entgegenwirkt. Maßvoller, nachhaltiger Fleischkonsum eben.
Kapitel 1
Was soll das sein: Nachhaltiger Fleischkonsum?
Unsere Vor-Vor-Vorfahren jagten Wildrinder, Wildschafe und Wildziegen, brieten sie über dem Feuer und aßen ihr Fleisch, so wie sie es mit vielen anderen Wildtieren auch taten. Bis sie auf die Idee kamen, Rinder, Schafe und Ziegen zu zähmen, sie bei sich aufzunehmen und für sie zu sorgen, weil sie davon viel mehr hatten als nur jeweils eine üppige Fleischmahlzeit.
Denn diese Tiere haben den Menschen eine zusätzliche, reiche Nahrungsquelle erschlossen, die sonst nicht zur Verfügung stünde. Da sie sich von Gräsern und anderen Wildpflanzen, die für uns ungenießbar sind, ernähren, fressen sie uns nichts weg, von dem wir selbst satt werden könnten. Ihre Milch und ihr Fleisch jedoch, die aus dem für uns sonst nutzlosen Pflanzenmaterial entstehen, liefern uns tierisches Eiweiß. Das war ehemals besonders wichtig in den kalten Jahreszeiten, in denen auf Äckern und Feldern nichts Essbares wuchs.
Mit den Weideflächen und den Heuwiesen fürs Winterfutter sind über die Jahrhunderte strukturreiche Landschaften entstanden, die es ohne diese Nutztiere nicht gäbe. Von den Almwiesen in den Alpen über die sattgrünen Weiden der Mittelgebirge bis zum Grünland hinter den Deichen im Norden sind sie nicht nur eine Augenweide für uns Menschen. Sie sind auch ein Schatz der Artenvielfalt: einer Vielfalt an Pflanzen, Schmetterlingen, Heuschrecken, Käfern, Kleinsäugern und Vögeln, die allesamt auf oder von dem Grünland leben.
Hinzu kommt, dass Grünland, wenn es dauerhaft beweidet oder als Heuwiese genutzt wird, ein hervorragender Kohlenstoffspeicher ist und auch viel CO2 aus der Atmosphäre holt. Gesundes Grünland ist für den Klimaschutz so wertvoll wie ein gesunder Laubwald. Weideland steht in aller Regel auch nicht in Konkurrenz zum Acker- oder Gartenbau, zur Erzeugung von direkt für den Menschen verwertbaren Lebensmitteln. Bei Weideland handelt es sich ganz überwiegend um Flächen, die kaum als Ackerland taugen, weil sie zu mager sind oder zu steil oder in ungünstigen Klimazonen liegen. Das trifft auf die Almen in den Alpen ebenso zu wie auf die Weiden und Wiesen in den Mittelgebirgen oder die salzigen Böden der Halligen an der Küste.
Seit ungefähr den 1960er-Jahren fällt das Grünland, diese kostbare Ressource für Artenvielfalt und Klimaschutz, immer schneller den Machenschaften der Agrarlobby zum Opfer. Die Wiederkäuer, die uns doch schadlos um eine zusätzliche Nahrungsquelle bereichert hatten, sind größtenteils von den Weiden in die Ställe verbannt worden. Und statt nur mit dem natürlichen Grün, für das ihr Verdauungsapparat geschaffen ist, werden sie auch mit eigens dafür angebauten energiereichen Pflanzen gefüttert. In unseren Breiten ist Grünland umgepflügt und somit zerstört worden, um Mais, Raps und Getreide als Viehfutter anzubauen. Rinder fressen außerdem Sojaschrot, für dessen Anbau Wald in Südamerika vernichtet wird. Sie werden mit Nahrungsmitteln gequält, die für uns Menschen bestens geeignet wären, aber Wiederkäuern Verdauungsprobleme bereiten. Und das alles, damit sie mehr Milch geben oder schneller ihr Schlachtgewicht erreichen.
Kein Kunstdünger, kein Kraftfutter
Angesichts von acht Milliarden Menschen auf der Erde, von denen zwei Milliarden mangelernährt sind, ist es absolut unverantwortlich, mehrere Kilogramm pflanzlicher Lebensmittel zu vernichten, um daraus ein einziges Kilogramm Fleisch zu gewinnen.
Aber noch gibt es ja zum Glück Fleisch, Milch und Milchprodukte von Rindern, Schafen und Ziegen, die draußen weiden beziehungsweise im Winter im Stall mit dem Mähgut von naturbelassenen Wiesen gefüttert werden. Und diese Produkte sollten wir kaufen!
Fleisch und Milchprodukte aus nachhaltiger Produktion müssen von Tieren stammen,
♦ die nicht mit für Menschen geeigneten Lebensmitteln gefüttert werden,
♦ die nicht mit Futter von eigens dafür angelegten Äckern gefüttert werden (etwa mit Turbogräsern und Hochleistungsklee, Futtermais oder Raps),
♦ die auf Grünland weiden und (fast) ausschließlich mit Mähgut von Grünland gefüttert werden. Im nachhaltigen Futter können auch Anteile einer Zwischenfrucht vom Acker sein, wenn diese Zwischenfrucht dazu dient, dem Boden eine Pause zu gönnen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um Hülsenfrüchte (Leguminosen) wie Rot- und Weißklee, Lupinen und Luzerne oder eine Mischung von Leguminosen, anderen Krautpflanzen und Gräsern,
♦ deren Weideland und deren Heuwiesen ausschließlich mit dem Kot und Urin dieser Tiere gedüngt werden, nicht aber mit Mineraldünger oder Gülle aus anderen Betrieben,
♦ deren Weideland und deren Heuwiesen nicht mit Pestiziden behandelt werden,
♦ die so gehalten werden, dass nur Einzeltiere im Krankheitsfall mit Antibiotika behandelt werden,
♦ deren Fleisch nicht um den halben Erdball transportiert, sondern regional vermarktet wird,
♦ oder von Wildtieren, die nicht gefüttert und nur in einem Maße gejagt werden, in dessen Folge der Naturhaushalt nicht beeinträchtigt wird.
Es ist nicht ganz einfach, nachhaltige tierische Produkte aufzutreiben. Aber zumindest Milchprodukte und Fleisch, bei denen es schon mal in die richtige Richtung geht, sind recht unkompliziert zu finden. Damit meine ich Fleisch und Milchprodukte von Rindern, Schafen und Ziegen, die zumindest im Sommer draußen weiden, die aber außer Gras zwecks Leistungssteigerung auch Getreide, Mais und Hülsenfrüchte bekommen. Das ist nicht komplett nachhaltig, aber dem Grünland und der Artenvielfalt zuliebe vertretbar. Und wenn Sie ganz konsequent sein wollen, dann leben Sie einfach so lange vegan, bis Sie die gewünschten nachhaltigen Tierprodukte gefunden haben. Also etwa Fleisch von Tieren, die wirklich nur frisches Gras, Heu und Grassilage*) bekommen haben.
*) Silage ist vergorenes Grünfutter, vor allem Gras, Mais (ganze Pflanze) und Leguminosen. Durch das Silieren des gemähten Grases entfällt das Risiko, dass das Mähgut bei einer Regenperiode auf der Wiese verfault.
Kapitel 2
War früher alles besser?
Wie hat es früher in unseren Dörfern ausgesehen? Falls Sie nicht bereits im Rentenalter sind, werden Sie das Bild wahrscheinlich nur aus Kinderbüchern kennen. Oder vielleicht von einer Reise durch eine der ärmeren ländlichen Regionen Europas, etwa durch Polen oder Rumänien, wo es heute noch vielerorts ungefähr so aussieht wie bis zum Ende der 1960er-Jahre in Westdeutschland – in der DDR ergab sich infolge der Kollektivierung zu dieser Zeit schon ein ganz anderes Bild.
Ich kann auf das Dorf in Mittelhessen, aus dem mein Vater stammt, zurückschauen, so wie ich es im Jahr 1968 als Neunjähriger erlebt habe: In jedem vierten Haus gibt es einen Stall und davor einen Misthaufen, auf dem jeweils ein Dutzend Hühner und ein Hahn herumturnen, scharren und picken. Wenn eine Familie hauptsächlich von ihren Kühen und Schweinen lebt, dann ist ihr Stall groß. Aber die Familie meines Vaters hat nur einen kleinen Stall und nur zwei Kühe. Dazu manchmal noch ein Kalb und zwei Schweine, hin und wieder auch drei. Denn diese Familie, deren Mitglied ich in den Ferien bin, lebt vor allem von der Dorfschmiede. Die Landwirtschaft ist hier Nebensache.
Zwei Drittel der Ställe und Misthaufen im Dorf sind schon verschwunden, erzählt mir mein Cousin, der Junior-Schmied. Die Männer haben Arbeit in Industriebetrieben gefunden und die Landwirtschaft aufgegeben. Die Alten erzählen vom Fischreichtum des Flusses am Dorfrand in früheren Zeiten: Im Frühherbst habe es derart von Lachsen gewimmelt, dass die Bauern sie mit der Mistgabel erlegten. Knechte und Mägde hätten sich ausbedungen, dass sie während des »Lachszuges« auch etwas anderes als Lachs zu essen bekommen. Angler aus dem Ruhrgebiet und sogar aus England seien ins Dorf eingefallen, um Lachse zu erbeuten. Damit hatte es kurz vor dem Ersten Weltkrieg jedoch ein Ende, weil flussabwärts eine Staumauer errichtet worden war.
Die beiden Kühe bekomme ich nur im Stall zu Gesicht. Wenn sie ab und zu einmal herauskommen, dann nur zum Arbeiten: Sie müssen den Pflug ziehen und den Wagen mit der Ernte, mit Heu, Kartoffeln, Steckrüben, Roggen, Hafer oder Weizen. Das Heu bekommen die Kühe das ganze Jahr über zu fressen, dazu kleingehäckseltes Haferstroh, sonst nichts.
In einem kleinen Raum zwischen Stall und Küche brodelt es alle paar Tage in einem gewaltigen Kessel. In ihm wird über dem Feuer die Schweinemahlzeit zubereitet. Im Trog landen natürlich die nahrhaften Küchenabfälle wie Kartoffelschalen und Kohlstrunke und auch die Reste von unserem Essen. Aber auch Frisches vom Feld kommt in den Schweinekessel, nämlich Kartoffeln, Steckrüben und andere Feldfrüchte und außerdem die Kleie, also die Schalen von den Getreidekörnern, die beim Dreschen übrig bleiben.
In den Stall wird regelmäßig Stroh eingestreut, sodass Kühe und Schweine nicht auf dem nackten Boden liegen müssen. Alle paar Wochen, wenn die Einstreu schon eine ziemlich dicke Schicht gebildet hat, wird ausgemistet. Und der Misthaufen im Hof wächst wieder ein Stück höher.
Ich schaue gerne zu, wenn die beiden Kühe von Hand gemolken werden, aber selbst kann ich das nicht. Ein bisschen von der Milch zweigen wir für uns ab und für die Katze. Der Rest wird in Kannen zum Dorfsammelplatz gekarrt, wo der Molkereiwagen sie abholt.
Einmal im Jahr kommt der Hausmetzger auf den Hof und eines der Schweine muss daran glauben. Draußen im Hof wird es geschlachtet, zerlegt und verwurstet. Anschließend gibt es ein Festessen.
Ein Teil des Fleischs und der Wurst wird an eine Metzgerei verkauft. Der Rest kommt für den Eigenbedarf in die Räucherkammer. Auf dem eigenen Hof gibt es zwar keine, aber im Nachbarhaus. Hier wohnen zwei Frauen, die immer mit Buchenholz heizen. Mit ihrer Räucherkammer verdienen sie ein bisschen Geld. Das Kalb und das zweite (oder dritte) Schwein werden an einen Schlachter verkauft.
Die Hühner finden im Misthaufen allerlei leckere Sachen: Getreidekörner, die nach dem Dreschen in der Stalleinstreu gelandet sind, Würmer, Käfer, Insektenlarven. Aber natürlich werden sie davon auch nicht richtig satt. Deshalb bekommen sie auch noch Hafer vom Hof und gekauftes Futter, das Muschelkalk enthält, damit die Eierschalen nicht brechen.
Vom Hof führt eine Holztür mit einem herzförmigen Fensterchen zum Plumpsklo. In die Grube darunter fließt der Urin von den Stalltieren und für die Menschen ist es die einzige Toilette. Wenn die Grube voll und der Misthaufen zu hoch geworden ist, werden Jauche und Mist auf den Äckern und Heuwiesen und im Garten verteilt. Mehr Dünger gibt es nicht. Nun ja, der Onkel experimentiert ein bisschen mit Kunstdünger, also: Mineraldünger, den es seit ein paar Jahren zu kaufen gibt. Er streut Blaukorn, das viele verschiedene Nährstoffe enthält, und Thomasmehl, das ist Phosphat aus der Stahlindustrie, und Kalk-Stickstoff-Dünger. All das verteilt er von Hand auf den Äckern. Pestizide gibt es auch schon, aber nur die großen Betriebe setzen sie ein.
So wie ich das Landleben 1968 erlebe, ist es ein schwindendes Paradies, dem wir nachtrauern und das wir zurückerobern müssen: tiergerecht, menschengerecht und vor allem umwelt- und klimaschonend, also nachhaltig? Jein!
Jedenfalls erlebe ich noch ein Vogelparadies. Überall lärmen Horden von Feldsperlingen. Aus allen Richtungen tönt hoch oben aus der Luft der sirrende Gesang der Feldlerchen. Die Spatzen wird es auch 50 Jahre später noch geben, aber nur noch einen Bruchteil von ihnen. Fast zwei Drittel der Feldlerchen werden dann verschwunden sein. Und der Kiebitz, dieser schwarzweiße Luftakrobat mit der Federhaube, wird in dieser Gegend in Mittelhessen bald aussterben.1 Die Anfänge des Artenschwunds reichen aber weit hinter die Zeit meiner Kindheit zurück. »Seine höchste Diversität an Arten und Pflanzengesellschaften hatte das Grünland zumeist bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Erst seit etwa 150 Jahren überwiegt der gegenläufige Prozess der Artenverarmung.«2
Das Tierwohl? Ein schöneres Leben für Hühner kann es kaum geben, als den ganzen Tag auf dem Misthaufen herumzuturnen. Den zwei bis drei Schweinen auf dem Hof meiner Verwandten geht es mit Sicherheit besser als 95 Prozent aller Schweine 50 Jahre später. Sie haben mehr Platz, Tageslicht, laufen und schlafen auf Stroh und haben keinen Stress, wenn auch keinen Auslauf im Freien. Auch die Kühe haben es weitaus besser als die Mehrzahl ihrer Artgenossinnen in den »modernen« Milchbetrieben.
Nachhaltig? Nein, natürlich ist die Schweine- und Hühnerhaltung auch schon zu dieser Zeit nicht nachhaltig, weil die Tiere mit Nahrungsmitteln gefüttert werden, die auch Menschen satt machen könnten. Das ist bei Schweinen und Hühnern auch kaum anders möglich.
Das fällt aber zu dieser Zeit noch nicht so sehr ins Gewicht wie heute, weil es 1968 noch viel weniger Menschen gibt, die ernährt werden müssen: In Deutschland wird die Bevölkerung von 1968 bis 2022 von 78 Millionen (BRD und DDR) auf 84 Millionen anwachsen, in Österreich von 7,4 auf neun Millionen, in der Schweiz von 6,0 auf 8,8 Millionen und weltweit von 3,5 auf acht Milliarden.
Die vielen Vögel und ihr munteres Gezwitscher werden zwar einige natursensible Dörfler*innen vermissen. Von einer so kleinteiligen Landwirtschaft wie in dieser Zeit könnte 50 Jahre später aber niemand mehr leben. Jedenfalls nicht, ohne auf den üblichen Lebensstandard mit Auto, Flachbildfernseher, Computer und Urlaubsreisen zu verzichten.
1968: Ich freue mich in den Ferien einmal mehr über die Blütenpracht und die vielen Vögel rund ums Dorf. 1968, das ist auch das Jahr der Studentenrevolte, einer Revolte dagegen, dass die Elterngeneration um jeden Preis die Verbrechen während der NS-Diktatur vergessen will, durch Konsum, »Volksmusik« und seichte Fernsehunterhaltung. Es ist eine Revolte gegen den Muff aus Kaiser- und Nazizeit an den Universitäten, Alt-Nazis in der Politik und der Justiz, eine Revolte gegen Kleingeistigkeit, kirchengeprägte Sexualmoral und Intoleranz. Für das drohende ökologische Inferno hat diese Bewegung noch keine Antenne.
1968 gründet sich auch der Club of Rome, eine Organisation von Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Fachgebieten und mehr als 30 Ländern. 1972 wird er seinen Report Die Grenzen des Wachstums veröffentlichen. Darin wird bereits alles beschrieben sein, was uns und unserem Planeten bevorsteht, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher.
Das wird aber keine Regierung auf der Welt, keine demokratische und keine diktatorische, zum Umdenken veranlassen. Immerhin wird der Bericht bei den politischen Gruppen ankommen, die während der 1970er-Jahre der Studentenbewegung nachfolgen werden, etwa den Bürgerinitiativen gegen Atomkraft. Innerhalb dieser Bewegungen soll auch die Agrarpolitik schon eine gewisse, aber noch keine zentrale Rolle spielen: Etliche der Aktivist*innen werden sich schon für Anbau und Vertrieb biologisch erzeugter Lebensmittel einsetzen, viele andere finden diese Anliegen der »Müslifresser« dagegen zu unpolitisch.
1953 trat das Flurbereinigungsgesetz in Kraft. Damit sollte die Kleinteiligkeit der landwirtschaftlichen Nutzflächen beseitigt werden, die vielerorts über Generationen durch Erbteilung entstanden war: Durch den Tausch der Grundbesitztitel entstehen aus vielen kleinen Feldern, Äckern und Weiden große, zusammenhängende Flächen, die sich besser mit Maschinen bearbeiten lassen. Die Folgen: Seit Mitte der 1960er-Jahre werden aus den bunten Flickenteppichen der Agrarlandschaft zunehmend größere eintönige Flächen. Baumreihen und Hecken verschwinden, obwohl sie überaus wichtig sind für die Artenvielfalt und den Schutz der Böden vor Erosion. Staunasse Wiesen werden trockengelegt, Bäche kanalisiert. Die Flurbereinigung schafft großflächig »Nutzungseinheiten, wie sie für eine industrielle Landwirtschaft notwendig sind. Gleichzeitig wurde die Grünlandnutzung auf ertragsarmen Standorten aufgegeben, wodurch die Flächen verbuschten oder vielfach aufgeforstet wurden.«3
In die gleiche Richtung zielt auch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die 1962 rechtskräftig wurde. Damit will der zunächst aus sechs Staaten bestehende Vorläufer der Europäischen Union die Selbstversorgung seiner Bevölkerung mit Lebensmitteln sichern. Und zwar, indem »die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des technischen Fortschritts, Rationalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz der Produktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskräfte«4 gesteigert wird.
Um 1968 spielen Antibiotika, diese Lebensretter der Humanmedizin, allmählich auch bei der Behandlung von Tieren eine Rolle. In dieser Zeit kommt außerdem eine besonders schnell wachsende Schweinerasse auf den Markt. Das Problem: Die Muttersauen dieser Rasse geben nicht genug Eisen mit ihrer Milch weiter. Die Pharmaindustrie entwickelt Eisenpräparate, »der erste ›Big Seller‹ der Tierärzte in Deutschland«.5 Dass sich daraus ein gigantischer Arzneimittelhandel entwickeln würde, zwischen Pharmakonzernen als Herstellern, Tierärzten als Dealern und Massentierhaltern als Abnehmern, das ahnt wohl noch niemand.
Auch ungefähr um 1968 herum sorgt das Insektenvernichtungsmittel DDT (Dichlor-Diphenyl-Trichlorethan) für Aufregung, aber nur in den Reihen von Vogelschützer*innen und Landwirtschaftsexpert*innen. DDT wird sich später als eine der ersten großen von der Agrarindustrie verursachten Umweltkatastrophen herausstellen. Das langlebige Gift reichert sich über die Nahrungskette immer weiter an, zunächst etwa bei Nagern, Tauben und Wasservögeln, dann bei den großen Greifvögeln wie Seeadlern und Wanderfalken. Es lagert sich in deren Fettgewebe ein. Die Greifvögel geraten durch DDT an den Rand der Ausrottung. Das ist aber nicht der Hauptgrund, warum die wohlhabenden Länder des Nordens den Einsatz dieses Gifts in der Landwirtschaft ab etwa 1970 einschränken und schließlich verbieten werden. Es mehren sich vielmehr die Indizien dafür, dass es beim Menschen Krebs erzeugt. In vielen armen Ländern des globalen Südens wird DDT auch noch im 21. Jahrhundert versprüht werden.
1968 erscheinen das Landleben und »die Natur da draußen« mir unbedarftem Jungen aus der Stadt noch als heile Welt. Die Weichen für industrielle Massentierhaltung, Degradierung der Böden, Überdüngung von kostbaren Biotopen selbst fern der landwirtschaftlichen Nutzflächen, die Verschmutzung von Bächen, Flüssen und Seen mit Agrarchemikalien, Tierfäkalien und Antibiotika sind aber schon gestellt. Nitrat wird vielerorts das Grundwasser verseuchen. Zudem hat ein nie dagewesenes Artensterben begonnen.
Für die Bauern und Bäuerinnen gilt der Grundsatz: wachsen oder weichen. Wachsen heißt häufig: sich bis in die nächste Generation hinein zu verschulden. Betriebe, die nicht wachsen wollen oder können, müssen fast zwangsläufig weichen. Es gibt bald keine Molkerei mehr, die Milch von einigen wenigen Kühen abholt. Und kaum mehr einen Hausmetzger, der eigens kommt, um nur ein einzelnes Schwein zu schlachten.
Dass sich eine Nebenerwerbslandwirtschaft mit zwei Kühen und drei Schweinen überhaupt nicht mehr rechnet, muss man unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gar nicht bedauern. Denn Nachhaltigkeit ist keine Frage der Betriebsgröße, solange die Zahl der Tiere in einem ausgewogenen Verhältnis zur Größe des Grünlands und der Ackerflächen steht.
Können wir die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft heute stärken, indem wir auf Fleisch (und alle anderen tierischen Produkte) verzichten? Bremsen wir damit auch die Regenwaldvernichtung in Südamerika? Jein, das können wir auch durch den Umstieg auf Biofleisch erreichen. Beenden wir mit dem Verzicht auf tierische Produkte auch die Verseuchung der Gewässer mit Schweinegülle? Ja. Schützen wir durch vegane Ernährung das Klima besser? Jein. Stoppen wir damit den Artenschwund? Nein! Denn für den Erhalt der Artenvielfalt sind nachhaltig bewirtschaftete Viehweiden und Heuwiesen unverzichtbar – und folglich auch die Weidetiere!
Kapitel 3
Grünland ist kostbar – aber warum?
Ellen1: »Warum sollten wir denn Viehweiden brauchen, damit es der Natur gut geht? Wenn kein Fleisch mehr gegessen und keine Milch mehr getrunken wird, dann können wir die Weideflächen doch einfach der Natur zurückgeben und die Natur wird Danke sagen.«
Liebe Ellen, wenn wir das Grünland einfach aufgeben, dann wird daraus mit der Zeit von ganz alleine Wald. In den Mittelgebirgen hätten wir in hundert Jahren fast nur noch Buchenwald und in den Alpen gäbe es statt der Almwiesen fast nur noch Tannen-Fichten-Wald. Das sind zwar sehr schöne Wälder und es gibt auch Lebewesen, die genau darauf spezialisiert sind: im Buchenwald etwa der Schwarzspecht oder der Raufußkauz, der in den Höhlen brütet, die ihm der große Specht gezimmert hat. Der Bergnadelwald ist für den Tannenhäher unentbehrlich. Aber im Laub- oder Nadelhochwald ist die Artenvielfalt verschwindend gering, verglichen mit einer strukturreichen Agrarlandschaft. Außerdem sind die Arten des Walds weit weniger gefährdet als die Arten des offenen Grünlands. Und für den Klimaschutz wäre durch Wald statt Weideland nichts gewonnen. Denn die Bäume können auch nicht mehr Kohlenstoff binden als nachhaltig bewirtschaftetes Grünland.
Dass Grünland für das Klima und den Artenschutz eine bedeutende Rolle spielt, ist in der Forschung und Teilen des Agrarsektors wohl bekannt: »Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die seltenen Arten immer an eine natürliche Entwicklung gebunden sind«, betont Andreas Bolte vom Thünen-Institut für Waldökosysteme. »Alles der Natur zu überlassen, kann unter Umständen auch zu einer Homogenisierung und dem Verlust lichtliebender Arten führen.«2 Martin Schulz, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, erinnert außerdem daran, dass jeder Hektar Grünland jedes Jahr 40 Tonnen CO2 bindet. »Wenn wir das Grünland umpflügen würden, wenn wir die Rinder abschaffen, dann haben wir klimatechnisch nichts gewonnen.«3
Grünland hat für den Klimaschutz eine ebenso große Bedeutung wie Wälder, so hat das Von-Thünen-Institut für Agrarrelevante Klimaforschung bereits 2011 festgestellt: »Bei einer Aufforstung von Ackerflächen steigt zwar der Kohlenstoffgehalt im Boden, allerdings nicht mehr als bei einer Umwandlung in Grünland«. »Wird hingegen Grünland aufgeforstet, führt dies langfristig zu keiner zusätzlichen Kohlenstoffspeicherung im Boden.« Und wie sieht es aus, wenn Wiesen und Weiden unter den Pflug kommen – denn das ist ja die gängige Praxis? »Wird eine Wiese in einen Acker umgewandelt, führt dies zu Humusverlusten von durchschnittlich 35 %.« Eine gewaltige Menge an Kohlendioxyd entweicht dabei innerhalb kürzester Zeit in die Atmosphäre. Soll dagegen aus Ackerland wieder Grünland werden, »kann es Jahrzehnte bis Jahrhunderte dauern, bis sich der Humus wieder angereichert hat.«4
Wegen seiner ganzjährigen Vegetation »ist der Boden im Grünland gegenüber Austrocknung und Erosion durch Wind und Wasser geschützt und verfügt über besonders hohe Humusgehalte sowie eine hohe Wasserspeicherkapazität,« schreibt das deutsche Umweltbundesamt (UBA) auf seiner Website. Grünland leiste dadurch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Es in Ackerland umzuwandeln, belaste die Atmosphäre, »da mit dem Humusabbau verstärkt Nitrat (NO3), Lachgas (N2O) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden«.5
»Auf Grünlandstandorten kommen über die Hälfte aller in Deutschland beobachteten Tier- und Pflanzenarten vor. Damit haben sie große Bedeutung für den Artenschutz und den Erhalt der Artenvielfalt«, erklärt das UBA.5 Manche Arten von Grünland, die über lange Zeit nur extensiv genutzt wurden, gehörten zu den artenreichsten Biotoptypen Mitteleuropas, ergänzt das Bundesamt für Naturschutz (BfN). Kalkmagerrasen zum Beispiel. »Über ein Drittel aller heimischen Farn- und Blütenpflanzen haben ihr Hauptvorkommen im Grünland.« Von den in Deutschland gefährdeten Farnen und Blütenpflanzen seien sogar rund 40 Prozent, nämlich 822 Pflanzenarten, hauptsächlich auf dem Grünland zuhause.6
»Artenreiches Grünland erreicht in Mitteleuropa Spitzenwerte von über 60 Pflanzenarten auf einem Quadratmeter«, schreibt eine Wissenschaftlergruppe um den Biologen Peter Sturm. Hinzu kommt: »Pro Pflanzenart rechnet man als Faustregel mit 8–10 vorkommenden Tierarten.« So seien »80 % der Heuschrecken- und Tagfalterarten in der Schweiz auf Grünland angewiesen« oder darauf spezialisiert.7
Grünland in Ackerland oder Wald umzuwandeln, ist also aus ökologischer Sicht eine schlechte Idee. Doch welche Bedeutung hat es für die Ernährungssicherheit? »Zwei Drittel der globalen Landwirtschaftsfläche sind Dauergrünland«, erklärt der Agrarökologe Urs Niggli. »Auf diesem Land wird das Vieh geweidet. Man könnte es zwar aus der Produktion nehmen. Dann wachsen dort Bäume«, daraus würde aber ein Ernährungsproblem entstehen. »Weil wir ohne diese riesigen Flächen nicht genügend Lebensmittel produzieren können. Wir müssten sie in Ackerland umwandeln. Die Folge wäre eine ökologische Großkatastrophe, denn das würde enorme Mengen CO2 freisetzen und die Biodiversität vollends zerstören.« Fleisch sei gut fürs Klima, »wenn wir das Dauergrünland mit nachhaltiger Viehwirtschaft nutzen und auf diese Weise Milch und Fleisch produzieren.« Das bedeute nicht, dass wir mehr Fleisch essen sollten, »im Gegenteil. Aber wir können auch nicht die ganze Menschheit vegan ernähren.« Dafür gebe es schlicht zu wenig Ackerland.8
Grünland zu erhalten und nachhaltig zu nutzen, ist also unumgänglich, gleichermaßen um die Menschheit ernähren zu können, die Artenvielfalt zu erhalten und das Erdklima zu schützen. Zu einer artenreichen Agrarlandschaft gehören natürlich nicht nur Heuwiesen und Weiden, sondern auch einzelne alte Bäume auf den Weiden, die den Tieren Schatten spenden, Baumreihen und Hecken, die Weiden und Äcker säumen und sie vor Austrocknung und Erosion schützen. Randstreifen entlang von Äckern, Bächen und Wegen, auf denen Wildpflanzen blühen, weil diese Streifen selten oder gar nicht gemäht werden – und niemals gedüngt. Bäche, die nicht kanalisiert und Wiesen, die nicht entwässert sind. Auf den Äckern sollte im einen Jahr diese, im nächsten eine andere Frucht wachsen. Und in manchen Jahren sollten sie brach liegen, damit der Boden sich erholen kann. Dann gedeihen hier Kräuter und Hochstauden, die zahllosen Insekten und Vögeln Nahrung bieten. Auch Hasen finden dann hier Futter, wenn auch nur vorübergehend, bis der Acker wieder unter den Pflug kommt.
Der Fairness halber sei über unsere Agrarbetriebe gesagt: Sie sind zwar derzeit die Hauptverursacher des Artensterbens bei uns in Zentraleuropa. Und sie heizen das Weltklima gewaltig mit an, auch dadurch, dass sie Grünland zu Äckern umbrechen, vor allem für den Maisanbau. Aber andererseits sollten wir nicht vergessen, dass die Vorfahren der heutigen Bauern und Bäuerinnen den Artenreichtum und die Schönheit der Agrarlandschaft (wo es sie noch gibt) überhaupt erst erschaffen haben. Das Problem fasst Tierarzt und Buchautor Rupert Ebner in wenigen Worten zusammen: »Eine über Jahrhunderte von Bauernarbeit geprägte artenreiche Kulturlandschaft verwandelt sich in eine monotone, artenarme grüne Ödnis.«9
Ein Maisacker ist biologisch ebenso tot wie eine Douglasienplantage. Zwischen 2005 und 2012 wuchs die Maisanbaufläche steil an, Grünland wurde zugunsten von Energiemais für die Biogasanlagen vernichtet – ein Irrweg, der zu mehr Klimaschutz führen sollte, aber das Gegenteil bewirkt hat. Dann blieb die Maisanbaufläche für einige Jahre konstant, bis seit 2017 wieder Grünland für Maisäcker geopfert wurde, diesmal nicht für die Biogasanlagen, sondern für Futtermais – für artfremdes Futter, mit dem unsere Kühe vollgestopft werden, damit sie mehr Milch geben.10
Seit 2013 sei der Anteil der Grünlandfläche am Agrarland allerdings wieder leicht gestiegen, so das Umweltbundesamt. »Nach wie vor sind die Ursachen des Grünlandumbruchs jedoch nicht beseitigt. Dies gilt besonders für den Bedarf an ackerbaulichen Futtermitteln« – etwa Futtermais für die Kühe und Hülsenfrüchte für die Schweine, »die Förderung des Anbaus von Energiepflanzen sowie die Nutzungsaufgabe«, also das Höfesterben. »Deshalb ist davon auszugehen, dass das Grünland auch zukünftig unter Druck stehen wird und die Nutzung weiter intensiviert wird. Ein wirksamer Grünlandschutz bleibt damit von herausragender Bedeutung.«5 Dass der Grünlandschwund zunächst gestoppt sei, führt das UBA auf die »Reform« der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) zurück. Darin wird unter dem Schlagwort »Greening« das Ziel erklärt, das Artensterben auf den Landwirtschaftsflächen zu stoppen.
Genau das ist aus Sicht des Europäischen Rechnungshofes aber missgelungen. Die Artenvielfalt auf dem Agrarland sei »seit vielen Jahren rückläufig. Beispielsweise sind die Feldvogel- und Wiesenschmetterlingspopulationen seit 1990 um mehr als 30 % zurückgegangen«, schreiben die Ausgabenwächter*innen der EU eingangs in ihrem Sonderbericht zur Biodiversität landwirtschaftlicher Nutzflächen. Und sie kommen zu einem vernichtenden Urteil über die Agrarreform von 2013 und stellen fest, »dass es an Koordinierung zwischen den politischen Maßnahmen und Strategien der EU mangelt, was u. a. zur Folge hat, dass sie dem Rückgang der genetischen Vielfalt nicht entgegenwirken.« Die Direktzahlungen an die Bauern, 70 % der EU-Agrarausgaben, wirkten sich »nur begrenzt auf die biologische Vielfalt landwirtschaftlicher Nutzflächen aus«. Zwar hätten einige Anforderungen des Greenings »das Potenzial, die biologische Vielfalt zu verbessern, doch haben die Kommission und die Mitgliedstaaten Optionen mit geringen Auswirkungen bevorzugt.«11
Auf das »Greening« und die EU-Agrarreformen komme ich später noch einmal zurück. Werfen wir bis dahin einen Blick darauf, was die Industrialisierung der Landwirtschaft und die Vernichtung von Grünland bislang angerichtet haben. »Die Lage in der Agrarlandschaft bleibt alarmierend«, heißt es in einem Bericht des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), an dem zahlreiche Ornitholog*innen mitgewirkt haben. »Einige Arten der Agrarlandschaft sind mittlerweile so selten, dass sie in immer größeren Bereichen unserer Landschaft fehlen, wie z. B. die Turteltaube.« Auch die einst so häufige Feldlerche sei an vielen Stellen nicht mehr anzutreffen. »Besonders stark haben Rebhuhn und Kiebitz in den vergangenen 24 Jahren abgenommen, beim Wiesenpieper sind drei Viertel der Brutpaare verschwunden. […] Weitere Negativbeispiele betreffen Arten des Feuchtgrünlandes: Bekassine, Uferschnepfe und Braunkehlchen haben über die vergangenen 24 Jahre bundesweit mehr als die Hälfte ihrer Bestände eingebüßt.«12
Deshalb müsse »Grünland unter strengen Schutz gestellt werden und eine Grünlandumwandlung bundesweit untersagt werden«, fordert das BfN. »Vor allem in Flussauen und auf Moorböden sollte ein generelles Grünlandumbruchverbot gelten. Bestehende Ackernutzungen in solchen Gebieten sollten schrittweise in Dauergrünlandnutzung überführt werden.«6
Wie kann Weideland artenreicher sein als Waldwildnis?
Wie kann eine von Menschen gestaltete und ausgebeutete Fläche, das Weideland, kostbarer sein als eine Fläche, auf der die Natur ohne jeden menschlichen Eingriff schalten und walten kann – auf der also nach landläufiger Vorstellung wilder Wald wuchern würde? Das klingt sonderbar, wenn nicht sogar makaber, ist also erklärungsbedürftig. Dafür muss ich etwas ausholen und werde mich dabei auf eine Hypothese stützen, die unbewiesen und nicht wirklich beweisbar ist, für die aber viele Indizien sprechen.
Schauen Sie sich einmal den Dokumentarfilm »Serengeti darf nicht sterben« an, von Ex-Zoodirektor und Fernsehlegende Bernhard Grzimek. Er hat dafür einen Oscar bekommen. Ausschnitte dieser großartigen Filmdokumentation von 1959 sind online verfügbar und den ganzen Film gibt es im Onlinehandel zu kaufen. Sie sehen darin eine Landschaft mit viel offenem Grasland, darauf einzelne Baumriesen, auch Baumgruppen und kleine Wälder, und überall große Pflanzenfresser: Herden von Gnus und Zebras, Trupps von Elefanten und Giraffen. So ähnlich dürfte es vor mehr als 10.000 Jahren auch in Zentraleuropa ausgesehen haben.
Denn damals weideten auch hier bei uns Elefanten, Nashörner und Wildpferde, außerdem Mammuts und Riesenhirsche und zudem die großen Pflanzenfresser, die es auch noch bis in unsere Zeit hinein gab oder immer noch gibt: die Wildrinder Auerochse und Wisent sowie Elche, Rothirsche, Damhirsche und Rehe. Man kann sich bei dieser Vielzahl großer Pflanzenfresser vorstellen, dass sie sich ihren idealen Lebensraum einfach »zurechtgefressen« haben, ähnlich wie die Tiere der Serengeti: also viel offenes Gras- und Buschland geschaffen haben, indem sie nachwachsende Bäumchen abgenagt, die Rinde von den Stämmen der älteren abgeschält oder sie mit ihrer Kraft schlicht umgerissen haben, um an ihre frischen Blätter zu kommen.
Elefanten, Nashörner, Wildpferde, Mammuts und Riesenhirsche sind in unseren Breiten vor etwa 10.000 Jahren ausgestorben – wegen des Klimawandels nach dem Ende der Eiszeit, vermuten die einen. Weil sie von uns Menschen ausgerottet wurden, argumentieren dagegen die Anhänger*innen der Overkill-Hypothese. Womöglich war es auch eine Kombination von beidem. Aber für die Overkill-Hypothese gibt es einige gute Argumente. Unsere europäischen Urahnen waren ausgezeichnete Großwildjäger. Auch in anderen Teilen der Erde traf das Aussterben von Megafauna-Arten zeitlich mit der Besiedlung durch Menschen zusammen, so in Nord- und Südamerika, auf Madagaskar und in Neuseeland.
Vor 13.000 Jahren gelangte der Homo sapiens über die zugefrorene Behringstraße nach Amerika. Tausend Jahre später waren zwei riesige nordamerikanische Pflanzenfresser ausgerottet: das tonnenschwere Riesenfaultier und das Prärie-Mammut. Den Jagddruck durch die Menschen »haben die Mammuts am Ende des Eiszeitalters zusammen mit neuen Klimaänderungen nicht überleben können«, bringt es der Mammut-Experte Dick Mol auf den Punkt. »Das ist der Kipppunkt gewesen.«13
In der Neuzeit haben wir dann erwiesenermaßen den Auerochsen ausgerottet, von dem unsere Hausrinder abstammen. Auch Wisent und Elch haben wir in Zentraleuropa eliminiert. Der Wisent hat in Zoos überlebt, der Elch in Nord- und Nordost-Europa. Die sehr verbreitete Annahme, dass in allen zentraleuropäischen Mittelgebirgen nur noch artenarmer Buchenwald wachsen würde, wenn wir Menschen die Natur nicht mehr beeinflussen würden, stimmt nur unter dem Gesichtspunkt, dass die Megafauna zu einem Großteil ausgerottet ist. Vor ihrer Ausrottung »entwickelte sich die heimische Diversität seit der letzten Eiszeit zu 99,7 % außerhalb der heute prägenden Buchenwälder«14 und Grünflächen waren vorherrschend.
Heute sind in Mitteleuropa als große wilde einheimische Pflanzenfresser nur noch Hirsche und Rehe übrig geblieben, aber die schaffen es alleine nicht mehr, Waldflächen zurückzudrängen und dadurch offenes Grünland zu schaffen. Daran werden sie zusätzlich noch durch die Jagd gehindert. Im Nutzwald sehr zu Recht, denn natürlich brauchen wir Holz, zum Beispiel für umweltgerechte Möbel und klimaschonendes Bauen. Aber viel lieber als den Wald zu schädigen, indem sie Baumtriebe abnagen und Rinde schälen, würden Reh und Hirsch auf Lichtungen und Weiden grasen. Es gibt keine Waldtiere unter den großen Pflanzenfressern – sie sind allesamt Savannenbewohner.
Wenn es hierzu noch eines Beweises bedarf, dann ist das der gescheiterte Versuch, eine Wisentherde im westfälischen Rothaargebirge auszuwildern: in einer Gegend, die intensiv forstwirtschaftlich genutzt wird und ansonsten von Milchviehhaltung geprägt ist. Die Wisente tummelten sich vorzugsweise auf den Wiesen, auf denen die Bauern das Heu für ihre Rinder ernten wollten. Und wenn sie durch die Wälder streiften, dann schälten sie die Rinde von den alten Buchen. Sie haben so versucht, sich einen geeigneten Lebensraum zurechtzufressen. Mehrere Waldbesitzer haben deshalb gegen die freilaufenden Wisente geklagt – erfolgreich.
Unsere Haustiere – Rinder, Schafe und Ziegen – sind an die Stelle der großen pflanzenfressenden Wildtiere getreten und halten anstelle der ausgerotteten oder scharf bejagten Pflanzenfresser unser Grünland baumfrei – und sichern dadurch die Artenvielfalt. Dass Haustiere und Wildtiere gleichermaßen Grünland erhalten können, hat sich auf vielen Naturschutzflächen gezeigt. Auf ehemaligen Truppenübungsplätzen, in Flussauen oder auf Salzwiesen an der Küste bleiben Hirsche und Rehe von der Jagd verschont. Heckrinder (das Ergebnis des Versuchs, den Auerochsen aus Hausrindern zurückzuzüchten), Pferde, Schafe, Ziegen und Wasserbüffel helfen ihnen dabei. Die großen Grasfresser gestalten den Landschaftstyp in diesen Naturschutzgebieten, je nachdem, ob und wie stark man sie bejagt, also: wie viele Tiere pro Hektar weiden dürfen. »Weidedichten nahe der Tragekapazität von Flächen führen zu kurzrasigerer Vegetation.«15 Dabei lässt man also so viele Großtiere weiden, dass sie gerade noch satt werden. »Bei sehr geringen Weidetierdichten entwickelt sich langfristig ein lichter Wald; Dichten zwischen beiden Extremen lassen halboffene Landschaften entstehen, die alten Hudelandschaften*) entsprechen.«
Also: Ob unser Mitteleuropa eine Steppen- oder eine Savannenlandschaft ist oder aber ein lichter oder ein dichter Wald, das entscheiden die großen Pflanzenfresser – je nachdem, wie viele von ihnen wir gewähren lassen. Wenn es jedoch nicht genug wilde Pflanzenfresser gibt, brauchen wir Rinder, Schafe und Ziegen, die diese Aufgabe übernehmen.
*) Waldhude oder Waldhute nannte man die Waldweide. Vor allem Schweine, aber auch Kühe wurden früher zu bestimmten Zeiten in den Wald getrieben, um dort zu grasen oder Waldfrüchte zu fressen.
Kapitel 4
Ist der Mensch von Natur aus Veganer?
Grünland gibt es nicht ohne Weidetiere und Weidetiere gibt es nicht ohne Fleisch- und Milchkonsum. Aber sind diese tierischen Produkte überhaupt für den menschlichen Konsum geeignet?
Horst: »Der Mensch – von Natur aus Veganer? Und was ist mit den Eskimos? Die wären dann ja alle tot!«
Lieber Horst, danke für den Hinweis! Ich komme später darauf zurück.
»Wie kann man nur irgend etwas essen, das Augen hat«, soll der Arzt John Harvey Kellog (1852–1943) gesagt haben, der Erfinder der Cornflakes und der Ur-Vater des Vegetarismus. Er fand, dass Fleischnahrung völlig ungeeignet sei für den Menschen. So sieht es auch der badische Zahnarzt Johann Georg Schnitzer, der tierische Lebensmittel generell als schädlich für den Menschen betrachtet, also auch Milchprodukte. Er empfiehlt pflanzliche Nahrung vorzugsweise zum rohen Verzehr. Schnitzer ist fraglos ein Vorkämpfer für gesündere Ernährung. Schon in den 1960er-Jahren vertrat er Thesen, die für die damalige Zeit revolutionär waren und heute zum Allgemeingut vieler gesundheitsbewusster Menschen gehören: Meide industriell verarbeitete Lebensmittel mit ihrem zugefügten Salz, Zucker und den Auszugsstoffen und Chemikalien, die sie schön aussehen lassen und haltbar machen sollen; meide isolierte Kohlenhydrate wie Zucker, Weißmehl und geschälten Reis; iss frisch zubereitete Mahlzeiten aus naturbelassenen Zutaten: Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst.