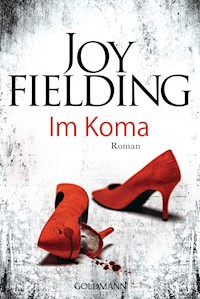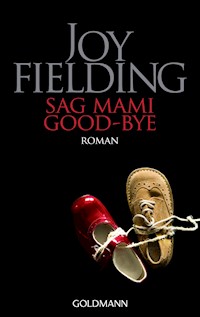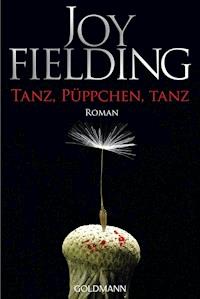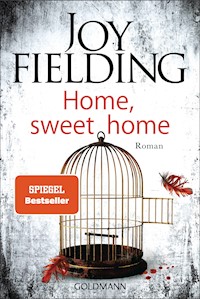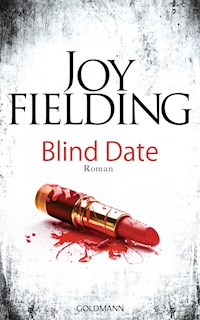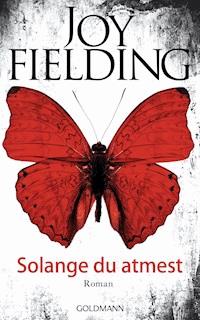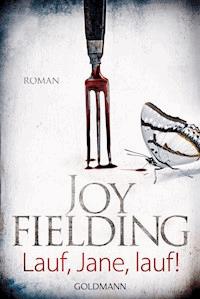Joy Fielding
FLIEH, WENN DU KANNST
Roman
Aus dem Amerikanischen vonMechthild Sandberg-Ciletti
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Don’t Cry Now« bei William Morrow, New York
Copyright © der Originalausgabe 1995 by Joy FieldingCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1995 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Umschlagmotiv:© Arcangel Images / Laura Kate Bradley; FinePic®, München
Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin
Th • Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-05411-3V007
www.goldmann-verlag.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Autorin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Copyright
Das Buch
Ein Anruf am frühen Morgen verändert Bonnie Wheelers wohlgeordnetes Leben schlagartig: Joan, die Exfrau ihres Mannes, warnt Bonnie vor einer geheimnisvollen Gefahr, in der sie und ihre kleine Tochter schweben sollen. Sie will Bonnie bei einem persönlichen Treffen alles erklären, doch als diese am vereinbarten Ort erscheint, findet sie Joan ermordet vor. Bonnie glaubt schon an eine teuflische Falle, denn natürlich ist sie für die Polizei die erste Tatverdächtige. Dann aber stellt sich heraus, dass Joans Warnungen nicht aus der Luft gegriffen waren. Bonnie beginnt an allem zu zweifeln, was ihr bisheriges Leben ausmachte: an ihrem Ehemann, ihren Freunden, ja sogar an ihrer eigenen Vergangenheit. Doch der Albtraum hat gerade erst begonnen …
Joy Fielding
gehört zu den unumstrittenen Spitzenautorinnen Amerikas. Seit ihrem Psychothriller „Lauf, Jane, lauf“ waren alle ihre Bücher internationale Bestseller. Joy Fielding lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida. Weitere Informationen unter www.joy-fielding.de
Mehr von Joy Fielding:
Die Schwester • Sag, dass du mich liebst • Das Herz des Bösen • Am seidenen Faden • Im Koma • Herzstoß • Das Verhängnis • Die Katze • Sag Mami Goodbye • Nur der Tod kann dich retten • Träume süß, mein Mädchen • Tanz, Püppchen, tanz • Schlaf nicht, wenn es dunkel wird • Nur wenn du mich liebst • Bevor der Abend kommt • Zähl nicht die Stunden • Flieh wenn du kannst • Ein mörderischer Sommer • Lebenslang ist nicht genug • Schau dich nicht um • Lauf, Jane, lauf!
(alle auch als E-Book erhältlich)
1
Sie dachte an Palmen, hohe braune Bäume, von Jahrzehnten stürmischer Winde gebeugt. Ihre langen grünen Blätter flatterten wie leere Handschuhe vor einem klaren blauen Himmel.
Rod hatte von einer möglichen gemeinsamen Reise nach Miami im nächsten Monat gesprochen. Ein paar Tage Konferenzen mit den angeschlossenen Sendern, hatte er gesagt, den Rest der Woche dann allein am Strand wie einst Burt Lancaster und Deborah Kerr – wie sie das fände? Sie fand es sehr verlockend. Seitdem verfolgten sie Bilder von Palmen und blauem Himmel. So eine Reise würde sich allerdings nicht ohne gewisse Schwierigkeiten arrangieren lassen – sie würde ihren Schulleiter belügen müssen, ihm erzählen, sie sei krank, ausgerechnet sie, die sich immer damit brüstete, zu diesen widerlich gesunden Leuten zu gehören, denen Erkältungen oder Grippeviren nichts anhaben konnten. Sie würde außerdem ihre Stunden schon im voraus genau planen und einteilen müssen, damit die Lehrkraft, die für sie einsprang, wissen würde, was in welchem Tempo durchzunehmen war. Aber das waren nur kleinere Unannehmlichkeiten, die sie für eine romantische Woche mit dem Mann, den sie liebte und der seit fünf Jahren ihr Ehemann war, gern in Kauf nahm.
Bonnie holte tief Atem und verscheuchte die Bilder von Palmen, die sich im Wind wiegen, um wieder die Realität in den Blick zu bekommen. Kleinere Unannehmlichkeiten vielleicht. Aber wie sollte es ihr gelingen, eine weiß Gott nicht ungesunde Gesichtsfarbe vor einem mißtrauischen Schulleiter zu kaschieren? Wie sollte sie es schaffen, dem Mann ins Gesicht zu sehen, ohne rot zu werden, mit ihm zu sprechen, ohne ins Stottern zu geraten? Wie sollte sie mit seinen besorgten Fragen nach ihrem Befinden umgehen? Sie haßte Lügen, schätzte Ehrlichkeit höher als alles andere. (»Du bist meine Brave«, hatte ihre Mutter oft gesagt.) Und sie war stolz darauf, daß sie in fast neunjähriger Tätigkeit als Lehrerin nicht einen Unterrichtstag wegen Krankheit versäumt hatte. Konnte sie es sich wirklich erlauben, fünf Tage hintereinander zu fehlen, nur um sich mit ihrem Mann an einem Strand in Florida zu aalen?
»Außerdem«, sagte sie laut und sah zu ihrer dreijährigen Tochter hinunter, »wie soll ich es schaffen, dich fünf ganze Tage allein zu lassen?« Sie neigte sich zu Amanda hinüber und streichelte ihre Wange mit der kaum verheilten kleinen Narbe, die von einem kürzlichen Sturz vom Dreirad stammte. Wie zerbrechlich Kinder doch sind, dachte Bonnie, während sie den süßen Kindergeruch ihrer Tochter einatmete.
Amanda öffnete die großen blauen Augen.
»Oh, du bist wach, hm?« fragte Bonnie und gab ihrer Tochter einen Kuß auf die Stirn. »Keine bösen Träume mehr?«
Amanda schüttelte den Kopf, und Bonnie lächelte erleichtert. Amanda hatte sie um fünf Uhr morgens weinend geweckt, von einem Alptraum erschreckt, an den sie sich nicht recht erinnern konnte.
»Nicht weinen, mein Schatz«, hatte Bonnie geflüstert und Amanda in ihr Bett geholt. »Du mußt nicht mehr weinen. Es ist ja alles gut. Mama ist da.«
Als sich Bonnie jetzt über sie neigte, sagte sie zärtlich: »Ich hab’ dich lieb, mein kleiner Schatz.«
Amanda kicherte. »Ich hab’ dich aber noch mehr lieb.«
»Das ist unmöglich«, entgegnete Bonnie. »Du kannst mich gar nicht mehr liebhaben als ich dich.«
Amanda verschränkte mit ernsthafter Miene die Arme über ihrer Brust. »Okay, dann haben wir uns eben beide genau gleich lieb.«
»Okay, wir haben uns beide gleich lieb.«
»Außer daß ich dich noch mehr liebhab’.«
Lachend schwang Bonnie ihre Beine aus dem Bett. »Ich glaube, jetzt wird’s langsam Zeit, dich für den Kindergarten fertigzumachen.«
»Das kann ich selber.« Und schon im nächsten Moment rannte Amanda mit flatterndem rosa Nachthemd durch den Flur zu ihrem Zimmer.
Woher haben sie nur diese Energie? fragte sich Bonnie, während sie wieder unter die Decke kroch, um noch einen Augenblick die Stille des frühen Frühlingsmorgens zu genießen.
Das Telefon läutete. Das schrille Geräusch zerriß so unerwartet die Stille, daß Bonnie zusammenzuckte. Wer konnte um diese Zeit anrufen? Es war noch nicht einmal sieben Uhr.
Widerstrebend öffnete sie die Augen und blickte zu dem Telefon auf dem Nachttisch neben dem großen französischen Bett. Dann richtete sie sich unwillig auf und hob verärgert den Hörer ab.
»Hallo?« Überrascht stellte sie fest, daß ihre Stimme noch ganz verschlafen klang. Sie räusperte sich, während sie darauf wartete, daß der Anrufer sich meldete. »Hallo«, sagte sie noch einmal, als es still blieb.
»Ich bin’s, Joan. Ich muß mit Ihnen sprechen.«
Bonnie stöhnte, und ihr Kopf fiel herab, als hätte ihr jemand einen Schlag in den Nacken gegeben. Noch nicht einmal sieben Uhr morgens, und schon war die geschiedene Frau ihres Mannes am Telefon. »Ist etwas passiert?« fragte sie, augenblicklich das Schlimmste befürchtend. »Sam und Lauren...?«
»Den beiden geht es gut.«
Bonnie atmete erleichtert auf. »Rod ist gerade unter der Dusche«, sagte sie und dachte, daß es selbst für Joan reichlich früh wäre, sich einen zu genehmigen.
»Rod brauche ich nicht. Ich möchte mit Ihnen sprechen.«
»Das ist jetzt aber keine gute Zeit«, erwiderte Bonnie so freundlich, wie es ihr möglich war. »Ich muß mich für die Arbeit fertigmachen...«
»Sie brauchen doch heute gar nicht zur Arbeit. Sam hat mir gesagt, daß heute Weiterbildungstag ist.«
»Das ist richtig. Trotzdem...«
»Können wir uns nicht gegen Mittag irgendwo treffen?«
»Nein, das geht auf keinen Fall«, antwortete Bonnie, erstaunt über die Bitte. »Ich bin den ganzen Morgen bei Vorträgen. Es geht, wie gesagt, um meine berufliche Weiterbildung.«
»Dann wenigstens mittags. Sie haben doch bestimmt eine Mittagspause.«
»Joan. Ich kann nicht...«
»Aber es muß sein.«
»Was soll das heißen? Es muß sein? Was meinen Sie damit?«
Was redete diese Frau da? Bonnie blickte ratlos zur Badezimmertür. Die Dusche lief noch. Rod röhrte lauthals »Take Another Little Piece of My Heart«. »Joan, ich muß jetzt wirklich Schluß machen.«
»Sie sind in Gefahr!« Die Worte klangen wie ein Zischen.
»Was?«
»Sie sind in Gefahr. Sie und Amanda.«
Augenblicklich überfiel Bonnie eisige Panik.
»Was soll das heißen? Wir sind in Gefahr? Was reden Sie da überhaupt?«
»Das läßt sich am Telefon nicht erklären. Es ist zu kompliziert«, entgegnete Joan, deren Stimme plötzlich beängstigend ruhig klang. »Sie müssen sich schon mit mir treffen.«
»Haben Sie getrunken?« fragte Bonnie jetzt ärgerlich, obwohl sie vorgehabt hatte, ruhig und freundlich zu bleiben.
»Klingt es so, als hätte ich getrunken?«
Bonnie mußte zugeben, daß es nicht so war.
»Hören Sie, Bonnie, ich zeige heute morgen mehreren Interessenten ein Haus in der Lombard Street 430. Ich veranstalte da so eine Art open house. Draußen in Newton. Spätestens um dreizehn Uhr, wenn die Eigentümerin nach Hause kommt, muß die Sache beendet sein.«
»Aber ich hab’ Ihnen doch schon gesagt, ich sitze den ganzen Tag in Vorträgen.«
»Und ich hab’ Ihnen gesagt, daß Sie in Gefahr sind«, wiederholte Joan so abgehackt, als säße hinter jedem Wort ein Punkt.
Bonnie wollte schon protestieren, doch dann überlegte sie es sich anders. »Also gut«, stimmte sie zu. »Ich werd’ versuchen, in der Mittagspause rauszukommen.«
»Aber vor eins«, sagte Joan.
»Vor eins«, bestätigte Bonnie.
»Und bitte erzählen Sie Rod nichts davon«, fügte Joan hinzu.
»Warum nicht?«
Statt einer Antwort hörte Bonnie das Knacken in der Leitung, als Joan auflegte.
»Es ist immer ein Vergnügen, von Ihnen zu hören«, sagte Bonnie ärgerlich, legte ihrerseits auf und starrte einen Moment lang frustriert vor sich hin. Was für einen Blödsinn hatte sich Joan nun wieder in den alkoholbenebelten Kopf gesetzt?
Sie hatte allerdings tatsächlich keinen benebelten Eindruck gemacht, wie Bonnie einräumen mußte, als sie jetzt aufstand und zum Badezimmer ging. Sie hatte klar und präzise gesprochen, als wüßte sie genau, was sie sagte. Eine Frau mit einer Mission, dachte Bonnie. Sie ging ans Waschbecken, wusch sich das Gesicht und putzte sich die Zähne, ging dann auf nackten Füßen über den blaugrauen dicken Teppich zum Wandschrank. Es wurde langsam Zeit, die Wintersachen wegzupacken und die Sommersachen in den Schrank zu hängen, aber wie lautete doch der dumme Spruch, den ihre Freundin Diana zu zitieren pflegte? Laß im Schrank die warmen Sachen, bis dem April vergeht das Lachen. Ja, richtig, dachte Bonnie und verschloß ihre Ohren den anderen, beunruhigenderen Stimmen, während sie sich ankleidete. Sie sind in Gefahr, hörte sie dann doch wieder Joans Stimme. Sie und Amanda.
Was konnte Joan damit gemeint haben? Was für eine Gefahr sollte ihr und ihrer Tochter drohen?
Bitte erzählen Sie Rod nichts davon.
»Warum nicht?« fragte Bonnie laut, als sie das rote Strickkleid über ihren schlanken Hüften glattstrich. Weshalb wollte Joan nicht, daß sie mit ihrem Mann über diese merkwürdige Behauptung sprach? Wahrscheinlich, weil er sie für verrückt erklären würde. Bonnie lachte. Rod war sowieso überzeugt davon, daß seine geschiedene Frau nicht richtig tickte.
Sie beschloß, sich nicht mit Joan zu treffen. Die Frau hatte ihr nichts zu sagen, was sie interessierte. Nichts, was ihr in irgendeiner Weise nützlich sein konnte. Doch schon während Bonnie den Entschluß faßte, war ihr klar, daß ihre Neugier die Oberhand gewinnen und sie sich vor dem Ende aus dem Vortrag stehlen würde, wahrscheinlich den wichtigsten Teil verpassen würde, um den ganzen Weg bis in die Lombard Street zu fahren und dort zu entdecken, daß Joan sich nicht einmal erinnerte, sie am Morgen angerufen zu haben. Ähnliches war schon des öfteren vorgekommen. Anrufe im Suff mitten in der Nacht, wütende Beschimpfungen zum Abendessen, tränenreiche Klagen, wenn man gerade zu Bett gehen wollte. Und hinterher alles vergessen. Wovon reden Sie? Ich habe Sie nie angerufen. Warum sollen Sie mir unbedingt das Leben schwermachen? Was, zum Teufel, reden Sie da?
Bonnie hatte sie gewähren lassen. Trotz allem, was sie von dieser Frau wußte, trotz des Kummers und der Sorgen, die sie Rod bereitet hatte, tat Joan ihr leid. (»Du bist eine gute Seele«, pflegte ihre Mutter zu sagen.) Sie mußte sich immer wieder klarmachen, daß Joan für den größten Teil ihrer Probleme selbst verantwortlich war, daß sie ganz bewußt zum Alkohol gegriffen und nicht mehr davon abgelassen hatte. Es war zu einfach, ihr Verhalten damit zu entschuldigen, daß es verständlich sei, wenn eine Frau nach einer solchen Tragödie, wie sie sie erlebt hatte, zu trinken begann.
Selbst dieses tragische Ereignis, das ihr Leben so verändert hatte, hatte sie ja größtenteils selbst heraufbeschworen. Zweifellos hätte es abgewendet werden können, wäre Joan nicht so nachlässig gewesen, ihr vierzehn Monate altes Kind allein in der Badewanne zu lassen, wenn auch nicht einmal eine Minute, wie sie später verzweifelt behauptet hatte. Sie hatte alle möglichen Erklärungen gehabt: Sam und Lauren hatten im anderen Zimmer gestritten; Lauren hatte geschrien; es habe sich angehört, als könnte Sam ihr etwas antun; nur deshalb war Joan aus dem Badezimmer gestürzt. Sie hatte nachsehen wollen, was die beiden älteren Kinder trieben. Als sie wieder zurückgekommen war, war ihr jüngstes Kind tot und ihre Ehe zu Ende gewesen.
Bitte erzählen Sie Rod nichts davon.
Weshalb ihn gleich am frühen Morgen aufregen, sagte sich Bonnie und beschloß, ihrem Mann nichts von Joans Anruf zu sagen, oder höchstens erst nach dem Zusammentreffen. Rod hatte im Augenblick im Studio genug um die Ohren – eine ungünstige Sendezeit am Nachmittag, eine unmögliche Moderatorin, ein abgedroschenes Konzept. Wie viele seichte Talkshows brauchte das Publikum eigentlich noch? Dennoch hatten sich unter seiner fachmännischen Leitung die Einschaltquoten stetig verbessert. Mittlerweile war sogar von landesweiter Ausstrahlung die Rede. Die Tagung, die nächsten Monat in Miami stattfinden sollte, war von zentraler Bedeutung.
Wieder sah sie sich unter hohen Palmen auf weißem Sandstrand stehen, und ein leichtes Lüftchen schien sie zu umfächeln, als sie sich an ihren kleinen Toilettentisch setzte, der dem Bett gegenüber stand; an der Wand daneben hatte sie einen Akt von Salvador Dali aufgehängt, eine gesichtslose Frau in gedämpftem Blau mit runden Hüften und überlangen Gliedern, deren kahlem Kopf strahlenförmig irgendwelche Emanationen entsprangen.
Vielleicht ist Glatzköpfigkeit die Lösung, dachte Bonnie, während sie vergeblich versuchte, ihr kinnlanges braunes Haar so um ihr schmales Gesicht zu arrangieren, wie die Friseuse es ihr gezeigt hatte. »Ach, gib’s doch auf«, sagte sie zu ihrem Spiegelbild und ließ ihr widerspenstiges Haar sein, wie es war. Trotz der feinen Linien rund um ihre tiefgrünen Augen, fand sie, daß sie gar nicht so übel aussah. Ihr hübsches Gesicht besaß jene Klarheit und Offenheit, die niemals wirklich außer Mode kamen und sie noch lange nicht wie fünfunddreißig erscheinen ließen. Als >frisch< hatte Joan es einmal beschrieben.
Vielfältige Bilder von Rods geschiedener Frau verdrängten erbarmungslos die Vision von Palmen und weißen Stränden, grell und siebdruckartig, den Bildnissen ähnlich, die Andy Warhol von Elizabeth Taylor und Marilyn Monroe geschaffen hat. »Joan«, sagte Bonnie vor sich hin und versuchte, das Wort in zwei Silben zu drehen, um es weicher zu machen, freundlicher. Jo-an. Jo-an. Es klappte nicht. Auch der Name blieb hartnäckig so, wie Joan im Leben war, unveränderbar, nicht zu retuschieren oder weichzuzeichnen.
Sie war eine imposante Frau, fast einen Meter achtzig groß, mit großen braunen Augen, von denen sie gern sagte, sie seien dunkel wie Zobel, flammend rotem Haar, das sie als tizianrot zu bezeichnen pflegte, und einem spektakulären Busen. Alles an ihr war Übertreibung, und dies war zweifellos einer der Gründe für ihren Erfolg als Immobilienmaklerin.
Was mochte sie diesmal wieder in petto haben? Warum das Melodram? Was war so kompliziert, daß sie es nicht am Telefon besprechen konnte? Was für eine Gefahr sollte das sein, von der sie gesprochen hatte?
Bonnie zuckte mit den Achseln. Sie würde es bald genug herausfinden, sagte sie sich.
Um zwölf Uhr achtunddreißig lenkte Bonnie ihren weißen Caprice in die Einfahrt des Hauses Lombard Street 430 – durch einen Verkehrsunfall war sie unterwegs aufgehalten worden und hatte über eine halbe Stunde bis hierher gebraucht. Sie stellte ihren Wagen direkt hinter Joans rotem Mercedes ab. Joans Geschäfte florierten offensichtlich. Trotz der Schwankungen auf dem Immobilienmarkt schien sie die letzte längere Durststrecke gut überstanden zu haben. Ja, Joan war eben eine Überlebenskünstlerin. Nur die in ihrer Nähe kamen um.
Dieses Haus dürfte nicht schwer zu verkaufen sein, dachte Bonnie, als sie, in die kühle Sonne blinzelnd, an dem großen Schild im Vorgarten vorüberging, auf dem die öffentlichen Besichtigungszeiten angekündigt waren. Es war ein einstöckiges Haus mit viel Holz, wie die meisten Häuser in diesem gediegenen Vorort von Boston, und hatte offensichtlich erst vor kurzem einen frischen weißen Anstrich erhalten. Bonnie stieg die Stufen zur vorderen Veranda hinauf. Die schwarze Haustür war nur angelehnt. Bonnie klopfte schüchtern, stieß die Tür dann ein Stück weiter auf. Augenblicklich hörte sie Stimmen aus einem der hinteren Zimmer. Die Stimmen eines Mannes und einer Frau. Vielleicht Joan. Vielleicht aber auch nicht. Möglicherweise mitten in einer Auseinandersetzung. Es war schwer zu sagen. Auf jeden Fall würde sie nicht lauschen. Sie würde ein paar Minuten warten, ein paarmal diskret hüsteln, die Leute wissen lassen, daß noch jemand im Haus war.
Sie sah sich um, nahm eines der Kurzexposés, die Joan in einem Stapel auf einem kleinen Hocker im Eingangsbereich bereitgelegt hatte. Dem Informationsblatt zufolge hatte das Haus eine Gesamtwohnfläche von zweihundertachtzig Quadratmetern, mit vier Schlaf- oder Gästezimmern im oberen Stockwerk und einem ausgebauten Souterrain. Im Erdgeschoß teilte eine breite Treppe das Haus in zwei symmetrische Flügel, auf der einen Seite das Wohnzimmer, auf der anderen das Eßzimmer. Küche und Arbeitszimmer befanden sich im hinteren Teil. Irgendwo dazwischen war ein Badezimmer.
Bonnie räusperte sich, zuerst gedämpft, dann noch einmal, lauter. Die Leute im hinteren Teil des Hauses redeten weiter. Sie sah auf ihre Uhr, ging dann etwas zaghaft ins Wohnzimmer, das ganze in Beige und Creme gehalten war. Sie würde bald gehen müssen. Sie würde sowieso schon zu spät zurückkommen und den ersten Teil des Nachmittagsvortrags zu der Frage, wie die Schulen von heute sich auf die Teenager von heute einstellen sollten, verpassen. Wieder sah sie auf ihre Uhr und klopfte mit dem Fuß ungeduldig auf den Parkettboden. Es war wirklich absurd. Es war ihr unangenehm, Joan zu stören, während diese sich bemühte, einen Abschluß zu machen, Tatsache war jedoch, daß Joan sie ausdrücklich gebeten hatte, vor eins hier zu sein, und bis zur vollen Stunde fehlte nicht mehr viel.
»Joan!« rief sie und ging in den Eingangsbereich zurück und wandte sich in Richtung Küche.
Das Gerede ging weiter, als hätte sie keinen Ton von sich gegeben. Sie hörte abgerissene Sätze – »Nun, wenn diese Gesundheitsreform durchgeführt wird...«, »Das ist eine wenig überzeugende Einschätzung der Dinge...« – und fragte sich, was da vorging. Weshalb sollte Joan anläßlich einer Hausbesichtigung eine solche Diskussion führen? »Ich muß unser Telefongespräch jetzt leider beenden, meine Dame«, hörte sie plötzlich die Männerstimme. »Sie wissen offensichtlich nicht, wovon Sie reden, und ich habe jetzt Lust auf ein wenig Musik. Wie wär’s mit dem immer klassischen Sound von Nirvana?«
Es war das Radio. »Du lieber Himmel«, murmelte Bonnie. Sie hatte ihre Zeit damit vertan, diskret zu hüsteln, damit irgendein unhöflicher Rundfunkmoderator ungestört einen gutgläubigen Anrufer beleidigen konnte. Wer ist hier eigentlich die Verrückte, fragte sie sich und versuchte nun endgültig die Geduld verlierend, die plötzliche Attacke von Nirvana zu übertönen. »Joan!« rief sie und trat in die gelb-weiße Küche.
Joan saß an dem langen Fichtenholztisch. Ihre großen dunklen Augen waren vom Alkohol verschleiert, ihr Mund war wie zum Sprechen leicht geöffnet.
Aber sie sprach nicht. Und sie rührte sich nicht. Nicht einmal, als Bonnie zu ihr trat und eine Hand vor ihrem Gesicht bewegte; nicht einmal, als Bonnie sie bei der Schulter nahm und schüttelte.
»Joan, Herrgott noch mal...«
Sie konnte später nicht sagen, wann genau sie erkannte, daß Joan tot war. Vielleicht, als sie den hellen roten Fleck bemerkte, der auf Joans weißer Seidenbluse wie eine abstrakte Malerei wirkte. Vielleicht, als sie das klaffende dunkle Loch zwischen ihren Brüsten sah und an ihren eigenen Händen das Blut fühlte, das warm und klebrig war wie Sirup. Vielleicht aber auch erst durch die schreckliche Mischung von Gerüchen, ob nun real oder eingebildet, die ihr plötzlich in die Nase stiegen. Oder waren es die Schreie, die aus ihrem Mund quollen und sich in gespenstischer Harmonie mit den Klängen von Nirvana vereinten?
Oder vielleicht die Schreie der Frau, die wie zu Stein erstarrt an der Wand neben der Küchentür stand und ihre Einkaufstüten umklammerte, als würde sie nur dadurch aufrecht gehalten.
Bonnie ging zu ihr. Die Frau wich in panischer Angst zurück, als Bonnie ihr die Einkaufstüten aus den Armen nahm. »Tun Sie mir nichts«, flehte sie mit jammernder Stimme. »Bitte, tun Sie mir nichts.«
2
Sie erschütterten das Haus wie ein heftiger Donnerschlag bei einem Gewitter – erschreckend, obwohl man ihn erwartet hat. Ihre Stimmen füllten den Vorraum; dann drückten sie wie ein Bienenschwarm ins Wohnzimmer. Die Frau neben ihr sprang vom Sofa auf, um sie zu begrüßen.
»Gott sei Dank, daß Sie hier sind«, rief sie in hohem Lamento.
»Haben Sie die Polizei gerufen?«
Bonnie sah, wie die Frau mit anklagendem Finger auf sie deutete, sah, wie alle Augen sich auf sie richteten, während der Raum sich mit Menschen füllte. Widerstrebend zwang sie sich, ihnen in die Gesichter zu schauen, obwohl sie im ersten Moment nur Joan vor sich sehen konnte, ihr feuriges tizianrotes Haar, das in krausen Locken um das aschfahle Gesicht fiel, den großen, leicht geöffneten Mund, leuchtend orangerot bemalt, die dunklen Augen, milchig vom Tod.
»Wer ist erschossen worden?« fragte jemand.
Wieder hob die Frau den Arm, zeigte diesmal zur Küche. »Meine Immobilienmaklerin. Von Ellen Marx Immobilien.«
Mehrere gesichtslose junge Männer in weißen Kitteln rannten durch den Korridor nach hinten. Zweifellos Sanitäter und Notarzt, dachte Bonnie, seltsam unberührt von allem, was um sie herum vorging. Diese plötzliche Distanziertheit gestattete ihr, alles, was jetzt geschah, detailgenau aufzunehmen. Mindestens sechs Personen befanden sich im Haus: die beiden Sanitäter; zwei uniformierte Polizeibeamte; eine Frau, deren Haltung sie als Polizeibeamtin kennzeichnete, die jedoch kaum dem Teenageralter entwachsen schien; und ein massiger Mann von etwa vierzig Jahren, mit unreiner Haut und einem Bauch, der ihm über den Gürtel hing. Er leitete offensichtlich das ganze Unternehmen und war den Sanitätern zur Küche gefolgt.
»Sie ist tot«, verkündete er bei seiner Rückkehr. Er trug ein schwarz-weiß kariertes Sportsakko und eine einfarbige rote Krawatte. Von seinem Gürtel hing ein Paar Handschellen herab. »Der Gerichtsmediziner wird gleich hier sein.«
Gerichtsmediziner, wiederholte Bonnie im stillen und fragte sich, woher diese merkwürdig klingenden Worte kamen.
»Ich bin Captain Mahoney, und das ist Detective Kritzic.« Er wies mit dem Kopf auf die Frau zu seiner Rechten. »Würden Sie uns bitte berichten, was hier geschehen ist?«
»Als ich nach Hause kam...«, hörte Bonnie die Eigentümerin des Hauses beginnen.
»Ist das Ihr Haus?« fragte Detective Kritzic.
»Ja. Ich wollte es verkaufen...«
»Ihr Name, bitte.«
»Wie bitte? Oh, Margaret Palmay.«
Die Polizeibeamtin notierte das auf ihrem Block.
»Und wer sind Sie?«
Bonnie brauchte einen Moment, um zu erkennen, daß sie die Angesprochene war. »Bonnie Wheeler«, stotterte sie. »Ich möchte meinen Mann anrufen.« Warum hatte sie das gesagt? Sie war sich nicht einmal bewußt gewesen, daß sie es gedacht hatte.
»Sie können Ihren Mann gleich anrufen, Mrs. Wheeler«, versetzte Captain Mahoney. »Aber zuerst müssen wir Ihnen einige Fragen stellen.«
Bonnie nickte. Sie verstand, daß es wichtig war, eine gewisse Ordnung zu wahren. Bald würde ein neuer Schwarm Leute eintreffen, mit sonderbaren Instrumenten und Pulvern, um zu messen und zu prüfen, mit Videokameras und grünen Leichensäcken und gelbem Plastikband, um das Haus abzusperren. >Tatort eines Verbrechens. Unbefugten ist der Zutritt verboten.< Sie kannte die Routine. Sie hatte es oft genug im Fernsehen gesehen.
»Bitte, Mrs. Palmay«, sagte Detective Kritzic freundlich. »Sie sagten eben, Sie wollten das Haus verkaufen...«
»Es steht seit Ende März zum Verkauf. Das war der erste öffentliche Besichtigungstermin. Sie sagte, sie würde um eins hier fertig sein.«
»Sie haben also keine Ahnung, wie viele Personen heute morgen das Haus besichtigt haben«, sagte Captain Mahoney. Es war mehr die Feststellung einer Tatsache als eine Frage.
»Im Vorraum liegt ein Gästebuch«, warf Bonnie ein, die sich erinnerte, ein solches Buch neben den Exposes gesehen zu haben.
Die Beamten nickten einander zu, und Detective Kritzic, die, wie Bonnie erst jetzt bemerkte, ähnlich rotes Haar wie Joan hatte, verschwand einen Moment. Mit dem Buch in der Hand kehrte sie zurück.
»Und als Sie nach Hause kamen?«
»Ich wußte, daß sie noch hier war«, berichtete Margaret Palmay, »weil ihr Wagen in der Einfahrt steht. Direkt dahinter steht ein zweiter Wagen, daher wußte ich, daß außer ihr noch jemand im Haus sein mußte. Ich mußte auf der Straße parken. Ich hätte ja gewartet, bis sie gegangen wären, aber ich war beim Einkaufen gewesen, und ein Teil der Sachen mußte schnell in den Gefrierschrank.« Sie brach ab, als wüßte sie nicht mehr weiter. Und vielleicht war es ja auch so.
Sie war eine hübsche Frau, fand Bonnie, ein bißchen klein vielleicht, mit gefälligen Rundungen und feinem blondem Haar, das sich in Höhe ihrer Ohrläppchen lockte. Die Nase zwischen den blaßblauen Augen war schmal, erinnerte an einen Vogelschnabel, ihr Mund war klein, aber ihre Stimme war klar und ruhig.
»Was geschah, als Sie ins Haus kamen, Mrs. Palmay?«
»Ich bin direkt in die Küche gegangen, und da hab’ ich sie gesehen.« Wieder wies sie mit anklagendem Finger auf Bonnie. »Sie stand über Joan gebeugt. Ihre Hände waren voller Blut.«
Bonnies Blick flog zu ihren Händen, und sie unterdrückte mit Mühe einen Aufschrei, als sie das dunkelrote Blut sah, das wie Fingerfarben an ihren Händen getrocknet war. Eine Hitzewelle durchfuhr sie, pflanzte sich blitzschnell von ihrem Kopf bis zu den Füßen fort und raubte ihr alle Energie. Ihr schwindelte, sie fühlte sich zum Umfallen schwach.
»Kann ich meinen Mantel ausziehen?« fragte sie und zog, ohne auf eine Antwort zu warten, vorsichtig, um mit ihren blutigen Fingern nicht das Seidenfutter des Mantels zu berühren, ihre Arme aus den Ärmeln.
»Wer ist Joan?« fragte Captain Mahoney mit zusammengezogenen Brauen.
»Das Opfer«, antwortete Margaret Palmay, und das Wort klang bei ihr unnatürlich.
Was denkt der denn, von wem wir sprechen? fragte sich Bonnie.
Captain Mahoney warf einen Blick in seine Notizen. »Sagten Sie nicht, daß sie Ellen Marx heißt?«
»Nein«, erklärte Margaret Palmay, »Ellen Marx ist der Name der Immobilienfirma, für die sie gearbeitet hat. Ihr Name ist... war... Joan Wheeler.«
»Wheeler?«
Wieder richteten sich alle Augen auf Bonnie.
»Wheeler«, wiederholte Captain Mahoney und kniff die Augen zusammen, als wollte er Bonnie ins Visier eines Gewehrs nehmen. »Eine Verwandte von Ihnen?«
Konnte man die geschiedene Frau des eigenen Ehemanns als Verwandte bezeichnen? »Sie war die geschiedene Frau meines Mannes«, antwortete Bonnie.
Niemand sagte etwas. Es war beinahe so, als wäre zu einer Schweigeminute aufgerufen worden, dachte Bonnie, die genau merkte, daß sich etwas verändert hatte, daß es im Raum eine Unterströmung gab, die vorher nicht dagewesen war.
»Gut, gehen wir noch einmal zurück.« Captain Mahoney räusperte sich und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Margaret Palmay. »Sie sagten, Sie hätten Mrs. Wheeler gesehen, wie sie über die Tote gebeugt stand, und ihre Hände seien voll Blut gewesen. Haben Sie eine Waffe gesehen?«
»Nein.«
»Wie ging es dann weiter?«
»Ich habe angefangen zu schreien. Ich glaube, sie hat auch geschrien, ich bin mir nicht sicher. Als sie mich dann sah, kam sie sofort auf mich zu. Zuerst hatte ich Angst, aber sie nahm mir nur die Tüten mit den Einkäufen aus den Händen, und dann rief sie die Polizei an.«
»Stimmen Sie mit Mrs. Palmays Aussage überein?« fragte Captain Mahoney, während er sich an Bonnie wandte, die aber stumm blieb. »Mrs. Wheeler, haben Sie an dem, was Mrs. Palmay gerade gesagt hat, etwas auszusetzen?«
Bonnie schüttelte den Kopf. Margaret Palmays Version der Vorgänge schien ihr ganz in Ordnung zu sein.
»Wollen Sie uns nicht sagen, was Sie hier zu tun hatten?«
Das wird schwieriger werden, dachte sie und fragte sich, ob ihr Bruder sich auch so gefühlt hatte, als er das erste Mal von der Polizei vernommen worden war; ob er ebenso nervös, so verstört gewesen war. Aber selbst wenn, so hatte er sich zweifellos inzwischen an diese Vernehmungen gewöhnt, sagte sie sich und versuchte, diese beunruhigenden Überlegungen zu vertreiben. Ihr Bruder war der letzte, an den sie jetzt denken wollte.
»Joan hat mich heute in aller Frühe angerufen«, begann sie. »Sie bat mich, sie hier zu treffen.«
»Wir dürfen doch annehmen, daß Sie nicht auf Haussuche waren?«
Bonnie holte tief Atem. »Joan sagte, sie müßte mir etwas mitteilen, worüber sie am Telefon nicht sprechen könnte. Ich weiß«, fuhr sie ohne Aufforderung fort, »das klingt wie etwas, das man im Kino zu hören bekommt.«
»Ja, so klingt es tatsächlich«, stimmte Mahoney unverblümt zu. »Waren Sie und die geschiedene Frau Ihres Mannes befreundet, Mrs. Wheeler?«
»Nein«, antwortete Bonnie kurz.
»Fanden Sie es ungewöhnlich, daß sie Sie anrief und sagte, sie müßte mit Ihnen sprechen?«
»Ja und nein«, versetzte Bonnie und fuhr erst zu sprechen fort, als er ihr einen Blick zuwarf, der nähere Erklärung verlangte. »Joan hatte ein Alkoholproblem. Sie hat immer wieder mal bei uns angerufen.«
»Darüber waren Sie sicher nicht allzu erfreut«, sagte Captain Mahoney und verzog dabei den Mund, was Bonnie als Versuch eines verständnisvollen Lächelns deutete.
Sie zuckte mit den Achseln, nicht sicher, wie sie auf diese Bemerkung reagieren sollte. »Könnte ich jetzt meinen Mann anrufen?« fragte sie wieder.
»Was hielt denn Ihr Mann davon, daß Sie sich mit seiner geschiedenen Frau treffen wollten?« fragte Captain Mahoney, ihre Frage als Anknüpfungspunkt nutzend.
Bonnie zögerte. »Er wußte nichts davon.«
»Er wußte es nicht?«
»Joan hatte mich gebeten, ihm nichts davon zu sagen«, erläuterte Bonnie.
»Sagte sie auch, warum?«
»Nein.«
»Haben Sie immer getan, was die geschiedene Frau Ihres Mannes von Ihnen verlangte?«
»Natürlich nicht.«
»Warum dann heute?«
»Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen.«
»Warum haben Sie eingewilligt, sich heute mit ihr zu treffen? Warum haben Sie Ihrem Mann nichts gesagt?«
Bonnie drückte eine Faust an ihren halb geöffneten Mund und senkte sie hastig wieder in ihren Schoß, als sie Blut schmeckte. Joans Blut. Sie mußte schlucken, um das aufsteigende Würgen zu unterdrücken.
»Sie sagte am Telefon etwas sehr Merkwürdiges zu mir.«
»Was denn?« Captain Mahoney trat ein paar Schritte näher zu ihr, seinen Stift gezückt, um ihre Antwort sogleich zu notieren.
»Sie sagte, ich sei in Gefahr.«
»Sie sagte, Sie seien in Gefahr?«
»Ja, ich und meine Tochter.«
»Hat sie auch gesagt, warum?« fragte Captain Mahoney.
»Sie hat behauptet, es sei zu kompliziert, um es am Telefon zu besprechen.«
»Und Sie hatten keine Ahnung, wovon sie sprach?«
»Nein.«
»Und daraufhin haben Sie eingewilligt, sich mit ihr zu treffen.«
Bonnie nickte.
»Wann sind Sie hier angekommen?«
»Um zwölf Uhr achtunddreißig«, antwortete Bonnie.
Captain Mahoney schien überrascht über die Genauigkeit der Zeitangabe.
»Ich habe im Auto eine Digitaluhr«, erklärte Bonnie und empfand ihre Worte im selben Augenblick als hoffnungslos albern. Sie kicherte und sah, wie Befremden die Neugier in den Gesichtern der Anwesenden im Zimmer verdrängte. Eine Tote war im Haus! Sie war ermordet worden. Es war nicht etwa irgendeine beliebige Person – es war die geschiedene Frau ihres Mannes. Und sie selbst hatte man gesehen, wie sie mit Blut an den Händen vor der Toten gestanden hatte. Das war entschieden nicht komisch. Bonnie lachte wieder, lauter diesmal.
»Finden Sie hier etwas erheiternd, Mrs. Wheeler?« fragte Captain Mahoney.
»Nein«, antwortete sie und würgte gleichzeitig einen neuerlichen aufsteigenden Schwall von Gelächter ab, so daß ihre Stimme brüchig und verzerrt klang. »Nein, natürlich nicht. Ich bin wahrscheinlich nur etwas nervös. Tut mir leid.«
»Haben Sie einen Grund, nervös zu sein?«
»Ich verstehe nicht.«
Detective Kritzic kam zum Sofa und setzte sich neben sie. »Möchten Sie uns vielleicht etwas sagen, Mrs. Wheeler?« Ihre Stimme nahm einen mütterlichen Ton an, der zu dem mädchenhaften Gesicht in Widerspruch stand.
»Ich möchte meinen Mann anrufen«, sagte Bonnie zum drittenmal.
»Wir wollen das hier doch erst fertigmachen, wenn Sie gestatten, Mrs. Wheeler.« Detective Kritzics Stimme hatte wieder ihren früheren Ton. Alle Schwingungen nachsichtiger Mütterlichkeit waren schlagartig verschwunden.
Bonnie zuckte mit den Achseln. Hatte sie denn eine Wahl?
»Sie kamen also um zwölf Uhr achtunddreißig hier an«, wiederholte Captain Mahoney und wartete, daß Bonnie fortfahren würde.
»Die Tür war angelehnt, da bin ich ins Haus gegangen«, erklärte Bonnie und ließ die Ereignisse noch einmal vor sich ablaufen. »Ich hörte Stimmen, die aus dem hinteren Teil des Hauses kamen, und wollte nicht stören, deshalb hab’ ich erst ein paar Minuten hier im Wohnzimmer gewartet, bevor ich in die Küche ging.«
»Haben Sie jemanden gesehen?«
»Nur Joan. Sonst war niemand hier. Die Stimmen, die ich gehört hatte, kamen aus dem Radio.«
»Und dann?«
»Und dann...« Bonnie zögerte. »Zuerst dachte ich, sie sei nur völlig betrunken. Sie saß am Tisch und hatte so einen leeren Blick. Ich bin zu ihr gegangen, und ich glaube, ich habe sie angefaßt.« Bonnie blickte zu ihren blutigen Fingern hinunter. »Ja, ich muß sie angefaßt haben.« Sie schluckte. »Und da hab’ ich begriffen, daß sie tot war. Dann hab’ ich geschrien, und sie auch.« Sie warf einen Blick auf Margaret Palmay. »Und dann hab’ ich die Polizei angerufen.«
»Woher wußten Sie, daß Joan Wheeler erschossen worden war?«
»Wie bitte?« »Sie sagten bei Ihrem Anruf, eine Frau sei erschossen worden.«
»Ach ja? Hab’ ich das gesagt?«
»Wir haben es auf Band, Mrs. Wheeler.«
»Ich weiß nicht, woher ich das wußte«, antwortete Bonnie wahrheitsgemäß. »Mitten in ihrer Bluse war ein Loch. Ich habe es wohl einfach angenommen.«
»Hat jemand Sie kommen sehen, Mrs. Wheeler?«
»Nicht daß ich wüßte.« Warum fragte er das?
»Üben Sie einen Beruf aus, Mrs. Wheeler?«
»Ja. Ich bin Lehrerin«, antwortete Bonnie und fragte sich, inwiefern ihre berufliche Tätigkeit hier von Belang war.
»In Newton?«
»In Weston.«
»Und an welcher Schule unterrichten Sie?«
»An der höheren Schule in Weston Heights. Ich unterrichte Englisch.«
»Um welche Zeit sind Sie aus der Schule weggegangen?«
»Ich hatte heute keinen Unterricht. Wir haben heute einen Weiterbildungstag. Zur beruflichen Fortbildung«, erklärte Bonnie. »Ich habe an einem Symposion in Boston teilgenommen. Ich bin kurz vor zwölf dort weggegangen.«
»Und Sie haben für die Fahrt von Boston nach Newton über vierzig Minuten gebraucht?« fragte er skeptisch.
»Der Massachusetts Turnpike war wegen eines Verkehrsunfalls blockiert«, sagte Bonnie. »Das hat mich aufgehalten.«
»Hat jemand Sie weggehen sehen?«
»Das weiß ich wirklich nicht. Ich hab’ versucht, mich möglichst unauffällig davonzustehlen. Warum?« fragte sie plötzlich. »Warum stellen Sie mir diese Fragen?«
»Sie sagen, daß die geschiedene Frau Ihres Mannes bereits tot war, als Sie hier eintrafen«, stellte er fest.
»Ja, natürlich sage ich das. Was sollte ich denn sonst sagen?« Bonnie sprang auf. »Was ist hier eigentlich los? Werde ich verdächtigt?« Logisch, ich bin verdächtig, sagte sie sich sofort. Was sonst. Man hatte sie mit Blut an den Händen vor der Toten stehen sehen, die die geschiedene Frau ihres Mannes war. Ganz klar, daß man sie verdächtigte. »Sie haben mir nicht geantwortet«, insistierte sie. »Verdächtigen Sie mich?«
»Wir bemühen uns nur herauszufinden, was hier geschehen ist«, antwortete Detective Kritzic ruhig.
»Ich möchte jetzt meinen Mann anrufen«, sagte Bonnie mit Entschiedenheit.
»Vielleicht rufen sie ihn am besten von der Dienststelle aus an.« Captain Mahoney klappte abschließend seinen Notizblock zu.
»Soll das heißen, daß ich verhaftet bin?« hörte Bonnie sich fragen und hatte dabei den Eindruck, es sei die Stimme einer anderen. Vielleicht wieder das Radio.
3
»Wo bist du gewesen?« Bonnie bemühte sich nicht, ihren Ärger und ihre Frustration zu verbergen. »Ich habe den halben Nachmittag versucht, dich zu erreichen.«
Diana Perrin starrte ihre Freundin verwundert an. »Ich hatte mit Mandanten zu tun«, antwortete sie ruhig. »Woher sollte ich denn wissen, daß man meine beste Freundin zur Polizei geschleppt hat, um sie in einer Mordsache zu vernehmen?«
»Sie glauben, ich hätte Rods geschiedene Frau umgebracht.« »Ja, sieht ganz danach aus«, meinte Diana. »Was, zum Teufel, hast du ihnen erzählt?«
»Ich habe nur ihre Fragen beantwortet.«
»Du hast ihre Fragen beantwortet«, wiederholte Diana kopfschüttelnd. Bonnie bemerkte, daß ihr langes dunkles Haar im Nacken zu einem ordentlichen Knoten gesteckt war, wie sich das für eine nüchterne Anwältin gehörte. »Wie oft hast du von mir gehört, daß man ohne einen Anwalt kein Wort mit der Polizei spricht?«
»Aber ich mußte doch mit ihnen sprechen! Ich habe Joan schließlich gefunden.«
»Um so mehr Grund, nichts zu sagen.« Mit einem tiefen Seufzer ließ Diana sich auf den Stuhl fallen, der auf der anderen Seite des Tisches stand.
Sie saßen sich an einem langen Tisch – vielleicht helles Walnußholz, vielleicht dunkle Eiche – in der Mitte eines kleinen, hell erleuchteten, spärlich möblierten Raums gegenüber. Der Linoleumboden war abgetreten, und die grünen Wände hatten dringend einen frischen Anstrich nötig. In die Zimmerdecke versenkt waren Leuchtstoffröhren; die Wände waren kahl; die Holzstühle hatten steife, gerade Lehnen, keine Kissen und waren äußerst unbequem, zweifellos so ausgesucht, damit bei niemandem der Wunsch aufkommen konnte, mehr Zeit als unbedingt nötig auf ihnen zu verbringen. Eine der Innenwände hatte ein Fenster, das einen ungehinderten Blick auf den Dienstraum des kleinen Vorortreviers bot. Es war nicht viel los. Einige Männer und Frauen waren an ihren Schreibtischen beschäftigt und warfen ab und zu einen Blick zu Bonnie hinüber. Seit einer guten halben Stunde hatte sie weder Captain Mahoney noch Detective Kritzic zu Gesicht bekommen.
»Also, was hast du ihnen erzählt?«
Wieder schilderte Bonnie die Ereignisse des frühen Nachmittags und suchte dabei in Dianas gewöhnlich so ausdrucksvollem Gesicht nach Zeichen einer Reaktion. Doch Dianas Gesicht verriet nichts. Ihre kühlen blauen Augen blieben ausdruckslos auf Bonnies Lippen gerichtet, während diese sprach. Was für eine schöne Frau sie ist, dachte Bonnie, die wußte, wie sehr Diana sich bemühte, ihre Schönheit wenigstens bei der Arbeit herunterzuspielen, indem sie kaum Make-up verwendete, streng geschnittene Kostüme und solide Schuhe mit flachen Absätzen trug. Dennoch war unübersehbar, daß Diana Perrin, zweiunddreißig Jahre alt und bereits zweimal geschieden, eine bildschöne Frau war.
»Was starrst du mich so an?« fragte Diana, als sie plötzlich Bonnies Blick bemerkte.
»Du siehst toll aus.«
»Na prächtig«, murmelte Diana. »Das meinten die Bullen wohl, als sie vorhin sagten, deine Reaktionen seien teilweise nicht angemessen gewesen.«
»Glaubst du, die werden mich verhaften?«
»Das bezweifle ich. Sie haben nicht genug Material, und da sie dich nicht auf deine Rechte aufmerksam gemacht haben, können sie nichts, was du ihnen erzählt hast, gegen dich verwenden.«
»Ist das, was ich ihnen erzählt habe, denn wirklich so schlimm?«
»Hm, schauen wir mal, was ich dir dazu sagen kann – unter Berücksichtigung der Tatsache natürlich, daß ich mich in meiner Praxis hauptsächlich mit Wirtschaftsrecht befasse und mit Strafrecht seit meinem Studium nichts mehr zu tun hatte. Also: Die Tote war die geschiedene Frau deines Mannes; ihr hattet nichts miteinander am Hut, trotzdem hast du eingewilligt, dich mit ihr zu treffen und deinem Mann nichts davon zu sagen; du hast dich aus einem Vortrag geschlichen und keinem Menschen etwas darüber gesagt, wohin du wolltest; du hast behauptet, du hättest zur Zeit des Mordes mit deinem Wagen irgendwo im Stau gestanden...«
»Das stimmt auch! Auf dem Massachusetts Turnpike war wegen eines Verkehrsunfalls alles blockiert. Das kann man doch überprüfen.«
»Das werden sie auch tun, das kann ich dir versprechen. Und genauso werden sie bei der Telefongesellschaft deine Anrufe überprüfen, sich bei der Schule nach dir erkundigen und bei den Leuten, die heute morgen an dem Symposion teilgenommen haben, auf dem du gewesen sein willst...«
»Da war ich doch auch, Herrgott noch mal!«
»Sie werden außerdem den Tachostand in deinem Wagen überprüfen, mit Margaret Palmays Nachbarn sprechen und deinen Anruf beim Notruf bis ins kleinste analysieren.«
»Aber was für ein Motiv sollte ich denn gehabt haben, Joan zu töten?«
Diana hob ihre schmale, wohlgebildete Hand und zählte die Gründe einen nach dem anderen an ihren Fingern ab. »Erstens – sie war die geschiedene Frau deines Mannes. Das könnte einigen als Motiv reichen. Zweitens – sie war eine Nervensäge. Drittens – sie war eine finanzielle Belastung für euch.«
»Aber die können doch nicht im Ernst glauben, ich hätte sie getötet, um Unterhaltszahlungen einzusparen!«
»Es sind schon Menschen für viel weniger getötet worden.«
»Verdammt noch mal, Diana, ich habe sie nicht getötet. Das weißt du doch!«
»Natürlich weiß ich das.« Diana drehte sich plötzlich ruckartig auf ihrem Stuhl herum, als wäre ihr eben eingefallen, daß sie etwas Wichtiges vergessen hatte. »Wo ist eigentlich Rod? Weiß er, was passiert ist?«
»Noch nicht. Ich konnte ihn erst vor zwanzig Minuten erreichen. Ich kann dir nicht sagen, wie fürchterlich das war. Ich konnte keinen Menschen auftreiben. Du warst in irgendwelchen Besprechungen; Rod war bei einem Arbeitsessen. Die einzige, die ich erreicht habe, war Pam Goldenberg.«
»Wer?«
»Ihre Tochter ist mit Amanda zusammen im Kindergarten. Wir wechseln uns immer mit dem Fahren ab. Ich hab’ sie gebeten, Amanda bei sich zu behalten, bis ich hier rauskomme.«
»Gut gemacht.«
»War auch an der Zeit.«
Diana griff über den Tisch und tätschelte ihrer Freundin die Hand. »Sei nicht so hart gegen dich selbst, Bonnie. Es kommt schließlich nicht jeden Tag vor, daß man über die tote Ex-Frau des eigenen Ehemanns stolpert.« Sie blickte zur Decke hinauf. »Was meinst du, wie Rod es aufnehmen wird?«
Bonnie zuckte mit den Achseln. »Ich denke, nach dem ersten Schock wird er es ganz gut wegstecken. Aber ich mache mir viel größere Sorgen um Sam und Lauren. Wie sollen die damit fertig werden, daß ihre Mutter ermordet wurde? Wie wird sich das auf sie auswirken?«
Dianas Stimme bekam einen zaghaften Ton. »Heißt das, daß die beiden zu euch ziehen werden?«
Bonnie überlegte. »Gibt es denn eine andere Möglichkeit?«
Sie schloß die Augen und hatte augenblicklich die Bilder der beiden halbwüchsigen Kinder Rods vor sich: Sam, sechzehn Jahre alt, Schüler an der Weston High School, sehr groß und sehr mager, mit schulterlangem Haar, das er sich gerade pechschwarz hatte färben lassen, und einem kleinen goldenen Ring im linken Nasenflügel; Lauren, vierzehn Jahre alt, eine mittelmäßige Schülerin, obwohl sie eine der besten Privatschulen in Newton besuchte, gertenschlank und rehäugig, mit dem dichten, langen roten Haar ihrer Mutter und dem gleichen vollen, sinnlichen Mund.
»Sie hassen mich«, murmelte Bonnie.
»Unsinn, sie hassen dich doch nicht.«
»Doch. Und ihre Halbschwester kennen sie kaum.«
Diana sah zum Innenfenster hinüber. »Da kommt Rod.«
»Gott sei Dank.« Bonnie sprang auf und beobachtete, wie eine junge Frau in zerknitterter blauer Uniform den großen, gutaussehenden Mann, mit dem sie verheiratet war, zu dem kleinen Büro wies. Bonnie lief zur Tür, wollte schon nach dem Knauf greifen und hielt plötzlich inne.
»Das darf doch nicht wahr sein«, sagte Diana und sprach damit Bonnies Gedanken laut aus.
»Ich glaub’ es einfach nicht.«
»Was tut die denn hier?«
Die Tür öffnete sich. Rod trat ins Zimmer, während die Frau hinter ihm von einem jungen Mann aufgehalten wurde, der ihr ein Heft oder einen Block zur Unterschrift hinhielt. Schon sammelte sich eine kleine Menschenmenge um sie. Aufgeregtes Getuschel war zu hören. »Ist das nicht Marla Brenzelle?« fragte jemand. »Ist das tatsächlich Marla Brenzelle?«
Marla Brenzelle, daß ich nicht lache, dachte Bonnie. Ich hab’ sie in der High School gekannt, als sie noch schlicht und einfach Marlene Brenzel war; bevor sie sich eine neue Nase und einen neuen Busen machen ließ, bevor sie sich ihre Zähne überkronen und ihren Bauch einnähen ließ, bevor sie sich von ihren Oberschenkeln das Fett absaugen und das Haar weizenblond färben ließ. Ich kannte sie schon, als ihr kein Mensch zuhörte außer den Unglücksraben, an die sie sich in den Schulpausen wie eine Klette hängte; ich kannte sie, lange bevor ihr Vater einen Fernsehsender kaufte und sie zum Star ihrer eigenen Talkshow machte. Das einzige, was sich bei Marlene Brenzel seitdem nicht verändert hatte, war ihr Hirn. Es hatte immer noch Spatzenformat.
»Oh, Rod! Ich bin so froh, daß du hier bist.«
»Ich bin gekommen, so schnell es ging. Marla wollte mich unbedingt selbst herfahren.« Rod nahm Bonnie in die Arme. »Was ist denn überhaupt los?«
»Hat man es dir nicht gesagt?« fragte Diana.
»Kein Mensch hat mir etwas gesagt.« Rod drehte sich nach Diana um, offensichtlich erstaunt über ihre Anwesenheit. »Was tust du denn hier?«
»Ich habe sie angerufen, als ich dich nicht erreichen konnte«, erklärte Bonnie.
»Ich verstehe nicht.«
»Vielleicht solltest du dich erst mal setzen«, meinte Diana.
»Was ist denn los?«
»Joan ist tot«, sagte Bonnie leise.
»Was?« Rod umfaßte mit beiden Händen eine Stuhllehne, als brauchte er Halt.
»Sie ist ermordet worden.«
Rods normalerweise schon blasses Gesicht wurde noch eine Spur blasser.
»Sie ist ermordet worden? Das ist doch unmöglich. Wie... wer...?«
»So wie es aussah, ist sie erschossen worden. Sie wissen nicht, wer es getan hat.«
Rod brauchte einen Moment, um ihre Worte zu verdauen. »Was soll das heißen, so wie es aussieht, ist sie erschossen worden? Woher weißt du denn, wie es aussah?«
»Ich war dort«, antwortete Bonnie. »Ich habe sie gefunden.«
»Was? Du hast sie gefunden? Wieso?« Rods Stimme drang bis in den Dienstraum hinaus, der Ton fassungsloser Verwirrung erregte die Aufmerksamkeit der ehemaligen Marlene Brenzel, die ihre Autogrammstunde abrupt unterbrach, um zu ihm zu eilen.
»Ich will sie hier drinnen nicht haben«, sagte Bonnie.
Rod trat hastig in den Dienstraum hinaus, hielt Marla auf, indem er ihr die Hand auf die Schulter legte und sich zu ihr neigte, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern. Bonnie sah, wie in den Augen der Frau Überraschung aufblitzte, obwohl in ihrem Gesicht kein Muskel zuckte. Die sind wahrscheinlich alle festgenäht, dachte Bonnie.
»Die hat so viele Schönheitsoperationen hinter sich, daß sie aussieht wie ein Fleckenteppich«, murmelte Diana. »Ihr Kinn ist so spitz, daß sie damit jemanden erstechen könnte.«
Bonnie mußte sich auf die Unterlippe beißen, um nicht zu lachen. Dann kam Rod wieder ins Zimmer, und das aufquellende Gelächter erstarb ihr in der Kehle.
Er hatte schon Mitte zwanzig die ersten grauen Haare gehabt, und war jetzt, Anfang vierzig, beinahe ganz ergraut. Doch ihn ließ das graue Haar jünger erscheinen; es betonte das dunkle Braun seiner Augen und verlieh den harten Kanten seines Gesichts – der langen Nase, dem eckigen Kinn – eine schmeichelnde Weichheit.
»Wissen es die Kinder schon?« fragte er.
»Noch nicht.« Bonnie ging zu ihm und schob ihren Arm unter den seinen.
»Was soll ich ihnen sagen?«
»Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein.« Captain Mahoney löste sich aus dem Menschenknäuel, das Marla Brenzelle umringte, trat in den kleinen Vernehmungsraum und schloß die Tür hinter sich. »Ich bin Captain Randall Mahoney von der hiesigen Kriminalpolizei. Detective Kritzic und ich haben Ihre Frau hierhergebracht.«
»Würden Sie mir bitte erklären, was eigentlich geschehen ist.«
Bonnie beobachtete ihren Mann, wie er dem Bericht des Captain zuhörte: Seine breiten Schultern krümmten sich schlaff nach vorn, als ihm bestätigt wurde, daß seine geschiedene Frau in der Tat erschossen worden war; seine Hände sanken wie leblos an seinen Seiten herab, als er erfuhr, daß Bonnie sich an diesem Morgen zu einem Zusammentreffen mit Joan bereit erklärt hatte, ohne ihm etwas davon zu sagen; und er schüttelte abwehrend den Kopf, als der Captain ihm sagte, daß Bonnie selbst die Polizei gerufen und dann jede weitere Kooperation mit der Begründung verweigert hatte, sie wolle erst mit ihrer Anwältin sprechen.
»Sie ist Wirtschaftsanwältin, Herrgott noch mal«, flüsterte Rod, ohne auch nur den Versuch zu machen, seine eingefleischte Abneigung gegen Diana zu verbergen. »Warum hast du sie angerufen?«
»Weil ich dich nicht erreichen konnte. Und ich wußte nicht, wen ich sonst anrufen sollte.«
Rod wandte sich wieder an Captain Mahoney. »Aber Sie werden doch meine Frau nicht verdächtigen«, sagte er herausfordernd.
»Im Augenblick geht es uns lediglich darum, Informationen zu sammeln«, antwortete Mahoney.
Bonnie hörte einen neuen Unterton in der Stimme des Polizeibeamten, einen feinen Anflug von Verständnisinnigkeit, als wollte er zu ihrem Mann sagen: Wir sind beide Männer; wir wissen doch, wie so etwas funktioniert; wir lassen uns nicht von unseren Emotionen hinreißen; jetzt, da Sie hier sind, wird es uns vielleicht endlich gelingen, Fortschritte zu machen.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn wir Ihnen einige Fragen stellen?« fragte Mahoney, als Detective Kritzic die Tür öffnete und ins Zimmer trat.
»Da ist vielleicht etwas los«, murmelte sie, offensichtlich ziemlich erhitzt von ihrem flüchtigen Zusammentreffen mit der Prominenz.
»Mr. Wheeler, das ist Detective Natalie Kritzic.«
Natalie Kritzic nickte etwas verlegen und versuchte, ein unterschriebenes Foto Marla Brenzelles hinter ihrem Rücken zu verstecken. »Ich habe gehört, Sie sind ihr Regisseur«, sagte sie. »Ich bin ein großer Fan der Sendung.«
Na reizend, dachte Bonnie.
Rod nahm das Kompliment mit einem Lächeln entgegen. »Wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise helfen kann, bin ich natürlich gern bereit...«
»Sie sind der geschiedene Mann von Joan Wheeler?« fragte Mahoney.
»Ja.«
»Darf ich fragen, wie lange Sie verheiratet waren?«
»Neun Jahre.«
»Und wann haben Sie sich scheiden lassen?«
»Vor sieben Jahren.«
»Kinder?«
»Ein Junge und ein Mädchen.« Er sah Bonnie hilfesuchend an.
»Sam ist sechzehn, und Lauren ist vierzehn«, bemerkte sie.
Rod nickte. Schweigend sahen sie zu, wie Randall Mahoney sich diese Informationen notierte.
»Wissen Sie etwas darüber, ob Ihre geschiedene Frau Feinde hatte, Mr. Wheeler?«
Rod zuckte mit den Achseln. »Meine geschiedene Frau war nicht besonders diplomatisch, Captain. Sie hatte nicht viele Freunde. Aber Feinde – das kann ich wirklich nicht sagen.«
»Wann haben Sie Ihre geschiedene Frau das letzte Mal gesehen, Mr. Wheeler?«
Rod mußte einen Moment überlegen. »Zu Weihnachten wahrscheinlich, als ich die Geschenke für die Kinder hinüberbrachte.«
»Und wann haben Sie das letzte Mal mit ihr telefoniert?«
»Daran kann ich mich nicht erinnern.«
»Aber wie Ihre Frau uns sagte, hat sie häufig bei Ihnen zu Hause angerufen.«
»Meine geschiedene Frau war Alkoholikerin, Captain Mahoney«, sagte Rod, als erklärte das alles.
»Standen Sie mit Ihrer geschiedenen Frau auf freundschaftlichem Fuß, Mr. Wheeler?«
»Beantworte das nicht«, riet Diana von der anderen Seite des Zimmers. Ihre Stimme war ruhig, aber dennoch energisch. »Das ist hier nicht von Bedeutung.«
»Ich habe kein Problem damit, diese Frage zu beantworten«, sagte Rod knapp in Dianas Richtung. »Nein, natürlich standen wir nicht auf freundschaftlichem Fuß. Sie war total übergeschnappt.«
»Glänzende Antwort«, hörte Bonnie Diana nicht gerade leise vor sich hin murmeln. Diana hob abwehrend die Hände und verdrehte die Augen.
Mahoney gestattete sich ein dünnes Lächeln. »Wie Ihre Frau uns berichtete, wurde sie von Ihrer geschiedenen Frau heute morgen angerufen und vor irgendeiner Gefahr gewarnt. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Ex-Frau damit gemeint haben könnte?«
»Joan hat gesagt, du wärst in Gefahr?« fragte Rod an Bonnie gewandt. Seine Stimme drückte die gleiche Ungläubigkeit aus wie sein gutaussehendes Gesicht. Mit einer Hand rieb er sich die Stirn, bis sie rosig wurde. »Nein, ich habe keine Ahnung, was sie damit gemeint haben könnte.«
»Wer würde vom Tod Ihrer geschiedenen Frau profitieren, Mr. Wheeler?«
Rods Blick wanderte langsam von Mahoney zu Bonnie, dann wieder zurück zu dem Polizeibeamten. »Ich verstehe die Frage nicht.«
»Ich rate dir, sie nicht zu beantworten«, unterbrach Diana erneut.
»Worauf wollen Sie hinaus?« fragte Rod ungeduldig, wobei schwer zu sagen war, ob seine Ungeduld sich gegen den Polizeibeamten oder gegen Diana richtete.
»Hat Ihre geschiedene Frau eine Lebensversicherung? Hat Ihre geschiedene Frau ein Testament gemacht?«
»Ich weiß nicht, ob sie ein Testament gemacht hat«, antwortete Rod, jedes Wort langsam und überlegt aussprechend. »Ich weiß, daß sie eine Lebensversicherung hatte, weil ich selbst die Prämien bezahlt habe. Das war Teil unserer Scheidungsvereinbarung«, fügte er erklärend hinzu.
»Und wer ist der Begünstigte dieser Lebensversicherung?« fragte Mahoney.
»Ihre Kinder. Und ich«, antwortete Rod.
»Und wie hoch ist die Versicherung?«
»Zweihundertfünfzigtausend Dollar«, gab Rod zurück.
»Und wem gehört das Haus in der Exeter Street 13? Auf wessen Namen ist es eingetragen?«
»Auf unser beider Namen.« Rod schwieg einen Moment und räusperte sich. »Gemäß unserer Scheidungsvereinbarung hatte sie das Recht gehabt, in dem Haus zu leben, solange die Kinder noch zur Schule gehen. Danach hätte sie es verkaufen müssen, und wir hätten den Erlös geteilt.«
»Wieviel ist das Haus Ihrer Meinung nach heute wert, Mr. Wheeler?«
»Da habe ich wirklich keine Ahnung. Joan war die Immobilienmaklerin.« Rods Gesicht hatte einen gereizten Ausdruck. »Ich denke, das reicht jetzt. Ich würde gern mit meiner Frau nach Hause fahren.«
»Wo waren Sie heute, Mr. Wheeler?«
»Pardon?« Rods Gesicht lief plötzlich rot an.
»Ich muß das fragen«, erklärte Mahoney beinahe entschuldigend.
»Aber er muß die Frage nicht beantworten«, warf Diana ein.
»Ich war im Studio«, antwortete Rod hastig.
Wieder verdrehte Diana die Augen zur Decke.
»Den ganzen Tag?«
»Selbstverständlich.«
Bonnie war plötzlich verwirrt. Wenn er den ganzen Tag im Studio gewesen war, wieso hatte sie ihn dann nicht erreichen können, als sie angerufen hatte?
»Ihre Frau hat über eine Stunde lang versucht, Sie zu erreichen, Mr. Wheeler«, sagte Mahoney, als hätte er Bonnies Gedanken gelesen.
»Ich habe mir mittags ein paar Stunden freigenommen«, erklärte Rod.
»Da haben Sie doch gewiß Zeugen...«
Rod atmete einmal tief durch und gab ein Geräusch von sich, das halb wie ein Lachen, halb wie ein Seufzen klang. »Nein, Zeugen habe ich keine. Ich habe das Mittagessen nämlich ausfallen lassen. Ich hab’ in der Zentrale zwar hinterlassen, daß ich zum Mittagessen gehen würde und nicht erreichbar wäre, tatsächlich habe ich mich aber in meinem Büro ein paar Stunden hingelegt. Wir sind in der vergangenen Nacht kaum zum Schlafen gekommen. Unsere kleine Tochter hat uns auf Trab gehalten. Sie hatte einen Alptraum.«
Bonnie nickte bestätigend.
»Es hat Sie also niemand gesehen?«
»Erst nach zwei Uhr, da mußte ich zu einer Besprechung. Hören Sie«, fuhr er unaufgefordert fort, »ich war vielleicht nicht gerade ein begeisterter Fan meiner geschiedenen Frau, aber ich habe ihr ganz gewiß nichts Böses gewünscht. Ich finde es grauenhaft, daß ihr so etwas zustoßen mußte.« Er drückte Bonnie fest an sich. »Das geht uns beiden so.«
Danach folgte eine lange Pause des Schweigens. Aus dem Dienstraum nebenan war Marla Brenzelles zwitscherndes Gelächter zu hören. Sie zieht da draußen die große Schau ab, dachte Bonnie, während sie die Frau beobachtete, die in ihrem leuchtendgelben Valentino-Kostüm hüftschwenkend umherstolzierte und ihren sie bewundernden Fans ein imaginäres Mikrofon unter die Nasen hielt.
»Ich denke, das ist im Augenblick alles«, sagte Mahoney. »Wir werden aber sicher noch einmal mit Ihnen sprechen müssen.«
»Wir sind jederzeit für Sie da«, erwiderte Rod, aber es klang nicht mehr so aufrichtig wie zu Beginn der Vernehmung.
»Wir müssen auch mit Sam und Lauren sprechen«, fügte Detective Kritzic hinzu.
Rod sah sie bestürzt an. »Sam und Lauren? Warum?«
»Sie haben mit ihrer Mutter zusammengelebt«, erklärte Detective Kritzic. »Es könnte sein, daß sie uns bei der Frage, wer ihre Mutter getötet hat, weiterhelfen können.«
Rod nickte. »Kann ich vorher selbst mit ihnen sprechen? Ich glaube, es wäre besser, wenn ich ihnen sage, was geschehen ist.«
»Aber natürlich«, antwortete Mahoney. »Jetzt hätten wir nur noch gern Ihre Genehmigung, das Haus durchsuchen zu dürfen. Es könnte ja sein, daß es dort irgendwelche Hinweise gibt.«
Rod nickte. »Jederzeit.«
»Gut, wir kommen dann in ein paar Stunden vorbei. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie bis dahin nichts im Haus verändern würden. Wenn Ihre Kinder etwas wissen oder Ihnen noch etwas einfallen sollte, das uns weiterhelfen könnte, rufen Sie uns bitte unverzüglich an.«
»In Ordnung.«
Rod drückte Bonnies Schulter und führte sie zur Tür.
»Ach, übrigens«, sagte Mahoney, als sie hinausgehen wollten, »besitzen Sie oder Ihre Frau eine Schußwaffe?«
»Eine Schußwaffe?« Rod schüttelte den Kopf. »Nein«, antwortete er und legte ein Maß an Entrüstung in dieses eine Wort, das für mehrere Sätze ausgereicht hätte.
4
Mit dem Auto ist Newton von Boston aus innerhalb von Minuten zu erreichen. Der Vorort zählt knapp dreiundachtzigtausend Einwohner und besteht aus vierzehn sehr unterschiedlichen Dörfern, mit Oak Hill im Südosten und Auburndale im Nordwesten. Joan Wheeler und ihre Kinder wohnten in West Newton Hill, dem exklusivsten Teil der Gemeinde.
Das Haus in der Exeter Street 13 war groß und im Tudor-Stil gebaut. Mehrere Jahre zuvor hatte Joan die ganze Fassade, auch Fenster und Türrahmen, in einem grünlichen Beigeton streichen und die vorderen Fenster im Erdgeschoß mit Buntglasscheiben versehen lassen. Infolgedessen machte das Haus jetzt den Eindruck, als könnte es sich nicht entscheiden, was es eigentlich sein wollte – Wohnhaus oder Kathedrale. Die bunten Fenster waren primitiv und rätselhaft: ein Mann in langen wallenden Gewändern, zu dessen Füßen ein Hund spielte; eine modern gekleidete Frau, die einen Wasserkrug auf dem Kopf balancierte; ein Sämann bei der Bestellung seines Landes; zwei dickliche Kinder, die an einem Wasserfall spielten.
Rod nahm seinen Kopf in die Hände, als Bonnie ihren Wagen in die Einfahrt lenkte.
»Geht’s dir nicht gut?« fragte Bonnie.
Rod richtete sich auf und lehnte seinen Kopf an die Kopfstütze. »Ich kann einfach nicht glauben, daß sie tot ist. Sie war immer so unglaublich vital.« Er blickte zur Haustür hinüber. »Mir graut davor, da reinzugehen. Ich weiß nicht, wie ich es ihnen beibringen soll... was ich sagen soll, um es ihnen leichter zu machen...«
»Du wirst schon die richtigen Worte finden«, sagte Bonnie zuversichtlich. »Und du weißt, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um ihnen zu helfen.«
Rod nickte schweigend, öffnete die Autotür und stieg aus. Dunkle Regenwolken hingen am Himmel.
»April ist der grausamste Monat«, deklamierte Bonnie lautlos, sich eines Gedichts von T. S. Eliot erinnernd, und schob ihre Hand in die ihres Mannes, als sie langsam und ernst den Weg hinaufgingen.
Vor der großen Flügeltür aus Holz blieb Rod stehen, kramte in seiner Tasche nach den Schlüsseln.
»Du hast Schlüssel?« fragte Bonnie überrascht.
Rod stieß die Tür auf. »Hallo!« rief er, als sie eintraten. »Ist jemand zu Hause?«
Bonnie sah auf ihre Uhr. Es war fast halb fünf.
»Hallo!« rief Rod wieder, und Bonnie ging ein paar zaghafte Schritte nach rechts, zum Wohnzimmer.
Die Wände des Raumes waren mit einem blaßblauen, in sich gemusterten Satin bespannt. Stilmöbel, ein Sofa mit altrosa Seidenbezug und zwei blaugoldene Sessel, standen vor einem großen offenen Kamin, mehrere offensichtlich teure, indische Teppiche lagen wie achtlos hingeworfen auf dem dunklen Parkettboden. An den Wänden hingen Kohlezeichnungen in schlichten Rahmen: eine Frau, die ein junges Mädchen an sich drückte; zwei Frauen mittleren Alters, die wie hingegossen in der Nachmittagssonne lagen; zwei alte Frauen beim Nähen.
»Die sind wirklich schön«, sagte Bonnie, den Blick auf die Zeichnungen gerichtet.
Auf dem Weg durch das Eßzimmer strich sie mit der Hand über den langen, schmalen Eichentisch, der, von hochlehnigen Stühlen mit rostroten Ledersitzen umrahmt, die Mitte des Raumes einnahm.