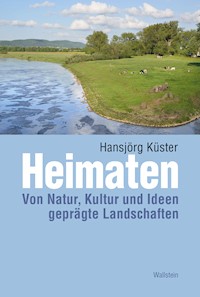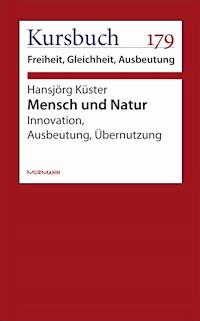16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Pflanzliches Leben ist grundlegend für alle Formen von Leben auf der Erde. Ein Leben ohne Tiere und Menschen auf der Erde ist möglich, ein Leben ohne Pflanzen hingegen undenkbar. Vom Moos bis zum Mammutbaum, von den Algen im Meer bis zur Idee der Nachhaltigkeit beschreibt Hansjörg Küster, Professor für Pflanzenökologie, die fundamentale Bedeutung der Pflanzen. Er schildert die pflanzliche Evolution genauso wie den Entwicklungsgang der einzelnen Pflanze vom Keimling bis zur Blüte. Und überrascht mit einem Vorschlag: Um die Klimakrise zu lösen, müssen und können wir uns an den Pflanzen orientieren. Pflanzen umgeben uns – überall. Oft sind es nur Teile von ihnen: Äpfel oder andere Früchte, Kartoffeln, Karotten, Salatblätter, ein Blumenstrauß. Es sind auch Produkte dabei: Gewürze, gemahlenes Korn in Form von Mehl, Pflanzenfasern, Holz, Pressspan. Früchte und Samen bilden die Nahrung vieler Vögel und Säugetiere. Kulturpflanzen und ihr Anbau werden schließlich zur treibenden Innovation menschlicher Kultur. Hansjörg Küster schildert den Entwicklungsgang der einzelnen Pflanze vom Keimling bis zur Blüte und zur Frucht, zeichnet vor allem aber auch die Evolution der Pflanzen innerhalb der Erdgeschichte nach. Pflanzen allein sind dazu in der Lage, organische Substanzen aufzubauen, sie geben lebensnotwendigen Sauerstoff in die Atmosphäre ab und haben, seitdem es Fotosynthese gibt, den Gehalt an Kohlenstoffdioxid in der Atmospähre so weit verringert, dass sich das Leben unter geeigneten Temperaturbedingungen abspielen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hansjörg Küster
Flora
Die ganze Welt der Pflanzen
C.H.Beck
Zum Buch
Pflanzliches Leben ist grundlegend für alle anderen Formen von Leben auf der Erde. Ein Leben ohne Tiere und Menschen auf der Erde ist möglich, ein Leben ohne Pflanzen hingegen undenkbar. Vom Moos bis zum Mammutbaum, von den Algen im Meer bis zur Idee der Nachhaltigkeit beschreibt Hansjörg Küster die fundamentale Bedeutung der Pflanzen. Er schildert die pflanzliche Evolution genauso wie den Entwicklungsgang der einzelnen Pflanze vom Keimling bis zur Blüte. Und überrascht mit einem Vorschlag: Um die Klimakrise zu lösen, müssen und können wir uns an den Pflanzen orientieren.
Über den Autor
Hansjörg Küster ist Professor für Pflanzenökologie am Institut für Geobotanik der Leibniz Universität Hannover. Bei C.H.Beck sind jüngst von ihm erschienen: Deutsche Landschaften. Von Rügen bis zum Donautal (2017), Der Wald. Natur und Geschichte (2019), Die Alpen. Geschichte einer Landschaft (2020).
Inhalt
1: Geschöpfe ohne Willen
2: Einfachste Organismen
3: Die willenlose Evolution
4: Die Pflanzenzelle
5: Die Algen im Meer
6: Tatsachen und Rätsel zur ersten Landpflanze
7: Die Wurzel
8: Der Spross
9: Das Blatt
10: Verschiedene Landpflanzen
11: Urpflanze und Kormus
12: Blüten und Pollenkörner
13: Samen und Früchte
14: Pflanzen als Nahrung
15: Kulturpflanzen
16: Hinter dem Gartenzaun
17: Vegetation ohne Grenzen
18: Wachstum und Wandel
19: Nachhaltige Nutzung
Wie dieses Buch entstanden ist – Ein Bericht statt eines Nachworts und eines Literaturverzeichnisses
Bildnachweis
Innenteil
Tafelteil
Register
1Sägetang und Gabelzunge, zwei große Algen, im Felswatt vor Helgoland
2Lebendrekonstruktion der fossilen Pflanzengattung Cooksonia, deren Vertreter zu den ältesten bekannten Landpflanzen gehören.
3In den charakteristisch geformten Blüten der Akelei erkennen einige fünf Vögel, die die Köpfe zusammenneigen und an ihren Flügeln verbunden sind. Die Römer sahen darin fünf Adler und benannten die Pflanze nach Aquila, dem Adler, «Aquilegia».
4Die Arnika besitzt einen Blütenstand, der insgesamt wie eine einzelne Blüte aussieht, aber aus zahlreichen kleinen Blüten besteht.
5Blütenbockkäfer in einer Margerite
6Früchte der Großen Klette besitzen Widerhaken, die im Fell von Tieren hängen bleiben und auf diese Weise verbreitet werden.
7Kloster Reichenau mit Kräutergarten, gestaltet nach dem mittelalterlichen Vorbild von Walahfrid Strabo
8Pollenkorn der Fichte
9 Zonobiome der Erde nach Walter und Breckle
10Lucas Cranach der Jüngere, Der Weinberg des Herrn, 1569, Epitaph für Paul Eber, Stadtkirche Wittenberg
11Oberrheinischer Meister, Das Paradiesgärtlein, etwa 1410/20
1
Geschöpfe ohne Willen
«Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren: Was sie willenlos ist, sei du es wollend – das ists!»
Friedrich Schiller
Pflanzliches Leben ist grundlegend für alle anderen Formen von Leben auf der Erde. 99,5 Prozent aller organischen Masse wurden von Pflanzen aufgebaut. Ein Leben auf der Erde ist möglich, wenn es dort keine Tiere, erst recht, wenn es dort keine Menschen gibt. Aber ein Leben auf der Erde ohne Pflanzen ist undenkbar. Sie allein sind dazu in der Lage, organische Substanzen aufzubauen, die von Tieren und Menschen als Nahrung aufgenommen werden können, sie geben lebensnotwendigen Sauerstoff in die Atmosphäre ab und haben, seitdem es Fotosynthese gibt, den Gehalt an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre so weit verringert, dass sich das Leben in seinen wesentlichen Zügen unter geeigneten Temperaturbedingungen abspielen kann. Das ist – von Ausnahmen abgesehen – nur zwischen dem Gefrierpunkt und etwas über 40 Grad Celsius möglich. Im Eis können die meisten Lebewesen nicht existieren, weil sie dann kein Wasser erhalten – es ist ja gefroren. Bei Temperaturen von weit mehr als 40 Grad Celsius werden Eiweiße denaturiert, das heißt, sie verlieren ihre Struktur und Funktion. Es gibt nur ganz wenige Lebewesen, die bei höheren oder niedrigeren Temperaturen leben können. Es ist ein großer Zufall, dass sich derzeit eine so enge Spanne an Temperaturen auf unserem Planeten zur Entwicklung besonders vieler Formen von Leben nutzen lässt. Wasser hat dabei eine wichtige Funktion: Es erwärmt sich weniger rasch als die Atmosphäre, kühlt aber auch langsamer ab und trägt so zur Stabilisierung der Temperaturen bei. Im Wasser war das Temperaturintervall von null Grad Celsius bis etwas über 40 Grad Celsius früher erreicht als außerhalb davon. Das Leben entstand im Wasser. Es konnte sich erst dann auf das Land ausbreiten, als die im Meer lebenden Pflanzen genug Fotosynthese betrieben und genug Kohlenstoffdioxid abgebaut hatten und die Temperaturen auf ein für das Landleben geeignetes Niveau abgesunken waren.
Pflanzen treten uns in vielen Erscheinungsformen entgegen. Sie leben überall dort im Meer, wo noch genug Sonnenlicht ins Wasser eindringt. Sie leben auf dem Land, wo noch genug Regen auf die Erdoberfläche trifft. Sie leben als Einzeller im Wasser, als winzige Moose auf dem Land. Es gibt untermeerische «Wälder» aus Tang. Wälder, die diese Bezeichnung wirklich verdienen, weil sie Bäume enthalten, finden wir aber vor allem auf dem Land. Darunter sind immergrüne tropische Regenwälder, Laub abwerfende Wälder der gemäßigten Zonen und Nadelwälder im hohen Norden. Pflanzen sind unsere Nahrung, Menschen sammeln sie, bauen sie als Kulturpflanzen an. Auch die meisten Gewürze sind pflanzliche Produkte.
Pflanzen haben jedoch keineswegs immer einen materiellen Nutzen. Wir können uns an ihnen auch einfach erfreuen, selbst an unscheinbaren Gewächsen, die wir am Wegrand finden. Von bestimmten Pflanzen pflücken wir Blumensträuße, die wir als Stillleben auf den Tisch stellen. Sie betreiben noch Fotosynthese, nehmen Wasser auf, was wir daran merken, dass wir das Wasser in der Blumenvase nachfüllen müssen, aber sie sind doch – willenlos – dem Tod geweiht, weil ihnen die Wurzeln fehlen. Wir beobachten, wie sich die Rose entfaltet, an jedem Tag einen anderen Anblick bietet: die geschlossene Knospe, die sich öffnenden Blüten, die abfallenden Blütenblätter. Blumen haben symbolische Bedeutungen, man nimmt eine ungerade Zahl von Tulpen oder Rosen, um einen Strauß zu binden und ihn zu überreichen. Rote Nelken sind für viele Menschen die Blumen der Sozialisten, Seerosen bringt man nicht mit, weil das Unglück bedeutet.
Dennoch wird die zentrale wichtige Bedeutung der Pflanzen von vielen Menschen nicht auf den ersten Blick wahrgenommen. Sie finden Tiere «interessanter». Pflanzen sind einfach «da», Tiere hingegen gilt es zu entdecken. Und sie scheinen so viel «lebendigere» Kreaturen zu sein als die Pflanzen. Im Grunde genommen aber leisten Tiere genau wie wir Menschen viel weniger als Pflanzen. Nur Pflanzen können über die Fotosynthese organische Stoffe aufbauen, aus dem Unsichtbaren sichtbare Materie schaffen. Tiere und Menschen sind auf die Syntheseleistung der Pflanzen angewiesen, um an Nahrung zu kommen.
Die Pflanzenwelt steht mit den drei wichtigsten Erdoberflächenprozessen, mit denen sich Geowissenschaftler befassen, in Verbindung. Der Kreislauf des Wassers als wichtigster dieser Prozesse wird von der Vegetation beeinflusst. Denn zusätzlich zu den Wassermengen, die von der Oberfläche des Landes und auch von den Oberflächen der Pflanzen verdunsten, geben Pflanzen weiteres Wasser ab. Neues Wasser steigt mit neuen Mineralstoffen aus dem Wurzelraum in die Blätter auf. Deswegen kann sich die Oberfläche von Blättern und Sprossen immer wieder abkühlen. Man nennt das Transpiration, ein Vorgang, der mit Verdunstung oder Evaporation (wörtlich: Dampfbildung) nichts zu tun hat. Auch Tiere geben Wasser ab, sie transpirieren ebenfalls oder schwitzen. Die Menge der Wasserabgabe durch Pflanzen ist erheblich größer als die von Tieren. Über bewachsenen Flächen bilden sich zusätzliche Wolken. Sie steigern auch die Regenmengen, die Pflanzen wie Tiere beleben.
Zweitwichtigster Erdoberflächenprozess ist die Fotosynthese, mit der die Pflanzen aus einfachen anorganischen Stoffen, Kohlenstoffdioxid und Wasser, unter Nutzung von Lichtenergie organische Substanzen herstellen. Ein großer Teil davon wird im Verlauf des drittwichtigsten Erdoberflächenprozesses, der Atmung oder Zellatmung, wieder abgebaut, und zwar möglicherweise bereits in der Pflanzenzelle, in der gleichen Zelle also, in der die Fotosynthese geleistet wird. Allerdings kann die Atmung niemals den gleichen Umfang wie die Fotosynthese erreichen, denn ein Teil der aufgebauten organischen Substanz wird für das Wachstum der Zelle und der gesamten Pflanze verwendet. Die Fotosyntheseleistung der grünen Teile der Pflanze muss dazu ausreichen, dass auch andere Pflanzenteile, etwa Wurzeln und Früchte, organische Substanz erhalten. Mit den Produkten der Fotosynthese bekommen genauso alle anderen Lebewesen, die keine grünen Pflanzen sind, ihre Nahrung, die Tiere also, die Pilze und auch viele Mikroorganismen. Wenn Tiere Fleisch fressen, muss auch dieses Fleisch ursprünglich einmal von organischer Substanz aufgebaut worden sein, die aus Fotosyntheseprodukten der Pflanze hervorgegangen ist.
Obwohl also die Bedeutung von Pflanzen ungleich größer ist als die von Tieren; obwohl es eine Welt aus Pflanzen und einigen Mikroorganismen geben kann, aber keine Welt, auf der ausschließlich Tiere leben; obwohl die von Pflanzen geleisteten stofflichen Umsetzungen erheblich größer sind und man sich allein von Pflanzen ernähren kann, ausschließlich von Tieren hingegen nur unter Schwierigkeiten; obwohl die Landschaft hauptsächlich durch Vegetation und nur zu einem kleinen Teil durch Tiere bestimmt wird – trotz alledem erfolgt der Zugang zur Biologie, der Wissenschaft vom Leben, für die meisten Menschen über Tiere. Tiere werden im Biologieunterricht meistens vor den Pflanzen behandelt. Tiere finden die meisten Menschen interessanter. Viel mehr Menschen gehen in den Zoo als in einen Botanischen Garten. Kinder bauen Nistkästen, um erste Naturerfahrungen zu sammeln, und legen viel seltener ein Herbarium an. Das ist «unlogisch», denn man befasst sich mit Organismen, die nicht ohne andere bestehen können, anstatt zuerst diejenigen Lebewesen zu besprechen, die an allem Anfang stehen. Und das sind die Pflanzen, nicht die Tiere.
Diese der Natur und der Evolution widersprechende Bevorzugung des tierischen Lebens hat weit zurückreichende Wurzeln. Laut dem biblischen Schöpfungsbericht nahm Gott sich für die Schöpfung der Pflanzen nur einen halben Tag Zeit, für die Schöpfung von Tieren und Menschen brauchte er hingegen zwei ganze Tage. Auch wenn man «Tage» hier nicht wörtlich als genau gleiche Zeitabschnitte von 24 Stunden Dauer auffassen muss, so währte doch die Erschaffung von Tieren und Menschen dem Schöpfungsmythos der Bibel nach viermal so lange wie die Erschaffung der Pflanzen. Tiere und Menschen wurden also als komplexer angesehen als die Pflanzen, die der Erde entsprossen. Dass das Leben aber mit der Schöpfung der Pflanzenwelt entstand und dass dieser Schritt der Evolution eigentlich der viel komplexere war als die Hervorbringung der Tiere und Menschen – das wurde nicht erkannt.
Die geringere Bedeutung, die Menschen den Pflanzen gaben, geht noch aus einer anderen alttestamentlichen Erzählung hervor: der Geschichte von der Sintflut. Noah verwendete Holz als Baustoff für die Arche – aber wo blieben die Bäume, als die Erde überflutet wurde? Er hätte die Arche auf ihrer Reise über den endlosen Ozean niemals ausbessern können. Nur die Tiere durften auf die Arche, jeweils ein männliches und ein weibliches Individuum. Pflanzen kamen nur in Form von Futter auf das Schiff. So wurden pflanzlicher Baustoff und pflanzliche Nahrung genutzt, aber nicht vor der Überflutung bewahrt. Alle Vegetation versank mit allen anderen Lebewesen, die Noah auf seiner Arche nicht mitnehmen konnte, in der Sintflut. Man hatte gewiss die Erfahrung gemacht, dass dies geschah, wenn Flüsse über die Ufer traten und das Land weithin unter Wasser setzten; in den Gebieten, in denen sich diese Katastrophen ereigneten, starben die Pflanzen sicher nicht überall ab. Aber in der Sintflut von biblischem Ausmaß? Hätte es nicht auch eine Arche Flora geben müssen?
Schließlich hörte es auf zu regnen, wie jeder aus der biblischen Geschichte über die Sintflut weiß. Das Zeichen dafür, dass wieder Land auftauchte, brachte die Taube zur Arche: Sie fand einen Ölbaumzweig. Das Wasser musste sich also vom Land zurückgezogen haben, und Landpflanzen wie der Ölbaum konnten wieder auf dem Land leben. Wo hatte der Ölbaum die Zeiten der Überflutung überdauert? Das beschäftigte die Menschen offenbar nicht; Pflanzen kamen wieder, ebenso wie die Landoberfläche wieder auftauchte, wenn sintflutartiger Regen aufhörte.
In der Schule haben wir nicht nur diese biblischen Geschichten gehört, viele von uns wurden als Kinder ebenfalls zuerst mit Tieren, dann mit Pflanzen vertraut gemacht. Kommt man aber dann, beispielsweise im Biologieunterricht, ausgehend von den Tieren endlich auch zu den Pflanzen, werden sie in der Regel mit Tieren verglichen. Eine Pflanze muss doch genauso wie ein Tier Gefühle, so etwas wie einen Blutkreislauf haben, sie muss sich mit anderen Pflanzen unterhalten oder mindestens kommunizieren können! Sie muss sich doch freuen können, Schmerzen haben! Und sie muss doch einen Willen haben! Wer nach solchen Parallelen zwischen Tier und Pflanze sucht oder behauptet, nach diesen Parallelen zu suchen, hat die Pflanze – und damit das Leben auf der Erde insgesamt – nicht verstanden. Dieser Aussage wird die eine oder andere Leserin, der eine oder andere Leser nicht zustimmen, vielleicht wird sie oder er sie sogar mit Empörung ablehnen. Aber sie ist grundlegend. Nicht im Entferntesten ist das Leben einer Pflanze von etwas geprägt, das «Willen» genannt werden könnte oder äußerlich sichtbar eine Aktivität anzeigt. Sie blüht und fruchtet, bildet neue Blätter, Sprosse, Zweige, Äste und Stämme, auch Wurzeln. Ihr Wachstum ist kein aktiver, aber auch kein wirklich passiver Vorgang. Von den Verben, die die Entwicklung einer Pflanze beschreiben, gibt es weder eine aktive noch eine passive Form. Niemand spricht von einem «gewachsen werden», eine Pflanze wird auch nicht «geblüht» oder «gefruchtet» und «gereift», aber die Pflanze keimt, wächst, treibt Blätter, Blüten, Früchte, ohne dies aktiv zu wollen. Um dies adäquat auszudrücken, benötigte man eigentlich ein Genus Verbi zwischen aktiv und passiv, wie es im Altgriechischen oder dem Sanskrit in der Form des Mediums existiert. Die Pflanze ist tatsächlich willenlos, sie kann von Menschen gepflanzt, gesät oder gezogen werden, alles andere ist weder der Macht von uns Menschen noch der Macht der Pflanze unterworfen.
Die Pflanze steht an einem Wuchs- oder Standort, an dem sie mit allen Stoffen versorgt wird, die sie für ihr Leben braucht, man kann sie dort «willenlos» nennen. Eine Wasserpflanze ist mit genügend Wasser versorgt, eine Landpflanze erhält Wasser aus dem Boden – oder über den Niederschlag, der zuerst in den Boden eindringt und dort die Wurzeln der Pflanze erreicht, um dann in deren andere Teile aufzusteigen. Alle notwendigen Mineralstoffe sind im Meerwasser vorhanden, viele davon auch in ausreichender Menge im Boden. Es gibt mehr Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre als im Wasser, aber in der Nähe der Wasseroberfläche ist doch genug davon vorhanden – genauso, wie es dort ausreichend Licht für die Existenz der Pflanze gibt. Ein Ort, an dem die Pflanze alles findet, was sie zum Leben braucht, ist sozusagen ihr «Schlaraffenland» aus Wasser, Luft, Mineralien und Licht.
Bei einem Tier spricht man aber in der Regel nicht von einem Standort, an dem es sich ein Leben lang aufhalten kann. Es gibt nur wenige Tiere, die ortsfest leben. Die meisten Tiere müssen sich vielmehr bewegen, ein Habitat suchen, innerhalb dessen sie von Ort zu Ort ziehen. An dem einen Ort gibt es Wasser, an einem anderen finden sie optimale Nahrung. Wasser und Nahrung müssen aufgespürt werden. Ihre Quellen müssen vom Tier mit speziellen Sinnen wahrgenommen werden, es muss zu einer koordinierten Aufnahme der Nahrung und des Wassers kommen, das Tier muss also fressen und trinken. Und dann muss es eine Ausscheidung von denjenigen Stoffen geben, die es nicht verwerten kann. Dies funktioniert jedenfalls bei komplex gebauten Tieren nur unter Verwendung eines Nervensystems, das Impulse von Ort zu Ort weiterleitet.
Pflanzen fressen keine organische Substanz wie die Tiere. Daher müssen sie den Ort nicht finden, an dem es etwas zu fressen gibt. Wozu bräuchten sie dann ein Nervensystem? Sie nehmen Wasser und Mineralien auf, behalten die Mineralstoffe und scheiden das Wasser durch die schon erwähnte Transpiration wieder aus. Aber sie besitzen nichts, was sich mit einem Kreislauf vergleichen lässt, einem Blutkreislauf etwa, der überschüssige Substanzen im Körper transportiert, um sie auszuscheiden. Das alles macht die Pflanze willenlos. Ein eigener Wille ist gar keine Kategorie, der für die Entwicklung einer Pflanze notwendig wäre.
Ein Wille ist überhaupt nichts unbedingt Lebensnotwendiges. Einen Willen zu haben, eine Absicht, aber auch Schmerzen empfinden zu können, all das ist kein notwendiges Kriterium, um das zu beschreiben, was Leben auszeichnet. Pflanzliches Dasein und auch das Leben der Tiere, ja selbst unser eigenes Leben ist viel stärker passiv, als wir denken. Aber wie dem auch sei: Auf jeden Fall ist die Pflanze ein ganz anderes Lebewesen als ein Tier, das man nur dann versteht, wenn man es nicht mit dem Tier vergleicht, wenn man also nicht das, was man im Tier sehen möchte, auf eine Pflanze überträgt. Nur dann wird die enorme Bedeutung der Pflanzenwelt klar. Das gilt sowohl für einen wissenschaftlichen als auch für einen emotionalen Zugang. Wie man die Dinge auch ergründet, ob man das Leben als Wunder sehen will, als Gottes Werk oder auf einer wissenschaftlichen Basis: Zentral für alles Leben auf dieser Welt sind in jedem Fall die Pflanzen, die das Habitat eines Tieres bilden, es einrahmen in den Ökosystemen, die Existenz der Tiere und auch die menschliche Existenz erst ermöglichen. Aber dazu bedurfte es niemals etwas, das man als «Initiative der Pflanzen» beschreiben könnte.
Genau das hat der Dichter Friedrich Schiller genial erfasst: «Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren: Was sie willenlos ist, sei du es wollend – das ists!»
*
Der rote Faden, der durch die folgenden Darstellungen zum Leben der Pflanzen leiten soll, ist ein historischer. Er führt die Organismen in der Reihenfolge auf, wie sie entstanden sind, in einer historischen Anordnung also. Zuerst entwickelten sich einfache Zellen ohne Zellkerne, dann setzten sich komplexere Zellen zusammen, die zu immer noch einfachen pflanzlichen Organismen aus vielen Zellen wurden. Das Leben entwickelte sich im Meer. Erst später entstand auch Leben auf dem Land. Dies war ein komplexer Vorgang, denn das Leben des Meeres musste sich erst in vieler Hinsicht zu einem Leben auf dem Land wandeln, und alle diese Vorgänge mussten der genialen Einsicht Friedrich Schillers entsprechen. Die Pflanze war und ist passiv; wenn sich neue Formen von Pflanzen entwickelten, musste das ebenfalls passiv vor sich gehen. Die Pflanze «ging nicht an Land». Die Entwicklung vom Leben im Meer zu einem Leben an Land fand dennoch statt. Dabei gab es keinen Stillstand. Nacheinander unterschied sich jedes Individuum einer Entwicklungsreihe von Pflanzen ein wenig von allen Individuen, die vorher dagewesen waren.