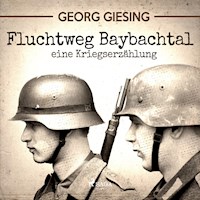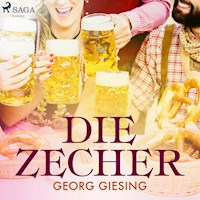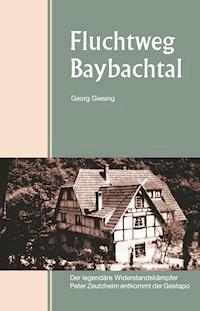
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte von Peter Zeutzheim, die Geschichte seiner Flucht aus dem Koblenzer Gefängnis, in das ihn die Nazis gesteckt hatten. Einer Flucht in die Wälder seiner Heimat, die ihn in abgelegene Dörfer und versteckte Mühlen, auf alte Burgruinen und in verlassene Schieferstollen führte – einer Flucht auf Leben und Tod. Die Erzählung von Georg Giesing, spannend wie ein Krimi geschrieben, ist authentisch. Peter Zeutzheim, im Vorder-Hunsrück und im Koblenzer Raum eine fast legendäre Gestalt, hat wirklich gelebt. Seine spektakuläre Flucht und sein Widerstand werden an den Originalschauplätzen beschrieben und schildern ihn als mutigen und aufrechten Mann, der sich auch vom allumfassenden und allgegenwärtigen Nazi-Regime nicht unterkriegen lässt. Ein sympathischer Einzelkämpfer aus unserer Region wird so zur Symbolfigur für den Widerstand, für das andere Deutschland, das sich selbst durch Nazi-Terror nicht das Rückgrat brechen ließ.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 1995 3. durchgesehene Auflage 2010 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-801-2 Titelfoto »Neumühle«: Gudrun Genßmann Porträt Zeutzheim: Privatfoto
Georg Giesing
Fluchtweg Baybachtal
Erzählung
RHEIN-MOSEL-VERLAG
***
(1. Teil)
Für Brigitte und Katja
Ein schlafendes Dorf. Die Schlagläden der Häuser sind geschlossen. Auf den Dächern liegt eine dünne Schicht Schnee. Weißes Pulver, das der Wind in unregelmäßigen Stößen auseinandertreibt. Die Luft ist klar und kalt, der Himmel wolkenfrei. Der Mond hat wenig Kraft, seine schwache Sichel ist kaum zu erkennen. Das Dorf liegt am oberen Rand des Berges, tagsüber reicht der Blick bis in die Eifel, folgt den tiefen Einkerbungen des Baybachtales, weiß um die Nähe der Mosel.
In den Nächten sind die Täler nur zu erahnen. Die Bergkuppen und bewaldeten Hangrücken verschwimmen ineinander zu dunklen Bändern, schwarzen Tüchern, graublauen Hunderücken. In dieser kalten Winternacht ist die Sicht frei und geht auf natürliche Weise zu den glänzenden Lichtpunkten des Nachthimmels, den blitzenden Lichtflecken, verliert sich der Blick im Gewirr der Sterne. Im Nordosten greifen lange Strahlenbündel die Dunkelheit ab. Lichtfinger suchen, überschneiden sich.
Es ist Kriegswinter. Dezember 1940. In einer guten Woche ist Weihnachten. Deutsche Aufklärungsflugzeuge überfliegen Mittelfrankreich. Die britische Hauptstadt London ist Ziel der Deutschen Luftwaffe. Aus dem Volksempfänger schnarren die scharfen Töne der Kriegsberichterstatter.
Die Rede ist von Vergeltungsangriffen. »Ohne Unterbrechung, pausenlos bei Tag und Nacht schmettern die deutschen Luftangriffe auf die militärischen Ziele der britischen Hauptstadt. Seit dem Beginn der Vergeltungsangriffe rast, ständig sich steigernd, die Schlacht um London. Kaum eine Stunde vergeht, in der nicht Kampfflieger und Stuka, Jäger und Zerstörer über dem Kriegsmeer an der Themse kreisen. Die britische Abwehr kann sie nicht daran hindern, obwohl sie durch Zusammenziehen von Jägern, Flak und Scheinwerfern aus dem ganzen Lande erheblich vermehrt worden ist.« Es folgt Marschmusik. Keine Rede vom Töten und Morden, von Verletzten, Verstümmelten, Verbrannten. Kein Wort über Mütter und Kinder, Alte, Kranke, von Zivilisten in dem Inferno. Schweigen über zerstörte Kirchen, Krankenhäuser, Museen. Vier Jahre nach Olympia ist aus der Feuerschale ein Flächenbrand geworden. Doch der Krieg ist noch weit.
Über der Garnisonsstadt Koblenz gleiten die Lichtbündel der Suchscheinwerfer. Der Wind weht die schwachen Geräusche ferner Explosionen gegen die Hunsrückberge. Jetzt gibt es kaum noch ein Dorf, das nicht Männer abgeben muss. Aus dem Soldatenspiel ist Ernst geworden.
Die Pies, Hammes, Liesenfelds, die Olbermanns, Mies und Berschs sind Krieger geworden. Aus Bauern hat man Landsknechte gemacht. Väter und Söhne. Schreiner, Bäcker, Melker oder Metzger. Jetzt sind sie Soldaten, deren Grau der Uniformen sie gleich macht. Deutschen Lebensraum sollen sie schützen, in Polen, Frankreich und anderswo.
Einige von ihnen stolzieren in kackbraunen Uniformen durch die Dörfer. Plustern sich auf, sind jetzt erschreckend wichtig. Der Krieg ist weit. Die Nacht still, das Grummeln unten am Fluss ist hier kaum zu hören. Die Menschen schlafen. Beulich in seiner Senke, Dorweiler oben am Hang. Der Zeiger der Kirchturmuhr in Macken ruht auf halb eins, als die Stille von einem mächtigen Knall durchbrochen wird.
***
Die Stadt liegt schwarz und ohne Lichter. Es ist schon der vierte Kriegswinter. Jetzt ist der Luftkrieg auch nach Deutschland gekommen. Die Verdunklung der Stadt ist polizeibehördlich angeordnet, um den britischen und amerikanischen Fliegern nicht noch zusätzlich den Weg zu weisen. Peter Zeutzheim lässt seinen schweren ›Büssing‹ im ersten Gang auf die Brücke rollen. Der Weg ist bewacht. Jedes Auto, das die Brücke überquert, wird kurz einer Kontrolle unterzogen. Die Sicherheitsmaßnahmen gehören zum Kriegsalltag. Man gewöhnt sich daran. Viel zu schnell ist eine Absonderlichkeit zu Normalität geworden. Kontrollen überall. Nicht nur hier, auch an den Landesgrenzen. Bei der Lebensmittelzuteilung, bei der Benzinversorgung, beim Betreten der Fabrik, wenn Vieh geschlachtet wird, Wahnsinn, sogar beim Grüßen. Uniformträger sind mit »Heil Hitler« zu grüßen, möglichst noch mit ausgestrecktem Arm. Grüßt man nicht, fällt man auf, kommt in Verruf, gilt schnell als Regime-Gegner. Es ist auch ein wenig lächerlich, doch auf diese Art kontrolliert jeder jeden. Peter Zeutzheim zeigt der Brückenwache seine Ausweispapiere und die Behördengenehmigung. »Weiterfahren. Alles klar. Heil Hitler.« Aber hinter so manchem Deutschen Gruß verbirgt sich Wut, der Gruß verdeckt die Gleichgültigkeit ebenso wie die Ablehnung. Der ›Büssing‹ dröhnt tief, als er von dem ersten in den zweiten Gang geschaltet wird.
Mit seinen Papieren kommt Zeutzheim durch jede Kontrolle. Er transportiert kriegswichtige Güter, auch wenn es nur Zement ist. Bei den Nazis ist fast alles kriegswichtig geworden. Wenn man darüber nachdenkt, ist es schon komisch, dass der einfache Putzlappen, der zum Reinigen eines MGs benutzt wird, kriegswichtig geworden sein soll.
Zeutzheim fährt mit seinem großen Lastzug durch Moselweiß. Die Uferstraße ist menschenleer. Hoffentlich nimmt das bald ein Ende. Es sieht so aus, als wenn dies ein Schrecken ohne Ende würde. Vier Jahre hat er beim Bau des Westwalls helfen müssen. Fahrten über Fahrten. Im Dienst des Vaterlandes. Nicht freiwillig. Zwang ist das richtige Wort. Er ist dienstverpflichtet worden. Und der ganze Betrieb gleich mit. Wirtschaftliche Mobilmachung heißt die Devise. Ein Volk steht in Waffen. Der Führer baut eine Front aus Stahl und Beton: Den Westwall. Festigungsanlagen sollen den Westen Deutschlands sichern. Gegen den Erzfeind, den Franzosen. Auf irgendeinem Parteitag hatte Hitler das verkündet. Und er, Zeutzheim, muss da mit. Seine vier LKW waren auf einmal staatspolitisch bedeutsam. Im Jahr 1938 hatte es angefangen. Zeutzheim wurde zum Dienst bei der Organisation Todt verpflichtet. Bunkerbau, Schartenstände, Panzersperren, Gräben und Höcker aus Beton. Von Basel bis Aachen, überall Drachenzähne aus Stein und Zement.
Unzählige Male hat er Fahrten in die Eifel gemacht, hat Baumaschinen transportiert, Moniereisen, Sand, Kies, Holz und Erde. Quer durch das Land werden die Menschen zwangsrekrutiert. Wer spurtet, bekommt einen Blechorden, wer nicht spurtet, wird in ein Arbeitslager gebracht.
Das liegt schon Jahre zurück, aber immer noch lässt ihn diese Organisation nicht los. Seit Jahren fährt er jetzt durch Deutschland. Das besetzte Frankreich kennt er. Von Berlin an den Golf von Biskaya. Zur Atlantikküste. Immer unterwegs. Stets auf Achse. Sein 1932 gegründetes Fuhrunternehmen hat der Staat jetzt in den Klauen. Zu Hause wäre er besser aufgehoben. In Pfaffendorf warten fünf Töchter und eine Frau auf ihn.
Aber die Räder seiner Lastwagen rollen durch Frankreich. Gegen seinen Willen. Die Franzosen mag er. Sympathische Leute. Erzfeind? Es ist wahnsinnig, lächerlich, traurig. Der Westwall hält keine Flugzeuge auf. Die Deutsche Wehrmacht hat Holland, Belgien, Frankreich im Westen Europas überfallen und nicht umgekehrt. Der Westwall ist eine Lüge.
Ein Betrug. Peter Zeutzheim ist kein Freund der Nazis. Uniformen sind ihm ein Graus. Uniformen haben vielleicht noch bei der Feuerwehr eine Berechtigung. Der Berg zur Pfaffendorfer Höhe hat es in sich. Jetzt ist der ›Büssing‹ leer, jetzt schafft er den Hang gerade noch im zweiten Gang. Zu Hause wird es eine Umarmung geben. Er kommt immer überraschend, das bringt die Arbeit mit sich. Als Zeutzheim den Wagen im Hof seines Hauses auslaufen lässt, ahnt er nicht, welche Überraschung auf ihn wartet.
***
Ihr Mann ist nicht zurückgekommen Maria Zeutzheim wartet. Die ganze Nacht. Sie hört jedes Geräusch. Kennt die Schritte. Doch es ist still. Kein Türschlagen, keine rollenden Räder, nicht das bekannte Ratschen, wenn die Handbremse des LKW angezogen wird. Auch keine Unruhe in den Ställen. Nichts. Die Kühe sind immer sehr feinfühlig. Wenn sich nachts etwas Fremdes dem Hof nähert, ein Tier oder ein Mensch, werden sie unruhig. Manchmal hat man den Eindruck, als ob sie eigene Nachtwachen aufstellen. Aber diesmal …
Die Nacht zum 25. Januar ist lang. Eine Winternacht. Still und klar und sehr lang. Die Mädchen schlafen. Sie sehen den Vater nicht oft. Der Krieg hat alles durcheinandergebracht. Geregelte Arbeitszeiten gibt es für einen Fuhrunternehmer nicht. Anrufe, schnelle Touren, plötzliche Aufträge, Verzögerungen. Lastwagenfahreralltag. Das ist alles schwierig genug. Und dann noch die Landwirtschaft. Manchmal ist Pitter zwei, drei Tage unterwegs. Dann die plötzliche Rückkehr. Unverhofft, auch mitten in der Nacht. »Wenn ich erst einmal über die Grenze bin, fahr ich auch durch. Nachts geht es besser. Dann sind keine Traktoren unterwegs. Auch keine Pferdefuhrwerke. Die Straßen sind freier. Ab und zu mal ein Militärkonvoi.« So hat es ihr Mann erklärt.
Wenn sich nachts das starke Motorgeräusch dem Haus nähert, ist Maria Zeutzheim beruhigt. Der Krieg hat das alles nicht einfacher gemacht. Die Abstände haben sich vergrößert. Es gibt Fahrten, die dauern Wochen.
Gefährlicher ist alles geworden. Die Autos fahren nachts nur mit abgeblendeten Lichtern. Die Sicht ist schlecht, das kostet Zeit. In Frankreich kommt es in der letzten Zeit immer wieder zu Anschlägen. Eisenbahnschienen werden gesprengt, Brücken beschädigt. Pitter hat ihr davon erzählt. Im Rundfunk ist darüber nichts zu hören. Und die vielen Flieger. Die Engländer fliegen nachts, und die wissen genau, was sie wollen. Heute ist es ein anderes Warten. Es ist etwas bedrohlicher als sonst. Peter ist auf dem Präsidium. Bei der Polizei. Was soll er da? Was wollen die Männer von ihm? Konkret sind sie bei ihrem Besuch nicht geworden. Höflich und ungenau. Die Ungewissheit ist es, die verunsichert. Macht Angst. Warum kommt er nicht zurück? Jetzt sind es schon zwölf Stunden. In dieser Nacht …
In dieser Nacht wartet Maria Zeutzheim vergebens. Der Besuch bei der Gestapo hat kein Ende. Auch das Telefon bleibt still. Das Polizeigebäude verbreitet Angst. Es ist grau und unpersönlich. Unfreundliche Einheitsfenster. Menschen kommen und gehen, die meisten in Eile, hasten aneinander vorbei.
Warum ist ihr Mann nicht zurückgekommen? Etwas Schlimmes muss passiert sein. Der uniformierte Pförtner schüttelt den Kopf. Weiß er nicht Bescheid oder schweigt er? Muss er schweigen? Er schüttelt den Kopf. Gestapo-Vorladung? Jeden Tag gibt es Vorladungen. Viele. Sie soll sich doch selbst umsehen. Maria Zeutzheim ist hartnäckig. Sie muss Klarheit haben. Sie dringt bis zu den Räumen der Gestapo vor. Überall auf den Fluren warten Menschen. Suchen. Sitzen auf Holzbänken. Die Luft ist schlecht, Schweiß und Bohnerwachs vermischen sich zu einem unangenehmen Geruch. Türen schlagen. Schilder, überall Schilder. Maria Zeutzheim fragt sich durch. Göbel heißt der zuständige Mann. Ein Raum mit Uniformträgern. Sicherheitspolizei. Auch Zivilisten. Blankgewienerte Schaftstiefel, dunkle Breeches-Hosen. Zwei Frauen mit weißen Blusen, eine mit Pagenschnitt, die andere mit deutschem Zopf.
»Zeutzheim? Sicher ist Ihr Mann bei uns. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern!« Der Kontakt zu ihrem Mann wird Maria Zeutzheim verwehrt. »Aber das hat sich Ihr Mann doch alles selber zuzuschreiben. Es gibt keinen Grund für uns, Sie zu ihm zu lassen. Sie sollten sich um Ihre Kinder kümmern.« Die Sekretärinnen heben noch nicht einmal die Köpfe. Der Mann lässt sie einfach stehen. Kalt abgeschmiert.
Maria Zeutzheim ist wütend. Vor Zorn ballt sie ihre Fäuste, gräbt sich die Finger tief in die Hand. Diese Bande! Arrogant und unmenschlich. Der Weg vom Präsidium bis zur Pfaffendorfer Höhe ist lang. So schwer wie heute ist er ihr noch nie gefallen. Ihr Mann sitzt im Polizeigefängnis. Am nächsten Tag ist Maria Zeutzheim wieder »Am Vogelsang«. Auch am Tag darauf. Die Stadt ist von einer dünnen Schneedecke überzogen. Die Straßen sind nass. Es ist ein feucht-kalter Wintertag, an dem die Menschen sich nicht unnötig im Freien aufhalten. Maria Zeutzheim hat diesmal die älteste Tochter mitgenommen.
Vielleicht lässt man das Kind zu seinem Vater. Annemarie ist in der letzten Klasse der Volksschule. Noch in diesem Sommer wird sie aus der Schule entlassen. Und jetzt ist der Vater im Gefängnis. Sie weiß, wie schlimm das für die Mutter ist. Für sie alle. Der Gestapo-Mann Göbel ist hart. Kein Besuch! »Ihr Mann ist immer noch uneinsichtig. Hat seine Schuld noch nicht eingestanden. Aber das wird nicht mehr lange dauern, Frau Zeutzheim.« Der drohende Unterton Göbels ist nicht zu überhören. Als sie das schreckliche Gebäude verlassen, hat inzwischen starker Schneefall eingesetzt. Jetzt ist ihr klar geworden, dass dieser Mann kein Pardon kennt. Ein Hundertfünfzigprozentiger. Und über die Gestapo macht sie sich ohnehin keine Illusionen. Sie weiß auch vom Verschleppen der Koblenzer Juden. Weiß von Frau Doktor Salomon, wie man die Verwandtschaft ihres Mannes gequält hat. Im Schneegestöber fällt ihr Blick auf die lange Reihe der Fenster am Polizeigebäude. Irgendwo dahinter liegen auch die Haftzellen.
Hinter einem der vergitterten Fenster ist jetzt ihr Mann. Maria Zeutzheim geht. Da ist ein Fenster. Eine Hand. Sie dreht sich. Winkt. Es ist kein richtiges Winken. Zum Winken gehört auch ein Arm, der ganze Körper. Hier ist es nur eine Hand, die sich hin und her bewegt. Und die Hand ballt sich zusammen, öffnet sich, schaukelt. Maria Zeutzheim starrt auf dieses Fenster mit der sich bewegenden Hand. Da gibt ihr jemand ein Zeichen. Sie bleibt stehen. Ihr Blick sucht den Haupteingang zum Polizeipräsidium. Einige Menschen verlassen das Gebäude. Ziehen ihre Mäntel um die Körper. Tasten mit den Schuhen den Schnee. Überqueren schnell die Straße. Polizei ist nicht zu sehen. Die Wachen haben sich wohl in die Nische des breiten Eingangsportals zurückgezogen. Die Hand ist immer noch da. Bewegt sich jetzt etwas langsamer. Ein Zettel fällt herunter, dreht sich wie ein Propeller, nicht größer als ein Streifen Zigarettenpapier, landet auf dem schneebedeckten Bürgersteig.
Das alles ist sehr schnell gegangen. Eine Minute, vielleicht noch weniger. Maria Zeutzheim geht auf den Zettel zu. Sie hat ihn nicht aus den Augen gelassen. Das ist eine Botschaft. Einer der Gefangenen muss sie beobachtet haben. Langsam bückt sich Maria Zeutzheim. Stößt mit den Füßen den Schnee vom Stiefel.
Ordnet die Strümpfe, drückt mit der Hand gegen den Stiefelschaft. Sie wischt dabei den Zettel vom Boden und lässt ihn in einem Stiefel verschwinden. Auch dieser Vorgang geschieht in wenigen Augenblicken. Mutter und Tochter stapfen nun, die Arme eingehakt, durch den Schnee. Die Neugier und die Aufregung durch die geheime Nachricht verdrängt einen kurzen Moment ihre Sorgen. In einer Toreinfahrt holt Maria Zeutzheim den Zettel aus ihrem Stiefel. Klein und mit spitzem Bleistift geschrieben steht auf dem dünnen Papierfetzen: »Mach Dir keine Sorgen!« Es gibt keine Unterschrift, doch Maria Zeutzheim erkennt die Handschrift ihres Mannes.
***
Wie groß ist die Zelle? Zwei Meter breit, knapp vier Meter lang. Ein Betonkasten. Um das vergitterte Fenster zu sehen, muss er auf den Holzschemel klettern. Das Fenster ist schwer zu öffnen. Einige Zentimeter weit geht es nur auf. Durch diesen Schlitz soll die Luftzufuhr geregelt werden. Lächerlich. Doch bietet der Spalt einen begrenzten Blick auf die Straße. Seit vierundzwanzig Stunden ist Peter Zeutzheim eingesperrt. »Vogelsang«, das Polizeigefängnis in Koblenz, wird nur vorübergehend sein Aufenthaltsort sein. Was danach kommt, ist ungewiss. Arbeitslager, KZ oder Zuchthaus, vielleicht aber auch ein Strafbataillon. Seitdem die Geheime Staatspolizei die uneingeschränkte Macht im Staat ausübt, ist alles möglich.
Zeutzheim macht sich da keine falschen Hoffnungen. Der Gestapo traut er alles zu. Die Gestapo braucht keine Gesetze, sie ist Gesetz. Mehr noch. Fahnder, Ankläger, Richter und Henker. Niemand hält sie auf, keiner wagt es, sich mit ihr anzulegen. Mit Menschenleben geht die Gestapo verschwenderisch um.
Terror ist ihre Methode. In Frankreich hat er das erfahren. Im August 1942. In Paris hat es einen Anschlag gegeben, auf einem Sportplatz. Hierbei wurden deutsche Soldaten getötet. Doch schon vorher hat die Gestapo Häftlinge ermordet. Getötet. Ohne Gerichtsverhandlung. Ohne Verteidiger.
In ganz Frankreich hat die Gestapo ihr Netz gespannt, überall ihre Büros, Stützpunkte. Und unter den Augen der deutschen Wehrmacht sind viele Franzosen nach Deutschland verschleppt worden. Als Gefangene. Er hat die Züge gesehen. Wehe dem, der sich widersetzt. In Deutschland ist es nicht anders. Koblenz ist keine Ausnahme. Der Gestapo-Mann Göbel hat ihn verhört. Schon zweimal.
Jeden Augenblick kann es wieder losgehen. »Sie haben keine Chance, Zeutzheim. Es liegen Zeugenaussagen gegen Sie vor. Und eins merken Sie sich gut, wir haben alle Mittel … und werden sie auch einsetzen. Wir haben alle Mittel, aber wenig Zeit.«
Die Verhöre waren Drohungen. An das, was kommt, mag Zeutzheim nicht denken. Die Gedanken springen. Zuhause die Kinder. Seine Frau Maria. Dieser verdammte Gärtner. Der Mann hat ihn denunziert. Dies haben die Gestapoleute angedeutet. Aussagen eines Mitarbeiters lägen vor und würden ihn belasten. Ein Volksschädling soll er sein. Ein Miesmacher, Meckerer, Zersetzer. Staatsfeind!
»Den Feindsender haben Sie gehört, Zeutzheim. Das ist Wehrkraftzersetzung. Das kann Sie den Kopf kosten.«
Zeutzheim weiß, dass die Gestapo etwas gegen ihn in der Hand hat. Aber er lässt sich nicht bluffen. Er muss die Nerven behalten.
Sich konzentrieren, seine Gedanken ordnen. Ansonsten … Er hat mit Gegenfragen geantwortet. »Woher wissen Sie das? Wer sagt das? Wann soll das gewesen sein?« Meistens hat er geschwiegen. Mit dem Kopf geschüttelt. Gezögert. Taktiert. Zeutzheim ist Sportler. Kampferprobt als Ringer bei ›Anker Pfaffendorf‹ dem Athletensportverein. Gaumeister sind sie gewesen, 32-33. Geboxt hat er bei ›Siegfried Koblenz‹. »Nicht zuschlagen, Pitter. Du musst erst den Gegner studieren. Lass ihn nicht zu nahe kommen, warte ab. Warte auf den richtigen Augenblick.« Immer wieder hat ihm das sein Trainer gesagt, bis es schließlich seine eigenen Gedanken waren. Boxen ist auch eine Verhaltenskontrolle. »Du musst lernen, dich zu beherrschen und den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Lerne dich beherrschen, dann beherrschst du auch deine Gegner.« Er hat sich beherrscht. Aber er würde das nicht durchhalten. Nicht bei der Gestapo. Das ist kein Kampf nach gleichen Kräften und festgelegten Regeln. Hier gibt es keine Ringrichter. Fairness ist den braunen Machthabern ein Fremdwort. Die Gestapo bricht alle Regeln. Es geht um seinen Kopf. Wenn die Gestapo sich einmischt, fließt Blut. Das gehört zu ihrem dreckigen Geschäft. Beim zweiten Verhör sind sie schon deutlicher geworden. »Sie sind ein Volksschädling! Sie haben gegen geltendes Gesetz verstoßen. Die Volksgemeinschaft kann auf Typen wie Sie verzichten. Zu einer Zeit, in der alle Opfer bringen müssen, werden wir es nicht hinnehmen, dass das Werk des Führers von Defätisten untergraben wird. Gegen Sie liegt eine Anzeige vor. Wir haben Zeugen. Sie haben in Ihrem Unternehmen einen niederländischen Staatsbürger beschäftigt, der uns die Wahrheit über Ihre Gesinnung gemeldet hat. Sie sollten im Interesse Ihrer Familie Ihre Schuld eingestehen. Es ist unsere letzte Warnung.«
Es muss einer der beiden Holländer gewesen sein, die er bei sich in der Landwirtschaft beschäftigt hat. Peter Zeutzheim erinnert sich. Oben auf der Pfaffendorfer Höhe hat er einen klaren Empfang. Sicher, ja, kann er BBC London empfangen. Das deutschsprachige Programm. Das ist etwas anderes als die vielen Goebbels-Schnauzen im Reichssender. Das passt den Nazis nicht. Das tut weh. Er lebt in einem Staat, der seinen Bürgern das Denken vorgibt und das Hören und Sprechen verbietet. Er hat es satt, sich täglich die militärischen Niederlagen als Siege aufschwatzen zu lassen. Natürlich hat er darüber gesprochen. In der Familie, mit Freunden, unterwegs, wenn es Anlass gab. Vielleicht hat er auch am falschen Ort den falschen Leuten zuviel gesagt.
Der Verräter schläft nie. Und hinterhältig sind sie, die Herren der Geheimen Staatspolizei. In seiner Abwesenheit waren sie in Pfaffendorf. Bei Maria.
Wann er wiederkäme?
Ob er in Frankreich sei? Wenn er demnächst nach Hause kommt, solle er doch einmal im Polizeipräsidium vorbeikommen, es gibt da noch etwas zu besprechen. Sie haben einige Fragen. Das war eine Falle, und er war in sie hineingetappt. Viel zu sorglos ist er dieser Einladung gefolgt. Jetzt sitzt er schon fast zwei Tage fest.
***
Maria Masen hebt den Topfdeckel hoch. Lauwarm ist die Milch. Vorsichtig hat sie den Zeigefinger der linken Hand in die weiße Flüssigkeit gesteckt. Sie öffnet die Feuerklappe. Die Scheite im Herd sind niedergebrannt. So wird die Milch nicht heiß werden. Neben dem Herd liegen zwei kräftige Holzprengel. Zu dick für den Ofen.
Mit Kohle feuert sie schon lange nicht mehr. Die Eierkohle ist kaum bezahlbar, die Briketts sind rationiert. Nun wird sie Holz aus dem Keller holen müssen. Für die Nacht gleich mit. Maria Masen streift sich den Kittel über, greift sich den Holzkorb und nimmt die Taschenlampe vom Fenstersims neben dem Windfang. Von hier führt die Haustüre direkt auf die Straße. Drei Stufen aus gemauerten Bruchsteinen trennen den Hauseingang vom Fahrweg. In den Keller gehen bedeutet für sie immer, das Haus zu verlassen. Das Haus liegt am Bach, etwas außerhalb des Ortes. Früher war das Holz in einem kleinen Anbau seitlich des Hauses, an der Giebelfront, untergebracht. Da war es vor Regen geschützt und gleichzeitig gut durchgelüftet. Holz muss trocknen. Holz braucht Zeit. Aber der Krieg hat es rar gemacht. Holz kostet. Die Weinberge sind leergefegt. Altholz ist selten.
Der Kellereingang liegt seitlich neben dem Hauseingang. Sie muss eine kleine Treppe hinuntergehen, bevor sie zu der Kellertüre kommt. Sie stößt mit dem rechten Arm die Holztüre auf, wundert sich, dass jemand vergessen hat, den Eisenriegel zu schließen. Der Raum ist dunkel. Er wird als Abstellraum genutzt. Meist nur für Werkzeug, leere Säcke und seit zwei Jahren eben auch für das Holz. Maria Masen legt die Taschenlampe so auf ein altes Kelterfass, dass der Schein der Lampe den Holzstapel erfasst, der an der Seitenwand aufgeschichtet ist. Dann sucht sie sich die passenden Scheite aus und legt sie in den Korb. Von der Kellertüre kommt ein Geräusch. Irgend-etwas fällt auf den Steinboden.
Maria Masen fährt herum. Erschrickt. Greift zur Taschenlampe, dann sofort zur Axt, leuchtet in den Winkel neben der Kellertüre. Da steht ein Mensch. Ein Mann. In Uniform. Ein Soldat. Ohne Helm oder Schiffchen. Der Strahl der Taschenlampe erfasst ein junges, blasses Gesicht. Alles läuft blitzschnell ab. Automatisch. Maria Masen ist erschrocken, doch ihr Handeln geschieht folgerichtig. Der Mann ist uniformiert. Unbewaffnet. Eine fremde Uniform. Ein fremder Soldat. Feind. Amerikaner. Der Mann hat Angst, noch mehr als Maria Masen. Ein Flüchtling. Der hat sich hier versteckt. Ein Flieger? Es kann nur ein Flieger sein. Wo kommt der her? Fünf Minuten später sitzt der fremde Mann bei Maria Masen am Küchentisch. Er zittert. Seine Hände sind schmutzig und zum Teil verbrannt. Das linke Bein ist voller Blut. Das Blut hat die Hose schwarz gefärbt. Der Stoff klebt am Körper, verdeckt die Wunde. Und die Augen sind furchtbar groß. Viel zu groß für das schmale, bartlose Gesicht. Der Soldat isst. Mit dem linken Auge ist auch etwas nicht in Ordnung. Doch die rechte Hand geht immer wieder hoch. Führt den Löffel zum Mund. Fischt das Brot aus der Milch. Greift zu den getrockneten Apfelscheiben. Der Mann hat Schmerzen, doch noch größer scheint sein Hunger zu sein.
Zwei Stunden später wird der Amerikaner vom Ortspolizisten abgeholt. Er hat Maria Masen noch die Hand gegeben und etwas zu ihr gesagt, doch sie hat es nicht verstanden. Der Mann hat sie freundlich und offen angesehen. Fremde müssen gemeldet werden. Kriegsgefangene oder entlaufene Ostarbeiter. Auch feindliche Soldaten, das ist Gesetz. In Brodenbach wird der Fremde verhört. Es gibt Schwierigkeiten, weil jeder nur die eigene Sprache versteht. Der Krieg macht das Verstehen nicht leichter. Zwei Tage später kommt ein Fahrzeug aus Koblenz und nimmt den fremden Soldaten mit. Eines steht jetzt schon fest. Der Mann ist Pilot der Royal Air Force. Es kann nur einer von dem abgestürzten Flugzeug sein, welches vor sechs Tagen oberhalb Alkens direkt neben der Landstraße zerschellte. In Koblenz wird der Soldat erneut verhört. Einige Tage später dann nach Oberursel gebracht, da ist ein Lager für gefangene Luftwaffensoldaten.
***
Die Wände der Zelle sind schmutzig und grau. Überall ist der Putz beschädigt. Feine Risse überziehen die dünne Farbhaut. An einigen Stellen sind Zahlen und Namen eingeritzt. »Horst Hansen. Gruß an Inge.« - »Paul Hinrich. Mainz.« Kyrillische Buchstaben. Französische Worte, die Zeutzheim nicht entschlüsseln kann. Wandzeichen. Verzweifelte Botschaften. Seit einigen Stunden ist ein zweiter Gefangener in die Zelle gebracht worden. Ein Mann mit hessischem Dialekt, mittelgroß, mit dunkelblonden Haaren. Er macht einen verstörten Eindruck. Ist wortkarg, sitzt auf seiner Pritsche und starrt vor sich hin. Der Raum ist kärglich. Zwei derbe Holzliegen, dünne Matratzen und ein paar verdreckte Wolldecken. An der Decke eine vergitterte Glühbirne. Natürlich auch noch der Stinktopf. Ein Blechkübel zur Verrichtung der Notdurft. Da ist der Geruch von Kot und Urin. Scharf, warm und süß. Der Dunst des Urins füllt den ganzen Raum, überlagert alles andere, auch den Geruch des eigenen Körpers. Peter Zeutzheim stellt sich auf den Rand seiner Pritsche. Streckt sich ein wenig, sucht den Blick durch den Fensterspalt. Zieht tief die frische Winterluft ein, füllt die Lungen mit Freiheit. Winterkalte, saubere Freiheit. Sicher hat er »Radio London« gehört. Unzählige Male.
Heute wird es wieder Verhöre geben. Gestern war nichts. Vierundzwanzig Stunden Ruhe. Doch es ist eine unheimliche Ruhe. Er hat viel Zeit zum Nachdenken, die Gestapoleute werden die Zeit nutzen. Sie haben ihre eigenen Methoden, die Menschen zum Reden zu bringen.
Zuerst ist er neugierig gewesen. Der Reiz des Verbotenen. In einem Land, in dem es mehr Verbote gibt als in irgendeinem anderen Land, werden auch viele Verbote missachtet. Nach seinen Frankreichfahrten hat er besonders deutlich gemerkt, dass die Meldungen des Londoner Senders der Wirklichkeit erheblich näher kamen als der braune Einheitsbrei des Reichsrundfunks. Der Kröpplinger Onkel hat es ihm mit einfachen Worten erklärt: »Die Braunen wollen die Köpfe der Menschen beherrschen. Und ein Weg in die Köpfe geht durch die Ohren.«
Seit fünf Jahren ist das Hören von Feindsendern verboten. Die Zeitungen sind voll mit Warnungen. Personen, die gegen die innere Widerstandskraft verstoßen, sind Volksfeinde. Das ist die Nazi-Sprache. Innere Widerstandkraft. Volksgemeinschaft. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen. In diesen Reihen marschieren die Mörder mit, geschützt durch ihre Uniformen. Göbel hat ihn einen »Miesmacher« genannt, einen »Meckerer«, »Volksschädling«. Gestern hatte er Ruhe. Heute wird etwas passieren. Das spürt er.
Es hat zu schneien begonnen. Zeutzheim folgt mit seinem Blick einzelnen Schneeflocken, die an seinem Fensterplatz vorbeischweben. Die Passanten unten auf der Straße haben es eilig. Huschen an den Wänden entlang, mit hochgeschlagenen Mantelkrägen, die Hüte und Mützen tief ins Gesicht gezogen, einige versuchen, sich mit Regenschirmen zu schützen. Zeutzheim steckt seinen rechten Arm durch den Schlitz. Hält die geöffnete Handfläche nach oben und fängt die zarten Flocken auf. In seiner Firma hat er zwei Holländer beschäftigt. Freiwillige. Menschen, die in Deutschland Arbeit suchten. Erst sehr spät hat er erfahren, dass die beiden mit den Nazis sympathisierten und sich einen Vorteil davon versprachen. Einer von ihnen ist sogar Zellenleiter einer NSDAP – Gruppe geworden. Ein holländischer Nazi. Zeutzheim ist sich sicher: Einer der beiden muss ihn denunziert haben.
Da ist der Bahnhof Koblenz. Unzählige Güterwaggons. Vollgepackt mit Kriegsgerät. Menschen. Stimmengewirr. Das Klirren von Eisen. Die harten Stöße, wenn die Puffer gegeneinander stoßen. Die Lokomotiven pressen ihre weiße Kraft durch die Schornsteine, überall zischt der Dampf, hüllt die schweren Maschinen in eine Nebeldecke. Im Bahnhof drängen sich unzählige Soldaten. Überall Feldgrau. Kommen. Gehen. Lange, blankgeknöpfte Mäntel. Ein Hin und Her.
Gebrüll, Kommandos, stilles Hasten. Blasse Gesichter unter den Stahlhelmen. Da ist viel Aufregung. Abschied. Tränen und Trauer. Stumme Gelassenheit. Neugier. Milchbärte mit fiebrigen Augen. Kinder in Kampfstiefeln, übergroße Skimützen, die von durchsichtigen Ohren gehalten werden. Flakhelfer. Im Kriegswinter 43/44 liegt kein Siegesbrausen mehr in der Luft. Gibt es keine Kapelle mehr, die den Badenweiler Marsch spielt. Im Kriegswinter 43/44 werden die großen Jungen in Uniformen gesteckt. Sie haben so gut wie keine Ausbildung. So sehen keine Helden aus. Der Rundfunk spricht von jungen Kämpfern. Und überall diese Kettenhunde, die scharfen Militärs. Da verabschiedet nicht mehr die Braut ihren Geliebten, jetzt nehmen die Mütter Abschied von ihren Söhnen. Hier wird das Kanonenfutter an die Front gefahren. Mittendrin steht er mit seinem ›Büssing‹. Wolldecken und dicke Rollen mit Drähten hat er geladen. Die sollen mit auf den Transport. Die Wolldecken kommen aus Krefeld, und die Kabeltrommeln hat er in Köln-Mülheim geladen. Die Waggons werden geöffnet. Junge Gesichter strecken sich zu den Fenstern hinaus. Das sind noch Kinder. »Wie viele werden von denen wiederkommen? Wie viele werden bleiben?« Das hat er gefragt. Das haben sich viele gefragt. Jeder hat daran gedacht.