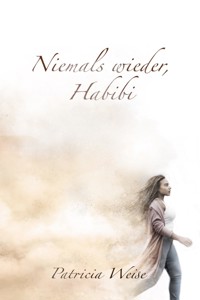Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitten im Arbeitsalltag bricht Sozialpädagogin Ivy einfach zusammen. Nach Wochen auf der Intensivstation erwacht sie und erfährt, dass sie einen schweren Schlaganfall erlitten hat. Nichts ist, wie es einst war. Ivys Geist ist intakt, ihr körperlicher Zustand jedoch nicht. Wird sie damit von jetzt auf gleich zum Pflegefall? Plötzlich ist für jeden noch so kleinen Teil ihres Lebens Unterstützung nötig. Niemand hilft ihr mehr als ihre große Liebe Ben. Gemeinsam versuchen sie, die notwendigen neuen Wege zu meistern. Physische und mentale Erschütterungen erschweren die Rückkehr in ein aktives Dasein. In aller Klarheit erlebt sie hautnah, welche Herausforderungen Menschen mit Handicap in Deutschland tagtäglich durchstehen müssen, und wie wichtig die Menschenwürde ist. Aber sie will dieses einzig verfügbare Leben nicht aufgeben. Ungeahnte Denkanstöße geben ihr dabei nächtliche Träume, in denen ihr Wesen erscheinen, die sehr deutliche Aussagen über sie treffen. Eine "own voice"- Story, die unter die Haut der Lesenden geht, dort verweilt und nachwirkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wortzähler: 40595
Flügellahm
Die wahre Geschichte einer erfundenen Frau
von
Patricia Weise
»Wenn unsere Augen Seelen statt Körper sehen würden, wie sehr anders wäre unsere Vorstellung von Schönheit.«
Frida Kahlo
Impressum:
1. Auflage, Dezember 2024
Texte: © 2024 Patricia Weise, alle Rechte vorbehalten
Umschlag: © George Francis Myers
Cover- und Kapitelschrift: Academy Engraved LET
Kapiteltrenner: Adobe Pro
Dieser Text ist ohne den Einsatz von KI entstanden.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Die Autorin behält sich eine Nutzung der Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.
Verantwortlich für den Inhalt: Patricia Weise
c/o Postflex #7898
Emsdettener Straße 10
48268 Greven
Lektorat: Kerstin Schmitz-Schuldt, 21ufos.de
Korrektorat, Buchsatz: Autorenträume
Wenn unsere Welt bunt sein soll,
fange jeder bei sich an,
um das möglich zu machen.
Niemand kann bestimmen, in welcher Hautfarbe, Orientierung oder unter welchen Lebensumständen der Mensch
geboren und leben wird.
Öffnet eure Augen für das vorhandene Leben und eure Herzen füreinander!
Daraus entsteht Menschlichkeit,
die uns verbinden wird.
Prolog
Das Leben war individuell, einmalig und höchstpersönlich in jedem Augenblick. Aufgewachsen in einer leistungsbezogenen Gesellschaft, suchte eine Frau ihre Erfüllung im täglichen Erleben. Irrungen oder Wirrungen sowie zwischenmenschliche Beziehungen ließen Freude oder Leid auftauchen und vergehen.
Diese Frau namens Ivy liebte Reisen, fremde Kulturen, ihre deutsche Heimat und die Natur. Die Entscheidung, ob Berge oder Meer, stellte sich ihr nicht: Dort, wo sie gerade war, erkannte sie die Schönheiten von Landschaften, Menschen und Tieren. Jedoch nicht mit einem alles verklärenden Blick, sondern wachen Auges. Das immense Interesse an Menschen und deren Handlungen konnte sie weder verstecken noch wollte sie es.
Ihr Name bedeutete „Efeu“ – eine starke Kletterpflanze – und schien ihrer Person gerecht zu werden. Nicht ihrer Größe wegen, aber aufgrund ihres Umgangs mit Hindernissen und Umwegen. Ihr Leben lang hatte sie daran festhalten wollen, dass sich jegliche Anstrengung lohnte.
Oft gönnte sie sich Ausflüge in ihr geistiges Fotoalbum, denn am Ende blieb nur das. Die Bilder, die sie aufrufen konnte oder die einfach erschienen, waren meist lichtdurchflutete Schätze, die niemand anderem jemals gehörten.
Vorbereitet konnte ich nicht sein, als sich alles änderte. Jeder Schritt schien unmöglich und der Zusammenbruch nah. Das, was geschehen ist, vergeht nicht einfach so. Aber es arbeitet in dir, nagt an deiner Seele und gibt keine Ruhe. Der einzige Weg ist: dich zu ändern, wenn alles zusammenbricht. Wer kann schon wissen, ob das Ergebnis nicht ein Durchbruch sein kann?
Nur der Mensch, der es versucht.
Kapitel 1: Windmond im Nebel
Das Jahr 2019 ging mit der eigenen beruflichen Kündigung in den Herbst über.
Der November war nie ihr liebster Monat gewesen und er würde sich wohl eines Tages für diese Abneigung rächen. Dauerhafter Regen und stürmische Winde prägten die Tage.
Der Morgen begann wie üblich: Ivy tat, was an Erledigungen nötig war, und da das Wochenende bevorstand, sollte alles geputzt und vorbereitet sein. Es war kein Zwang, aber ein Drang, das eigene Zuhause sauber und wohnlich zu hinterlassen.
Dann machte sie sich selbst zurecht, denn sie hatte noch einen späten Termin. Seit fast drei Wochen war sie in ihrem neuen Arbeitsbereich der Ambulanten Hilfen in der naheliegenden Stadt tätig. Neue Wege und Erfahrungen versprach sie sich von diesem Wechsel.
Ivy wusch ihre Haare, föhnte sie trocken und schminkte sich dezent. Zufrieden lächelte sie ihr Spiegelbild an. Im Flur nahm sie ihre Tasche, schloss die Tür hinter sich ab und stieg ins Auto. Unterwegs sah sie zwischen den vorübereilenden Wolken, dass der Vollmond sich heute vollenden würde.
Schön, dass du da bist, dachte sie.
Sie fuhr die kurze Strecke zur Adresse der Familie, wurde vom aufgeregten Gebell eines Hundes begrüßt und betrat das Eigenheim. Frau Wagner und ihre Tochter Samantha hatte Ivy bereits bei einem Gespräch im Jugendamt kennengelernt. Herr Wagner war leitender Angestellter in einem regionalen Unternehmen, wie sie aus den Unterlagen entnommen hatte, und stellte sich Ivy mit aller Höflichkeit vor.
„Nehmen Sie doch bitte Platz“, sagte er und hob einladend die Hand in Richtung des Esstisches.
Ivy durchschritt das Wohnzimmer mit mehrteiliger Sitzgarnitur und einem Panoramafenster voller Pflanzen. Der Essbereich füllte den Erker vollständig aus. Die Küche schloss sich an und rundete den gemütlichen Gesamteindruck ab. Der Blick in den herbstlichen Garten erinnerte sie mit allem Nachdruck an das Ende des Jahres.
Das Ehepaar nahm ihr gegenüber Platz. Frau Wagner kümmerte sich ausschließlich um das Haus und die beiden Kinder. Ihr Mann war beruflich stark eingebunden und oft unterwegs.
„Sind die Mädchen auch da?“, fragte Ivy.
„Die beiden sind oben in ihren Zimmern“, erwiderte Frau Wagner.
„Zunächst möchte ich mich Ihnen vorstellen“, begann sie das Elterngespräch. „Mein Name ist Ivy Sabio. Ich bin verheiratet, 56 Jahre alt und wohne im Nachbarort. Von Beruf bin ich Sozialpädagogin und systemische Therapeutin. Wie Sie wissen, ist es meine Aufgabe, Ihnen als Eltern beratend zur Seite zu stehen. Meine Kollegin ist für Samantha zuständig.“
„Was ist eine systemische Therapeutin?“, fragte Herr Wagner und zog die Stirn kraus.
„Ich habe eine mehrjährige Ausbildung absolviert“, erläuterte Ivy. „Systemisch erkläre ich gern folgendermaßen: Wenn eine mechanische Uhr nicht mehr funktioniert, sucht ein Uhrmacher als Spezialist nach Auslösern und Ursachen. Die Berater und Therapeuten suchen genau dort, im umgebenden System, im persönlichem Umfeld, nach den möglichen Ursprüngen. Der Fokus liegt immer auf der Suche nach Lösungen.“
Die Eltern nickten.
„Natürlich werden wir uns kollegial austauschen, um mehrere Sichtweisen zu entwickeln. Welche Erwartungen haben Sie als Eltern an die Unterstützung durch mich?“
Frau Wagner nahm einen tiefen Atemzug. „Wir wissen nicht weiter“, sagte sie verhalten. „Wir haben doch alles getan, damit es den Mädchen gut bei uns geht.“ Ratlos schaute sie ihren Mann an. „Als wir die beiden aufgenommen haben, waren wir so glücklich, da wir keine eigenen Kinder bekommen konnten. Und jetzt das … Was ist nur geschehen?“
Trauer und Enttäuschung waren in diesen Worten hörbar und Ivy konnte Frau Wagner verstehen. Kinder zu adoptieren, war eine immense Aufgabe, die schon nicht so einfach war. Aber Geschwisterkinder aus einem fernen Land aufzunehmen, noch eine zusätzliche Herausforderung mit mehreren Unbekannten.
„Samantha ist nun in der Pubertät, testet ständig jede Grenze aus und raubt uns den Schlaf“, sagte Herr Wagner. „Ihre jüngere Schwester Sophia ist in der Grundschule und ein liebes Mädchen.“
„Die Große wird vor allem mir gegenüber frech und vorlaut“, ergänzte Frau Wagner.
Ivy erkannte eine erste Problematik.
Die Eltern erwarteten anscheinend Dankbarkeit von den Kindern, dachte sie.
Auf diesem Level würde es keine Sieger geben. Ihr war klar, dass es wichtig wäre, den Prozess Schritt für Schritt zu begleiten.
„Ich verstehe Sie und wir werden als Team gemeinsam Lösungsansätze entwickeln“, sprach sie den Eltern Mut zu.
Sie unterhielten sich noch eine Weile über die Abläufe in der Familie und der Schule und vereinbarten den nächsten Termin. Sie bedankte sich lächelnd für die offene Unterhaltung und packte zusammen.
Plötzlich geschah es: Ivys rechter Arm fiel vom Tisch hinab, als hätte jemand eine unsichtbare Fernbedienung gedrückt und den Arm abgeschaltet. Sie legte ihn wieder auf den Tisch, wo er nicht liegenblieb.
„So können Sie aber nicht selbst nach Hause fahren“, sagte Herr Wagner sofort.
Sie nickte und fragte: „Könnte ich meinen Mann anrufen?“
Frau Wagner reichte ihr mit besorgter Miene das Telefon und Ivy wählte die Nummer. Zeitgleich ging es ihr schlechter und sie ließ den Hörer sinken. Frau Wagner nahm ihr das Telefon ab und drückte auf die Wahlwiederholungstaste.
„Hallo, hier ist Wagner. Ihre Frau ist bei uns. Sie hat einen Schwächeanfall oder etwas Ähnliches.“ Sie gab ihm die Adresse und legte auf.
Kurze Zeit später klingelte es und Frau Wagner eilte zur Tür. Als Ivys Mann das Wohnzimmer betrat, spiegelte sein Blick ihr das eigene Elend. Mit besorgter Miene eilte er zu ihr, die noch immer auf dem Stuhl am Esstisch saß.
„Ich bin hier“, sagte er, kniete sich vor sie und nahm ihren Kopf in seine Hände.
„Ben“, flüsterte sie.
Wieder wie aus dem Nichts ging es ihr schlechter, der Kopf schmerzte und die Körperkraft ließ zusehends nach.
„Der Krankenwagen müsste gleich kommen“, sagte Herr Wagner.
Seine Frau lief auf die Straße, um das Rettungsfahrzeug einzuweisen. Längst war es draußen dunkel geworden.
Als die Rettungssanitäter hereinkamen, bemerkte Ivy, dass ihr übel wurde, und im nächsten Augenblick, wie ihre Blase versagte. Die Peinlichkeit war grenzenlos, als sie spürte, wie der Urin an ihren Hosenbeinen hinunterlief.
„O nein“, flüsterte sie leise. Weinend und zutiefst verunsichert, schämte sie sich maßlos.
Die fremden Männer legten sie auf die Transportbahre und schoben sie in den Rettungswagen. Sie sah wie im Nebel die Lichter der Notaufnahme blinken und dann wurde es dunkel um Ivy.
Das Erste, was sie wahrnahm, war das Krankenbett in einem Zimmer, welches mit einem Vorhang zu ihrer rechten Seite abgeteilt war. Jede Erinnerung war verloren und schien unwiederbringlich gelöscht. Waren es Stunden, Tage, Wochen gewesen? Wo war sie? Die Erinnerung wollte sich nicht einstellen.
Unbekannte Menschen in hellblauen Kitteln sprachen mit ihr. Sie verstand nicht alles, aber sie wirkten freundlich und kümmerten sich um sie.
„Sie hatten einen Schlaganfall, aber das wird schon wieder“, sagte eine junge Frau und lächelte ihr zu.
Die Aussage der Krankenschwester schlug wie eine Handgranate direkt neben Ivy ein. Sie bemerkte einen Schlauch, der in ihrem Hals steckte und bei jeder Bewegung unangenehm war. Als sie etwas sagen wollte, stellte sie entsetzt fest, dass kein Wort aus ihrem Mund kam. Vielleicht waren es Töne, aber sie konnte eindeutig nicht sprechen. Die Angst nahm jede Zelle ihres Körpers ein und ließ ihn im Chaos zurück. Sie schlief ein, während ihre Tränen auf das Kissen tropften.
Der nächste wache Moment brachte ihr den Anblick ihres besorgten Mannes, der wie immer versuchte, sie durch ein Lächeln zu erfreuen.
„Ich bin hier, Liebling“, sagte er. „Endlich bist du wach. Du darfst nicht aufgeben, hörst du?“
Sie wollte ihn gern fragen, wie lange sie denn schon im Krankenhaus war. Es gelang nicht. Panik stieg in ihr auf und niemand konnte ihr die akute Angst des Moments nehmen. Wie sollte sie sich nur äußern? Es war ein Zustand wie nach einer Narkose, wobei sie aufwachte, sich aber nicht verständlich machen konnte.
Etwas Ähnliches hatte sie schon mal erlebt, als sie inmitten einer Operation am Unterleib aufgewacht war. Ein junger Arzt hatte ihr damals erschrocken eine erneute Spritze gesetzt und sie war wieder weggedämmert. Anfangs hatte sie gedacht, sich das Erlebnis eingebildet zu haben. Doch als der Arzt später in ihr Zimmer gekommen war, hatte sie ihn wiedererkannt.
Damit konnte sie sich etwas beruhigen, denn damals war es gelungen, warum also nicht auch hier wieder?
Ivy beobachtete, wie die Krankenschwester ihren Ehemann tröstete. Dann schlief sie wieder ein.
Der Schlaf wurde anscheinend durch die Medikamente verlängert. Wie lange schlief sie? Was geschah um sie herum? Sie wusste es nicht.
Dann wurde sie erneut wach und sah in Bens tieftraurige Augen. „Mein Schatz“, sprach er beruhigend auf sie ein, „du bist auf der sogenannten Zwischenstation. Hier gibt es gute Ärzte und Pflegepersonal. Erst hast du fast sieben Tage auf der Intensivstation gelegen. Ich habe solche Angst um dich gehabt, weil du keinerlei Anzeichen der Besserung gezeigt hast. Aber wir schaffen das schon, glaube mir!“
Ivy wollte ihm so viel sagen. Aber ihr Körper fand einfach seine Stimme nicht wieder. Die Wut über dieses Ausgeliefertsein überkam sie wie ein Blitz – und genauso schnell riss sie sich die Sonde aus ihrem Hals. Eigentlich nur, um zu sagen: „Ich bin hier und ich verstehe dich!“
Ben sprang erschrocken auf und rief nach den Pflegern, um alles wieder richten zu lassen.
In diesem Augenblick geschah das Seltsamste, was sie jemals erlebt hatte: Ivy löste sich aus ihrem Körper und sah sich selbst als Hülle im Bett liegen, während sie in der oberen Zimmerecke schwebte und auf das nunmehr versammelte Pflegepersonal und ihren Mann hinabsah. Sie erblickte sich auf dem Rücken liegend, blass und abwesend. Ihre Beine wie bei einem Baby angezogen. Nichts erinnerte an die Frau, die sie vorher gewesen war.
Ihre Augen in dem Bett waren geschlossen. Ivy hingegen sah jede kleinste Bewegung und spürte die Sorgen der anderen. All das wirkte aus der Entfernung noch bedrückender und es tat ihr im Herzen weh, Ben so hilflos zu sehen.
War es so weit? Fürchteten sie, dass es zu Ende ginge, oder wussten sie nicht, was sie tun könnten?
„Hört mich doch“, schrie jede Faser ihres Körpers.
Die Klarheit in ihrem Kopf war vollständig anwesend. Sie wollte ihnen unbedingt Hoffnung bieten. Sie glitt wieder in ihren Körper, öffnete die Augen und streckte die linke Hand nach Ben aus.
„Huch!“, rief er und sah sie überrascht an.
„Wie wundervoll ist das denn bitte?“, fragte der junge Pfleger.
Ben hatte Tränen in den Augen. Es war eine Kampfansage für das Leben und nicht die Aufgabe. Was der Tod eventuell schon plante, wollte sie noch nicht mitgehen. Sie merkte, wie der Zustand völliger Hilflosigkeit sie wieder losließ, und spürte die Angst nicht mehr in dem vorherigen Ausmaß.
Schon oft hatte sie von Nahtoderfahrungen gehört und sie als Hirngespinste abgetan, aber genau das war ihr gerade geschehen. Woher kam ihre Skepsis für solche Phänomene? Ivy hätte am liebsten den Kopf geschüttelt, wenn sie gekonnt hätte, denn alles schien surreal. Alte und bereits vor langer Zeit entstandene Muster taten sich vor ihren Augen auf. Wie bei einem Flickenteppich konnte sie unterschiedliche Webarten erkennen. Einige Teile waren bereits verschlissen. Ivy spürte dennoch förmlich die Nadelstiche der Vergangenheit. Das Werk ihrer Vorfahren? Das konnte doch nicht zutreffen, oder? Von dieser Sichtweise wurde ihr schwindelig.
Ihr gesamter Körper hatte auf Notstand geschaltet, bediente die Zellen nur mit ausreichend Energie zum Überleben. Aber Ivy wollte nicht passiv auf den Tod warten, sie wollte leben. Das Ganze hatte mit ihrem Geist begonnen, der aufgeschrien hatte und noch immer schrie. Wie der Seufzer der Ergebenheit klang das nicht, eher wie ein hilfloses Rufen, das momentan niemand hören konnte. Ivy nahm die Gefühle jedoch überall in sich wahr. Erschöpft schlief sie ein.
Ihre erste bewusste Begegnung war furchterregend. Das Chaos der Gedanken spielte ihr einen Streich, oder?
Da erschien eindeutig ein Mischwesen aus einer Art Wolke vor ihr. War es ein Drache? Einerseits mit riesigen Flügeln versehen, andererseits mit bläulichen Schuppen bedeckt, nahm das Tier vor ihr Platz und verdunkelte jegliche Sicht. Ivy hatte ernsthaft Sorge, verrückt geworden zu sein. Was in aller Welt geschah hier?
Das war der Moment, in dem sie ihre Angst spürte. Die finsteren Blicke des Drachen verhießen nichts Gutes. Ein dunkles Grollen wie bei einem Gewitter erklang.
„Du bist meine Phoebe, nicht wahr?“, wagte sie es trotzdem, das Wesen anzusprechen. „Also meine Angst, die ich so oft spüre.“
Der riesige Drache nickte kurz und schnaubte: „Wie immer du mich nennen möchtest.“ Das klang diabolisch und sanft zugleich. Um die Worte zu untermalen, stiegen weiße Dunstschwaden aus dem Rachen des Drachens auf.
Ivy hatte ihrer Angst einen Namen gegeben und konnte ihr nun unverhohlen ins Gesicht schauen. Phoebe war eine Greisin in Drachengestalt mit dem Gesicht eines frechen Kindes. Als wäre dies nicht ungewöhnlich genug, sprach eine unglaubliche Arroganz aus ihren unruhigen, grün gefleckten Augen.
„Was schaust du denn so?“, kam es wie aus der Pistole geschossen.
Ivy machte sich kleiner. Diese Stimme klang nach Ärger, den sie nicht wollte.
Wenn Phoebe wütend wie gerade wurde, stellten sich rot schimmernde Hornplatten auf ihrem Rücken auf und ließen sie noch mächtiger erscheinen. Der Drachenkörper hatte Falten an allen Stellen, aber das Selbstbewusstsein war beeindruckend und löste Neid in Ivy aus. Nicht, dass sie selbst so werden wollte; es beeindruckte sie vielmehr, dass der Drache alles ungehemmt zeigte.
„Bemühe dich nicht“, fuhr Phoebe fort und schnaubte höhnisch, „ich kann deinen Gedanken jederzeit Feuer unter dem Hintern machen, bis sie nach meiner Pfeife tanzen.“
Ja, sie war ein alter und furchterregender Drache, der jederzeit seine Flügel um Ivy legen konnte. Die kleinen spitzen Krallen an den Enden ihrer Flügel bohrten sich in Ivys Arme. Der Schmerz war anhaltend, jedoch von Gewöhnung geprägt. Vielleicht würde sie ihn vermissen, wenn er nicht mehr da wäre? Gerade war das Erleben so real und lief permanent an und in ihrem Körper ab. In diesem unmittelbaren Moment der Angst verharrte sie in Schockstarre und wusste nicht, wie und wann sie da herauskommen könnte.
Phoebe grinste sie siegessicher an. „Du magst es nicht, aber du gehörst mir“, betonte sie. „Ich dirigiere dich, leite dich und du gehorchst!“
Der Drachenkopf schwang wie der eines Schlangenbeschwörers hin und her. Ivy wollte sich regen, aufmüpfig ein lautes „Nein“ in dieses Gesicht schreien. Aber ihre Stimme fand den Weg ans Licht nicht.
„Erinnerst du dich nicht?“, zischte Phoebe mit dämonischem Blick. „Du hast mich in dein Leben eingeladen, du allein.“
„Das habe ich nicht“, erwiderte diese unsicher.
„Du warst genau vier Jahre alt, als du nach mir gerufen hast“, schnaubte die Drachenfrau. Kleine Rußpartikel stiegen wie Blasen aus ihren Nüstern auf.
Ivy zuckte zusammen, denn das waren die Zeiten der ersten epileptischen Anfälle in ihrer Kindheit gewesen.
„Warum bist du geblieben?“, flüsterte sie.
Der Drache lachte laut. „Weil du es, wie die meisten Menschen, nicht geschafft hast, mich von deiner eigenen Sicherheit zu überzeugen. Du schenkst mir deine Lebensenergie und ich mache immer das Beste daraus. Darauf gebe ich dir mein Wort!“ Phoebe rekelte sich und faltete anschließend die mächtigen Flügel eng an ihren Körper.
Ivy war hin- und hergerissen, ob sie dieses Wesen schrecklich oder bemerkenswert finden sollte. War die Angst der Vergangenheit oder der Zukunft zugehörig? Wahrscheinlich beides. Wenn Ivy sich ängstigte, dann befand sie sich immer im Fluchtmodus, und nur in ihren Träumen gab es augenscheinlich kein Entrinnen. War nicht das hier auch nur ein schlimmer Traum?
Was sollte sie nun tun? Phoebe hatte ihr deutlich gesagt, dass es die eigene Schuld war. Sie erschien einfach auf der Bildfläche und verschluckte alles Licht vor Ivys Augen und in ihrem Inneren.
„Du kennst ja meine kleine Schwester, nicht wahr?“, unterbrach Phoebe die Überlegungen und gähnte ausgiebig.
„Was oder wen meinst du?“ Ivy schüttelte ihren Kopf.
„Agora hat eine wichtige Aufgabe zu erfüllen“, sagte der Drache. Er grinste gehässig und entblößte dabei sein gelbliches Gebiss. Ein gruseliger Anblick, der Ivy einen Schauer über den Rücken jagte.
„Meinst du Angora, die Kaninchen- oder Katzenrasse?“, fragte sie die Drachenfrau.
„Höre gefälligst zu!“, polterte Phoebe. „Ich sagte A-gora. Sie bringt mir jede Person, die sich in ihren Netzen verfangen hat und festsitzt.“ Der Kragen um den Drachenhals stellte sich drohend auf.
„Ist deine Schwester eine Spinne, die Menschen fängt?“ Ivy war verunsichert, aber zunehmend mutiger.
„Muss ich dir denn alles erklären? Agoraphobie ist unter anderem Platzangst“, sagte das Wesen und stöhnte genervt.
„Du Dummerchen! Wir sind alles, was nötig ist, und haben uns an die Bedürfnisse der Menschen angepasst und unsere Form natürlich auch“, belehrte Phoebe sie und kratzte sich am Bauch. „In Situationen, in denen die Menschen nicht fliehen oder angreifen können, schlägt unsere Stunde. Das kann überall sein: im öffentlichen Raum, im Dunkeln, mit Zuschauern oder ohne … Du siehst: Wir arbeiten zuverlässig.“ Stolz nickte sie ihre eigenen Worte ab. „Ihr Menschen lebt nicht genug in der Wirklichkeit, kreist ständig um euch selbst und verliert alles andere aus den Augen“, fügte sie etwas gelangweilt hinzu. „Natürlich habt ihr die Existenz von Agora entdeckt und denkt, die Agoraphobie zu kennen. Aber ihr kratzt lediglich an der Oberfläche.“ Sie kicherte wie eine alte Hexe im Märchenfilm. Ihre Schulter hob den rechten Flügel hoch, den sie schließlich mit unerwarteter Eleganz von sich streckte. „Ach, sieh mal an, ich kann das!“ Phoebe grunzte vor Vergnügen.
Ungläubig starrte Ivy die alte Drachenlady mit dem jungen Gesicht an.
„Was denn? Habe ich einen wunden Punkt erwischt?“, fragte diese mit gespieltem Bedauern. „Du magst nicht, wie ich dich behandle, aber das juckt mich nicht.“ Phoebe verdrehte ihre Augen.
Von dieser Unterhaltung mit einem Drachen wurde ihr flau im Magen.
„Du hast Höhenangst, nicht wahr?“, fuhr Phoebe fort.
Ihr blieb nichts weiter übrig, als zu nicken.
„Das ist Akro, meine andere Schwester, die dich lenkt, wenn du deine eingebildete Überempfindlichkeit nicht in den Griff bekommst. Deine Akrophobie, die mit dir viel Spaß hat.“
In diesem Moment fiel ihr ein, dass sie als Kind öfter gestürzt war und in ihren nächtlichen Träumen vom Gefühl des Fallens wach geworden war. Somit irrte Phoebe, denn die Angst vor der Höhe hatte andere Ursachen. Gerade als sie dies ausdrücken wollte, schüttelte sich die Drachenfrau. „Nur weil du glaubst, etwas zu wissen, hast du nicht automatisch recht.“
Ivy war geschockt, denn das laute Aussprechen ihrer Gedanken war überraschend zutreffend.
„Wie oft kommst du zu mir?“, fragte sie.
Phoebe pustete ihr eine Rauchwolke ins Gesicht, „Nein, ich komme nicht zu dir. Ich wohne in dir, habe es mir richtig gemütlich gemacht, und wenn so nach mir verlangt wird, bleibe ich.“
Der Atem roch nach Feuer und verbranntem Holz.
„Hör mir gut zu, denn ich weiß alles über deine Ängste, nicht schön oder klug genug zu sein. Das nervt. Die Angst um dein Leben jedoch ist eine Wohltat. Deine Makel sind mein Futter. Es gab hingegen Zeiten, in denen du mich fast verhungern lassen wolltest. Das war sehr unhöflich!“
„Wann soll das gewesen sein?“
„Nun, als du Ben kennengelernt hast. Du hast es gewagt, mich rausschmeißen zu wollen.“
Ein wütendes Schnauben erklang, das Ivy nur am Rande wahrnahm, denn sie musste lächeln und Phoebe verschwand augenblicklich vor ihren Augen.
Zu gern erinnerte sie sich an diese erste schicksalhafte Begegnung. Als sie sich kennengelernt hatten, gab es einen kurzen, aber heftigen Regenschauer im Mai. Ein Mann stieß an der Tür mit ihr zusammen, die sich die nasse Kapuze abzog und ihre Haare schüttelte. Die Wassertropfen flogen wild auf ihn zu, aber er starrte Ivy nur an. Sie bemerkte es, dachte jedoch, er sei verärgert, weil sie zu ungestüm in das Café gestürzt kam. Er hatte augenscheinlich vor zu gehen und sie hielt ihn auf.
„Sorry“, sagte sie und tropfte vor sich hin.
„Ach, das ist doch nicht schlimm.“ Er räusperte sich und blickte sie abwartend an.
„Darf ich dich auf einen Kaffee einladen?“, fragte Ivy lächelnd, da er ihr sympathisch war.
„Gern“, sagte er und hielt ihr die Hand hin. „Benjamin … Ich bin Ben.“
„Freut mich, mein Name ist Ivy“, antwortete sie schmunzelnd und schüttelte seine Hand.
Er folgte ihr zu einem freien Tisch. Die Bedienung kam und nahm die Bestellung auf.
Die folgende Zeit verging wie im Rausch: Sie redeten, lachten und strahlten sich an.
Erst viele Monate später hatte Ben ihr erzählt, wie er diese erste Begegnung erlebt hatte; dass er kaum hatte glauben können, ihr gegenüberzusitzen.
„Ich war immer der Ansicht gewesen, keinen Erfolg bei Frauen zu haben. Was hatte sich geändert? Die Antwort saß in deiner Gestalt vor mir. Dein Aussehen und deine Ausstrahlung faszinierten mich. Der Regen hatte die Frisur zerstört, aber diese Tatsache verunsicherte dich überhaupt nicht. Dein lächelndes Gesicht nahm mich gefangen, denn mit so großen braunen Augen hatte mich niemand zuvor angesehen. Wichtig war auch deine Mimik und wie du gesprochen hast, mit einer Prise Witz, die unterhaltsamer war als jedes Gespräch zuvor. Deine Augen strahlten Wärme aus und dein Mund weckte in mir den Wunsch, dich zu küssen. Meine Hände wollten zu deinen. Das war der Moment, in dem ich mein Herz an dich verlor.“
Beide vergaßen sie an jenem Tag die Zeit. Es gab nichts um sie herum, das zur Ablenkung hätte dienen können. Dem Kaffee folgten zwei Gläser Tee mit einem Stück Erdbeerkuchen, das sie sich teilten. Auch Ivy hatte die Zeit nicht beachtet, als sie einen Anruf erhielt. Ein Blick auf ihre Uhr besagte, dass über zwei Stunden vergangen waren.
„Ich komme sofort“, versprach sie.
„Ich war durch den Wind“, hatte Ben erzählt, „denn wenn du nun gehen würdest, hättest du aus meinem Leben ebenso heftig entschwinden können, wie du hereingeplatzt warst.“
„Darf ich dich wiedersehen?“, fragte er umgehend. Seine Nervosität war damals für sie offensichtlich.
In diesem Moment nahm Ivy seine Hand und schaute in seine grünlichen Augen. „Das fände ich sehr schön.“
Ben schob ihr sein Handy hin und sie tippte ihre Nummer ein. Als sie die Rechnung verlangte, wollte er es mit einer Handbewegung unterbinden.
Ivy zahlte jedoch. „Das nächste Mal bist du dran“, sagte sie mit einem Augenzwinkern.
Sie nahm Mantel und Tasche und entschwand mit einem Winken.