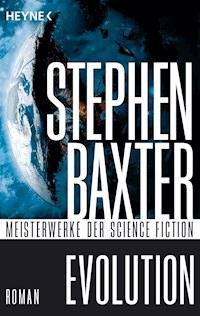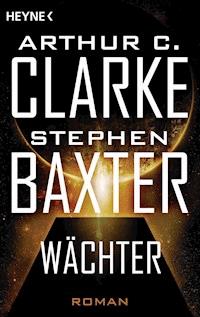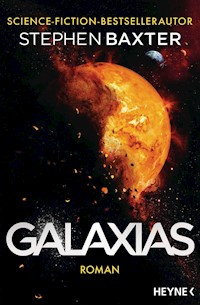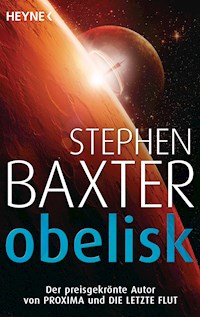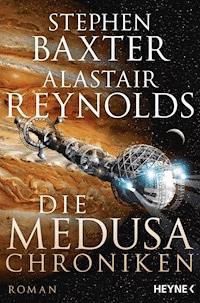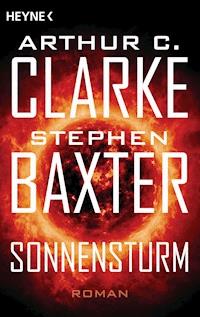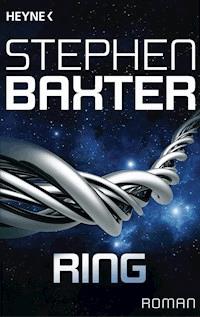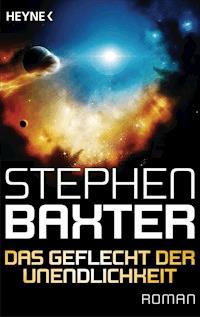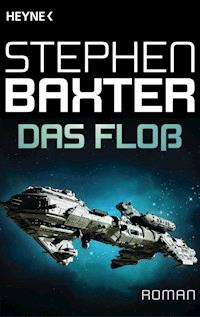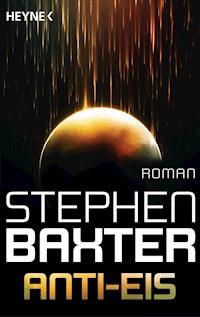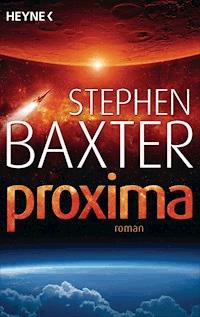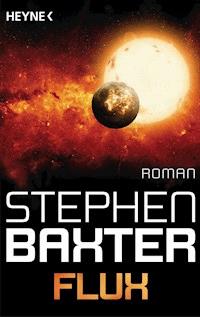
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Schatten der Vergangenheit
Dura und ihre Mitmenschen leben im Inneren eines Neutronensterns. Sie wissen, dass sie Geschöpfe der Urmenschen sind, riesigen Wesen, die einst von den Sternen kamen, und nach deren Ebenbild geschaffen wurden. Die Urmenschen sorgten dafür, dass ihre winzig kleinen Körper den extremen Bedingungen und der Strahlenhölle auf dem Neutronenstern angepasst wurden. Und sie gaben Duras Volk einen Auftrag – doch im Laufe der Zeit haben Dura und ihre Kameraden ihn vergessen. Als die Xeelee auftauchen und den Neutronenstern angreifen, erhalten so manche vergessenen Dinge wieder einen Sinn …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
STEPHEN BAXTER
FLUX
Roman
1DURAWURDEAUSDEM Schlaf gerissen.
Etwas stimmte nicht. Der Geruch der Photonen hatte sich verändert.
Sie sah fast nicht die Hand vor Augen, und sie krümmte die Finger. Plasma richtete sich in spiralförmigen Wirbeln an den Linien des Magfelds aus und spielte purpurfarben um die Fingerspitzen. Die Luft war warm und stickig, und alles, was sie sah, waren verschwommene Konturen.
Für einen Moment hing sie hier, zu einer Kugel zusammengerollt, im Griff des elastischen Magfelds.
In der Ferne hörte sie panische Stimmen. Sie kamen aus der Richtung des Netzes.
Dura schloss die Augen, legte die Arme um die Knie und versuchte, sich wieder in den Schlaf des Vergessens zu flüchten. Nie wieder. Beim Blut der Xeelee, fluchte sie lautlos, nicht noch einen Störfall; nicht noch einen Spin-Sturm. Sie wusste nicht, ob der kleine Stamm Menschlicher Wesen einen weiteren Sturm überleben würde … oder ob sie die Kraft besaß, eine erneute Katastrophe zu überstehen.
Nun lief ein Zittern durch das Magfeld, von dem sie umhüllt war. Sie spürte ein angenehmes Kribbeln auf der Haut, und sie passte sich dem Rhythmus des Feldes an, wie ein Kind, das in den Armen seiner Mutter gewiegt wird. Dann – was weniger angenehm war – spürte sie einen Stoß gegen den Rücken …
Nein, das war nicht das Magfeld. Sie streckte sich und dehnte dabei die Feldlinien. Sie rieb sich den Schlaf aus den Augen und schüttelte den Kopf, um klare Sicht zu bekommen.
Die Knüffe, die sie im Rücken spürte, stammten von der Faust ihres Bruders Farr. Sie sah, dass er Latrinendienst gehabt hatte; er hielt noch den Plastikbeutel in der Hand, in dem sich der mit Neutronen angereicherte Kot befunden hatte, den er aus dem Netz entsorgt und in die Luft gekippt hatte. Sein hagerer, noch im Wachstum befindlicher Körper zitterte im instabilen Magfeld. Er schaute zu ihr auf, wobei er sein rundes Gesicht in drollige Sorgenfalten gelegt hatte. Er hatte sein Haustier an einer Flosse gepackt, ein Luft-Schwein – ein fettes Jungtier, das ungefähr die Größe von Duras Faust hatte und das noch zu jung war, um ihm die sechs Flossen zu perforieren. Das Tierchen, das wegen des Störfalls offensichtlich in Panik geraten war, zappelte in Farrs Griff, wobei es einen dünnen Strahl blauer, suprafluider Winde ausstieß.
So vernarrt, wie Farr in das Tier war, wirkte er sogar noch jünger als die zwölf Jahre, die er eigentlich zählte – Dura war dreimal so alt –, und er umklammerte das Ferkel, als ob er sich damit seine Kindheit bewahren wollte. Der Mantel war zwar groß und bot viel Platz, sagte Dura sich, aber er war kein Ort für Kinder. Farr musste schnell erwachsen werden.
Er hatte große Ähnlichkeit mit Logue, ihrem Vater.
Die noch immer schlaftrunkene Dura spürte plötzlich eine starke Zuneigung und Sorge um den Jungen; sie streichelte seine Wange und strich ihm sanft über die Stirn.
»Hallo, Farr«, begrüßte sie ihren Bruder lächelnd.
»Ich wollte dich nicht aufwecken.«
»Das hast du auch nicht. Der Stern hat mich geweckt, lange bevor du gekommen bist. Wieder ein Störfall?«
»Der schlimmste bisher, sagt Adda.«
»Lass Adda doch reden«, sagte Dura und strich ihm übers schlauchartige Haar, das wie immer wirr und struppig vom Kopf abstand. »Wir werden es überleben. Bisher haben wir es noch immer überlebt, stimmt’s? Du gehst jetzt zu deinem Vater zurück und sagst ihm, ich würde gleich kommen.«
»Geht in Ordnung.« Farr lächelte sie an, stieß sich ab und schwamm unbeholfen durchs Magfeld auf das Netz zu, wobei er noch immer die Flosse des Luft-Schweins umklammerte. Dura sah, wie die schlanke Gestalt im glitzernden, die Welt durchdringenden Feld verschwand.
Dura richtete sich zu ihrer ganzen Größe auf, streckte sich und dehnte dabei das Magfeld. Dann machte sie mit offenem Mund Lockerungsübungen. Sie spürte, wie die Luft durch die Kehle in Lunge und Herz strömte und von den Kapillaren an die Muskeln abgegeben wurde; sie spürte die Energie in jeder Faser ihres Körpers.
Sie schaute sich um und roch die Photonen.
Duras Welt war der Mantel des Sterns, eine gigantische Höhle mit weißgelber Luft, die unten vom Quantenmeer und oben von der Kruste begrenzt wurde.
Die Kruste war eine dicke Matte, die mit purpurfarbenem Gras und Bäumen bewachsen war, welche aus der Ferne wie Haare wirkten. Wenn sie schielte – indem sie die Brennweite ihrer parabolischen Netzhaut veränderte –, erkannte sie dunkle Punkte, die sich um die Wurzeln der an der Unterseite der Kruste wachsenden Bäume versammelt hatten. Vielleicht handelte es sich um Rochen, eine Herde wilder Luft-Schweine oder andere Pflanzenfresser. Die Tiere waren zu weit entfernt, als dass Dura alle Einzelheiten hätte erkennen können, doch die Amphibien machten einen verwirrten Eindruck und wirbelten umeinander, wobei es immer wieder zu Zusammenstößen kam; fast glaubte sie, ihre Schreie zu hören.
Weit unter ihr bildete das purpurne Quantenmeer den Boden der Welt. Das amorphe und tödliche Meer war von einer Dunstschicht überzogen. Das Meer selbst war von dem Störfall nicht betroffen worden, wie sie erleichtert feststellte. Bisher existierte in Duras Erinnerung nur ein einziger Störfall, der so gravierend gewesen war, um ein Seebeben auszulösen. Beim Gedanken an dieses schreckliche Ereignis zitterte sie wie das Magfeld; sie war wohl so alt wie Farr gewesen, als die Neutrino-Geysire ausgebrochen waren und die Hälfte der Menschlichen Wesen – einschließlich Phir, Duras Mutter und Logues erster Frau – in den geheimnisvollen Raum jenseits der Kruste gespült hatten.
Die stahlblau glühenden Feldlinien umgaben sie wie ein Käfig. Die in einem Abstand von etwa zehn Mannhöhen verlaufenden Feldlinien füllten den Raum in einer hexagonalen Struktur aus; vom Ursprung weit oben – im Norden – legten sie sich wie die Flugbahnen riesiger Tieren um den Stern und vereinigten sich schließlich am pastellrot schimmernden Südpol, Millionen von Mannhöhen entfernt.
Sie hielt die Hände vors Gesicht und versuchte, wie mit einem Sextanten die aktuellen Abstände und Struktur der Feldlinien zu bestimmen.
Zwischen den Fingern sah sie das Lager, eine Insel quirligen Lebens – umherstreifende, ängstliche Luft-Schweine, geschäftige Menschen, das vibrierende Netz – inmitten der aufgewühlten Luftmassen. Farr mit seinem zappelnden Luft-Schwein glich einem Staubkorn, das an den unsichtbaren Feldlinien entlanggezogen wurde.
Dura versuchte, die kleine, chaotische Bastion der Menschheit zu ignorieren und sich auf das Feld zu konzentrieren.
Normalerweise war die Drift des Felds so gleichmäßig und berechenbar, dass die Menschen ihr Leben danach ausrichteten. Die in Richtung der Kruste wandernden Feldlinien wurden von zwei unterschiedlichen Schwingungen überlagert: spitze Amplituden, die einen Tag markierten und flachere, komplexere Oszillationen, anhand derer die Menschen die Monate zählten. In der Regel konnten die Menschen der Drift des Feldes leicht ausweichen; sie hatten immer reichlich Zeit, das Netz abzubauen und das Lager in einer anderen Ecke des leeren Himmels aufzuschlagen.
Dura wusste sogar, wodurch die Schwingungen der Feldlinien verursacht wurden; nur dass dieses Wissen ihr nicht viel nützte: der Stern hatte nämlich einen Trabanten, der sich weit jenseits der Kruste befand – einen Planeten, eine Kugel wie der Stern, nur kleiner und leichter –, der über ihren Köpfen rotierte und mit unsichtbaren Fingern an den Feldlinien zupfte. Und jenseits dieses Planeten wiederum – der sinnlose Gedanke stahl sich wieder in ihr Bewusstsein –, jenseits dieses Planeten waren die Sterne der Ur-Menschen, unendlich weit entfernt und ihrem Blick für immer verborgen.
Normalerweise waren sie im driftenden Feld so sicher wie in Abrahams Schoß; Menschen, Luft-Schweine und andere Lebewesen bewegten sich frei zwischen den Feldlinien, ohne dass sie irgendeiner Gefahr ausgesetzt gewesen wären …
Aber nicht bei einem Störfall.
Durch den aus den Fingern gebildeten Sextanten sah sie, dass die Struktur des Feldes durch die suprafluide Luft beeinflusst wurde, die danach strebte, sich an die veränderte Rotation des Sterns anzupassen. Instabilitäten – große, parallel verlaufende Wellenberge – wanderten bereits an den Feldlinien entlang und übertrugen die Nachricht vom erneuten Erwachen des Sterns vom geographischen Pol zum magnetischen Pol.
Die von den Feldlinien emittierten Photonen rochen bitter. Ein Spin-Sturm war im Anzug.
Dura hatte ihre Schlafstelle ungefähr fünfzig Mannhöhen vom Zentrum des Lagers der Menschlichen Wesen entfernt eingerichtet, an einer Stelle, wo das Magfeld besonders stark und sicher gewesen war. Nun schwamm sie auf das Netz zu. Durch die Bewegung wurde ein prickelnder Strom in ihrer Epidermis induziert, und sie hangelte sich wie an einer Leiter am unsichtbaren, elastischen Magfeld entlang. Wo sie nun den letzten Rest der Müdigkeit abgeschüttelt hatte, beschlich sie nachträglich ein Gefühl der Angst – eine Angst, die sich mit dem Schuldgefühl wegen ihrer Saumseligkeit verquickte –, und während sie durch das Magfeld glitt, spreizte sie die mit Schwimmhäuten versehenen Finger und kraulte durch die Luft, um den Zeitverlust aufzuholen. Weil die Luft mit suprafluiden Neutronen gesättigt war, setzte sie Duras Schwimmbewegungen fast keinen Widerstand entgegen; sie versuchte, die zunehmende Ungeduld durch schnelleres Schwimmen zu kompensieren.
Die Feldlinien glitten nun wie Träume durch ihr Blickfeld. Sie schlugen Wellen, während sie von im Dunst der Pole verborgenen Giganten geschüttelt wurden. Die in Schwingung versetzten Linien stießen ein dumpfes Stöhnen aus. Die Amplitude der Wellen betrug bereits eine halbe Mannhöhe. Bei Bolders Eingeweiden, sagte sie sich, vielleicht hat dieser alte Narr Adda diesmal doch recht; vielleicht wird dies der schlimmste Sturm aller Zeiten.
Langsam, quälend langsam, wurde das Lager größer, und wo sie zuvor nur ein Konglomerat aus Bewegung und Geräuschen wahrgenommen hatte, erkannte sie nun Einzelheiten der Gemeinschaft. Das Lager war um das zylindrische Netz, das aus geflochtener Baum-Rinde bestand und seinerseits im Magfeld verankert war, angelegt. Die meisten Leute banden sich zum Schlafen und Essen am Netz fest; der Zylinder war auf ganzer Höhe mit einem Flickenteppich aus Habseligkeiten, Decken, Besen, schlichten Kleidungsstücken – Ponchos, Tuniken und Gürteln – sowie spärlichen Lebensmittelvorräten überzogen. Halbfertige hölzerne Artefakte und ungegerbte Luft-Schwein-Häute baumelten an den Seilen des Netzes.
Das Netz hatte eine Höhe von fünf und eine Länge von einem Dutzend Mannhöhen. Den Aussagen der älteren Leute, zu denen auch Adda gehörte, war das Netz mindestens fünf Generationen alt. Und es war die Heimat von ungefähr fünfzig Menschen – und ihr ganzer Besitz.
Während Dura sich durch das Magfeld kämpfte, betrachtete sie die fragile Konstruktion plötzlich ganz nüchtern und objektiv – als ob sie nicht in einer Decke geboren worden wäre, die an den Knoten des schmutzigen Netzes befestigt gewesen war, als ob sie nicht auch dort sterben würde. Wie zerbrechlich es doch wirkte: wie schwach und schutzlos sie in Wirklichkeit waren. Obwohl Dura unterwegs war, um ihren Leuten in diesem Augenblick der Gefahr Beistand zu leisten, fühlte sie sich dennoch deprimiert, schwach und hilflos.
Die Erwachsenen und größeren Kinder drifteten am Netz entlang und besserten die Knoten aus. Sie sah Esk, der geduldig an einem Abschnitt des Netzes arbeitete. Dura glaubte, er hätte ihr Näherkommen bemerkt, aber sicher war sie sich nicht. Philas, seine Frau, war bei ihm, und Dura wandte den Blick ab. Hier und da sah sie kleine Kinder und Babies, die noch immer am Netz festgebunden waren. Weil die Eltern und älteren Geschwister arbeiteten und sich nicht um sie kümmern konnten, hingen sie einsam und verlassen im Netz und wimmerten ängstlich. Vergeblich zerrten sie an den Fesseln, und Dura empfand Mitleid mit jedem von ihnen. Dann erkannte sie Dia, die ihr erstes Kind erwartete. Zusammen mit ihrem Mann Mur zog Dia Werkzeug und Kleidungsstücke aus dem Netz und stopfte sie in einen Sack; Schweiß glitzerte auf ihrem angeschwollenen, nackten Bauch. Dia war eine feingliedrige Mädchenfrau, und durch die Schwangerschaft wirkte sie noch verletzlicher und jünger; als die kinderlose Dura die Frau, die alle Anzeichen der Angst zeigte, bei der Arbeit sah, wallte ein Beschützerinstinkt in ihr auf.
Die Tiere – die kleine Herde des Stammes, die aus einem Dutzend Luft-Schweinen und derselben Anzahl Ferkel bestand – wurden entlang der Achse des Netzes angebunden. Das Quieken der Tiere bildete einen dissonanten Kontrapunkt zu den Schreien der Menschen; sie ballten sich im Zentrum des Netzes zu einer zitternden Masse aus Flossen zusammen, in der jedoch die Körperöffnungen und die Stiele mit den großen Kugelaugen zu erkennen waren. Ein paar Leute hatten sich ins Netz begeben und versuchten, die Tiere zu beruhigen und Erkennungsmarken an den perforierten Flossen anzubringen. Beim Näherkommen sah Dura, dass der Abbau des Netzes langsam und ungleichmäßig erfolgte; die Herde quiekte und zappelte panisch.
Sie hörte, dass die Leute vor lauter Angst und Ungeduld die Stimme erhoben. Was aus der Ferne wie eine konzertierte Aktion ausgesehen hatte, erwies sich beim Näherkommen als ein ausgesprochenes Chaos.
Da sah sie am Rande ihres Blickfelds – ein weißblaues Zucken in der Ferne … die Schwingungen der Feldlinien, deren Ursprung im hohen Norden lag, verstärkten sich: gewaltige, gezackte Instabilitäten, mit denen die kleinen Unregelmäßigkeiten, die sie bisher beobachtet hatte, überhaupt nicht zu vergleichen waren.
Es blieb nicht mehr viel Zeit.
Logue, ihr Vater, hing ein Stück vom Netz entfernt im Magfeld. Adda, der schon zu alt und zu langsam war, um beim Abbau des Lagers mit den anderen mitzuhalten, schwebte mit missmutigem Gesicht neben Logue. Logue brüllte mit seiner sonoren Bariton-Stimme Befehle, was nach Duras Beobachtungen jedoch keinen erkennbaren Einfluss auf den chaotischen Arbeitsablauf hatte. Noch immer empfand Dura dieses seltsame Gefühl der Zeitlosigkeit und Entrücktheit, und sie musterte ihren Vater, als ob sie ihn seit vielen Wochen zum ersten Mal wieder sähe. Das zerzauste flachsblonde Haar klebte ihm am Kopf. Logues Gesicht war maskenhaft starr und von Narben und Falten übersät; und trotzdem schimmerten noch die weichen, jungenhaften Züge durch, die nun für Farr typisch waren.
Als Dura näher kam, drehte Logue sich zu ihr um; seine Wangenmuskulatur arbeitete. »Du hast dir aber viel Zeit gelassen«, knurrte er. »Wo bist du gewesen? Du wirst hier gebraucht. Siehst du das denn nicht?«
Seine Worte rissen sie aus ihrem tranceähnlichen Zustand, und obwohl Eile durchaus geboten war, spürte sie, wie Zorn in ihr aufwallte. »Wo ich gewesen bin? Ich bin mit einem Xeelee-Nightfighter zum Kern geflogen. Wo sollte ich denn sonst gewesen sein?«
Unangenehm berührt wandte Logue sich von ihr ab. »Du sollst diese blasphemischen Äußerungen unterlassen«, murmelte er.
Ihr war zum Lachen zumute. Sie ärgerte sich über ihn, über sich selbst und über die ständigen Reibereien zwischen ihnen. »Ach, in den Ring damit. Was soll ich tun?«, fragte sie kopfschüttelnd.
Nun beugte der alte Adda sich nach vorne; die mit schütterem Haar bewachsene Kopfhaut war von Schweiß überzogen. »Ich weiß nicht, ob du noch viel tun kannst«, sagte er säuerlich. »Sieh sie dir an. Welch ein Chaos.«
»Wir werden es nicht rechtzeitig schaffen, nicht wahr?«, fragte Dura ihn und wies nach Norden. »Schaut euch diese Wellen an. Sie halten direkt auf uns zu.«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht.« Mit leeren Augen schaute der alte Mann zum Südpol, dessen sanftes Glühen sich in den Augenhöhlen widerspiegelte; Partikeln wirbelten um die Ränder, die von winzigen Reinigungssymbionten in ständiger Arbeit aus den Augenhöhlen entfernt wurden.
»Mur, du verdammter Narr«, brüllte Logue plötzlich. »Wenn du den Knoten nicht aufbekommst, dann schneide ihn durch. Zerreiß den Strang. Zernage ihn, wenn es anders nicht geht! Aber er muss aufgehen, oder das halbe Netz wird vom Sturm ins Quantenmeer geblasen …«
»Der schlimmste, den ich je erlebt habe«, murmelte Adda und sog die Luft ein. »So säuerlich haben die Photonen noch nie gerochen. Wie ein ängstliches Ferkel … Aber …«, fuhr er dann fort, »ich erinnere mich noch an einen Spin-Sturm aus meiner Kindheit …«
Dura konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Adda wusste von allen wahrscheinlich am besten über die Eigenheiten des Sterns Bescheid. Aber er gefiel sich auch in seiner Rolle als Untergangsprophet … er klammerte sich an die Mysterien seiner Vergangenheit, an die wilden, tödlichen Zeiten, an die nur er sich erinnerte …
Wutentbrannt, wobei ihm schier die Gesichtszüge entgleisten, drehte Logue sich zu Dura um. »Während du hier noch grinst, könnten wir schon tot sein«, zischte er. Seine dunkelbraunen Augen waren fast schwarz vor Zorn.
»Ich weiß.« Sie berührte seinen Arm und spürte die warme Luft, die aus den angespannten Muskeln gepresst wurde. »Ich weiß. Es – tut mir leid.«
Er sah sie stirnrunzelnd an und streckte die Hand aus, als ob er sie berühren wollte. Doch dann zog er sie zurück. »Vielleicht bist du doch nicht so stark, wie ich immer geglaubt habe.«
»Nein«, sagte sie leise. »Vielleicht bin ich doch nicht so stark.«
»Komm«, sagte er. »Wir helfen uns gegenseitig. Und wir helfen unseren Leuten. Wenigstens ist bisher noch niemand umgekommen.«
Dura arbeitete sich über die Flusslinien des Magfelds zum Netz vor. Männer, Frauen und größere Kinder hatten sich zu Trauben zusammengeballt, wobei die dünnen Leiber durch die Turbulenzen des Magfelds immer wieder zusammenstießen, während sie am Netz arbeiteten. Mit ängstlichen Blicken beobachteten sie die näherkommenden Störstellen des Feldes, und Dura hörte, wie die Leute Gebete murmelten – oder schrien –, um die Xeelee gnädig zu stimmen.
Nachdem sie die Menschlichen Wesen eine Zeitlang beobachtet hatte, wurde Dura bewusst, dass sie sich nicht so eng zusammengeschlossen hatten, um effizienter zu arbeiten, sondern weil sie Geborgenheit suchten. Anstatt das Netz zügig und systematisch abzubauen, behinderten die Leute sich gegenseitig; ganze Sektionen des verschlungenen Netzes wurden überhaupt nicht bearbeitet.
Duras Gefühl der Niedergeschlagenheit und Hilflosigkeit verstärkte sich noch. Vielleicht wäre sie in der Lage, ihnen bei der Arbeitsorganisation zu helfen – sie wusste selbst, dass sie in ihrer Eigenschaft als Logues Tochter verpflichtet war, eine Führungsrolle zu übernehmen. Doch beim Blick in die ängstlichen Gesichter der Menschen und die großen, runden Augen der Kinder erkannte sie den Schrecken, der ihre eigenen Aktivitäten lähmte.
Indem die Menschen sich aneinanderdrängten und beteten, reagierten sie vielleicht genauso angemessen auf diese Katastrophe, als wenn sie versucht hätten, das Lager an einen anderen Ort zu verlegen.
Sie krümmte sich in der Luft und schwamm auf einen verlassenen Abschnitt des Netzes zu, um Esk und Phila aus dem Weg zu gehen. Logue würde die Führung allein übernehmen müssen; Dura ließ sich lieber führen.
Die Wellenfront näherte sich dem Lager. Dura spürte die in der Luft liegenden Schwingungen, ergriff die Halteleine und presste sich an das vibrierende Netz. Für einen Augenblick wurde ihr Gesicht in die Maschen gedrückt, und sie erblickte ein Luft-Schwein, das weniger als eine Armeslänge von ihr entfernt war. Die Löcher, die durch die Flossen gestochen worden waren, hatten sich im Lauf der Zeit geweitet, und an den Rändern hatte sich Narbengewebe gebildet. Das Luft-Schwein schien ihr direkt in die Augen zu sehen; die sechs Augenstiele waren ausgefahren und auf sie gerichtet. Dieses Tier war eines der ältesten Luft-Schweine – als Kind, so sagte sie sich sehnsüchtig, hatte sie die Namen aller Tiere der kleinen Herde gekannt –, und es musste schon viele Spin-Stürme überstanden haben. Na schön, sagte sie sich. Welche Prognose gibst du ab? Glaubst du, unsere Chancen, diesen Sturm zu überleben, seien größer als bei den vorangegangenen? Glaubst du, dass du selbst ihn überstehen wirst?
Das Tier schaute sie nur mit traurigen Stielaugen an, ohne dass es ihre Fragen beantwortet hätte. Doch sie roch die Angst in seinen Ausdünstungen.
Plötzlich schimmerte das Netz blauweiß, und ihr Kopf warf einen Schatten.
Als sie sich umdrehte, sah sie, dass eine Feldlinie sich ihr bis auf wenige Mannhöhen genähert hatte; sie vibrierte glühend in der Luft, wie ein Kabel, das ein elektrostatisches Leuchten aussandte. Das Licht blendete sie.
Ihre Stammesgenossen hatten anscheinend alle Versuche aufgegeben, das Netz abzubauen; nicht einmal Logue und Adda hatten sich in die trügerische Sicherheit des Habitats begeben. Die Leute hielten sich einfach irgendwo fest, umarmten sich und nahmen die kleinsten Kinder in die Mitte, wobei das halb abgebaute Netz sich wie ein Segel blähte. Das Weinen der Kinder durchdrang den Raum.
Und dann brach der Spin-Sturm mit voller Wucht los. Eine mannshohe, zerklüftete Diskontinuität raste auf der nächsten Feldlinie am Netz vorbei; weder die Luft-Schweine, die mit ihrem ›Düsenantrieb‹ ohnehin schon recht schnell waren, vermochten diesen Diskontinuitäten zu entkommen, und schon gar nicht die Menschen mit ihren langsamen Schwimmbewegungen. Dura versuchte, sich nur auf das feste Seil in ihren Händen und das Magfeld zu konzentrieren, das ihren Körper wie immer in einem sanften Griff hatte … aber es gelang ihr nicht, die plötzliche Atemnot zu ignorieren und die heiße Druckwelle, die durch die Luft röhrte. Sie glaubte, taub zu werden und fürchtete um den Bestand des Magfelds.
Sie schloss die Augen so fest, dass sie spürte, wie die Luft aus den Höhlen gepresst wurde. Konzentration, sagte sie sich. Du verstehst, was hier abläuft. Dieses arme Luft-Schwein, das am Netz festgebunden ist, weiß auch nicht mehr als ein Ferkel im ersten Sturm. Aber du weißt es; schließlich bist du ein Menschliches Wesen.
Und dieses Verständnis gewährleistet unser Überleben … nur dass sie selbst nicht so recht daran glaubte, auch wenn sie die Worte wie ein Gebet intonierte.
Die Luft war eine Neutronensuppe, ein Suprafluid. Suprafluide reagierten kritisch, wenn sie über längere Zeit hinweg angeregt wurden. Der rotierende Stern wirkte wie ein Dynamo und induzierte ein elektrisches Feld in der Luft, wobei die Feldlinien zu regelmäßigen Strukturen angeordnet wurden, die sich an der Rotationsachse des Sterns ausrichteten – und zwar parallel zur Achse des Magfelds. Die Feldlinien durchzogen die Welt. Solange man ihre Nähe mied, geschah einem nichts; jedes Kind wusste das. Doch bei einem Störfall, so wusste Dura, wurden die Feldlinien instabil … und die Luft verlor im Bereich einer kollabierenden Feldlinie die Suprafluidität und verwandelte sich von einem stabilen, lebensspendenden Fluidum in eine turbulente Zone.
Die erste Wellenfront schien sich bereits abzuschwächen. Sie öffnete die Augen und orientierte sich im Raum, ohne dass sie den Griff um das Seil gelockert hätte.
Die Feldlinien, parallele Stränge, die in der Unendlichkeit verschwanden, durchzogen auf der Suche nach einer neuen Konfiguration den Himmel. Es war ein majestätischer Anblick, und für einen Moment stellte Dura sich vor, wie die den Stern umspannenden Feldlinien sich bündelten und neu ausrichteten, als ob der Stern unter dem Einfluss eines gigantischen Bewusstseins stünde.
Das Netz vibrierte in ihrem Griff, und das raue Seil scheuerte die Handflächen auf; der stechende Schmerz riss sie aus ihren Träumen. Sie seufzte und kämpfte gegen die Müdigkeit an.
»Dura! Dura!«
Die kindliche, ängstliche Stimme drang aus einer Entfernung von einigen Mannhöhen an ihre Ohren. Sie nahm eine Hand vom Netz und drehte sich um. Dort war Farr, ihr kleiner Bruder, der wie ein Fragment aus Stoff und Fleisch in der Luft hing. Er schwamm auf sie zu.
Nachdem Farr sie erreicht hatte, nahm Dura ihn in den Arm und half ihm, Arme und Beine im Netz zu vertäuen. Er zitterte und keuchte, und sie sah, dass die Haare pulsierten, als ob sie von Suprafluiden durchströmt würden.
»Ich bin abgeworfen worden«, sagte er und atmete stoßweise. »Ich habe das Ferkel verloren.«
»Das sehe ich. Bist du in Ordnung?«
»Ich glaube schon.« Er schaute mit leerem Blick zu ihr auf und richtete dann die Augen gen Himmel, als ob er dort nach der Ursache für sein Missgeschick suchte. »Das ist so schrecklich, Dura. Werden wir sterben?«
Beiläufig strich sie ihm übers Haar. »Nein«, erwiderte sie mit einer Überzeugungskraft, die sie nicht aufgebracht hätte, wenn sie allein gewesen wäre. »Nein, wir werden nicht sterben. Aber wir sind in Gefahr. Komm jetzt, wir haben zu arbeiten. Wir müssen das Netz abgebaut und zusammengelegt haben, bevor es von der nächsten Welle zerrissen wird.« Sie deutete auf einen kleinen, nicht sehr festen Knoten. »Löse diesen Knoten dort. So schnell wie möglich.«
Mit zitternden Händen dröselte er den Knoten auf. »Wann wird die nächste Welle kommen?«
»Wir haben noch genügend Zeit, um die Arbeit zu erledigen«, sagte sie mit fester Stimme. Um auch wirklich sicherzugehen, schaute sie flussaufwärts – nach Norden –, von wo die nächste Welle kommen würde, derweil sie sich mit einem widerspenstigen Knoten abmühte.
Sie musste erkennen, dass ihre Prognose falsch gewesen war. Die über das Netz verteilten Menschen stießen Warnrufe aus; sie hatte den Eindruck, dass nur ein paar Herzschläge verstrichen waren, bis sie die ersten Schreie hörte.
Die nächste Welle raste auf sie zu; sie hörte bereits den durch die Konvektion verursachten Lärm. Diese neue Instabilität war groß, mit einer Periode von mindestens fünf oder sechs Mannhöhen. Wie erstarrt klammerte Dura sich an das Netz. Die Druckwelle näherte sich ihr schneller, als sie es in Erinnerung hatte, und je näher sie kam, desto größer wurde die Amplitude, als ob sie durch die Energie des Störfalls noch verstärkt würde. Und natürlich bedeutete eine größere Amplitude auch eine höhere Geschwindigkeit. Bei dieser Instabilität handelte es sich um ein komplexes Muster aus Wellen, die auf der wandernden Feldlinie ›ritten‹, eine Überlagerung, die um die Feldlinie rotierte und wie eine gierige Bestie auf sie zukam …
»Diesmal erwischt es uns, nicht wahr, Dura?«, fragte Farr.
Dann trat Stille ein, die Ruhe vor dem Sturm. In Farrs Stimme hatte frühreife Erkenntnis mitgeschwungen. Es war ein Trost für Dura, dass sie ihn nicht anlügen musste.
»Ja«, sagte sie. »Wir waren zu langsam. Ich glaube, das Netz wird zerreißen.« Sie fühlte sich entrückt, als ob sie sich an weit zurückliegende Dinge erinnerte.
Je näher die Welle kam, desto stärker wurde sie von der Feldlinie abgestoßen und bildete dabei phantastische fraktale Muster aus. Es hatte den Anschein, als ob eine Elastizitätsgrenze überschritten worden wäre und die Feldlinie unter der übermäßigen Belastung nachgäbe.
Trotz der von ihm ausgehenden Gefahr hatte der Vorgang, der sich nur wenige Mannhöhen entfernt abspielte, einen ästhetischen Reiz.
Sie hörte die dünne Stimme von Adda, der sich irgendwo auf der anderen Seite des Netzes befand. »Verschwindet vom Netz. Oh, verschwindet vom Netz!«
»Tu, was er sagt. Komm!«
Langsam hob der Junge den Kopf; er klammerte sich noch immer mit leerem Blick ans Seil, als ob er die tödliche Schönheit überhaupt nicht wahrnähme. Sie schlug ihm auf die Hand. »Komm schon!«
Der Junge schrie auf und befreite sich aus dem Netz. Er sah sie an, wobei in seinem Blick der Vorwurf stand, verraten worden zu sein … und doch war es eher das Gesicht eines wachsamen Kindes als das eines verwirrten und vor Angst gelähmten Erwachsenen. Dura ergriff seine Hand. »Farr, du musst jetzt schwimmen, wie du noch nie zuvor geschwommen bist. Nimm meine Hand; wir dürfen uns nicht verlieren …«
Dann stieß sie sich vom Netz ab. Zuerst schien sie Farr hinter sich her zu ziehen, doch bald hatten ihre Schwimmbewegungen sich synchronisiert. Mit kräftigen Stößen schwammen sie durch das zähe Magfeld und entfernten sich vom Netz, das dem Untergang geweiht war.
Keuchend vor Anstrengung blickte Dura zurück. Wie eine tödliche, blauweiße Wand driftete die Schockwelle durch die Luft und raste wie eine Sense auf das Netz mit den daran hängenden Menschen zu. Dura verglich die Welle mit einem wundervollen Spielzeug; es glühte in einem hellen Licht, und die durch den Wärmestrom verursachte Geräuschentwicklung war so enorm, dass man fast keinen klaren Gedanken fassen konnte. Dura hörte das Quieken der Luft-Schweine, und streiflichtartig dachte sie an das alte Tier, mit dem sie für einen Moment in einer merkwürdigen Halbkommunikation gestanden hatte; sie fragte sich, ob die arme Kreatur überhaupt wusste, wie ihr geschah.
Vielleicht die Hälfte der Menschlichen Wesen hatte Addas Rat befolgt und die Flucht ergriffen. Die anderen, die anscheinend vor Angst erstarrt waren, klammerten sich noch immer ans Netz. Die schwangere Dia driftete mit Mur in der Luft; Philas machte sich noch immer am Netz zu schaffen, was indes völlig sinnlos war, und ignorierte das Flehen ihres Ehemanns Esk, sich in Sicherheit zu bringen. Dura vermutete, dass Philas glaubte, mit ihren Anstrengungen die Instabilität zu bannen.
Dura wusste, dass die Energie der Rotations-Instabilitäten schnell aufgezehrt wurde. Sehr bald schon würde dieser phantastische Dämon in sich zusammenfallen, und die Luft würde wieder ruhig und still daliegen. Und tatsächlich schrumpfte die glühende, tosende und nach sauren Photonen stinkende Instabilität schon merklich zusammen, während sie auf das Netz zuhielt.
Doch wie sie sofort erkannte, schrumpfte sie nicht schnell genug …
Mit einem durch die Konvektion verursachten Heulen, das so laut war wie tausend Stimmen, raste die Instabilität in das Netz …
Es war, als ob eine Faust in ein Tuch gerammt worden wäre.
Die Luft innerhalb des Netzes verwandelte sich von einem Suprafluid in eine viskose, turbulente Masse, die wie eine rasende Bestie um die Feld-Instabilität wirbelte. Dura sah, wie die Knoten platzten; mit einer fast majestätisch anmutenden Trägheit zerfiel das Netz zu einem Gewirr aus Seilen und Matten, an die Erwachsene und Kinder sich klammerten.
Die Luft-Schwein-Herde wurde wie von der Hand eines Riesen in die Luft geschleudert. Dura sah, dass einige Tiere, die offensichtlich schon tot waren oder gerade verendeten, schlaff im Magfeld hingen; der Rest raste durch die Luft, wobei die Tiere blaue Gaswolken aus den hinteren Körperöffnungen ausstießen.
Ein Mensch, der sich an ein Floß aus Seilen klammerte, wurde von der Instabilität selbst angezogen.
Die Entfernung war zu groß, als dass Dura es mit Bestimmtheit hätte sagen können, aber sie glaubte, Esk erkannt zu haben. Sie war bereits Dutzende Mannhöhen von der Position des Netzes entfernt; zu weit, um ihn anzurufen, geschweige denn um ihm zu Hilfe zu kommen. Und dennoch sah sie das nun Folgende so deutlich, als ob sie selbst auf den Schultern ihres todgeweihten Liebhabers auf den tödlichen Bogen zugetrieben wäre.
Esk driftete zusammen mit dem Geflecht aus Seilen durch die Ebene der oszillierenden, bogenförmigen Instabilität und wurde um den virtuellen Begrenzungsbogen gewirbelt. Ohne dass er eine Kursänderung versucht hätte, wurde sein Flug abgebremst, und dann trieb er auf einer spiralförmigen Bahn in die Instabilität hinein, wie ein Luft-Schwein, das die Orientierung verloren hatte.
Esks Körper zerplatzte, die Haut schälte sich von Brust und Bauch, und die Extremitäten rissen mit einer Leichtigkeit ab, als ob er eine Puppe gewesen wäre.
Farr stieß einen unartikulierten Schrei aus. Es war der erste Laut, den er seit dem Verlassen des Netzes von sich gegeben hatte.
Dura ergriff seine Hand und drückte sie fest. »Hör mir zu«, übertönte sie den tosenden Bogen. »Es hat schlimmer ausgesehen, als es war. Esk war schon tot, als er den Bogen erreichte.« Das entsprach durchaus den Tatsachen; als Esk in die Zone der aufgehobenen Suprafluidität geriet, setzten auch die Körperfunktionen – Atmung, Kreislauf und Muskulatur – aus, die von der Suprafluidität der Luft unterstützt wurden. Esk musste den Eindruck gehabt haben, sanft einzuschlafen, während die Luft in den Überströmkapillaren des Gehirns gerann.
Das hoffte sie zumindest.
Die Instabilität entfernte sich von der Position des Netzes und wanderte weiter, um schließlich irgendwo im Süden zu verpuffen. Dura sah, wie der Bogen bereits Energie abgab und zusammenschrumpfte.
Zurück blieb ein Lager, das genauso gründlich zerstört worden war wie der Körper des armen Esk.
Dura zog Farr gegen den leichten Widerstand des Magfelds näher zu sich heran und strich ihm übers Haar. »Es ist vorbei. Gehen wir zurück und schauen, was wir tun können.«
»Nein«, entgegnete er und klammerte sich an seine Schwester. »Es wird nie vorbei sein, nicht wahr, Dura?«
Die Menschen bewegten sich in kleinen Gruppen durch die glitzernden Feldlinien, die sich mittlerweile wieder stabilisiert hatten, und hielten Ausschau nach Verwandten und Freunden. Dura driftete zwischen den Gruppen umher und suchte nach Logue beziehungsweise nach Leuten, die etwas über Logues Verbleib wussten; während der ganzen Zeit hielt sie Farrs Hand.
»Dura, hilf uns! Oh, beim Blut der Xeelee, hilf uns!«
Sie vernahm die Stimme aus einer Entfernung von einem Dutzend Mannhöhen – brüchig und verzweifelt. Sie drehte sich in der Luft um und suchte nach dem Rufer.
Farr fasste sie am Arm und wies in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. »Dort. Es ist Mur, neben diesem Netzfragment. Siehst du ihn? Und Dia ist anscheinend auch bei ihm …«
Die hochschwangere Dia … Dura schwamm schnell durch die Luft, wobei sie ihren Bruder mitzog.
Mur und Dia hingen allein in der Luft, nackt und ohne Werkzeuge. Mur hielt seine Frau an den Schultern und wiegte ihren Kopf. Dia lag ausgestreckt und mit leicht gespreizten Beinen da; die Hände hatte sie auf den angeschwollenen Unterleib gelegt.
Das Gesicht des jungen Mur verriet Härte und Entschlossenheit; er sah Dura und Farr mit pechschwarzen Augen an. »Es ist soweit. Sie ist früh dran, aber der Störfall … ihr müsst mir helfen.«
»In Ordnung.« Mit sanftem Druck schob Dura Dias Hände weg und fuhr mit dem Finger über den Unterleib. Sie spürte, wie das Baby in der Gebärmutter zappelte. Der Kopf steckte tief im Becken. »Ich glaube, der Kopf ist eingeklemmt«, sagte sie. Dia sah sie mit schmerzverzerrtem Gesicht an; Dura versuchte, sich ein Lächeln abzuringen. »Aber sonst ist alles in Ordnung. Es wird nicht mehr lange dauern …«
»Mach weiter, verdammt!«, zischte Dia mit schmerzverzerrtem Gesicht.
Verzweifelt schaute Dura sich um. Die Luft um sie herum war leer; die nächsten Menschlichen Wesen waren Dutzende von Mannhöhen entfernt. Sie waren auf sich allein gestellt.
Sie schloss für einen Moment die Augen und wehrte sich gegen die Versuchung, die Luft nach Logue abzusuchen. Statt dessen versenkte sie sich in ihr Innerstes, um dort Kraft und Stärke zu finden.
»Es wird alles gut werden«, sagte sie. »Mur, leg ihren Kopf in den Schoß und fass sie an den Schultern. Du musst sie festhalten; mit leichten Schwimmbewegungen stabilisierst du deine Position und …«
»Ich weiß selbst, was ich zu tun habe«, sagte Mur barsch. Er fasste Dia an den Schultern und trat mit den kräftigen Beinen langsam Luft.
Dura fühlte sich der ganzen Sache nicht gewachsen. Verdammt, sagte sie sich, wobei sie sich selbst über ihre Reaktion ärgerte, verdammt, das habe ich noch nie gemacht. Was erwarten sie überhaupt von mir?
Was war als nächstes zu tun? »Farr, ich brauche deine Hilfe.«
Der Junge schwebte mit offenem Mund eine Mannhöhe entfernt in der Luft. »Dura, ich …«
»Mach schon, Farr; es ist sonst niemand da, der uns helfen könnte«, sagte Dura. »Ich weiß, dass du Angst hast. Ich habe auch Angst. Aber nicht so viel wie Dia. Im Grunde ist es gar nicht so schwer. Wir schaffen das schon …«, flüsterte sie ihm beim Näherkommen zu.
Solange nichts schiefgeht, sagte sie sich.
»In Ordnung«, sagte Farr. »Was soll ich tun?«
Dura packte Dias rechtes Bein und umklammerte die Wade. Das mit Luft-Schweiß bedeckte Bein zitterte, und Dura spürte, wie Dia die Beine spreizte; die Vagina öffnete sich mit einem leisen Schmatzen, wie ein kleiner Mund. »Nimm das andere Bein«, sagte sie zu Farr. »Sieh zu, wie ich es mache. Halte das Bein gut fest; du wirst kräftig ziehen müssen.«
Der offensichtlich verängstigte Farr gehorchte zögernd.
Das Baby rutschte den Geburtskanal hinauf. Der Anblick hatte Ähnlichkeit mit einem großen Happen, der den Schlund hinunterrutschte. Dia warf den Kopf zurück und stieß ein Stöhnen aus; die Nackenmuskulatur verspannte sich.
»Es ist soweit«, sagte Dura mit einem schnellen Seitenblick. Sie und Farr waren in Position und hielten Dias Knöchel fest; Mur trat Luft und drückte gegen die Schultern seiner Frau, so dass das ganze Ensemble langsam durch die Luft driftete. Sowohl Murs als auch Farrs Augen waren auf Duras Gesicht geheftet.
Erneut stieß Dia einen unartikulierten Schrei aus.
Dura lehnte sich zurück, packte Dias Wade und stemmte sich mit den Beinen gegen das Magfeld. »Farr! Pass auf. Wir müssen ihre Knie durchdrücken. Mach schon; du brauchst keine Angst zu haben.«
Farr sah für einen Moment zu; dann lehnte er sich zurück und folgte dem Beispiel seiner Schwester. Mur stieß einen Schrei aus und drückte fest gegen die Schultern seiner Frau, um Farr und Dura bei ihren Bemühungen zu unterstützen.
Mit einem Schrei drückte Dia die Knie durch.
Farrs Hand glitt über Dias zuckende Wade. Er riss die Augen auf und taumelte schockiert in der Luft. Dia zog das Bein wieder an.
»Nein!«, schrie Mur. »Farr, weitermachen! Du darfst jetzt nicht aufhören!«
»Aber wir tun ihr doch weh«, sagte Farr mit sichtlichem Unbehagen.
»Nein.«
Verdammt, sagte Dura sich, Farr müsste doch wissen, was hier vorgeht. Dias Becken bestand aus zwei beweglichen Teilen; wo die Geburt so kurz bevorstand, würden die Knorpel, welche die beiden Segmente des Beckens zusammenhielten, sich in Dias Blut auflösen, und das Becken würde sich problemlos öffnen. Der Geburtskanal dehnte sich bereits, und die Vagina klaffte weit auseinander. Es war alles vorbereitet, damit das Baby mit dem Kopf voran aus der Gebärmutter an die frische Luft gelangen konnte. Es ist ganz einfach, sagte Dura sich. Und es ist deshalb so einfach, weil die Ur-Menschen es so eingerichtet hatten; vielleicht hatten sie es damals sogar schwerer …
»Es hat alles seine Richtigkeit«, rief sie Farr zu. »Glaub mir. Wenn du jetzt aufhörst, wirst du ihr weh tun. Und du wirst dem Baby weh tun.«
Dia schlug die Augen auf. Sie schwammen in Tränen. »Bitte, Farr«, sagte sie und streckte die Hand nach ihm aus. »Es ist alles in Ordnung. Bitte.«
Er nickte, nuschelte eine Entschuldigung und zog erneut an Dias Bein.
»Sachte«, rief Dura und versuchte, ihre Bewegungen zu synchronisieren. »Nicht so schnell und nicht ruckartig, sondern schön langsam …«
Der Geburtskanal klaffte wie ein dunkelgrüner Tunnel. Dia spreizte die Beine weiter auseinander, als man es für möglich gehalten hätte. Unter der Haut des Mädchens zeichnete sich ab, dass die an den Hüftknochen aufgehängten Beckenhälften nun weit geöffnet waren.
Dia stieß einen Schrei aus; sie bekam Magenkrämpfe.
Dann kam das Baby; es wand sich wie ein Luft-Ferkel durch den Geburtskanal und verließ ihn mit einem leisen, schmatzenden Laut, gehüllt in einen Nebel grüngoldener Luft-Tröpfchen. Nachdem das Baby den Geburtskanal verlassen hatte und ins Magfeld, seinen zukünftigen Lebensraum, eingetaucht war, machte es instinktiv erste, schwache Schwimmbewegungen.
Duras Blick heftete sich auf Farr. Mit vor Staunen offenem Mund verfolgte er die unsicheren Bewegungen des Babys in der Luft, wobei er noch immer Dias Bein umklammerte. »Farr«, sagte Dura. »Komm zu mir. Langsam und gleichmäßig – so ist es richtig …«
Das Restrisiko für Dia bestand nun darin, dass die Beckenhälften nach dem Zusammenklappen nicht bündig abschlossen; und selbst wenn keine Komplikationen auftraten, würde es noch einige Tage dauern, bis das Becken wieder mit Knorpelmasse versiegelt war. Während dieses Zeitraums würde sie fast bewegungsunfähig sein. Mit Duras und Farrs Hilfe schob sie gespreizten Beine zusammen, und Dura sah, dass die Beckenhälften wieder in die Ausgangsstellung zurückglitten.
Mur hatte einen Tuchfetzen aus der mit Treibgut durchsetzten Luft gefischt und wischte damit das Gesicht der in Halbtrance liegenden Dia ab. Dura säuberte Dias Bauch und Beine.
Farr schwamm langsam auf sie zu. Dura sah, dass er das Baby aufgesammelt hatte; nun drückte er das Kind so stolz an sich, als ob es sein eigenes gewesen wäre und ließ sich auch nicht von dem Fruchtwasser stören, das ihm auf die Brust tröpfelte. Der Mund des Babys hatte noch immer die charakteristische Schnabelform, die erforderlich gewesen war, um an die Zitzen in der Gebärmutter zu gelangen, über die der Embryo mit Nährstoffen versorgt wurde; ein winziger Penis war aus der Hautfalte zwischen den Beinen gesprungen.
Grinsend präsentierte Farr das Baby seiner Mutter. »Es ist ein Junge«, sagte er.
»Jai«, flüsterte Dia. »Er heißt Jai.«
Von den ursprünglich fünfzig Menschlichen Wesen hatten vierzig überlebt. Von den Luft-Schweinen waren bloß noch sechs ausgewachsene Tiere übrig, davon vier männliche. Das Netz war irreparabel beschädigt.
Logue war verschollen.
Der Stamm drängte sich im Magfeld zusammen, inmitten der ruhig daliegenden Luft. Mur und Dia wiegten ihr quengelndes Baby. Ohne allzu große Begeisterung übernahm Dura die Rolle einer Predigerin und hielt mit den Menschlichen Wesen eine Art Gottesdienst ab, wobei sie das Wohlwollen der Xeelee erbat. Schweigend verfolgte Adda den Vorgang aus der Nähe; trotz seines Alters war er noch ein vitaler, dynamischer Mann. Und während der ganzen Zeit hielt Dura Farrs Hand.
Dann übergaben sie die Leichen, die sie geborgen hatten, der Luft; langsam drifteten sie dem Quantenmeer entgegen.
Nach dem Gottesdienst schwamm Philas, Esks Witwe, mit eckigen Stößen auf Dura zu. Wortlos musterten die beiden Frauen sich; Adda und die anderen zogen sich diskret zurück.
Philas war eine hagere Frau, die einen erschöpften Eindruck machte; das Haar hatte sie zu einem Knoten zusammengebunden, wodurch das Gesicht wie ein Totenschädel wirkte. Sie starrte Dura an, als ob sie ihr die Legitimation absprechen wollte, um Esk zu trauern.
Die Menschlichen Wesen waren monogam … aber es herrschte ein Frauenüberschuss. Also ergibt Monogamie keinen Sinn, sagte Dura sich, und trotzdem praktizieren wir sie. Zumindest in der Theorie.
Esk hatte sie beide geliebt … auf jeden Fall hatte er ein zärtliches Gefühl für beide verspürt. Und aus seinem Verhältnis mit Dura hatte er weder Philas gegenüber noch den anderen ein Hehl gemacht. Philas hatte sicher keinen Schaden dadurch erlitten.
Vielleicht würden sie sich nun gegenseitig helfen, sagte Dura sich. Vielleicht würden sie sich sogar einmal umarmen. Aber sie würden nie darüber sprechen.
Und sie, Dura, durfte nicht einmal öffentlich um Esk trauern.
»Was sollen wir nun tun, Dura?«, fragte Philas schließlich. »Sollen wir das Netz reparieren? Was sollen wir tun?«
Beim Blick in die leeren Augen der Frau hätte Dura sich am liebsten in sich selbst verkrochen und sich hinter der Trauer um ihren Vater und Esk verschanzt, nur um der Konfrontation mit Philas auszuweichen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Woher sollte ich es auch wissen?
Aber sie hatte keine Wahl. Sie musste sich der Realität stellen.
2ZEHN MENSCHLICHE WESEN – Dura mit Farr im Schlepptau, Adda, die Witwe Philas und sechs weitere Erwachsene – entfernten sich von der Position des verwüsteten Lagers. Auf der Suche nach Nahrung schwammen sie durch das Magfeld Richtung der Kruste.
Wie üblich bildete Adda die Nachhut, während sie die Feldlinien kreuzten. Ein Auge war mit den Narben des Alters bedeckt – wo ihm nun dieser Gedanke kam, stocherte er mit einem Finger in der Augenhöhle herum, um die ungebetenen kleinen Gäste, die sich ständig dort einnisten wollten, zu vertreiben –, doch das andere Auge war noch intakt, und beim Schwimmen suchte er die Luft über sich ab. Er bildete immer die Nachhut, um sich ein Bild von der Lage zu machen … außerdem kaschierte er dadurch die Tatsache, dass es ihm manchmal schwerfiel, mit den anderen mitzuhalten. Er prahlte ständig damit, dass er immer noch ein so guter Schwimmer sei wie die Jungen. Das stimmte natürlich nicht, aber er behauptete es eben. Früher hatte er sich mit der Geschmeidigkeit eines von einer Neutrinoquelle beflügelten Luft-Ferkels durch das Magfeld bewegt, doch das war schon lange her. Heute war er so steif wie eine Xeelee-Großmutter. Im Lauf der Zeit hatten Addas Wirbel sich verschoben, so dass es nun den Anschein hatte, er würde zum Schlag ausholen, anstatt Schwimmbewegungen auszuführen; es bedurfte einer bewussten Anstrengung, das Becken zurückzustoßen, die Beinarbeit mit dem Hüftschwung zu synchronisieren und den Kopf als ›Spoiler‹ einzusetzen, so dass sich bei der Krümmung des Rückgrats eine aerodynamische Bewegung ergab. Die Haut war durch das Alter so zäh wie Baumrinde geworden; das hatte durchaus seine Vorteile, aber es bedeutete auch, dass seine Sensibilität für die Stellen im Magfeld, an denen die stärksten Ströme in der Epidermis induziert wurden, beeinträchtigt wurde. Verdammt, er spürte das Magfeld nicht einmal mehr, sondern er führte die Schwimmbewegungen nur noch rein mechanisch aus.
Das gleiche galt dieser Tage auch für den Sex.
Wie immer hatte er seinen abgenutzten, bewährten Speer bei sich, einen angespitzten Stab, den sein Vater vor Hunderten von Monaten aus einem Baumstamm herausgebrochen hatte. Die Finger schlossen sich um die Griffmulden des perfekt ausbalancierten Schafts, und die elektrischen Ströme, die das Magfeld im Holz induzierte, kitzelten die Handfläche. Wie sein Vater ihn gelehrt hatte, hielt er den Speer beim Klettern parallel zu den Feldlinien des Magfelds … denn das Holz – wie überhaupt jedes Material – war parallel zu den Feldlinien solider, als wenn es sie geschnitten hätte. Und wenn Gefahr im Verzug war, dann kam sie mit größter Wahrscheinlichkeit entlang der Linien des Magfelds, wo die Fortbewegung am leichtesten war. Jedes Kind wusste das.
Es gab zwar nicht viele Räuber, die Menschen angriffen, aber Adda hatte immerhin schon einige gesehen, und sein Vater hatte ihm noch schlimmere Geschichten erzählt. Zum Beispiel die Rochen … bereits ein ausgewachsener Luft-Eber – ein größerer Verwandter des Luft-Schweins – war für einen Mann oder eine Frau ein ernstzunehmender Gegner, und ein Kind schleppte er gar mit der gleichen Leichtigkeit davon, als ob er Krypton-Gras von der Kruste abfraß, wenn der Hunger ihn dazu trieb.
Das tat er schon, wenn er nur halb so hungrig war, wie die Menschlichen Wesen es bald sein würden.
Adda betrachtete den Käfig aus glühenden Feldlinien, die sich bis zum unendlich weit entfernten, von rotem Dunst verhüllten Südpol erstreckten und die den Himmel, in dem seine Gefährten sich bewegten, durchschnitten. Wie immer – selbst wenn er sich nur ein kurzes Stück von der illusionären Abgeschlossenheit des winzigen Lagers der Menschen entfernte – wurde er von der schieren Größe der Mantel-Welt überwältigt; und als sein Blick den in der Unendlichkeit zusammentreffenden parallelen Feldlinien folgte, kam es ihm so vor, als ob sein winziges Bewusstsein an diesen Linien entlanggezogen würde. Die Insel aus Schutt, welche die Position des zerstörten Lagers markierte, nahm sich aus wie ein Schmutzfleck auf der sauberen, weißgelben Decke aus Licht, die der Stern über die Welt breitete. Und seine Gefährten – es waren noch immer neun, wie er auf einen Blick erkannte – schwammen mit unbewusst synchronisierten Bewegungen im Feld; sie hatten Seile und Netzreste um die Hüften geschlungen und den Blick nach oben, zur Kruste gerichtet. Ein Mann hatte sich von den anderen abgesetzt; er hatte ein an den Feldlinien befestigtes, verlassenes Netz einer Spin-Spinne gefunden und suchte es nach Eiern ab.
Die Bewegung der Menschlichen Wesen war überaus ästhetisch. Und wenn eine Kinderschar im Magfeld herumtobte – wobei sie so heftig paddelten, dass man das Glühen der in den Beinen induzierten Felder sah und so schnell um die Flusslinien wirbelten, dass ihre Gestalten verschwammen –; nun, dann glaubte man kaum, dass es in dieser oder einer der legendären Welten der Ur-Menschen einen schöneren Anblick gab.
Doch gleichzeitig wirkten die Menschen so klein und hilflos vor dem Hintergrund des Feldlinien-Käfigs und den tödlichen Mysterien des tief unter ihnen liegenden Quantenmeeres. Ein Luft-Schwein hingegen passte irgendwie hierher, sagte er sich. Rund und fett und kompakt … es war sogar imstande, den Ausbruch eines Neutrino-Geysirs zu überstehen; dazu musste es nur die Stielaugen einfahren, die Flossen anlegen und den Sturm abreiten. Was konnte ihm schon zustoßen, solange es nicht gerade aus dem Stern geschleudert wurde? Und wenn der Sturm sich dann gelegt hatte, fuhr das Schwein einfach wieder die Augen aus, entfaltete die Flossen und widmete sich erneut der Nahrungssuche – denn ein Baum war ein Baum, in welchem Abschnitt der Kruste er auch wuchs. Oder es paarte sich, sagte Adda sich und grinste.
Die Menschen waren anders. Die Menschen waren zart. Sie waren nicht sehr widerstandsfähig. Er dachte an Esk: er war ein verdammter Narr gewesen, aber trotzdem hatte er einen solchen Tod nicht verdient. Und, was am schwersten wog, die Menschen waren fremd. Wenn Adda einen dieser lästigen Parasiten aus der Augenhöhle geholt und ihn näher betrachtet hätte, dann hätte er das gleiche Grundmuster wie beim Durchschnitts-Luft-Schwein festgestellt: sechs symmetrisch angeordnete Flossen, eine Ansaugöffnung an der Vorderseite, mehrere Austrittsöffnungen an der Rückseite und sechs winzige Augen. Alle Mantel-Tiere besaßen die gleiche Struktur, nur dass sie hinsichtlich der Größe oder der Proportionen variierten; die gemeinsamen Merkmale waren sogar noch bei Tieren wie den Rochen zu erkennen, die auf den ersten Blick einer anderen Gattung anzugehören schienen …
… bis auf die Menschen. Es gab kein Wesen in dieser weiten Welt, das Ähnlichkeit mit einem Menschen gehabt hätte.
Andererseits war das auch kein Wunder. Schon mit der Muttermilch sogen die Kinder das Wissen ein, dass die Ur-Menschen von einem weit entfernten Ort gekommen waren, der natürlich viel besser gewesen war als dieser hier. Adda vermutete, dass die Menschen auf allen Planeten in diesem Glauben aufwuchsen – und dass man Kinder hierher gebracht hatte, damit sie sich in einer schwierigen Umwelt bewährten und sich eines Tages wieder der menschlichen Gemeinschaft anschlossen, unter dem gütigen Blick dieses multiplen und abstrakten Gottes, den Xeelee.
Also hatte man die Menschlichen Wesen hier ausgesetzt. Adda zweifelte nicht am Wahrheitsgehalt der alten Geschichte – verdammt, allein der Formationsflug der Menschen war der beste Beweis –, doch andererseits, so sagte er sich, während er den Flug der Menschlichen Wesen am Himmel verfolgte, wollte er gar nicht die Statur eines Luft-Schweins haben. Fett und rund und von Winden angetrieben.
In dieser Disziplin hatte er mit zunehmendem Alter indes eine beträchtliche Routine erlangt. Vielleicht wäre ein Dasein als Luft-Schwein doch nicht so schlecht gewesen.
Adda war das älteste Menschliche Wesen. Er wusste durchaus, was die anderen von ihm hielten: dass er ein griesgrämiger alter Narr sei, der noch einmal an seiner eigenen Muffigkeit ersticken würde. Doch das kümmerte ihn nicht weiter. Schließlich war es kein Zufall, dass er all seine Altersgenossen überlebt hatte. Dennoch war er nur ein schlicht strukturierter Mensch, der nicht mit den Führungsqualitäten und der Eloquenz eines, sagen wir, Logue gesegnet war. In dieser Hinsicht reichte er nicht einmal an Dura heran, sagte er sich, auch wenn sie sich dessen bisher vielleicht noch nicht bewusst geworden war. Dafür nervte er die Leute mit Anekdoten aus seiner Jugend. Sollten sie ruhig über ihn lachen; solange sie auch nur eine der Lektionen beherzigten, die ihm beim Überleben geholfen hatten, war Adda zufrieden.
Natürlich gab es auch Episoden, die er mit niemandem teilte. So stand es für ihn zum Beispiel außer Frage, dass die Störfälle eine neue Qualität erlangt hatten.
Störfälle, Spin-Stürme, hatte es immer schon gegeben. Ihm waren, auf abstrakter Ebene, sogar die Gründe für ihre Entstehung bekannt: die Verlangsamung der Rotation des Sterns und der daraus folgende explosive Ausgleich der Spin-Energie. Doch in den letzten Jahren hatte die Intensität der Störfälle ständig zugenommen … wie auch ihre Häufigkeit.
Die Störfälle hatten nun andere Ursachen. Titanische Kräfte zerrten am Stern …
Sein skurriles Verhalten hatte indes einen Vorteil, den er sich selbst nur halb eingestanden und den anderen gegenüber schon gar nicht geäußert hatte. Hinter der düsteren Fassade versteckten sich nämlich die grenzenlose Liebe, die er beim Anblick des wunderschönen Fluges durch das Magfeld für seine Mitmenschen fühlte und der Herzschmerz, den er beim Verlust selbst des nutzlosesten Lebens empfand.
Adda umklammerte den Speer und schwamm mit neuer Energie der Kruste entgegen.
Farr schwebte mit angezogenen Knien in der Luft. Mit einigen kräftigen Stößen entleerte er den Darm. Er sah, wie die fahlen, geruchlosen Kotkügelchen sich funkelnd in der Luft verteilten und dem UnterMantel entgegenstrebten. Der mit Neutronen gesättigte Kot würde in den lebensfeindlichen UnterMantel eintauchen und schließlich im Quantenmeer versinken.
So weit oben war er noch nie gewesen.
Die Wipfel der Bäume waren nur noch wenige Schwimm-Minuten entfernt, vielleicht ein Dutzend Mannhöhen. Die runden, bronzefarbenen Blätter der Bäume waren auf das Quantenmeer gerichtet und bildeten ein glitzerndes Dach, das die Welt überspannte. Beim Schwimmen schaute er sehnsüchtig zur Decke empor, als ob die Blätter Sicherheit versprächen – und gleichzeitig war er nervös. Denn hinter den Blättern, in der Dunkelheit, befanden sich die Baumstämme, und hinter den Baumstämmen war die Kruste, auf der sich alles mögliche Getier tummelte … zumindest, wenn man Adda und einigen Kindern Glauben schenken wollte.
Dennoch wäre er lieber dort oben zwischen den Bäumen, sagte Farr sich, als hier draußen zu hängen.
Er stieß sich am Magfeld ab und flog weiter.
Trotz seiner Jugend war die Furcht für Farr ein alltäglicher Begleiter. Er hatte sogar schon Todesangst verspürt. Doch die Angst, die ihn nun überkam, hatte eine neue Qualität; er setzte sich mit ihr auseinander und versuchte sie zu ergründen.
Die neun Erwachsenen schwammen mit gleichmäßigen Stößen nach oben, wobei die Gesichter den Bäumen zugewandt waren. Die Körper bewegten sich effizient, jedoch mit unterschiedlicher Eleganz; Farr roch die Photonen, die sie ausdünsteten und hörte ihren rhythmischen Atem. Sein eigener Atem ging schnell; die Luft hier oben war dünn. Und trotz der intensiven Schwimmbewegungen wurde ihm kalt.
Ohne dass es ihm bewusst geworden wäre, war Farr ins Zentrum der Gruppe gelangt, so dass die Menschen nun einen Schutzwall um ihn bildeten. Dann bemerkte er, dass er dicht neben seiner Schwester Dura schwamm, als ob er ein kleines Kind wäre, das an die Hand genommen werden wollte.
Wie peinlich.
Damit es nicht gar zu offensichtlich wurde, beugte er sich leicht nach vorne, so dass er auf den Rand der Gruppe zuglitt und sich von Dura entfernte. Dort angekommen, überkam ihn erneut diese Angst – eine Art Platzangst. Kopfschüttelnd, als ob er einen Luftaustausch vornehmen wollte, wandte er sich von der Gruppe ab und drehte sich in der Luft, so dass er nun den Mantel im Blick hatte.
Farr wusste, dass der Mantel einen Durchmesser von vielen Millionen Mannhöhen hatte. Aber die Menschen konnten nur in einem Abschnitt mit einer Höhe von ungefähr zwei Millionen Mannhöhen überleben. Farr wusste auch weshalb … oder zumindest wusste er teilweise Bescheid. Die komplexen Verbindungen schwerer Zinnkerne, aus denen sein Körper bestand (so hatte sein Vater es ihm erklärt), waren nur in diesem Sektor stabil, wo die durch den Austausch von Neutronenpaaren bewirkten Bindungskräfte Bestand hatten. Es hatte mit der Neutronendichte zu tun: zu weit oben gab es zu wenig Neutronen, um die komplexe Bindung zwischen den Atomkernen zu unterstützen; zu weit unten, im mit Neutronen gesättigten UnterMantel, gab es zu viele Neutronen – dort würden die Atomkerne, aus denen sein Körper bestand, sich zu einer Neutronenflüssigkeit auflösen.
Und hier – in der Nähe der Baumkronen, in der Randzone des Habitats – befand er sich mehrere zehntausend Mannhöhen oberhalb der Position des zerstörten Netzes.
Farr schaute nach unten und überblickte den Weg, den sie genommen hatten. Die Feldlinien durchschnitten den weiten Himmel; es waren Hunderte von parallelen, weißblauen Strahlen, die in der Ferne in nebligen Fluchtpunkten zusammentrafen. Die Feldlinien verschwammen unter ihm, und die Abstände zwischen ihnen verkürzten sich perspektivisch, bis die Linien schließlich in einem strukturierten blauen Dunst über dem Quantenmeer miteinander verschmolzen. Das tödliche Meer selbst lag purpurfarben unterhalb der Feldlinien; die Oberfläche war von Dunst verhüllt.
… Und die Oberfläche des Meeres war nach unten gekrümmt.
Farr musste schlucken, um einen Schrei zu unterdrücken. Dann schaute er wieder auf das Meer und sah, dass es in alle Richtungen leicht abfiel; es bestand kein Zweifel daran, dass er eine große Kugel betrachtete. Sogar die Feldlinien krümmten sich leicht, während sie auf die Horizonte des Meeres zuliefen. Es hatte den Anschein, dass sie das Meer wie ein Käfig umschlossen.
Farr war in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass die Welt – der Stern – eine vielschichtige Kugel darstellte, einen Neutronenstern. Die Kruste war die Oberfläche der Kugel; das Quantenmeer war der unzugängliche Mittelpunkt; und der Mantel, einschließlich des menschlichen Habitats, war die zwischen Kruste und Quantenmeer befindliche Luft-Schicht. Doch die Theorie war eine Sache; das Phänomen mit eigenen Augen zu sehen war eine andere.
Er war hoch oben. Und er spürte es. Er schaute in die Tiefe, in die Leere, die sich zwischen ihm und dem Meer erstreckte. Die Stelle, wo das Netz sich befunden hatte, war nur noch zu erahnen. Wenn die Überreste wenigstens noch zu sehen gewesen wären, hätte er etwas gehabt, woran er sich in dieser gigantischen Leere hätte festhalten können …
Woran hätte er sich festhalten sollen?
Plötzlich glaubte er, der Magen würde sich in Luft auflösen, und das Magfeld, in dem er emporkletterte, war nicht mehr nur unsichtbar, sondern es kam ihm fast nonexistent vor. Er hatte den Eindruck, sich im freien Fall zu befinden …
Er schloss die Augen und versuchte sich in eine andere Welt zu flüchten, in die Phantasien seiner Kindheit. Vielleicht wäre er noch einmal ein Krieger in den Kern-Kriegen, den epischen Schlachten mit den Kolonisten am Beginn der Zeit. Einst waren die Menschen stark und mächtig gewesen, mit magischen ›Wurmloch-Schnittstellen‹, mit denen sie Tausende von Mannhöhen in einem Schritt bewältigten, und sie hatten große Maschinen besessen, mit denen sie zu den Sternen und darüber hinaus flogen.
Doch die Kolonisten, die mysteriösen Bewohner vom Herzen des Sterns, hatten ihr schäbiges Reich verlassen, um Krieg gegen die Menschheit zu führen. Sie hatten die Schnittstellen und die übrige Technik zerstört oder gestohlen und hätten die Menschheit noch vom Antlitz des Mantels getilgt, wäre da nicht der listenreiche Farr gewesen: Farr der Ur-Mensch, der gigantische Gottes-Krieger …
Plötzlich spürte er eine Berührung an der Schulter; er schlug die Augen auf und erblickte – keinen Kolonisten –, sondern Dura, die mit einem bewusst ausdruckslosen Gesicht vor ihm schwebte. Sie wies nach oben. »Wir sind da.«
Farr schaute nach oben.
Blätter – von denen jeweils sechs zu symmetrischen ›Blüten‹ angeordnet waren – hingen direkt über seinem Kopf. Unmotivierte Dankbarkeit wallte in Farr auf, und er verschwand in der Dunkelheit hinter dem Laub.
Ein Ast, der ungefähr den Umfang seines Körpers hatte und aus pechschwarzem Holz bestand, führte in die von einem blauen Glühen durchdrungene Finsternis … nein, sagte er sich, es war genau umgekehrt; irgendwo dort oben war der Baumstamm, der aus der Kruste wuchs, und aus ihm wuchs der Ast, und aus diesem wuchsen wiederum die Blätter, die sich dem Meer zuwandten. Er strich über das Holz; es war hart und glatt, aber erstaunlich warm. Ein paar Zweige baumelten am Ast, und winzige Blätter drängten sich, dem Licht entgegenstrebend, zwischen ihre größeren ›Verwandten‹.
Er schlug die Arme um den Ast, als ob er den Arm seiner Mutter umklammerte. Das Holz wärmte seinen ausgekühlten Körper. Irgendwie war ihm das peinlich, doch er verdrängte dieses Gefühl wieder; Hauptsache, er war in Sicherheit.
Dura schlüpfte durch die Blätter und setzte sich neben ihn. Im Dämmerlicht zeichneten sich die Konturen ihres Gesichts ab. Sie lächelte ihn verlegen an. »Mach dir nichts draus«, sagte sie so leise, dass die anderen es nicht hörten. »Ich weiß, wie du dich fühlst. Mir ging es genauso, als ich zum ersten Mal hier oben war.«
Farr runzelte die Stirn. Zögernd stieß er sich vom Ast ab. »Wirklich? Aber ich habe den Eindruck, als ob … als ob ich vom Baum gezogen würde …«
»Es heißt ›vom Baum fallen‹.«
»Aber das ist doch lächerlich, nicht?« ›Fallen‹ bedeutete für Farr, wenn man beim Schwimmen im Magfeld den Halt verlor. Die Fallhöhe betrug jedoch höchstens ein paar Mannhöhen – aufgrund des, wenn auch minimalen, Luft-Widerstands und der in der Haut induzierten Ströme wurde man bald abgebremst. Ein völlig ungefährlicher Vorgang. Anschließend schwamm man einfach weiter.
Dura grinste. »Man hat den Eindruck …« – sie zögerte – »… als ob man vom Baum abrutschte, im freien Fall durch das Magfeld stürzte und schließlich im Meer versänke. Und bei dieser Vorstellung dreht sich einem der Magen um.«
»Genauso ist es«, sagte er, wobei er sich über ihre präzise Beschreibung wunderte. »Aber was hat das zu bedeuten? Weshalb haben wir dieses Gefühl?«
Achselzuckend zupfte sie an einem Blatt. Mit einem schmatzenden Geräusch löste sich das schwere, fleischige Blatt vom Ast ab. »Ich weiß es nicht. Logue sagte, es sei tief in uns drin. Ein Instinkt, über den die Menschen schon verfügten, als sie zu diesem Stern gebracht wurden.«
Farr dachte darüber nach. »Muss wohl mit den Xeelee zu tun haben.«
»Vielleicht. Oder mit noch älteren Wesen. Wie dem auch sei, es ist nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Hier.« Sie hielt ihm das Blatt hin.
Vorsichtig ergriff er es. Das handtellergroße, bronzefarbene Blatt war von radialen purpurnen und blauen Linien durchzogen. Es war elastisch und warm wie das Holz, schien sich indes nach der Trennung vom Ast schnell abzukühlen. Er drehte es um und berührte es mit der Fingerspitze; die Unterseite war trocken und geschwärzt. Er schaute zu Dura hoch. »Danke«, sagte er. »Aber was soll ich damit?«
»Vielleicht ist es essbar«, sagte sie lachend.
Nachdem er ihr Gesicht gründlich gemustert hatte, um sich zu vergewissern, dass sie keinen Witz gemacht hatte – normalerweise veralberte Dura ihn nicht; dazu war sie nämlich zu ernsthaft … aber man wusste ja nie –, führte Farr das Blatt zum Mund und biss hinein. Die Masse war weich und schien geradezu auf der Zunge zu zergehen, doch sie schmeckte erstaunlich gut, wie das Fleisch eines Luft-Ferkels; und dann stopfte Farr sich das Blatt in den Mund.
Nach wenigen Sekunden hatte er es verzehrt und leckte sich genießerisch die Lippen. Das Blatt war ein wohlschmeckender, aber leichter Imbiss gewesen und hatte seinen Hunger nur verstärkt. Suchend schaute er sich um. Hier oben auf der Baumkrone hatten die Blätter sich nach unten zum Quantenmeer