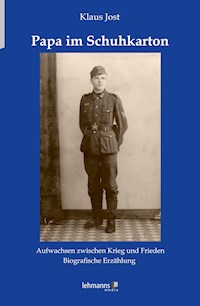Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Bedarf an der Begutachtung von Straftätern wächst. Insbesondere spektakuläre Fälle erwecken ein breites öffentliches Interesse. In diesem Buch geht es in der Darstellung von Strafrechtsfällen psychologischer Begutachtungspraxis (z. B. Kindesmisshandlung, Tötungs- und Sexualdelikte) nicht nur um die Frage nach der Schuldfähigkeit, sondern auch darum, einen Zugang zu den Handlungsweisen von Tätern zu eröffnen. Damit wird das mitunter zunächst Unfassbare greifbarer. Erfahrungsgemäß ist dies für alle am Verfahren Beteiligten hilfreich. Das Buch ist auch für psychologische Laien geeignet, da es für sie die notwendigen Hintergrundinformationen bereitstellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Bedarf an der Begutachtung von Straftätern wächst. Insbesondere spektakuläre Fälle erwecken ein breites öffentliches Interesse. In diesem Buch geht es in der Darstellung von Strafrechtsfällen psychologischer Begutachtungspraxis (z. B. Kindesmisshandlung, Tötungs- und Sexualdelikte) nicht nur um die Frage nach der Schuldfähigkeit, sondern auch darum, einen Zugang zu den Handlungsweisen von Tätern zu eröffnen. Damit wird das mitunter zunächst Unfassbare greifbarer. Erfahrungsgemäß ist dies für alle am Verfahren Beteiligten hilfreich. Das Buch ist auch für psychologische Laien geeignet, da es für sie die notwendigen Hintergrundinformationen bereitstellt.
Dr. phil. Klaus Jost arbeitete viele Jahre an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Frankfurt am Main. Er ist Fachpsychologe für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Rechtspsychologie sowie als Dozent für Psychologie in der Erwachsenenbildung tätig.
Klaus Jost
Forensisch-psychologische Begutachtung von Straftätern
Ausgewählte Problemfelder und Falldarstellungen
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2008
Alle Rechte vorbehalten © 2008 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN 978-3-17-019676-6
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-022754-5
epub:
978-3-17-028082-3
mobi:
978-3-17-028083-0
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Willensfreiheit, eine Illusion? Eine alte und neue Kontroverse – die Frage nach der Verantwortlichkeit
2 „Normal“, „abnorm“, „gestört“, „verrückt“, „gesund“, „psychisch krank“ – was heißt das eigentlich?
3 Beurteilung der Schuldfähigkeit – mögliche Konsequenzen
3.1 Schuldfähigkeitsrelevante Merkmale
3.2 Maßregeln – Unterbringung und Sicherung
4 Begutachtung
4.1 Die Begutachtungssituation – Beziehung zwischen Gutachter und Proband
4.2 Voraussetzungen für eine sach- und personengerechte Begutachtung
4.3 Zur Validität von Gutachtenaussagen und -beurteilungen
4.3.1 Diagnostische Validität
4.3.2 Validität von Einschätzungen zur Schuldfähigkeit
4.3.3 Validität von Prognosen
5 Ausgewählte forensische Problemfelder und Darstellungen von Gutachtenfällen
5.1 Delinquentes Verhalten erklären und beurteilen oder Straftäter „wegsperren für immer“?
5.2 Ein Mann, der mehrere Dutzend Einbruchdiebstähle begeht, „einem Drang folgend“
5.3 Pathologische und gewohnheitsmäßige Spieler
5.3.1 Ein wegen Betrugs und Unterschlagung Angeklagter mit fraglicher Spielsucht
5.3.2 Ein wegen Bandendiebstahls pp. angeklagter „Berufsspieler“
5.3.3 Ein Bankräuber mit fraglicher Spielsucht
5.4 Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen
5.4.1 Zur Glaubhaftigkeit der Aussagen eines Mannes, der Jahre später als Zeuge angibt, zur Erhellung der bislang ungeklärten Tötung zweier Personen beitragen zu können
5.5 Zur Sozialprognose eines wegen Raubes pp. zu mehrjähriger Freiheitsstrafe und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilten Mannes
5.6 Misshandelnde Eltern – Sadisten oder in der Erziehung überfordert?
5.6.1 Eine wegen Kindesmisshandlung angeklagte Mutter
5.6.2 Ein wegen Kindesmisshandlung angeklagter Vater
5.7 Gewalttäter – einfach nur brutale Menschen?
5.7.1 Die Erwachsenenreife und Schuldfähigkeit eines Zwanzigjährigen, dem versuchter Totschlag zur Last gelegt wird
5.7.2 Ein junger Erwachsener, der beschuldigt wird, eine Bekannte seiner Freundin getötet zu haben
5.8 Sexualstraftäter – Monster oder Patienten?
5.8.1 Die Schuldfähigkeit und Gefährlichkeit eines wegen wiederholten (versuchten) sexuellen Missbrauchs von Jungen angeklagten Mannes
5.8.2 Die Schuldfähigkeit eines jungen Erwachsenen, dem versuchte Vergewaltigungen von zwei Mädchen und zwei Frauen zur Last gelegt werden
6 Ausblick
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Der Mensch ist weder gut noch böse.Eine realistische Auffassung sieht in beidenMöglichkeiten reale Potentiale und untersuchtdie Bedingungen, unter denen sie sich jeweils entwickeln. Erich Fromm
Ich wusste früher wenig über die Psychologie desMordes – so gut wie gar nichts –, aber ich wusstedoch genug von der menschlichen Natur, um zu wissen,dass Mörder keine glücklichen Menschen sein können. Paul Moor
Die vorgelegte Schrift ist kein Lehrbuch, womit auch Beschränkungen in der herangezogenen Literatur gerechtfertigt werden können. Es handelt sich gleichwohl um ein Fachbuch mit dem Schwerpunkt forensischer Falldarstellungen. Dieses gibt einen Teil der mehrere Jahrzehnte langen Erfahrung des Autors in der psychologischen Begutachtung von Personen wieder, die unterschiedlichster Straftaten beschuldigt wurden. Bei den mitgeteilten Fällen geht es vorwiegend um Beurteilungen des möglichen Vorliegens psychischer Störungen, die in ihren Auswirkungen die Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit von Beschuldigten zum Tatzeitpunkt betreffen können, sodass Gerichte gegebenenfalls von einer eingeschränkten oder gar aufgehobenen Schuldfähigkeit ausgehen müssen. Vor allem bei schwerwiegenden Delikten stellt sich dem Gutachter auch die Frage zukünftiger Kriminalprognose. Wenn sich in den Falldarstellungen überwiegend männliche Täter finden, so entspricht dies durchaus dem Faktum, dass Männer im Vergleich zu Frauen häufiger als Straftäter in Erscheinung treten, etwa in einer Relation von 10:1.
Gleichsam als inhaltliche Prämissen für die Tätigkeit der psychologischen Beurteilung von Straftatbeschuldigten erfolgen eingangs Erörterungen zur neurobiologisch infrage gestellten Willensfreiheit des Menschen, zu Wandlungen von Begriffs- und Urteilskategorien (z.B. des „Normalen“ und „Abnormen“), zu den strafrechtlich relevanten Schuldfähigkeitsmerkmalen sowie zur Begutachtungssituation selbst mit ihren zu fordernden persönlichen und methodischen Voraussetzungen. Die daran anschließenden Darstellungen ausgewählter Gutachtenfälle sind zum besseren Verständnis in einzelne Problemfelderörterungen eingebettet, die im Sinne knapper Abrisse keineswegs erschöpfend sind, aber notwendige Hintergrundinformationen liefern sollen. Die Gutachten der anonymisierten Fälle sind überarbeitet und auf das inhaltlich Wesentliche erheblich gekürzt, ohne dabei an Authentizität einzubüßen. Ihre Darstellung verzichtet auf sehr detaillierte Befundmitteilungen (insbesondere bei psychopathologisch irrelevanten sog. „Normalbefunden“), auch auf die Präsentation von einzelnen (z.B. numerischen) Kennwerten aus der Durchführung psychologischer Testverfahren. Insofern handelt es sich auch nicht um Beispielgutachten, wie sie für die Forensische Psychiatrie von Nedopil und Krupinski (2001) vorgelegt wurden. Mit forensischen Falldarstellungen setzt man Begutachtungsergebnisse der Kritik durch Leser und Fachleute aus. Sicher wird der eine oder andere manches vielleicht anders sehen können oder gewisse Schlussfolgerungen und Einordnungen so nicht treffen. Dies liegt in der Natur der Sache und entspricht dem Umstand, dass trotz allen Bemühens um Objektivität das Gutachtenergebnis nicht völlig frei von subjektiver Sichtweise und Einflussnahme ist. Ganz überwiegend geht es dem Autor in den Falldarstellungen darum, neben der Beantwortung forensischer Fragestellungen einen erklärenden Zugang zu den von Menschen begangenen Straftaten zu ermöglichen. Hierin liegt auch das Besondere der psychologischen Begutachtung von Straftatbeschuldigten, sich nicht allein auf die Feststellung möglicher psychischer Störungen zu beschränken, sondern die Täterpersönlichkeit, deren Entwicklung und einen möglichen dynamischen Zusammenhang mit dem einzuschätzenden Tatgeschehen herzustellen. Allein dadurch wird häufig erst ein erklärender Zugang zu dem mitunter zunächst Unfassbaren möglich.
Einzig aus Gründen der Erleichterung des Schreibens und der Lesbarkeit des Textes erfolgt – abgesehen von Falldarstellungen – in der Bezeichnung von Personen eine Beschränkung auf die männliche Form. Selbstverständlich beziehen sich Ausführungen ebenso auf Gutachterinnen, Diagnostikerinnen, Therapeutinnen und Straftäterinnen. Der Autor bittet um Verständnis und Nachsicht der Leserinnen.
Für die engagierte und ermutigende Unterstützung in der Realisierung des Buchprojekts möchte der Unterzeichner insbesondere Herrn Dr. Ruprecht Poensgen sowie Frau Alina Piasny vom Kohlhammer-Verlag herzlich danken.
Seligenstadt, im Herbst 2007
Klaus Jost
1 Willensfreiheit, eine Illusion? Eine alte und neue Kontroverse – die Frage nach der Verantwortlichkeit
Auch delinquentes menschliches Verhalten zu verstehen und zu erklären, ist eine wichtige Aufgabe psychologischer Diagnostik und Begutachtung. Die Frage nach seiner Zurechenbarkeit hat sich mit der grundlegenden Kontroverse auseinanderzusetzen, ob menschliches Verhalten einem freien Willen unterliegt oder determiniert ist. Mit dem zum Teil rasanten Fortschreiten naturwissenschaftlicher Erkenntnisse werden bekannte naturphilosophische Grundauffassungen neu diskutiert, infrage gestellt oder erfahren Unterstützung. So haben auch neurowissenschaftliche, speziell neurobiologische Befunde der Hirnforschung die Diskussion um Determinismus und Indeterminismus wiederbelebt. Determinismus beschreibt die naturphilosophische Grundauffassung oder Lehre, dass alle Vorgänge in der Welt ursächlich bestimmt sind. Nichts an Geschehen ist zufällig, es ist vielmehr notwendige Wirkung bestimmter Ursachen. Auf menschliches Verhalten übertragen sind es anlage- oder umweltbedingte (genetische, biologische, erlebnisbedingte) Faktoren, durch die das Verhalten festgelegt ist. Der Determinismus lässt der Spontaneität des Menschen keinen Raum. Verhalten und der Wille dazu sind determiniert, d. h. auch der Willensakt unterliegt äußeren oder inneren Ursachen. (Willens-)Freiheit und sittliche Verantwortlichkeit sind danach nicht möglich, sie werden geleugnet (ethischer Determinismus). Im Gegensatz dazu hat aus der Sicht des ethischen Indeterminismus der freie Wille zwar seinen Raum, unterliegt aber eher dem Zufall. Der handelnde Mensch verhielte sich danach wie ein Zufallsgenerator.
Wie kommen Hirnforscher dazu, Freiheit und freie Willensentscheidung zur Disposition zu stellen oder gar zu leugnen, sie als Illusion zu bezeichnen? Wie kommt es zu dieser neuerlichen, jetzt neurophilosophischen Diskussion, in der ein „neuronaler Determinismus“ (Schnädelbach, 2004) vertreten wird mit allen Konsequenzen für Verbindlichkeiten von Moral und Schuld, sodass Michel Friedman in Bearbeitung seines Promotionsthemas „Konsequenzen der neurobiologischen Forschung für den Schuldbegriff des Strafrechts“ vermutlich eher in provokanter Weise die Forderung aufstellt: „Wir müssen den Schuldparagrafen des Strafrechts überdenken“ (Bender, 2006).
Zweifellos hat die Hirnforschung seit den 1990er Jahren geradezu revolutionäre Fortschritte zu verzeichnen, nicht zuletzt durch die Bereitstellung neuer technischer Möglichkeiten bildgebender Verfahren wie Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), die über die Elektroenzephalographie (EEG) hinausgehend eine genaue Lokalisierung von Aktivitäten im gesamten menschlichen Gehirn möglich machen. Wir wissen heute sehr viel mehr über Funktionen des Gehirns als noch vor zehn Jahren. Nicht wenige Fragen, denen sich die Hirnforschung zuwendet, berühren auch die Interessen anderer Wissenschaften, z. B. der Neuro-Psychologie, die sich bislang eher mit den Folgen von Hirnschädigungen auf das menschliche Verhalten befasste. Man erhofft sich jetzt u. a. Klärungen oder zumindest Fortschritte im Verständnis menschlicher Ich- und Bewusstseinszustände. Man möchte mehr über Wahrnehmungsvorgänge und Handlungsplanungen wissen, wo und wie im Gehirn Emotionen und Affekte entstehen, wie Gedächtnis repräsentiert ist. Der Hirnforscher Gerhard Roth (2001a, b) stellt u. a. Fragen nach neurobiologischen Grundlagen psychischer Erkrankungen und deren therapeutischer Beeinflussbarkeit. In einem Brückenschlag von Hirnforschung und der Freudschen Psychoanalyse sucht Roth nach möglichen neurobiologischen Entsprechungen des sogenannten Unbewussten, er fragt, welche möglichen Faktoren das Ich determinieren, ob das Ich oder eher das Unbewusste das menschliche Erleben und Handeln bestimmt. Roth (2001b) spricht davon, dass Resultate und Einsichten der Hirnforschung „die Lehre Freuds in einigen wichtigen Punkten zu bestätigen scheinen“, u.a. darin, dass das unbewusste Erfahrungsgedächtnis unser Handeln stärker bestimme als das bewusste Ich. Nach Roth (2006) finden folgende drei Grundannahmen Freuds eine späte neurobiologische Unterstützung:
„Das Unbewusste kontrolliert das Bewusstsein stärker als umgekehrt.“
„Das Unbewusste oder ‚Es‘ entsteht vor dem Bewusstsein; es legt sehr früh die Grundstrukturen des Psychischen und des bewussten Erlebens, des ‚Ich‘ fest.“
„Das Ich hat keine oder nur geringe Einsicht in die unbewussten Determinanten des Erlebens und Handelns.“
Es fällt auf, dass in der Hirnforschung der Begriff des Unbewussten uneinheitlich verwendet wird. So werden z.B. die aufeinander abgestimmten Bewegungs- und Handlungsabläufe eines routinierten Autofahrers oder auch Bergsteigers der Instanz des Unbewussten oder des Unterbewussten zugeordnet. Eigentlich handelt es sich um ein ehemals bewusst eingeübtes und schließlich automatisiertes oder teilautomatisiertes Geschehen. Auch das im Millisekundenbereich liegende Vorbereitungsintervall einer nach Reizexposition bewussten Wahrnehmung oder Handlung dem Unbewussten zuzuordnen, erscheint problematisch. Es mehren sich deshalb Stimmen, die eine Aufwertung der Psychoanalyse jedenfalls durch die Hirnforschung sehr kritisch sehen, ihr auch keinen Erkenntniswert in der Aufklärung des Unbewussten zusprechen. So äußert der Psychoanalytiker Tilmann Habermas (2006, S. 40): „In letzter Zeit sprechen manche … von einer Renaissance der Psychoanalyse durch die Ergebnisse der Hirnforschung, da diese endlich die von der Psychoanalyse behaupteten unbewussten psychischen Prozesse belegt habe. Dabei hat die Beobachtung, dass im Gehirn bestimmte Areale besser durchblutet werden, kurz bevor die Person eine Entscheidung trifft, einen Gedanken hegt oder etwas fühlt, nichts mit Freuds Begriff des Unbewussten zu tun, in dem ein Gedanke im Unbewussten eine Dynamik entfaltet, weil er verdrängt wurde. Die Zukunft der Erforschung des Unbewussten liegt nicht im Gehirn ….“
Was hat das Ganze mit der Frage zu tun, ob es den freien Willen gibt oder nicht? Nach der Befundlage neurobiologischer Experimente ist in der Tat davon auszugehen, dass unsere subjektiven Erfahrungen, unsere Wahrnehmungen, unser Denken, Fühlen, unsere Willensakte durch ihnen unmittelbar vorausgehende, ca. 300–500 Millisekunden beanspruchende zerebrale Verarbeitungsprozesse vorbereitet werden. Das heißt, das subjektive Erleben tritt mit der genannten zeitlichen Verzögerung ein, es „hinkt den verursachenden Hirnprozessen um einige hundert Millisekunden hinterher“ (Grawe, 2004, S. 122). Einzelne Hirnforscher sehen genau hierin einen Beleg für die alleinige biologische Begründung menschlichen Verhaltens und die Unterstützung der These seiner Vorherbestimmtheit, wodurch die Beteiligung eines freien Willens als verhaltensbestimmende Einflussgröße auszuschließen sei (Soma-Psyche-Kontroverse). Sie gehen davon aus, dass wir nicht entscheiden, sondern unser Gehirn jeweils schon entschieden hat, bevor wir den subjektiven Eindruck haben, eine Handlungsentscheidung zu treffen. Heißt dies in der Konsequenz – wie die beiden Wissenschaftsjournalisten Siefer und Weber (2006) unter Bezug auf Wolfgang Prinz nahelegen – wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun? Dieser Gedanke provoziert, er erschüttert vielleicht auch unsere Sicht auf uns selbst. Grawe (2004, S. 44) stellt folgende Fragen in den Raum: „Können wir keinen noch so geheimen Gedanken denken, keine freie Willensentscheidung treffen, ohne dass diese durch ein spezifisches Muster neuronaler Erregungen in unserem Gehirn hervorgebracht würden?“ „Sollte Willensstärke nur auf der Übertragungsbereitschaft von Synapsen beruhen?“ Und er gibt gleich eine Antwort: „Das ist starker Tobak, den die Neurowissenschaften uns da zumuten.“ Nehmen wir ein alltägliches Beispiel: Wenn ich mich entscheide, zu Hause zu bleiben und mein Wohnzimmer zu renovieren, statt mich mit einem Freund zu treffen, was ich viel lieber täte, tue ich dies dann nur deshalb, weil im Frontalhirn entsprechende neuronale Gegebenheiten entstanden sind? Sicher nicht! Die Antworten der Neurowissenschaftler in diesem Kontext sind zu simpel, um einen komplexen Entscheidungsvorgang zu erklären. Menschliches Erleben und Verhalten ist zu vielschichtig, als dass es nur annähernd durch neurowissenschaftliche Beobachtungen des Gehirns mittels bildgebender Verfahren erklärt werden könnte. Das Gefühl der Freude z.B. ist mehr und etwas anderes als die Summe der daran beteiligten aktivierten Hirnareale. Es existiert keine Erklärung, wie aus physikalischen Ereignissen in den Nervenzellen emotionale oder geistige Erlebnisse entstehen. Die menschliche Person und ihre Identität lassen sich erst recht nicht neurowissenschaftlich verorten und beschreiben.1 Im Übrigen kann die heutige Neurowissenschaft der Komplexität des Gehirns nicht im Geringsten entsprechen. „Auch wenn das Gehirn deterministisch funktioniert, ist es in seiner Komplexität niemals vollständig beschreib- und verstehbar“ (Rösler, 2004, S. 32).2
Kommen wir zurück auf die hirnbiologischen Experimente, die in den Ergebnissen zeigen, dass unserem Handeln im Millisekundenbereich anzusiedelnde zerebrale Verarbeitungsprozesse vorausgehen. Es mag verunsichern, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die das Handeln, Denken, Fühlen vorbereitenden Hirnprozesse unbemerkt, unbewusst ablaufen und wir darüber auch keine Kontrolle haben. Nichtsdestoweniger gehören diese zerebralen Verarbeitungsprozesse dem jeweils denkenden oder handelnden Menschen an, niemandem sonst! Auch „handelt“ das Gehirn nicht von sich aus. Wie könnte es von Bedürfnissen, Wünschen und unmittelbaren Absichten erfahren, wenn nicht durch die Person, in der es sich befindet? Die dem Handeln gerade eben vorausgehenden Hirnprozesse sind bereits Bestandteile des Willensaktes (Entschlusses), der mit dem subjektiven Erleben nicht eingeleitet, sondern abgeschlossen wird (vgl. Grawe, 2004). Grawe (2004, S. 122f.) führt aus: „Wenn ich die vorbereitenden Prozesse als ebenso zu mir gehörig betrachte wie mein bewusstes Erleben, dann bin immer noch ich es, der die Entscheidungen trifft. Mein Selbst, meine Persönlichkeit besteht eben aus impliziten (unbewussten) und expliziten (bewussten) Anteilen. Meine Willensentscheidungen werden mir nicht von irgendetwas Fremdem aufgezwungen. Die Determinanten meines Verhaltens sind meine eigenen Determinanten, auch so weit und so lange sie mir nicht bewusst sind. … In die Autorenschaft sind meine impliziten Anteile eingeschlossen.“
Zur Frage, wie frei Willensentscheide sind, gibt die Psychologie recht klare Antworten.3 Die Bedingungen unseres Denkens und Handelns sind zahlreich. Bestimmend sind bewusste und unbewusste, äußere und innere, körperliche und andere Determinanten, die wir auch als Dispositionen beschreiben können. Sowohl der Anteil als auch die Bedeutung unbewusster Determinanten werden hoch eingeschätzt. Sie nehmen – wie uns z.B. Werbung deutlich machen kann – Einfluss, bevor wir etwas davon wahrnehmen. Willensentscheidungen beeinflussende unbewusste Determinanten sind wesentlich auch über Erziehung vermittelte hohe Wert- und Zielvorstellungen. Ihre Stabilität garantiert nicht nur Konsistenz und Kontinuität des eigenen psychischen Haushalts, sondern auch Sicherheit im sozialen Umgang und Vorhersehbarkeit des Tuns des jeweils Handelnden. Aus all dem ergibt sich, dass die Freiheit in Willensentscheidungen relativ zur Person zu verstehen ist, nicht aber Beliebigkeit von Entscheidungen und Handlungen heißen kann. „Sobald ich akzeptiere, dass mein Selbst wesentlich mehr umfasst als das, was mir bewusst ist, kann ich auch akzeptieren, dass meine Entscheidungen in dem Moment, wo ich sie subjektiv fälle, schon festgelegt waren, nämlich durch die implizite Seite meines Selbst“ (Grawe, 2004, S. 123). Wir können also davon ausgehen, dass wie auch immer beeinflusste und bestimmte Willensentscheidungen von Menschen der jeweiligen Person angehören und dass diese Willensentscheidungen in den der Person gegebenen Grenzen auch frei sind. Subjektiv erfahren Menschen diese Freiheit auf verschiedenen Ebenen, zum einen dadurch, dass sie sich als Autor des Handelns wahrnehmen, zum anderen in Situationen des Reaktions- und Handlungsaufschubs oder auch der Handlungsalternativen, die Menschen in die Lage versetzen, dieses oder aber auch etwas ganz anderes zu tun, vielleicht sogar keine der Handlungsalternativen zu wählen (Freiheitsbewusstsein).
Aus der Tatsache, dass implizite (unbewusste) wie explizite (bewusste) Handlungsanteile allein der in ihren Grenzen frei handelnden Person zuzuordnen sind, ist zu folgern, dass sie es ist, der ihr Tun zuzurechnen ist, wofür ihr dann auch die Verantwortung zukommt. Verantwortung ist an Regeln und Prinzipien orientiert und hat Adressaten. Das soziale Gefüge im Blick formuliert Kant („Kritik der praktischen Vernunft“) den kategorischen Imperativ, eine allgemeine und unbedingte Sollensvorschrift, nach der der Mensch sein Handeln ausrichten soll: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“
Verantwortung für sein Tun zu haben, schließt ein, dass ich gegebenenfalls schuldig werden kann, indem ich gegen gegebene Regeln und Prinzipien, die ein soziales Zusammenleben garantieren, verstoße. In der psychologischen und auch psychiatrischen Begutachtungssituation von Menschen, die gegen Gesetze verstoßen, geht es hierbei nicht um die moralische Dimension und Bewertung von Schuld, sondern vielmehr immer um die Frage, ob es Gründe gibt, die Menschen nicht oder nur eingeschränkt fähig machen, Schuld (Verantwortung) für ein bestimmtes gesetzeswidriges Handeln zu übernehmen. Unser Strafrechtssystem setzt die Willensfreiheit des Menschen gleichsam als Axiom voraus. Nur deshalb ist auch der allgemeine Schuldvorwurf legitim. Insofern steht auch nicht seitens der psychologischen oder psychiatrischen Sachverständigen die Begutachtung der Handlungsfreiheit eines Straftäters an, eher geht es in der Analyse des engeren und weiteren Tatgeschehens und seiner Determinanten um die Frage einer möglichen Einschränkung von Freiheitsgraden, „d.h., der Nachweis von Unfreiheit ist eher möglich als der von Freiheit“ (Rasch & Konrad, 2004, S. 74). Der Sachverständige hat in der Beurteilung eines Straftäters und seiner Handlungen „bis zum Beweis des Gegenteils“ grundsätzlich von dessen Willensfreiheit auszugehen. In aller Regel werden die Freiheitsgrade auch nicht dadurch eingeschränkt, dass Motive strafbaren Handelns (in Teilen) als unbewusst einzustufen sind. Es ist weitgehend psychologischer Konsens, dass die unbewussten die bewussten Handlungsdeterminanten an Bedeutung übertreffen. Rasch und Konrad führen hierzu aus: „Es gilt, sich zu vergegenwärtigen, dass Handeln aus dem Unbewussten das Häufigere, das ‚Normale‘ und Alltägliche ist.“ Insofern ist auch nicht deshalb, weil ein strafbares Handeln u. a. unbewussten Motiven entspringt, die ja „ohne die Mitwirkung bewusstseinsnaher Instanzen der Persönlichkeit“ nicht handlungswirksam werden, dieses von vornherein zu exkulpieren (vgl. Rasch & Konrad, 2004, S. 203). Der Sachverständige hat in der Begutachtung von Tätern strafbarer Handlungen demnach stets systemimmanent von einer freien Willensbildung und der Zurechenbarkeit des Tuns auszugehen, jedenfalls so lange sich keine Anhaltspunkte ergeben, die eine Einschränkung oder gar Aufhebung der Schuldfähigkeit nahelegen.
1 Der Marburger Psychologieprofessor Frank Rösler äußert in einem Interview, in dem es um Fragen der neurobiologischen Unterstützung psychoanalytischer Annahmen geht: „Was wir bei der Bildgebung de facto sehen, ist nichts anderes als eine Veränderung der Durchblutung im Gehirn. Das ist alles. Was wir damit machen, ist eine Interpretation der Daten in Abhängigkeit von der Anordnung des Experiments“ (Sentker & Blumenthal, 2006).
2 Ähnlich äußert sich der frühere Leiter des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit Professor Fritz Henn in einem Interview in der Wochenzeitung „Die Zeit“ zu den hirnbiologischen Grundlagen menschlichen Verhaltens: „… wir müssen das System verstehen – und das tun wir noch lange nicht. Deshalb finde ich auch die deutsche Diskussion über den freien Willen etwas unsinnig. Sicher lässt sich die gesamte Hirnaktivität letztlich auf Moleküle zurückführen. Aber sicher ist auch, dass die Komplexität des Systems Gehirn ungeheuer groß ist. Und wie schwer solche Systeme zu durchschauen sind, wissen wir aus der Physik“ (Die Zeit Nr. 27, 29.06.2006).
3 Mit der Thematik der Freiheit oder des Determinismus des Willens hat sich freilich eingehend die Philosophie befasst und positioniert (s. z. B. Holzamer, 1990). Schnädelbach (2004) kritisiert denn auch, dass Hirnforscher, die einen „neuronalen Determinismus“ vertreten, nicht sachkundig sind und „souverän alles ignorieren, was zumindest in den letzten fünf Jahrzehnten philosophisch zu ihrem Thema gesagt wurde“. Die philosophische Tradition spricht davon, dass der Mensch ständig die Möglichkeit der Wahl besitzt, so oder anders zu handeln, von einem „Vermögen“ des freien Willens.
2 „Normal“, „abnorm“, „gestört“, „verrückt“, „gesund“, „psychisch krank“ – was heißt das eigentlich?
In einer dpa-Meldung vom Juli 2006 (Ärzte Zeitung, 25.07.2006), in der das Forschungsergebnis einer Studie berichtet wird, lautet die Überschrift: „Neun von zehn Häftlingen haben psychische Störungen“. In Printmedien finden sich Schlagzeilen wie „der kranke Messerstecher“, „das abnorme Sexmonster“, „der schizophrene Amokfahrer“. „Wenn ein besonders widerwärtiges Verbrechen geschieht, wenn bei einer Gewalttat kein Motiv zu erkennen – oder wenn es nicht nachzuvollziehen ist, wenn ein Gesetzesbrecher sich ‚uneinfühlbar’ verhält, konfrontiert uns die Boulevardpresse unweigerlich mit Schlagzeilen wie ‚irre Mörder‘, ‚gemeingefährliche Geisteskranke‘ oder ‚verrückte Sexualverbrecher‘“ (Finzen, 1996, S. 38). Ein Pressekommentar zum Urteil im Fall des „Kannibalen von Rotenburg“ trägt den Titel „Pervers und abartig“. Nicht wenige Meldungen über Straftäter sind mit Attribuierungen verbunden, die sich auch einer psychologischen oder psychiatrischen Terminologie bedienen.
Was heißt das aber, wenn wir Begriffe wie „normal“, „abnorm“, „gestört“, „verrückt“, „gesund“, „psychisch krank“ verwenden? Was meinen wir eigentlich, wenn wir beispielsweise von einem normalen sexuellen Verhalten, von einer normalen sexuellen Orientierung sprechen? Sollen wir es etwa als normal ansehen, wenn sehr viele, nämlich zigtausende von Menschen auf Internetseiten kinderpornographischen Inhalts zugreifen?
„Normal“ bedeutet etymologisch „der Norm, der Vorschrift entsprechend“, „gewöhnlich“, „allgemein üblich“, „durchschnittlich“, „geistig gesund“. „Abnorm“ steht für etymologische Varianten wie „nicht normal“, „gegen die Regel“, „ungewöhnlich“, „krankhaft“. Das Abnorme ist ebenso vielgestaltig wie die Norm, auf die es sich bezieht. So kann z.B. die Bezugnahme erfolgen auf eine
Statistische Norm (abnorm wäre dann das Ungewöhnliche),
Idealnorm (abnorm wäre dann das Verwerfliche),
Sozialnorm (abnorm wäre dann das Abweichende).
Wie unsicher oder auch nachdenklich wir werden können in der Einschätzung dessen, was wir als normal oder nicht normal ansehen, wird deutlich, wenn wir Situationen unter verschiedenen Kontextbedingungen beurteilen. Als der Dichter Christian Friedrich Hebbel 1853 ein Irrenhaus besuchte, notierte er in seinem Tagebuch: „Grauenvoll: Massen von Wahnsinnigen zu sehen, denn dadurch wird das Unnormale scheinbar wieder normal.“
Auch in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen tut man sich schwer mit dem Begriff des Abnormen, er wird immer wieder problematisiert. Der amerikanische Biologe und Sexualforscher Alfred Charles Kinsey (1894–1956) hat bekanntlich den Normalitätsbegriff deshalb in Zweifel gezogen, weil er bei seinen statistischen Erhebungen viele der in Lehrbüchern seinerzeit als abnorm, krank oder pervers bezeichneten sexuellen Verhaltensweisen in Bevölkerungsgruppen als sehr verbreitet feststellte.
Ein anderer Aspekt, weshalb die verschiedensten Begriffe aus den Bereichen klinisch-psychologischer und psychiatrischer Diagnostik, insbesondere solche, die Differenzen zum „Normalen“ und Defizite bezeichnen, problematisch erscheinen, liegt in ihrem Bedeutungswandel durch Übertritt in die Alltagssprache. Alltagssprachlich verwendet werden die Begriffe mit einer deutlich negativen, häufig herabsetzenden Wertung verknüpft, so z. B. wenn jemand sagt, „der ist ja gestört“. Wenn ich jemanden aufgrund bestimmter Verhaltensweisen als „verrückt“ oder „irre“ bezeichne, kann es passieren, dass ich mir eine Beleidigungsklage oder Ohrfeige einhandle. Welcher Bedeutungswandel hat stattgefunden? Der Begriff „verrückt“ bedeutet ursprünglich „an eine andere, eine falsche Stelle gebracht“. Seit dem 17. Jahrhundert finden sich dann Formulierungen wie „verrückt im Kopf“. Heute bedeutet „verrückt“: „nicht bei Verstand, geistesgestört, irre sein“. „Geistesgestörtheit“ und „Irresein“ sind ursprünglich psychiatrische Diagnosen. Die Institutionen, in denen sich entsprechende Personen zur Behandlung aufhielten, wurden vor noch nicht allzu langer Zeit „Irrenanstalten“ genannt. So hatte man 1864 in Frankfurt am Main ein neu gebautes Hospital für psychisch Kranke eröffnet, das noch 1920 den Namen „Städtische Heilanstalt für Irre und Epileptische“ trug.
Es ist wohl das Schicksal nicht weniger psychiatrischer und psychologischer Diagnosen in einer alltagssprachlichen Verwendung schließlich zu Bezeichnungen zu mutieren, mit denen andere herabgesetzt und beschimpft werden können. So wecken z. B. „Hysterie“, „Schizophrenie“, „Schwachsinn“ oder auch „Idiotie“, mit der im psychiatrischen Sinne der höchste Grad von Schwachsinn gemeint ist, bestimmte negative Konnotationen. Dies ist sicher mit ein Grund dafür, dass gewisse diagnostische Bezeichnungen und Begriffe aufgegeben und durch andere Fachausdrücke ersetzt werden1, bis diese schließlich das gleiche Schicksal ihrer missbräuchlichen Verwendung erfahren und zur „Metapher der Diffamierung“ (Finzen, 1996) werden2. Dass sich insbesondere psychiatrische Diagnosebezeichnungen in ihrer alltagssprachlichen Verwendung offenbar so sehr dafür eignen, Menschen herabzusetzen, zu verletzen und zu beleidigen, hat sicher mit den nach wie vor negativen Einstellungen, Vorbehalten und Vorurteilen gegenüber Menschen mit psychischen Störungen zu tun, zu denen offenbar auch nicht wenige Personen in Strafhaft zählen. Dazu passt, dass auch Psychotherapie noch immer ein Tabuthema zu sein scheint: Nach einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg wäre es jedenfalls 41 % der fast 2000 befragten Deutschen ab 14 Jahre „ausgesprochen peinlich“, wenn ihr Umfeld (Nachbarn oder Bekannte) davon erfahren würde, dass sie sich in Psychotherapie befinden (Quelle: www.netdoktor.de, 04.08.2003).
Auch die auf den ersten Blick so positiv erscheinenden Begriffe „normal“ und „gesund“ sind nicht nur uneindeutig, sondern auch schillernd. Es gibt sicher Menschen, die im Sinne des Gewöhnlichen, Durchschnittlichen und Üblichen nicht normal sein möchten, zumal die Norm und das Normale viel zu sehr abhängig sind von den jeweils geltenden gesellschaftlichen Bedingungen und damit der Individualität zu wenig Raum bleibt. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts meint der Begriff „normal“ aber auch „geistig gesund“, was ihm zweifellos eine positive Bedeutung verleiht. Menschen möchten in diesem Sinne als „normal“ gelten, denn „unnormal“ oder „abnorm“ zu sein, würde heißen, als „geistig nicht gesund“ bzw. „krankhaft“ angesehen zu werden. Gleichwohl bleibt das Verständnis von geistiger Gesundheit an die jeweils herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse gebunden. Auch ist die Definition von geistiger/psychischer Gesundheit und abweichendem Verhalten kulturell bedingt und mit dem jeweiligen Zeitgeist verknüpft. Jede Diagnose abweichenden Verhaltens steht in einem gesellschaftlichen Zusammenhang und drückt in gewisser Weise die in dieser Gesellschaft geltenden Regeln, Normen und Werte aus. Die Grenze des Normverhaltens bestimmt die Gruppe. Regeln, Normen und Werte sind veränderbar und verändern sich auch tatsächlich in der Zeit. So wurde z.B. im Jahre 1973 die Homosexualität durch die American Psychiatric Association (A.P.A.) – nach einer erfolgten Abstimmung – von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen. „Der Grund war, daß viele Homosexuelle ihren Lebensstil durchaus nicht als unangemessen und auffällig empfinden und auch keine begleitenden psychischen Probleme erleben“ (Bourne & Ekstrand, 1992, S. 465). Diagnosen abweichenden Verhaltens sind Werturteile, sie können auch im Sinne des Machtmissbrauchs und der Unterdrückung von Menschen eingesetzt werden. So ist bekannt, dass u.a. in der ehemaligen Sowjetunion politisch Andersdenkende als geisteskrank diagnostiziert und in psychiatrischen Einrichtungen „behandelt“ wurden.
Aus der Feststellung der Vieldeutigkeit diagnostisch verwendeter Begriffe ergibt sich die Notwendigkeit ihrer Präzisierung, vor allem auch deshalb, weil aus ihrer Verwendung erhebliche Konsequenzen resultieren. In strafrechtlichen Gutachten erfolgen Schlussfolgerungen in Fragen der Schuldfähigkeit, der Prognose und Therapie von diagnostizierten Tätern. Nach unserer geltenden Rechtsauffassung kann Krankheit im Falle von Rechtsverstößen Schuld aufheben, sodass auch eine Bestrafung entfällt. Aber auch Krankheit ist ebenso wenig wie normales oder abnormes, funktionales oder dysfunktionales Verhalten abstrakt definierbar, sondern stets nur innerhalb eines jeweiligen Bezugsrahmens zu bestimmen. In der Psychiatrie und Klinischen Psychologie existiert kein allgemein verbindlicher Krankheitsbegriff. Selbst die Gesundheitswissenschaften tun sich schwer damit.
Krankheit als das Fehlen von Gesundheit zu definieren, befriedigt nicht. Es stellt sich zwangsläufig die Frage, was Gesundheit ist. Auch psychische Erkrankungen legen Grenzziehungen zur psychischen Gesundheit nahe. Wie aber können wir psychische Gesundheit beschreiben? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat versucht, Gesundheit – auch geistige und psychische Gesundheit – an einer Idealnorm orientiert zu definieren. Danach ist „Gesundheit der Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens“ (Corazza et al., 1990, S. 213). Diese Sichtweise ist zu Recht als wenig realitätsgerecht und „alltagstauglich“ kritisiert worden.
Gesundheitspsychologische Untersuchungen beschreiben seelisch gesunde im Vergleich zu weniger gesunden Menschen als Personen, die folgende Merkmale/Eigenschaften in relativ höherer bzw. geringerer Ausprägung bieten (vgl. Becker, 1997):
hohe Selbstachtung und großes Selbstvertrauen,
seelische Stabilität,
großes Gerechtigkeitsgefühl,
Optimismus und Harmonie,
Fähigkeit, mit Stress umzugehen,
geringe Ängstlichkeit und Gereiztheit,
weniger körperliche Beschwerden,
bessere Konzentration und größere Energie,
Sicht auf den Sinn des eigenen Lebens,
im sozialen Kontext:
größere Selbstsicherheit,
mehr Vertrauen,
höhere Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme,
Vermögen, sich zu behaupten,
größere Unabhängigkeit von Meinungen anderer.
Ein sehr viel angemesseneres Verständnis von psychischer Gesundheit als das der Weltgesundheitsorganisation erhalten wir, wenn wir gleichzeitig die Bedingungen berücksichtigen, die einerseits die Gesundheit erhalten und andererseits die Gesundheit gefährden können. Danach wäre – im Vorstellungsbild einer Waage – von der psychischen Gesundheit einer Person auszugehen, wenn im individuellen System ihrer Persönlichkeit die protektiven (schützenden) und kompensatorischen (ausgleichenden) Anteile sowie die ihr gegebenen Umweltstabilisierungen (Stützen) gegenüber den konstitutionellen Vulnerabilitäten (anlagebedingten Verletzbarkeiten) und Umweltbelastungen dieser Person überwiegen (vgl. Becker, 1982; Becker & Minsel, 1986).
Anders ausgedrückt: Die lebens- und überlebensnotwendige psychische Homöostase wird durch eine Balance aller einflussnehmenden biologischen, psychischen und sozialen Faktoren der Person gewährleistet. Die Balance entscheidet über die psychische Gesundheit und bewahrt sie. Psychische Krankheit wäre demnach die „gesunde Antwort“ auf ein negatives Ungleichgewicht der genannten Faktoren mit der Folge, dass Belastungen nicht ausreichend widerstanden werden kann und diese ihre krankmachende Wirkung entfalten können. Mit anderen Worten, es kommt zu einer psychisch instabilen Lage, die sich schließlich als psychische Krankheit manifestiert (Jost, 2006).
Mit der genannten Umschreibung von psychischer Gesundheit sind wesentliche Entstehungsbedingungen psychischer Erkrankungen angesprochen. Der vor allem in den 1960er und 1970er Jahren zum Teil heftige psychiatrische Richtungs- und Schulenstreit mit seinen recht unterschiedlichen pathogenetischen Überzeugungen hat allerdings sehr viel Uneinigkeit in den konkreten Ursachenerklärungen psychischer Erkrankungen hervorgebracht3 bis hin, dass deren Existenz von einigen Anhängern der sog. Antipsychiatrie überhaupt in Frage gestellt wurde. Eine sehr verbesserungsbedürftige Diagnostik psychischer Erkrankungen hat schließlich zur Entwicklung sog. Klassifikationssysteme geführt, sodass eine Beliebigkeit in der Einschätzung psychischer Auffälligkeiten sehr eingeschränkt, Objektivität und Reliabilität diagnostischer Entscheidungen deutlich erhöht wurden. Damit wurde auch die wissenschaftliche Verständigung über psychische Störungsbilder verbessert. Die heute geläufigen, auch in der strafrechtlichen Begutachtungspraxis angewandten, nicht an Richtungen und Schulen von Psychologie und Psychiatrie gebundenen, internationalen Klassifikationssysteme psychischer Störungen sind das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) und die in Deutschland bevorzugte International Classification of Diseases – 10. Revision (ICD-10). Diese auf psychopathologischen Konventionen beruhenden, operationalen diagnostischen Klassifikationssysteme vermeiden die Termini „Krankheit“ und „Erkrankung“ und verwenden den Begriff „Störung“, der jedoch bekanntermaßen nicht weniger problematisch ist als der Krankheitsbegriff. Abgesehen von eindeutig organisch verursachten Störungen erfolgen im ICD-10 keine ätiopathogenetischen (ursachenbezogenen) Zuordnungen. Diagnosen erfolgen nicht mehr (an einem ätiologischen Krankheitsmodell orientiert) nosologisch, vielmehr auf der Grundlage phänomenologischer Symptomenlisten, was sich spätestens dann als unzureichend erweist, wenn es um die Therapie von Störungen geht. Die Therapie kann der Frage nach den (hypothetischen) Ursachen einer Störung gar nicht ausweichen.
Da aus der Sicht der Gesetzgebung und im Hinblick auf die im Strafgesetzbuch (StGB) festgeschriebenen Schuldfähigkeitsbestimmungen (§§ 20 und 21 StGB) der Krankheitsbegriff eine herausragende Rolle spielt, haben die traditionelle nosologische Einteilung psychischer Störungen und die mit ihnen verbundenen ätiopathogenetischen, verlaufstypischen und prognostischen Annahmen nach wie vor eine hohe Bedeutung.
Nach traditioneller nosologischer Einteilung (s. Abb. 2.1) können psychische Störungen exogen, endogen oder reaktiv verursacht sein. Daneben gibt es psychische Störungen, die Überschneidungsbereichen der Ursachenkreise zuzuordnen sind. Exogene psychische Störungen sind (hirn-)organisch bedingt. Hierunter fallen akute, chronische und residuale Krankheitszustände infolge direkter oder indirekter Hirnschädigung. Endogene psychische Störungen sind nicht eindeutig und ausreichend organisch erklärbar, weshalb von inneren Bedingungen ausgegangen wird. Es sind dies in der Hauptsache die affektiven und schizophrenen Psychosen. Reaktive psychische Störungen sind vorrangig durch die Persönlichkeit sowie durch Erleben und Erfahrungen der Person bedingt.
Abb. 2.1: Nosologische Unterteilung psychischer Störungen nach dem Schwerpunkt ihrer Ursachen
Will man psychische Störungen in ihrer Entstehung und Ausgestaltung verstehen, muss man stets von einem Bedingungs gefüge ausgehen, in welchem die Person, ihre anlagebedingte Verletzbarkeit und Störungsbereitschaft (Vulnerabilität) sowie das soziale Umfeld koexistieren und aufeinander Einfluss nehmen. Um die Einflussnahme von Bedingungen geht es wohl auch in dem von Rasch (1986) vorgeschlagenen „strukturell-sozialen Krankheitsmodell“, dem ein enger Bezug zur psychologisch-psychiatrischen Begutachtungspraxis zukommt. Dieses Modell rekurriert auf das „Wesen von ‚Krankheit‘“, wobei Krankheit „sich im Verhalten des Einzelnen erkennen und beschreiben lässt“. Das Modell auf die strafrechtliche Begutachtung übertragen heißt, dass „die Zuerkennung von Krankheit, die Auswirkung auf die Schuldfähigkeit haben kann, davon abhängt, ob der zu beurteilende Zustand die Struktur von ‚Krankheit‘ hat und ob er die allgemeine soziale Kompetenz der Persönlichkeit beeinträchtigt“ (Rasch & Konrad, 2004, S. 51). So verstanden ist „Krankheit“ vornehmlich „an dem Ausmaß einer entindividualisierenden, typisierenden Umprägung eines Menschen zu messen, an seinem Aufgehen in Verhaltensweisen, die der spezifischen Anomalie oder Krankheit selbst eigen sind“. Beeinträchtigungen der sozialen Kompetenz könnten z.B. sein: „Einengung der Lebensführung“, „verzerrte Realitätsbeurteilung“, „Festgelegtsein auf bestimmte Verhaltensmuster“ (Rasch & Konrad, 2004, S. 52).
Kehren wir zurück zur Eingangsfrage. Wir müssen uns über die Problematik diagnostischer Begrifflichkeiten, Bezeichnungen und Zuordnungen im Klaren sein. Sie unterliegen Wandlungen. Sie erfahren aber auch Präzisierungen durch Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft und Forschung. Die strafrechtliche Begutachtung erfordert solche Präzisierungen, wenn von Krankheit, Störung oder Abnormität die Rede ist. Wie noch aufzuzeigen sein wird, genügt allerdings in der Begutachtungspraxis nicht allein eine präzise Feststellung des Vorliegens einer psychischen Erkrankung oder Störung. So muss im Rahmen der Erörterung einer womöglich verminderten oder gar aufgehobenen Schuldfähigkeit eines kranken Straftäters die Einflussnahme seiner Störung auf die strafbare Handlung und das Tatgeschehen aufgezeigt werden. Ganz im Sinne von Rasch wird damit auch eine Erhellung des individuellen und sozialen Hintergrundes einer vorgeworfenen strafbaren Handlung ermöglicht.
1 Immer wieder gemachte Vorschläge eines Begriffswechsels, z.B. die Bezeichnung „abnorm“ aufzugeben und konsequent durch „abweichend“ zu ersetzen, können schon deshalb keine gute Lösung darstellen, weil häufig für neue Begriffe die Vieldeutigkeit fortbesteht.
2 Seit geraumer Zeit laufen Kinder, bei denen eine Legasthenie vorliegt, oder von denen bekannt wird, dass sie mit einem Psychologen oder Therapeuten in Kontakt stehen, Gefahr, durch entsprechende Verballhornungen als „Legastheni“, „Psycho“ oder „Schizo“ verspottet zu werden.
3 Diesbezügliche Kontroversen hat es jedoch historisch schon früher gegeben: „In der klinischen Psychiatrie entstanden sehr unterschiedliche nosologische Systeme, deren gemeinsamer Nenner das Bestreben war, die verwirrende klinische Vielfalt seelischer Störungen durch einen an der Symptomatik oder auch an spekulativen ätiologischen Hypothesen ausgerichteten begrifflichen Rahmen zu ordnen und damit handhabbar zu machen. Den größten Gegensatz findet man hier zwischen den ‚romantischen Psychiatern‘ des frühen und den materialistisch eingestellten ‚Gehirnpsychiatern‘ des ausgehenden 19. Jahrhunderts“ (Hoff, 2005, S. 1052). Die einen schrieben Geisteskrankheiten weitgehend der Eigenverantwortung der Betroffenen zu, die anderen sahen in ihnen Erkrankungen des Gehirns. Erinnert sei an Wilhelm Griesinger (1817–1868), der in seinem berühmten Lehrbuch „Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten“ darlegte, dass „Geisteskrankheiten“ Gehirnkrankheiten seien.
3 Beurteilung der Schuldfähigkeit – mögliche Konsequenzen
Unter bestimmten, in der Strafprozessordnung (StPO) festgeschriebenen Regelungen ist die Begutachtung eines Straftäters vorgesehen. Diese kann durch die verschiedenen Institutionen der Prozessbeteiligten initiiert werden. In der Regel erteilen Staatsanwaltschaften oder Gerichte einen Gutachtenauftrag in Fällen des Vorwurfs schwerwiegender Straftaten, z.B. Raub, Kindesmisshandlung, Tötungshandlungen. Die am häufigsten gutachterlich zu beantwortende Frage ist die nach der Schuldfähigkeit eines Straftäters zum Zeitpunkt der ihm angelasteten Tat(en).
Dem deutschen Strafrecht liegt das sog. Schuldprinzip zugrunde. Danach kann eine Person für ihre Straftat nur dann bestraft werden, wenn sie für diese auch verantwortlich zu machen ist. Mit anderen Worten, Bestrafung setzt Schuldfähigkeit voraus, die im Einzelfall zu hinterfragen ist. Bei vom Gericht festgestellter Schuldunfähigkeit unterbleibt demnach eine Bestrafung und es erfolgt Freispruch. Wird eine erhebliche Minderung der Schuldfähigkeit konstatiert, hat dies in aller Regel strafmildernde Konsequenzen. Die Entscheidung über eine Minderung oder gar Aufhebung der Schuldfähigkeit obliegt stets dem Gericht. Der Sachverständige hat diesbezüglich Zurückhaltung zu üben. Seine Aufgabe ist es erst recht nicht, über moralische Schuld zu urteilen. Er hat vielmehr zu Fragen psychischer Störungen eines Beschuldigten Stellung zu nehmen und gegebenenfalls zu den damit verbundenen möglichen Konsequenzen für die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit der handelnden Person. Der Ausgang der gutachterlichen Stellungnahme dient dem Gericht zur Entscheidung über die Schuldfähigkeit des Delinquenten.
3.1 Schuldfähigkeitsrelevante Merkmale
Unter welchen Bedingungen Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit gegeben sein kann, regeln die §§ 20 und 21 des Strafgesetzbuches (StGB):
§ 20 (Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen)
Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.
§ 21 (Verminderte Schuldfähigkeit)
Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.
Für die Schuldfähigkeitsbegutachtung ergibt sich das Problem, dass die in den §§ 20 und 21 StGB benannten vier schuldausschließenden bzw. -mindernden psychischen Merkmale/Störungsgruppen (krankhafte seelische Störung, tiefgreifende Bewusstseinsstörung, Schwachsinn, schwere andere seelische Abartigkeit) juristische Formulierungen darstellen, die nicht mit psychiatrisch/psychologisch diagnostizierbaren Zuständen deckungsgleich sind. Es handelt sich um Rechtsbegriffe, die gleichsam einer „Übersetzung“ in die Terminologie psychiatrischer und psychologischer Krankheits-/Störungsbilder bedürfen.
Tab. 3.1: Psychische Merkmale und zuzuordnende Diagnosen nach ICD-10 (vgl. Rasch & Konrad, 2004)
Psychisches Merkmal
Diagnose
Kodierung ICD-10
Krankhafte seelische Störung
Hirnerkrankungen
F0–F09
Störungen durch psychotrope Substanzen
F1–F19
Schizophrenien, anhaltende wahnhafte Störungen, psychotische Störungen
F2
Affektive Störungen
F3
Tiefgreifende Bewusstseinsstörungen
„Normalpsychologische“ Bewusstseinsstörungen, Affekt
F43
Schwachsinn
Intelligenzminderungen
F7
Schwere andere seelische Abartigkeit
Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
F4
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
F6
Schizotype Störung
F21
Induzierte wahnhafte Störung
F24
Anhaltende affektive Störungen
F34
Abhängigkeitssyndrom (Sucht)
F1x.2
In Tabelle 3.1 sind die in § 20 StGB genannten schuldfähigkeitsrelevanten psychischen Merkmale und die ihnen zuzuordnenden Diagnosen aufgeführt. Die diagnostischen Kategorien folgen der unter dem Dach der Weltgesundheitsorganisation erarbeiteten Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10; Dilling, Mombour & Schmidt, 2000).
Die Schuldfähigkeitsbegutachtung hat den Gesetzesvorschriften entsprechend sequentiell zu erfolgen. In einem ersten Schritt ist in einem diagnostischen Prozess das Vorliegen eines oder mehrerer der in den §§ 20 und 21 StGB genannten vier schuldausschließenden bzw. -mindernden psychischen Merkmale/Störungsgruppen zu untersuchen und festzustellen, ob diese zum Tatzeitpunkt gegeben waren. Ist dies zu bejahen, ist in einem zweiten Schritt deren Relevanz im Hinblick auf die dem Beschuldigten angelastete Tatbegehung zu prüfen, d.h., es ist zu klären, ob eine oder auch mehrere der zum Tatzeitpunkt vorhandenen Störungen Konsequenzen für die Unrechtseinsicht oder das Steuerungsvermögen hatten. Ähnlich wie andere Autoren (z. B. Schwarte & Saß, 2004) präzisieren Scholz und Schmidt (2003, S. 12) die beiden Entscheidungsstufen bei der Schuldfähigkeitsbeurteilung:
Zunächst ist festzustellen, ob bei dem Beschuldigten zum Zeitpunkt der Tat eine psychische Störung aus den im § 20 StGB genannten Störungsgruppen vorgelegen hat.
Nur wenn dies der Fall ist, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob im Hinblick auf die vorgeworfene Tat die Fähigkeiten des Beschuldigten, das Unrecht der Tat einzusehen (Einsichtsfähigkeit) oder nach dieser Einsicht zu handeln (Steuerungsfähigkeit), aufgehoben oder erheblich vermindert waren.
Bei der Schuldfähigkeitsbeurteilung interessieren demnach stets der psychische Zustand des Beschuldigten und die Auswirkungen dieses Zustandes im Zeitpunkt der ihm angelasteten Tat. So reicht z. B. die Diagnose einer Schizophrenie allein nicht aus, um bei einem wegen Totschlags Angeklagten von einer verminderten oder gar aufgehobenen Schuldfähigkeit auszugehen. Ist jedoch aufzuzeigen, dass sich eine gegebene paranoid-halluzinatorische Symptomatik dieses Angeklagten u.a. in Form imperativer Stimmen und Wahnvorstellungen äußerte, die sich auf eine bestimmte Person richteten, die er schließlich tötete, weil Stimmen dies ihm befahlen und sagten, dass es sich bei der genannten Person um den „leibhaftigen Satan“ handele, ist die „Sachlage“ eine andere. Hier ist womöglich davon auszugehen, dass bereits die Einsicht in die Unrechtmäßigkeit der Tat fehlte. Sollte sie dennoch gegeben gewesen sein, wird allerdings auf dem Hintergrund der halluzinierten imperativen Stimmen, „den Satan töten zu müssen“, eine nicht mehr ausreichende Steuerungsfähigkeit eigenen Handelns anzunehmen sein. Hierbei ist ein zielgerichtetes, planvolles Vorgehen mit der durch die Krankheit bestimmten Tathandlung durchaus vereinbar. Es ändert nichts an der Beurteilung. Nehmen wir aber einen anderen Deliktfall des gleichen, an einer schizophrenen Psychose erkrankten, jetzt wegen Handydiebstahls Angeklagten. Hier wird wegen eines fehlenden Zusammenhangs zwischen Erkrankung und Straftat letztlich von der gegebenen Schuldfähigkeit auszugehen sein.
Dem schuldfähigkeitsrelevanten psychischen Merkmal „Krankhafte seelische Störung“ sind neben schizophrenen Psychosen ferner Hirnerkrankungen, Störungen durch psychotrope Substanzen und affektive Störungen zu subsumieren. Unter Hirnerkrankungen sind alle organisch bedingten, das Gehirn betreffenden Veränderungen, Störungen oder Prozesse zu verstehen, die letztlich Auswirkungen auf psychische und geistige Funktionen einer Person haben. Unter anderem zählen hierzu die Demenzen unterschiedlicher Ausprägung und Ursache, organisch bedingte Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Zu den affektiven Störungen zählen manische und depressive Zustandsbilder. Die insgesamt eher seltenen Straftaten während einer manischen Episode führen im Allgemeinen zur Schuldunfähigkeitsannahme (Rasch & Konrad, 2004). Die „kriminogene Bedeutung endogener Depressionen“ erscheint vergleichsweise weniger klar. „Veröffentlichungen aus Gutachtenmaterial legen die Vermutung nahe, dass endogene Depressionen nur selten zu Straftaten disponieren“ (Rasch & Konrad, 2004, S. 265). Nicht wenige Depressionen gehen allerdings mit einer erheblichen Suizidneigung einher. Es gibt Fälle, in denen die Suizidalität mit einem paranoiden Katastrophendenken und einer wahnhaften Hoffnungslosigkeit verbunden ist, sodass der Betroffene nicht nur sich tötet, sondern zugleich auch nahe Angehörige (Kinder, Ehepartner) mit in den Tod nimmt. Man spricht in diesem Zusammenhang vom „erweiterten Suizid“. Misslingt der eigene Suizid, kommt es wegen der Tötung der Angehörigen zu einem Strafverfahren. Der unmittelbare Zusammenhang der Straftaten mit der Erkrankung wird letztlich von der Schuldunfähigkeit des Täters ausgehen lassen müssen.
Durch psychotrope Substanzen hervorgerufene psychische und Verhaltensstörungen können mit dem Konsum und der Wirkung einer ganzen Reihe chemischer Stoffe in Zusammenhang stehen, u.a. Alkohol, Opiate, Cannabinoide (Haschisch, Marihuana), Sedativa, Hypnotika, Kokain, Stimulantien, Halluzinogene, Lösungsmittel. Bekanntermaßen werden Straftaten nicht selten unter dem Einfluss von Alkohol begangen. Der Konsum von Alkohol bewirkt psychische Veränderungen, z.B. im Bereich des Emotionalen, auch die Kritikfähigkeit betreffend, sodass sich bei schwerwiegenden, unter Alkoholintoxikation begangenen Delikten häufig die Frage nach dem Steuerungsvermögen des Beschuldigten zum Tatzeitpunkt stellt.
Unter dem schuldfähigkeitsrelevanten Merkmal „Tiefgreifende Bewusstseinsstörung“ sind die sogenannten normalpsychologischen Bewusstseinsstörungen zu verstehen, die unter bestimmten Umständen bei ansonsten als psychisch gesund geltenden Menschen auftreten können. „Von praktischer Bedeutung ist unter ihnen eigentlich nur der Affekt, der affektive Erregungszustand, der affektive Ausnahmezustand, der bei einem Streit oder nach längerer Auseinandersetzung – meist bei Partnerkonflikten – plötzlich ausbricht und den Täter fortreißt“ (Rasch & Konrad, 2004, S. 70), sodass es beispielsweise zur Tötungshandlung kommt. Rasch und Konrad (2004) weisen darauf hin, dass das Opfer u.U. auch ein Zufalls- oder Ersatzopfer sein kann. Wesentliches Kennzeichen des Affekts als einer rasant aufsteigenden, intensiven Gefühlslage ist seine kurze Dauer. Es handelt sich demnach um rasch vorübergehende psychische Störungen. Diese treten vor allem in Form von Erregungs- oder auch Hemmungszuständen (Affektexplosion, Affektschock oder -stupor) in Erscheinung und stellen Reaktionen auf schwere psychische oder körperliche Belastungen dar. Nach Rasch und Konrad (2004, S. 270) sind typische Affektdelikte Tötungsdelikte im Rahmen hochgradig konflikthafter Partnerbeziehungen. „Hier geht in der Regel der Tat eine sich über Monate und Jahre erstreckende Auseinandersetzung voraus, die vom späteren Täter … mit dem Gefühl erlebt wird, selbst Opfer zu sein.“ Seine psychische Verfassung ist durch eine erhebliche emotionale Instabilität, Verzweiflung und Suizidalität geprägt. „Die sich schließlich entladenden Aggressionen werden vielfach durch ein Stichwort ausgelöst, das den Täter in einem wesentlichen Erlebnisbereich trifft.“ Die mit dem Affekt einhergehende Bewusstseinsstörung stellt dabei keine Trübung, sondern eine Einengung des Bewusstseins dar. Rasch und Konrad (2004, S. 70) relativieren die Feststellung der primären psychischen Gesundheit von Affekttätern. Sie gehen bei „schweren Affektausbrüchen“ davon aus, dass diese „sich in aller Regel auf der Basis einer Persönlichkeitsentwicklung ereignen, die sich bereits in Richtung auf Krankheitsartigkeit vollzog“. Auch Nowara (2004, S. 177) sieht in der Vorgeschichte von Affekttätern häufig eine bereits eingetretene Persönlichkeitsentwicklung, „die gewisse krankhafte Züge trägt“. Mit Blick auf mögliche Persönlichkeitsabweichungen von Affekttätern wird für die Gutachtenerstattung eine „Gesamtschau der Täterverfassung“ für erforderlich gehalten, „die sich auf die Dimensionen Persönlichkeit, körperliche Befunde, exogene Einflüsse (Alkohol oder Medikamente), die psychische Verfassung in der Zeit vor der Tat und das Tatverhalten selbst erstreckt“ (Rasch & Konrad, 2004, S. 274).
Mit dem schuldfähigkeitsrelevanten Merkmal „Schwachsinn“ sind intellektuelle Mängel gemeint, die keine organische Ursache erkennen lassen [Intelligenzdefizite auf (hirn-)organischer Basis sind der „Krankhaften seelischen Störung“ zugeordnet.]. Der Intelligenzmangel unbekannter Genese ist gleichsam als eine nicht ausreichende intellektuelle Entwicklung zu verstehen. Beim familiär gehäuft auftretenden erblichen Schwachsinn sind bereits die Voraussetzungen für eine normale geistige Entwicklung nicht gegeben. Forensisch ist beim Vorhandensein gravierender intellektueller Mängel mit Konsequenzen vor allem in Form einer Beeinträchtigung der Einsichtsfähigkeit des Betroffenen zu rechnen. Für die Diagnose des Schwachsinns1 ist keinesfalls der sog. „klinische Eindruck“ ausreichend. Eine testpsychologische Untersuchung ist unerlässlich. In der forensischen Begutachtung Erwachsener kommt hierfür bevorzugt der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (HAWIE) in seiner jeweils aktuellen Form zur Anwendung, daneben auch andere standardisierte Tests zur Intelligenzdiagnostik. „Intelligenzbeurteilungen“ wie sie in Vergangenheit nicht selten auf der Basis schulischer und beruflicher Leistungen vorgenommen wurden, sind als unzureichend, wegen ihrer Fehlerhaftigkeit als inakzeptable Intelligenzschätzungen anzusehen.
Tab. 3.2: Intelligenzdiagnosen nach Wechsler anhand des Intelligenzquotienten (IQ)
IQ
Diagnose
< 63
extrem niedrige Intelligenz
63–78
sehr niedrige Intelligenz
79–90
niedrige Intelligenz
91–109
durchschnittliche Intelligenz
110–117
hohe Intelligenz
118–126
sehr hohe Intelligenz
> 126
extrem hohe Intelligenz
Neben der Feststellung einer globalen intellektuellen Leistungsfähigkeit anhand eines Gesamtintelligenzquotienten (IQ; s. Tab. 3.2) erlauben standardisierte Intelligenztests aufgrund eines Testprofils differenzierte Aussagen über Stärken und Schwächen (Teilleistungsstörungen) geistigen Leistungsvermögens. Es ergeben sich damit auch Hinweise auf eine mögliche unzureichende (schulische) Förderung geistiger Potenzen. Nicht selten finden wir in der frühen Biographie erwachsener Straftäter ein schulisches Versagen, das weniger mit den tatsächlichen geistigen Möglichkeiten des Kindes, vielmehr eher mit sozialen Schwierigkeiten und einem Mangel entsprechender Kompetenzen sowie Verhaltensstörungen in Zusammenhang steht. Ohne ausreichende und angemessene Untersuchung und unter der falschen Diagnose „Minderbegabung“ werden dann mitunter die Feststellung des Sonderschulbedarfs getroffen und völlig falsche Weichen für die weitere Entwicklung gestellt.
Eine Analyse des individuellen Intelligenztestprofils ist auch deshalb wichtig, weil der identische IQ zweier oder mehrerer Personen durch eine sehr unterschiedliche Zusammensetzung von Einzelleistungen zustande kommen kann. So wissen wir, dass auch intelligenzgeminderte Personen unverhoffte Begabungen bieten können, z.B. neben schweren sprachlichen Defiziten relativ befriedigende Leistungen bei visuell-räumlichen Aufgabenstellungen.
Tab. 3.3: ICD-10-Diagnosen der Intelligenzminderung (Richtwerte)
IQ
Grad der Intelligenzminderung
50–69
leichte Intelligenzminderung (Debilität)
35–49
mittelgradige Intelligenzminderung (Imbezillität)
20–34
schwere Intelligenzminderung
< 20
schwerste Intelligenzminderung (Idiotie)
In Tabelle 3.3 sind die verschiedenen Grade einer Intelligenzminderung nach ICD-10 dargestellt. „Von einer potenziell forensisch relevanten Intelligenzminderung kann man ab einem IQ unter 70 sprechen, als Obergrenze wird ein IQ von 80 angegeben. Allerdings ist … zu beachten, dass das Ausmaß an Intelligenz in Beziehung zur Art der Tat gesetzt werden muss, d. h. für einfache Sachverhalte gelten andere Anforderungen als für kompliziertere Vorgänge“ (Schwarte & Saß, 2004, S. 172). Intelligenzgeminderte Personen bieten fast stets auch Beeinträchtigungen des Anpassungsverhaltens, weshalb spätestens bei ausgeprägterem Schwachsinn Unterstützungsmöglichkeiten etwa in geschützter Umgebung indiziert sind.
Es entspricht einem weit verbreiteten Vorurteil, dass Schwachsinnige stärker zu Straftaten neigen. Sie bieten insgesamt keine größere Deliktdisposition als durchschnittlich begabte Personen (vgl. Nowara, 2004). Internationale Forschungsergebnisse weisen allerdings auf eine Überrepräsentanz von Oligophrenen bei bestimmter Delinquenz wie Sexualstraftaten, Gewalthandlungen gegen Personen und Brandstiftung. „Die aus der psychischen Behinderung resultierenden Schwierigkeiten im sozialen Umgang äußern sich erwartungsgemäß auch in der Unfähigkeit, sexuelle Beziehungen in sozial gebilligter Weise aufzunehmen“ (Rasch & Konrad, 2004, S. 277).
Mit dem schuldfähigkeitsrelevanten Merkmal „Schwere andere seelische Abartigkeit2
“ (SASA)3 sind u. a. psychische Auffälligkeiten gemeint, die als ichdyston erlebte, schwere neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen in Erscheinung treten. Die Betroffenen leiden in der Regel sehr darunter. Ferner sind unter das SASA-Merkmal als ichsynton imponierende Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen von eindeutiger Abnormität zu subsumieren.4 Häufige Delikte im Kontext mit dem genannten Merkmal sind Brandstiftung und pathologisches Spielen (Abnorme Gewohnheiten und Impulskontrollstörungen), auch unterschiedliche Sexualstraftaten, z. B. pädophile Handlungen (Störungen der Sexualpräferenz). Was die Einschätzung der Schwere einer dem SASA-Merkmal zuzuordnenden Störung anbelangt, ist diese nur im Einzelfall möglich. Rasch und Konrad (2004, S. 72) schlagen vor, die „‚Gleichwertigkeit‘ mit Krankheit im Sinne des strukturell-sozialen Krankheitsbegriffs zugrundezulegen“. Im Hinblick auf die Begutachtung ist auch hier von Belang, welche Auswirkungen die Störung auf die Verhaltensmöglichkeiten einer Person im Zeitpunkt ihrer strafbaren Handlung hatte. Vor Zirkelschlüssen ist zu warnen. So sind z.B. Sexualdelikte nicht deshalb schon Ausdruck einer schuldfähigkeitsrelevanten Störung des Täters, weil sein Tun besonders abwegig erscheint. Wir wissen, „dass nicht jede sexuelle Abweichung in eine Straftat münden muss und nicht jeder Sexualtat auch immer eine sexualpathologische Entwicklung zugrunde liegen muss. Gerade im Bereich von Sexualstraftaten wird … häufig (zu Unrecht) angenommen, dass die Tat einen ‚krankhaften‘ Hintergrund haben muss“ (Nowara, 2004, S. 178). Auch die vorhandene Störung der Sexualpräferenz einer Person kann im Falle einer begangenen Sexualstraftat nicht zwangsläufig von einer erheblichen Minderung ihrer Steuerungsfähigkeit im Zeitpunkt der Tat ausgehen lassen. Im Folgenden sind in der Praxis bewährte Merkmalskataloge nach Saß (1987) dargestellt, die Indizien für bzw. gegen eine erhebliche Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit bei Vorliegen einer „Schweren anderen seelischen Abartigkeit“ (SASA) beinhalten (s. Tab. 3.4 und 3.5). Die Schweregradeeinschätzung im Rahmen der Schuldfähigkeitsbegutachtung betreffend geht Saß davon aus, dass diese sich stets an den psychopathologischen Phänomenen der krankhaften seelischen Störungen zu orientieren hat (Scholz & Schmidt, 2003).
Tab. 3.4: Kriterien als Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit bei SASA (vgl. Saß, 1987, 2003)
Positivkriterien
psychopathologische Disposition der Persönlichkeit
chronische konstellative Faktoren, z.B. Abusus
Schwäche der Abwehr- und Realitätsprüfungsmechanismen
Einengung der Lebensführung
Stereotypisierung des Verhaltens
Häufung sozialer Konflikte auch außerhalb des Delinquenzbereichs
emotionale Labilisierung in der Zeit vor dem Delikt
aktuelle konstellative Faktoren, z.B. Alkohol, Ermüdung, affektive Erregung
Hervorgehen der Tat aus neurotischen Konflikten bzw. neurotischer Symptomatik
bei sexuellen Deviationen: Einengung, Fixierung und Progredienzphänomen
Tab. 3.5: Kriterien als negative Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit bei SASA (vgl. Saß, 1987, 2003)
Negativkriterien
Tatvorbereitungen
planvolles Vorgehen bei der Tat
Fähigkeit zu warten
lang hingezogenes Tatgeschehen
komplexer Handlungsablauf in Etappen
Vorsorge gegen Entdeckung
Möglichkeit anderen Verhaltens unter vergleichbaren Umständen
Hervorgehen des Deliktes aus dissozialen Charakterzügen (Fehlen psychopathologischer Störungen)5
Bei der Begutachtung eines Tatbeschuldigten zur Frage einer erheblich verminderten oder gar aufgehobenen Einsichts- und Steuerungsfähigkeit ist wiederum sequentiell vorzugehen, d.h. zunächst ist zu klären, ob eine der SASA zuzuordnende Störung gegeben ist. Erst bei Vorliegen ist in einem zweiten Schritt die Erheblichkeit der Störung im Hinblick auf die Straftat zu untersuchen, wobei die von Saß vorgeschlagenen Positiv-/Negativkriterien wichtige Entscheidungshilfen darstellen. Ausdrücklich ist allerdings davor zu warnen, die Merkmalskataloge rezeptbuchartig zu verwenden. Die Begutachtung der Persönlichkeit/Persönlichkeitsentwicklung eines Beschuldigten auf dem Hintergrund der Biographie, die Beurteilung der (aktuellen) Lebensumstände und der Tatkonstellation sind unverzichtbar und ermöglichen auch erst Entscheidungen über Vorhandensein oder Nichtvorhandensein indizieller Schuldfähigkeitsmerkmale.
3.2 Maßregeln – Unterbringung und Sicherung
Ein Gericht, das bei einem Straftäter im Hinblick auf sein Tun die sichere Feststellung einer verminderten oder gar aufgehobenen Schuldfähigkeit trifft, stellt unter bestimmten Voraussetzungen bezugnehmend auf § 63 StGB die Frage der Erfordernis der Unterbringung des Delinquenten in einem psychiatrischen Krankenhaus (psychiatrischer Maßregelvollzug). Zu ihrer Klärung ist ein Gutachten vorgeschrieben, weshalb nicht selten von vornherein der Auftrag an den Sachverständigen ergeht, im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen zur Anwendung der §§ 20 oder 21 StGB auch hierzu Stellung zu nehmen:
§ 63 (Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus)
Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und der Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.
Zu beachten ist, dass die psychische Störung, die eine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit zur Folge hat, einen längerdauernden Zustand darstellen muss. Eine große Gruppe der Untergebrachten stellen Sexualdelinquente dar. In der Bestimmung der Maßregel geht es um Besserung, aber vor allem um die Sicherung der Allgemeinheit vor einem Täter, der als gefährlich eingestuft wird. Ihre gerichtliche Anordnung orientiert sich primär am Sicherungsgedanken. Die Grundintention des Maßregelvollzugs ist allerdings auf Behandlung der psychischen Störungen des Straftäters angelegt. Vom Sachverständigen werden prognostische Aussagen über den Täter, sein zukünftiges Handeln und seine Gefährlichkeit erwartet (s. Kap. 4.3.3).
Die gerichtliche Anordnung der Unterbringung eines Straftäters in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB ist unabhängig von Einschätzungen seiner Schuldfähigkeit:
§ 64 (Unterbringung in einer Entziehungsanstalt)
(1) Hat jemand den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen, und wird er wegen einer rechtswidrigen Tat, die er im Rausch begangen hat oder die auf seinen Hang zurückgeht, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, weil seine Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, wenn die Gefahr besteht, dass er infolge seines Hanges erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird.
(2) Die Anordnung unterbleibt, wenn eine Entziehungskur von vornherein aussichtslos erscheint.
Es handelt sich bei der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt um Straftäter mit einer stoffgebundenen Sucht, bei der eine Bindung an Alkohol oder andere berauschende Substanzen besteht.
Bei wiederholter Straffälligkeit kann für bestimmte, in der Regel schuldfähige Täter neben der Freiheitsstrafe nach § 66 StGB die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Ein gerichtlicher Vorbehalt dieser Anordnung ist möglich, seit 2004 auch die nachträgliche Anordnung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. Es handelt sich primär um den Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hangtätern, „bei denen Freiheitsstrafen zur Spezialprävention nicht ausreichen“ (Rasch & Konrad, 2004, S. 134). Rasch und Konrad (2004, S. 138) äußern sich kritisch zum gerichtlichen Umgang mit den sog. Hangtätern: „Die innerhalb der Rechtsprechung zum Begriff des Hangs aufgestellten Definitionen verweisen durchweg auf psychisch gestörte Persönlichkeiten, die in hohem Maße hilfsbedürftig sind und nicht lediglich in sichere Verwahrung abgeschoben werden sollten.“ Gerade deshalb setzt die erforderliche und vorgeschriebene Begutachtung auf Seiten des Sachverständigen einen großen Erfahrungshintergrund voraus, freilich auch im Hinblick auf prognostische Einschätzungen (s. Kap. 4.3.3), wobei zu bedenken ist, dass zukünftiges Verhalten und Handeln durch geeignete Interventionen durchaus beeinflusst werden können. Hierbei darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass es Fälle von Therapieresistenz gibt, die jedenfalls durch die derzeit verfügbaren Behandlungsverfahren nicht erreicht werden.
1 Bisweilen wird auch von Minderbegabung oder in der Terminologie Kraepelins (1856–1926) von Oligophrenie gesprochen.
2 Der sehr zweifelhafte, auch diskriminierende Begriff „Abartigkeit“ entstammt den „Musterungsvorschriften der Deutschen Wehrmacht im Kriege“. Seit langem wird der Ersatz durch eine passendere Bezeichnung in der Gesetzestextformulierung gefordert.
3 Im Hinblick auf detaillierte Ausführungen zum Merkmal der „schweren anderen seelischen Abartigkeit“ und der Frage der Schuldfähigkeit sei auf Scholz und Schmidt (2003) verwiesen.
4 Die fortschreitende Entwicklung bildgebender Untersuchungsmöglichkeiten (PET, fMRT) hat für Persönlichkeitsstörungen (Psychopathien) Ergebnisse lokaler zerebralorganischer Aktivitätsstörungen erbracht, weshalb sich hier die Frage der Zuordnung zu den Merkmalen des § 20 StGB neu stellen kann. U. a. werden organische Grundlagen der kriminogen recht bedeutsamen dissozialen (antisozialen) Persönlichkeitsstörung diskutiert. Schwarte und Saß (2004, S. 174) berichten von neueren Befunden aus Untersuchungen bei antisozialen Persönlichkeitsstörungen unter Anwendung bildgebender Verfahren, die auf „eine beiderseits verminderte präfrontale Aktivität sowie limbische Untererregbarkeit“ hinweisen. Diese „funktionellen Gegebenheiten führen zu einer Schwäche, Situationen im Hinblick auf ihren emotionalen Gehalt richtig einzuschätzen, außerdem zu einem allgemein verminderten Erregungsniveau sowie zu einer mangelnden Inhibition von Verhalten, was sich als hirnorganisch bedingt erhöhte Disposition für kriminelles Verhalten interpretieren lässt.“
5 Saß (1987) unterscheidet zwischen Dissozialität als einer „normalpsychologischen“ Erlebens- und Verhaltensvariante und kriminellem Verhalten, dem psychopathologische Auffälligkeiten zugrunde liegen.