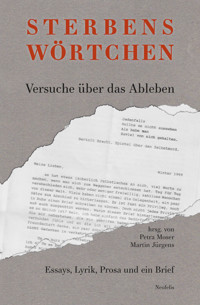14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Baiers Essays stützen sich ebenso auf Anschauung wie auf Recherche, neugierige Beobachtung bestimmt sie nicht weniger als genaue Lektüre. Sie handeln von Staatsaffären (de-Broglie-Affäre), aber auch von Land und Leuten (Okzitanien), von politischen Ereignissen (den Nachwirkungen der Résistance, dem Auftritt der »Neuen Rechten«, dem französischen Konservatismus und Antisemitismus), aber auch von literarischen Erkundungen (Artaud, Céline, Giono, Sartre/Flaubert) und von den Wechselfällen des deutsch-französischen Politik- und Ideen-Dialogs (»Kommunisten und Anverwandte«, »Franzosentheorie«, »Blick zurück vom Zaun«) – Lesevergnügen und Lehrstück zugleich. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Ähnliche
Lothar Baier
Französische Zustände
Berichte und Essays
FISCHER E-Books
Inhalt
Einführung, etappenweise
Französische Zustände – Zustände zwischen Metropole und Provinz, zwischen hochentwickelter Technologie und archaischen Lebensformen, zwischen Giscardie und Mitterrandien, zwischen Intellektuellendebatte und Rumoren unter der Oberfläche, zwischen Mythen und Erlebtem –, davon will dieses Buch erzählen; der Anlaß der Erzählung ist jedoch weniger das Staunen über diese Zustände als über die wachsende Distanz, die sich in der Wahrnehmung der französischen Angelegenheiten zeigt. »Schaffen wir französische Zustände!« hatte es 1968 bei uns geheißen. Die französischen Zustände der achtziger Jahre interessieren nicht einmal mehr – jenseits der Grenze nichts als graues Rauschen, kaum unterbrochen von der Nachricht des linken Wahlsiegs. Oder ist es gar nicht die Entfernung, die das Interesse lähmt, sondern die allzu große Nähe? Sind Frankreich und die Bundesrepublik einander nicht immer ähnlicher geworden? Hier wie dort die gleichen Autos, die gleichen multinationalen Konzerne und die gleiche Arbeitslosigkeit, und im »deutschen Herbst« 1977 liefen einem in Frankreich auch noch deutsche Polizisten über den Weg. Export und Import funktionieren wie geschmiert, und selbst wenn die Geschäftsführer nicht jedem sympatisch sind, so führen sie doch diskret und effizient die Geschäfte. Frankreich: französischsprachige Westregion, die Bundesrepublik: deutschsprachige Ostregion. Hat die Angleichung schon jene kritische Schwelle überschritten, jenseits derer Erkenntnis unmöglich wird? Der Bericht von Zuständen ist nicht mehr als ein Versuch, ein Stück von der Distanz wiederherzustellen, die die Voraussetzung jeder Wahrnehmung ist.
Warum gerade Frankreich? »Für die beiden Nachbarvölker ist nichts wichtiger, als sich zu kennen. Irrtümer können hier die blutigsten Folgen haben.« Was Heine 1844 in seinen Briefen über Deutschland als Begründung anführte, hat sich nach ihm zwar gleich mehrfach blutig bestätigt, klingt heute aber ziemlich pathetisch und wäre als Begründung nur ausgeliehen. Im Angesicht der Weltlage empfiehlt es sich zweifellos, voneinander Kenntnis zu nehmen; aber das gilt für alle Arten von Nachbarn. Warum also Frankreich?
Das Motiv für diese Wahl ist meine ganz persönliche Angelegenheit; ich hänge an Frankreich. Es ist eine Anhänglichkeit, wie man sie etwa einem Lehrer gegenüber verspürt, dessen Lektionen sich hinterher als brauchbar und prägend herausstellen, mehr noch, der selber ein Stück Wegs mitgegangen ist. Der Lehrervergleich wird denen am ehesten einleuchten, die wie ich in den fünziger Jahren in ein bundesdeutsches Gymnasium gegangen sind – unser Alternativunterricht kam aus Frankreich. Auf der Bank Bergengruen und Wiechert, unter der Bank Camus und Sagan; im Staatstheater Nathan der Weise, im Kellertheater Die schmutzigen Hände. Frankreich war etwas von unten, Subkultur, bevor man davon sprach; französische Filme wie Schrei, wenn du kannst bebilderten die Idee von einem verlockenden und gleichzeitig beängstigend freien Leben. Die Freiheit zeigte sich dort als Anstrengung; bequemer war es schon, sich den »Bindungen« anzuvertrauen, die man damals restaurierte: klerikale Moral, Klassenbewußtsein der Gebildeten, preußischer Humanismus. So wie man uns die Bluejeans aus den PX-Läden als »undeutsch« ausreden wollte, so verdächtigte man die französischen Gedanken; nicht immer erfolgreich. Nichts hat mich so sehr für Sartre und seinen Atheismus eingenommen wie der Versuch eines philosophisch dilettierenden Studienrats, die Lehre von der Existenz, die der Essenz vorausgeht, christlich besserwisserisch zu widerlegen. Überhaupt Sartre: Mein Faible für ihn hängt vielleicht weniger mit der Überzeugungskraft seiner Philosophie zusammen als mit dem Gefühl der Dankbarkeit dafür, daß der ferne Verbündete der fünfziger Jahre uns seinerseits die Treue gehalten hat, über Vietnam und Mai 1968 bis zu »Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt …« (»on a raison de se révolter …«).
Mit den ersten Reisen in dieses Land, »das das Andere all dessen war, was er war und kannte« (André Gorz), Geschichtslektionen, zu denen keine Schule imstande war: unvergeßlich der Augenblick, als der französische Autofahrer den Ärmel hochkrempelt und dem sechzehnjährigen deutschen Autostopper die eintätowierte KZ-Nummer zeigt und auf deutsch hinzufügt, daß er den Kindern der Henker nichts nachtrage. Die »Zeit des Ungeistes«, die mit dem »Zusammenbruch« zu Ende gegangen war und nun in nebelhafter Ferne lag, hatte sich unauslöschlich in eine Haut eingegraben, und der 1942 Geborene spürte, daß er etwas mit diesem Zeichen zu tun hatte, ohne es benennen zu können, weil niemand dazu etwas sagen konnte, die Versuchung, der Sprachlosigkeit durch Verleugnung zu entkommen, den Teil in mir, den die KZ-Nummer bezeichnete, zu hassen. Um so beneidenswerter wurde alles, was französisch war. André Gorz schreibt rückblickend auf die Zeit, als er noch als der österreichische Jude Gerhard Horst in einem Schweizer Internat lebte: »Denn vor dem französischen Absoluten war er nichts: ein kleiner Trottel, der sich im Finstern abstrampelte …« Nicht nur als ein kleiner Trottel fühlte ich mich, sondern auch als ein deutscher. Warum nicht zur Fremdenlegion gehen, die damals Nachschub für Algerien suchte, um diesen Makel loszuwerden? Aber die Angst war größer, und die pappelgesäumten französischen Nationalstraßen übten einen unwiderstehlicheren Reiz aus als die Aussichten auf ein unbekanntes Algerien, vor allem wenn die Straßen nach Paris führten.
Paris, durch die Filme der »nouvelle vague« hindurch betrachtet: reales Kino, Bombenattentate und Claude Lutters Jazz in der rue de la Huchette, Demonstrationen und schnippische Mädchen.
»Ich habe schon / 1963 gekündigt und fahre zum ersten Mal / nach Paris. Es ist eine Sensation. / Hans und ich finden zwei Huren für siebzehn Francs, / anschließend trinken wir Rotwein am Tresen, / reden über Rimbaud und stellen uns ab jetzt / unser Leben ganz toll vor.«
Überflüssig, hier noch eine individuelle Variante anzufügen; eine ganze Generation hat es so erlebt und nichts begriffen.
Kann man eine Stadt und ein Land überhaupt begreifen? Obwohl ich inzwischen sehr viel Zeit in Frankreich verbracht und viele Franzosen kennengelernt habe, bin ich nicht viel klüger geworden: Was Frankreich wirklich ist, gegenüber den Projektionen aus dem Elend der westdeutschen Restauration, weiß ich immer noch nicht. Was kann man von einem Land wissen? Je mehr ich im Lauf der Zeit gesehen habe, desto fragwürdiger ist mir die Wahrnehmung selbst geworden. Was bedeutet es, wenn etwas, das ich sehe oder höre, zum Resultat einer Analyse, zu einem Klischee, einem Vorurteil nicht paßt? Ist es eine Widerlegung? Dazu ist der Vorgang, bei dem eine Wahrnehmung entsteht, selbst viel zu schwankend. Damit die Wahrnehmung zustande kommt, muß etwas da sein, an dem sie sich abarbeiten kann – warum nicht auch Klischees und Vorurteile? Wenn in diesem Buch an die Stelle von Statistiken direkte Beobachtungen und individuelle Auskünfte treten, so wird damit nicht das Konkrete gegen das Abstrakte ausgespielt. Ich betrachte die Beobachtung lediglich als einen möglichen Zugang; er liegt, im Unterschied zu anderen, in meiner Reichweite.
Ich habe kein Buch über Frankreich zusammenstellen wollen und erst recht keines, das es besser wissen will als andere. Was ich zusammengetragen habe, sind Facetten von unterschiedlicher Farbe und Zeichnung. Ob sie zusammen ein Bild ergeben, ein französisches Bild, das hängt gewiß von den jeweiligen Vor-Bildern der Leser ab. Die Facetten und ihre Anordnung sind nicht die Arbeit eines Fachmanns, sondern eines Bastlers; und wie in jede Bastelarbeit hat die Person des Bastlers etwas von sich selbst hineingelegt. Das generelle positive Vorurteil gegenüber Frankreich, das man nicht mit jener Neurose namens »Frankophilie« verwechsein sollte, hat, wie gesagt, mit der Geschichte meiner Generation zu tun; anderes hängt mit Interessen, Neigungen, biographischen Zufällen zusammen. Hätte zum Beispiel Hans Magnus Enzensberger mich nicht aufgefordert, für die Zeitschrift TransAtlantik zur Abwechslung einmal einem politischen Kriminalfall, der de-Broglie-Affäre, nachzugehen, wären mir einige ziemlich aufschlußreiche Einblicke in die Zwischenetagen des giscardianischen Staatsgebäudes entgangen. Keine Recherchen und keine Lektüre haben aber einen solchen erheblichen Perspektivenwechsel erzwungen wie die ausgedehnten Aufenthalte in der französischen Provinz und die damit verbundenen Standortveränderungen: War das noch der Blick des Westdeutschen, vom »Modell Deutschland« trotz aller Abwehr geprägt, oder schon der des französischen Provinzlers (auf Zeit)?
An den Rändern der Zentrale
»Dieses verfluchte Paris! Eine zentralisierende, despotische Stadt, in der alles geplant, wie am Schnürchen geregelt wird.« Das schreibt Maria-Antonietta Macciocchi in Der französische Maulwurf. Jeder deutsche Französischlehrer hat Beispiele für den zentralistischen Despotismus parat: Wenn zwischen zwei Dörfern eine Brücke erneuert werden soll, hat die Pariser Verwaltung das letzte Wort. Das Budget, über das die Gemeinde verfügt, reicht gerade aus, um die Heizung im Rathaus und eine Schreibkraft zu bezahlen; alle anderen Ausgaben müssen beim Präfekten, das heißt dem Statthalter der Zentrale, beantragt werden. Das soll sich nach der von der neuen linken Regierung beschlossenen Dezentralisierung alles ändern. Der Provinzler auf Zeit allerdings fragt sich, ob der Pariser Despotismus, so wie er ihn erfährt, überhaupt reformierbar ist.
Er will ja keine Brücken bauen oder Dorfstraßen asphaltieren. Aber er hat sich auf eine Sendung von »France-Musique« gefreut und muß bei der Ansage hören, daß das Villa-Lobos-Konzert nur in der Pariser Region stereophon übertragen wird: 600 km von Paris entfernt nimmt der Gebrauchswert einer Stereoanlage spürbar ab. Gerade wenn sich die Medien Mühe geben, die Benachteiligung der Provinzler auszugleichen, machen sie sie erst recht deutlich. Rufen Sie an, heißt es vor Radiosendungen mit Hörerbeteiligung, mit R-Gespräch, »falls Sie nicht in der Pariser Region wohnen«. Der Ton, in dem diese Einschränkung ausgesprochen wird, ist unnachahmlich: Der ›gute‹ Radiohörer ist ohnehin nur in der Region von Paris zu finden. Die heimliche Ehrfurcht, mit der die Pariser Angelegenheiten immer verfolgt worden waren, verwandelt sich in der Provinz in eine verhaltene Wut. Nicht einmal die kapitalistische Markterschließung zeigt sich hier von ihrer verführerischen Seite – bis ein bestelltes Buch in dem Kleinstadtbuchladen eintrifft, vergehen mehrere Wochen.
Die Provinzler auf Dauer teilen diesen Groll nur selten; von Paris haben sie sich nie etwas versprochen außer Staatsakten. Paris ist für sie so weit entfernt, daß sich gleichzeitig die Distanz zu dem Ausländer zu verringern scheint: Als Fremde stehen Pariser und Engländer oder Deutsche fast auf derselben Stufe. Der Provinzler auf Zeit hat diesen Zustand zu schätzen gelernt, der die xenophobischen Reflexe der ländlichen Provinzbewohner gleichmäßig auf alle Landfremden verteilt und dadurch mildert; allerdings hat er sich auch die Vorstellung abschminken müssen, in den Provinzbewohnern schlummerten lauter verhinderte Aufrührer, die mit der geballten Faust in der Tasche dem Tag entgegenfieberten, an dem sich der Unmut der Provinzen im Aufstand entladen wird, wie seinerzeit in der Vendée, der Provence oder in Lyon. Die Entfernung zur Pariser Zentrale wird zwar als Maßeinheit einer Welt empfunden, in der die Willkür regiert, aber sie schafft auch Distanz zur Macht; jahrhundertelange Erfahrung hat die Provinzler gelehrt, daß die Zentralmacht nicht wie ein Panoptikum funktioniert – sie sieht nicht alles. Im Bischofssitz von Viviers an der Rhone scheint die Erinnerung an die viele Jahrhunderte zurückliegende Epoche noch lebendig zu sein, in der das Vivarais zusammen mit Arles zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehörte: Damals ging es uns gut, sagt der Priester, da war die Macht noch weiter weg. Der Provinz geht es aus denselben Gründen gut, aus denen es ihr schlecht geht: Schlecht geht es ihr, weil die Kraft zur Erschließung der Regionen von der Zentrale aufgesaugt wurde; in den letzten hundert Jahren hat das Departement Ardèche ein Drittel seiner Bewohner verloren, und im Tal des Flusses Ardèche ist die Trasse einer begonnenen und dann doch nicht eröffneten Bahnlinie als Symbol erlahmter Erschließungsenergie stehengeblieben. Wo die Bürger auf schlechten Straßen schlecht vorankommen, trifft aber auch die Macht auf Kommunikationsprobleme; Regionen mit löchriger Infrastruktur sind meistens auch Regionen verdünnter Kontrolle. Als beispielsweise der gefürchtete »lange Arm des Bundeskriminalamts« im Herbst 1977 sogar die entlegensten Cevennentäler nach deutschen Terroristen abtasten wollte, unter Einschaltung französischer »Amtshilfe«, kehrten die ortskundigen Gendarmen mit den Auskünften zurück, die sie wie gewohnt in den Dorfkneipen bekommen hatten. Wie Horst Herolds Datenverarbeitung die beim Rouge am Tresen gesammelten Daten verarbeitet hat, das wüßte ich heute noch gern. Zu behaupten, daß es der Provinz gut ginge, weil das Innenministerium weit weg ist, wäre natürlich übertrieben; ich will damit nur sagen, daß ich die Provinzler unter dem Zentralismus, der sie erst zu Provinzlern macht, nicht so habe stöhnen hören, wie man es sich als westdeutscher Föderalist gewöhnlich vorstellt.
Die schlimmsten Leiden, die der französische Zentralismus in seiner jakobinischen Form verursacht hat, ihre Homogenisierung zu Franzosen, haben die Provinzler im 19. Jahrhundert durchgestanden. Was hat, als vergesellschaftender Faktor, die Nachfolge angetreten? Der Warenmarkt natürlich und die Medien, das weiß jeder. Als Provinzler auf Zeit muß ich aber bei den Medien ein kleines Fragezeichen setzen: Außer der Sportzeitung Equipe wird in meiner Umgebung keine der Pariser Zeitungen gelesen; die regionalen Zeitungen – Le Progrès und Le Dauphiné libéré – kommen aus Lyon und Grenoble. Das Fernsehen: seine zentralisierenden Botschaften haben Mühe, durch die Filter der Provinzgewohnheiten zu den Augen und Ohren vorzudringen. Der Fernseher läuft zwar den ganzen Abend, aber ich habe niemals erlebt, daß sich die Bauernfamilien von ihm stören ließen; die Kinder schauen nur gelegentlich von ihren Schularbeiten auf, und das Gespräch bei Tisch wird nicht einem Film zuliebe unterbrochen. Fernsehen muß sein; aber man weiß offenbar nicht recht, weshalb. Die Lokalseiten der Zeitung dagegen werden mit großem Interesse gelesen. Warum aber soll jeder seine eigene Zeitung halten? Ist der Dauphiné ausgelesen, bringen die Kinder ihn beim Nachbarn vorbei.
Der Kritiker des Konsumismus kann gelegentlich ins Schwärmen geraten, wenn er entdeckt, mit welchem Beharrungsvermögen die Provinzler sich dem Diktat des Konsums widersetzen: Auf der Müllkippe hinterm Dorf habe ich noch nie etwas gefunden, das man brauchen kann (während wir uns aus dem heimischen Sperrmüll ganze Wohnungseinrichtungen zusammensuchen). Es wird repariert, gebastelt, geflickt, was das Zeug hält; auf den Müll wandern nur die zu nichts mehr verwendbaren Reste. Recycling und Selbstversorgung wurden hier praktiziert, lange bevor daraus städtische Schlagworte wurden. Daß die Bauern unter den Provinzlern sich vor allem mit dem ernähren, was sie selbst anbauen oder im Stall fettgefüttert haben, ist ein Gebot der bäuerlichen Ökonomie, kein Zugeständnis an die antikonsumistische Ökologie.
Dennoch hätte der wütende Pasolini an diesen französischen Bauern so wenig seine reine Freude gehabt wie an den Bauern der Abruzzen: Gerade weil sie keine gelernten Konsumenten sind, können sie den Verführungstechniken nicht widerstehen, derer sich die modernen Konsumpromoter bedienen. Da sich die weite Fahrt zum nächsten Supermarkt auch lohnen muß, kehren sie zurück, den Kofferraum vollgestopft mit billigem Ramsch; weil das japanische Walkie-Talkie im Sonderangebot so preiswert war, muß es mitgenommen werden; es existiert dazu kein Äquivalent, an dem es gemessen und bewertet werden könnte; für seine Unersetzbarkeit sind die zweihundert Francs kein zu hoher Preis. Daß das Walkie-Talkie nach vierzehn Tagen nicht mehr funktioniert und außerdem seinen Zweck nie erfüllt hat, weil seine schwache Leistung nicht in den Talgrund reichte, wo der Bauer bei der Arbeit erreichbar sein wollte, merkt er zu spät.
Der Provinzler auf Zeit fühlt sich da überlegen; er würde sich den Schrott nicht andrehen lassen, den die Centres Leclerc, Carrefours und Mammouths an die Einheimischen loswerden. Er hat dann viel Zeit gebraucht, um zu begreifen, daß die Mühe der Bastelei und Selbstversorgung, die er nicht kennt, den Wunsch hervorbringen kann, einmal aus dem Reich der Notwendigkeit und der Gebrauchswerte entlassen zu werden und sich durch den simplen Tauschakt den Zutritt zum Universum der Wünsche zu verschaffen. Es hat zuerst sein Geschmacksempfinden verletzt, wenn er eine Bauernküche betrat und den alten, rauchgeschwärzten Schrank durch ein Monstrum aus Resopal ersetzt sah, mit indirekter Beleuchtung für Hochzeits- und Kommunionsporträts; irgendwann aber hat er zu ahnen begonnen, daß die gebrauchten Formen, deren Lob er mit Bert Brecht so gern singt, für ihre lebenslangen Benutzer zum Symbol der Niederlage werden können – ihre Schönheit ist auch die Kehrseite unbeweglicher Verhältnisse.
Die Auswirkungen, die der Regionalismus der siebziger Jahre in der Provinz hinterläßt, sind von einer eigenartigen Ambivalenz aufgeladen. Eine Gruppe von Jugendlichen ist mit der traditionellen Kirchweih unzufrieden und hat ein alternatives Dorffest organisiert. Statt der üblichen Tanzkapelle spielt eine Folkloregruppe mit Drehleier und Dulcimer, und das okzitanische »théâtre de la Carriera« führt ein feministisches Theaterstück auf. Für ein Wochenende haben die Jugendlichen das Dorf in ein Museum verwandelt: Auf einem Brachfeld wird mit dem Ochsengespann gepflügt, im Gemeindesaal sind landwirtschaftliche Geräte von einst ausgestellt, Handwerker führen in Kleidern von 1900 die Künste ihrer Altvorderen vor. Die Touristen sind ebenso begeistert wie der Provinzler auf Zeit; so möchte er seine Provinz gern sehen: stolz auf ihre Eigenart, traditionsbewußt, resistent gegenüber dem Konformismus der Moden. Festlich gekleidet ziehen die Einheimischen durchs Dorf und loben die Initiative der Jungen: Das Jahr über ist so wenig los im Dorf, daß jede Abwechslung dankbar aufgenommen wird, auch die ungewohnte und provozierende. Am Abend sind alle Plätze vor der Freilichtbühne besetzt; die Touristen verstehen zwar kein Wort von den okzitanischen Dialogen, und die einheimischen Männer runzeln die Stirn, wenn auf der Bühne eine Frauenkommune das Erbe des verstorbenen Winzers übernimmt, aber der Schlußbeifall ist artig und herzlich. Bis zum nächsten Theater wird ein ganzes langes Jahr vergehen.
Vierzehn Tage später findet die traditionelle »vogue« statt, die Kirchweih, die früher mit der Verabschiedung der Rekruten zusammenfiel. Auf dem Dorfplatz spielt eine Kapelle unter rotierenden Strobolampen, an der Schießbude wetteifern die Bauern, als Jäger geübte Schützen, um die schönsten Plastikblumen, am Lottostand kann man mit ein wenig Glück einen Satz bunter Gläser gewinnen. Die Jüngeren tanzen auf der Straße, die Älteren gesellen sich zu wechselnden Gruppen, es geht laut, fröhlich, fast ausgelassen zu – und dem Beobachter fällt auf, wenn er sich an die Stimmung vierzehn Tage früher erinnert, wie vorsichtig, beinahe ängstlich sie sich damals in ihrem als Musuem hergerichteten Dorf bewegten. Es hat dann wieder eine Weile gedauert, bis ihm dämmerte, daß die Dorfbewohner nicht aus Konsumverblödung sich bei Flitterkram und hochgeregelter Bumsmusik wohler fühlen. Die Vergangenheit, der sie in den Ausstellungen des Jugendclubs begegneten, war ihnen noch nicht so ferngerückt, um sie souverän betrachten zu können. Wer sich noch an die Zeit – Anfang der fünfziger Jahre – erinnert, als der erste amerikanische Traktor ins Dorf kam, sieht das Ochsengespann mit anderen Augen als der Städter, der den Dieselgestank nicht mehr riechen kann. Es ist für die Dorfbewohner offenbar noch nicht so viel Zeit verstrichen seit dem kleinen Sprung nach vorn, den Technik und Konsum ermöglicht haben, um das Bedrohliche aus den Bildern einer idyllischeren Vergangenheit zu tilgen – die Drohung, die verfluchten alten Zeiten könnten wiederkehren. So fühlen sie sich vielleicht mehr bei sich, wenn sie von schlecht imitierter Radiomusik berieselt und von Discoleuchten angestrahlt werden, als vor Bildern ihrer selbst, die via städtische Nostalgie reimportiert worden sind. Das Authentische wird zum Entfremdenden, und das Surrogat – »l’Ersatz«, wie es seit der deutschen Okkupation in Frankreich heißt – zum Echten: eine der Formen von Ungleichzeitigkeit, die dem Provinzler auf Zeit erst nach Jahren aufgehen.
Pasolini und andere haben in ihrer blinden Wut auf den Konsumismus nicht sehen können, daß die bäuerlichen Kulturen wahrscheinlich schon früher verschwunden wären, wenn sie nicht ein Stück weit die Konsumgesellschaft in sich aufgenommen hätten. Wären die Touristen nicht ins Dorf gekommen, sagt die fünfundzwanzigjährige Jean-Marie, und hätten die Leute nicht gezwungen, sich an lange Haare, Ehen ohne Trauschein oder Frauen in Jeans zu gewöhnen, dann wäre ich schon längst abgehauen. Ist der Preis des Überlebens unausweichlich jene »Zerstörung der Kultur des einzelnen«, die im Supermarkt als Teilnahme an der gesellschaftlichen Kommunikation erworben wird?
Es gibt Provinzler, die die Supermärkte als eine Übergangserscheinung betrachten. Während die kleinen Läden unter der neuen Konkurrenz zu leiden haben, erfreuen sich die traditionellen Wochenmärkte tatsächlich nach wie vor großen Zulaufs. Die Quincaillerie, die zu meinem Lieblingsladen geworden ist, weil man dort nicht nur Werkzeuge und Zubehör in allen denkbaren Ausführungen, sondern auch fachmännische Ratschläge kaufen kann, hat ein Viertel ihres Umsatzes verloren, seit in der Nähe ein Heimwerker-Supermarkt eröffnet worden ist. Aber ihr Besitzer gibt sich gelassen: Ein paar harte Jahre, sagt er, müssen wir noch durchhalten, dann haben wir es geschafft; dann haben die Leute begriffen, was sie im Supermarkt alles nicht kaufen können; dann sind die Bohrmaschinen aus dem Sonderangebot kaputt und niemand kann dort zeigen, wie man die Kohlebürsten auswechselt. Unser Sonderangebot, das ist unser Wissen.
Der Besitzer der Quincaillerie ist übrigens Kommunist.
Kommunisten und Anverwandte
Für einen Bürger der Bundesrepublik Deutschland heute entspricht dieser Ladeninhaber genau dem Bild des Kommunisten, das er gern herbeizitiert, wenn er jemandem die Absurdität des sozialliberalen Radikalenerlasses klarmachen will. Monsieur Ressayre mit seinem unausrottbaren Glauben an die ausgleichende Kraft des Marktes – ein Element der »Subversion«? Wäre eine französische Regierung jemals auf den Gedanken gekommen, Kommunisten aus dem öffentlichen Dienst zu verjagen, dann wäre in »meiner« Gegend der Bahnhof seines Vorstehers, das Krankenhaus seines Direktors, das Atomkraftwerk seines Technischen Leiters beraubt – von verwaisten Schulen und Postämtern ganz zu schweigen. Aber wenn wir unter uns sind, machen wir uns über die französischen Kommunisten eben deshalb lustig, weil sie so ›staatstragend‹ sind.
Die Kommunistische Partei Frankreichs und die ihr verbundene Gewerkschaft CGT gehören für unsereinen – ich meine damit alle, die sich 1968 auch für die Bundesrepublik »französische Zustände« wünschten – seit diesem Mai 1968 zur Partei der Ordnung, die die Ruhe in den Fabriken wiederherstellte und de Gaulle vor dem Absturz bewahrte. Unsere Sympathien gelten der Gewerkschaft CFDT, die im Gegensatz zur CGT und KPF den aktiven Streik der Uhrenarbeiter von LIP in Besançon unterstützte und ein Konzept von autonomer Aktion der Arbeiter entwickelt hat; und sie gehören der linkssozialistischen Partei PSU, die 1958 gegen die zwiespältige Kolonialpolitik von SFIO und KPF gegründet worden war und als einzige linke Partei in Frankreich sich den Protest der Atomkraftgegner und Ökologen zu eigen gemacht hat. Der Provinzler auf Zeit muß allerdings zugeben, daß seine politischen Neigungen eher ein Hindernis waren bei dem Versuch, die politische Situation in der Region zu verstehen.
So hat er sich fast wie zu Hause gefühlt, als er ein Flugblatt der regionalen PSU in die Hand bekam, das zum Kampf gegen die in der Gegend besonders massierte Atomindustrie aufrief – bis er erfuhr, daß die PSU-Sektion aus zwei Leuten bestand, einem Lehrerehepaar. Die geliebte CFDT fand er in keinem hoffnungsvolleren Zustand; als sich während einer Demonstration vor dem Atomkraftwerk Tricastin, in dem man gerade Haarrisse an den Dampfleitungsstutzten entdeckt hatte, die Gewerkschaftsdelegierten zerstritten und die CGT nach Hause fuhr, blieb nur ein verlorenes Häuflein zurück, die regionale CFDT, verstärkt durch ein paar unermüdliche Atomkraftgegner. Alles stalinistisch verseucht, meldete sich der linksradikale Reflex.
Mit der Zeit (die meisten Wahrnehmungen sind eine Funktion der Zeit) kommt die Einsicht, daß die Wahl der Gewerkschaft und selbst der politischen Partei weit weniger eine politische Option ausdrückt als den sozialen Status. Nicht weil die Arbeiter in den wenigen Betrieben der Region allesamt Kommunisten wären, treten sie, wenn sie überhaupt in die Gewerkschaft gehen, der CGT bei, sondern weil sie Arbeiter sind; die CFDT, bis in die sechziger Jahre eine christliche Gewerkschaft, gilt in der Region als Gewerkschaft der Besseren, der Aufsteiger, der Neuankömmlinge, nicht als Arbeiterorganisation. Und weil die CGT als die Gewerkschaft angesehen wird, kann sie den Arbeitskämpfen konkurrenzlos ihren Stempel aufdrücken.
Aber was für einen. Als 1978 die Arbeiter einer Textilmaschinenfabrik in der Ardèche den zur Stillegung bestimmten Betrieb besetzten, war die CGT mit von der Partie; als sie den Betrieb schließlich in eigene Regie übernahmen, entzog die CGT die Unterstützung: Selbstbestimmung ist in ihrem Konzept nicht vorgesehen. Im Nachbardepartment Gard haben im Jahr 1980 Bergleute mit Unterstützung von CGT und KPF die Kohlengrube Destival bei Alès besetzt und den Abbau auf eigene Rechnung fortgesetzt: aktiver Streik nach dem Vorbild von LIP, dachte sich der Provinzler auf Zeit und fuhr hin. »Sprecht von uns«, war an die Mauer der Zeche geschrieben. Mit den Arbeitern zu sprechen war allerdings nicht vorgesehen; keiner der am Eingang versammelten Bergleute wollte oder konnte über den Kampf Auskunft geben: »Warten Sie auf den Gewerkschaftsdelegierten, der kommt um halb eins und erklärt alles.« Was für ein Unterschied zum Streik bei LIP! Kein Funktionär hatte dort das Privileg der Sprache, jedes Belegschaftsmitglied, das am Eingang zur Fabrik die Besucher empfing, ob Feinmechaniker oder Putzfrau, konnte die Geschichte des Kampfes erzählen und seinen Sinn erläutern und war stolz darauf, es zu können.
Daß in der Kommunistischen Partei derselbe Geist der Ordnung und Hierarchie regiert wie in der CGT, deren Boß Henri Krasucki ZK-Mitglied ist, weiß jeder, der sich ein wenig in der Szene auskennt. Die staatliche Elektrizitätsgesellschaft EDF zum Beispiel kann gar nichts Klügeres tun, als Leute von CGT und KPF auf verantwortliche Posten zu setzen: Statt die Konstruktionsgeheimnisse der (in amerikanischer Lizenz gebauten) Leichtwasserreaktoren an Moskau zu verraten, werden sie dafür sorgen, daß die atomkritische CFDT keine Nachrichten über Unfälle nach draußen trägt und die Atomenergie ins Gerede bringt. In »meinem« Department war es der kommunistische Bürgermeister der Kleinstadt Cruas, der die EDF dazu ermutigte, auf seiner Gemarkung ein Atomkraftwerk mit vier Reaktoren zu errichten. Wer von der Rhonetalbahn aus zwischen Valence und Montélimar die Betonfestung bestaunt, die mit ihren riesigen Kühltürmen die Gebirgsausläufer des Coiron überragt, sollte nicht vergessen, daß er das Resultat einer kommunistischen Initiative vor Augen hat.
Also doch: Partei der Ordnung und Staatsvermittlung? Doch was die KPF auf der Ebene der Politik an revolutionärer Glaubwürdigkeit einbüßt, gewinnt sie auf der Ebene des Alltagslebens. In der Region stellt sie die einzige, wenn auch minoritäre, Gegenkultur dar, deren Bedeutung mit dem Niedergang des katholischen Einflusses stetig zustimmt. Der säkulare Kampf zwischen Klerikalismus und Laizismus, der die ganze Dritte Republik in Atem hielt, wiederholt sich mit Generationenverspätung in der frommen Provinz. Hier ist die traditionelle laizistische Kulturorganisation »Oeuvres laïques« fest in den Händen der KP. Das attraktive Volksfest in der Region wird von der KP veranstaltet, die über ihre nationalen Kontakte berühmte Stars engagieren kann; der Chansonsänger Jean Ferrat selbst ist KP-Mitglied und Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in der Ardèche, die allerdings zum größten Teil aus Zweitwohnsitzen Pariser Intellektueller besteht.
Wer soll noch Trost spenden und Wunder versprechen in dieser von Inflation und Arbeitslosigkeit heimgesuchten Welt, nachdem auf der anderen Seite der Rhone die seit 1918 gelähmte Marthe Robin gestorben ist, die dank ihrer angeblichen Stigmatisierung zur Herrin über Dutzende von Internaten und Altersheimen aufgestiegen war? Wenn der wohnsitzlose Landarbeiter und der pensionierte Briefträger im Café sitzen und Georges Marchais auf dem Bildschirm anhimmeln, weil er es den Journalisten wieder einmal gegeben hat, dann mag zugleich die Ahnung von einer besseren Welt aufblitzen, in der die Beschissenen von heute die Logenplätze einnehmen werden. So wie der Papst zwischen irdischem Jammertal und himmlischen Reich vermittelt, so steht Georges Marchais in Kontakt mit jenem mythischen Land östlich jedes geographischen Ostens, das den Namen Sowjetunion trägt: Wenn L’Humanité Dimanche vom 1. Juni 1980 auf der Titelseite den Papst Johannes Paul II. und den KP-Chef beim Händedruck im Pariser Elysée-Palast zeigt, zeigt die Parteizeitung nicht das Zusammentreffen unvereinbarer Gegensätze, sondern die Begegnung Gleichrangiger: Botschafter ähnlicher Himmel. Die kommunistische Verwaltung des Arbeiterstädtchens Firminy bei Saint-Etienne hat konsequenterweise niemand anderen als den ersten sowjetischen Kosmonauten Jurij Gagarin zum Schutzpatron der neuen Sporthalle erwählt.
Schatten über der Vergangenheit von Georges Marchais, Krise des Marxismus, innerparteiliche Opposition, Rassismus in der KPF? Nichts als Pariser Querelen, Haarspaltereien der Theologen, die dem Kommunismus als Hoffnung und als Gegenkultur wenig anhaben können. Was geht es die Verdammten der Provinz an, wenn Anfang 1981 in Paris reihenweise alte Parteimitglieder, darunter die Schriftsteller Hélène Parmelin und Eugène Guillevic, die KP verlassen, die in der Pariser Region zur Jagd auf ausländische Arbeiter bläst? Als auf dem Kolloquium des linken Schriftstellerverbandes »Union des Ecrivains« die kommunistische Journalistin Catherine Clément das Verhalten ihrer Partei als faschistisch angriff (wofür sie am folgenden Tag aus der KPF ausgeschlossen wurde), regte sich im teilweise kommunistisch besetzten Saal nur dünner Protester kam von zwei Schriftstellern und KP-Mitgliedern aus Grenoble. Was man am Alpenrand für eine antikommunistische Veranstaltung hielt, war im Pariser Intellektuellenmilieu schon als von Moskau gesteuerte Versammlung gehandelt worden; einige Teilnehmer zogen deshalb die Zusage zurück, sich auf diesem Kolloquium »über aktuelle Aspekte des Faschismus« zu äußern. Was ist der französische Kommunismus, fragt sich der Provinzler auf Zeit und der Beobachter aus der Bundesrepublik, wenn der Kommunist Jean Elleinstein, der im Ruf eines führenden, selbstbewußten Dissidenten steht, einerseits zur Redaktion der KP-Zeitschrift Révolution gehört und andererseits im Figaro-Magazine, dem Zentralorgan der »Neuen Rechten«, eine wöchentliche Kolumne hält? Wo überhaupt ist Frankreich zu finden?
Paris, Paris
»Dort weht der Atem des Lebens, sagst Du mir, wenn Du von Paris redest. Ich finde, daß er oft nach verfaulten Zähnen riecht, Dein Atem des Lebens. Für mich steigen von dem Parnaß, zu dem Du mich einlädst, mehr Miasmen auf als Taumel. Die Lorbeeren, die man sich dort entreißt, sind, das wirst Du mir zugeben, ein wenig mit Scheiße bedeckt.«
So Flaubert an seinen Pariser Dichterfreund Maxime du Camp – der Provinzler auf Zeit, der früher ungeduldig die Kilometer gezählt hat, die ihn noch von Paris trennten, merkt auf einmal, daß der Provinzler Flaubert ihm aus der Seele spricht. Wenn er im Programm von »France-Culture« die Literaten miteinander streiten hört, amüsiert er sich über den aufgeregten Ton, der dem fernen Hörer signalisieren soll, daß in diesem Augenblick in diesem Pariser Studio die wichtigste Sache der Welt verhandelt wird. Der Provinzler kommt sich klüger vor: Was die Intellektuellen dort veranstalten, sagt er sich mit dem Blick auf den Kamm der Cevennen, ist nicht mehr als ein »bruit dans Landerneau«, mit anderen Worten, ein Sturm im Pariser Wasserglas. Selbst die zur Pariser Intellektuellen gewordene Maria-Antonietta Macciocchi notiert auf ihrer Reise durch die geographischen und gesellschaftlichen Provinzen: »Diese Stadt ist für mich in so weite Ferne gerückt, daß es mir zuweilen vorkommt, als könnte sie ebensogut in Belgien oder in Holland liegen.« Vorbei die Zeit, in der die Pariser Debatten mit der Ehrfurcht des Novizen verfolgt wurden, der im Geist schon am Sitz des Konzils lebt. Um Paris habe ich jahrelang einen Bogen gemacht. War ich einmal dort, dann fror es mich schnell; entgegen den Gesetzen der Physik schien mir die rasende Bewegung in dieser Stadt keine Wärme, sondern Kälte zu erzeugen. Ein Gefühl, mich immerzu falsch zu benehmen, den Code nicht zu beherrschen, der die Umgangsformen regelt; dazu das Gefühl der Armut – das gute Menü, das ich mir auf dem Land noch leisten kann, wird in Paris unbezahlbar. Oder flüchtet sich der Ausländer, der als Deutscher kein beliebiger Ausländer ist, in die Rolle des französischen Provinzlers, um sich nicht als ganz und gar Fremden erfahren zu müssen?
Den Zeitpunkt, an dem der Provinz-Reflex nicht mehr recht greifen wollte, kann ich datieren: Es war während des Pariser Faschismus-Kolloquiums im Februar 1981, veranstaltet von jenem Schriftstellerverband, der aus dem Mai 1968 hervorgegangen ist. Die »pariserischen«, die wichtigtuerischen und cliquenhaften Momente blieben zwar so wenig aus wie die theatralischen: Mehr als einmal wurde an das »Wachsamkeitskomitee antifaschistischer Intellektueller« erinnert, als schriebe man das Jahr 1934 und als stünde die Ausrufung der Volksfront auf der Tagesordnung. Aber zugleich wurde etwas von dem Ruf ganz real, den Paris als Metropole des Asyls genießt – eine Internationale der Emigranten aus aller Welt war da versammelt, von Carmen Castillo aus Chile bis hin zu Efim Etkind aus der Sowjetunion. Vladimir Pozner, der Mitstreiter Aragons und Nizans in den revolutionären Initiativen der dreißiger Jahre, nahm ebenso an der Debatte teil wie Arthur London, der Überlebende der Slánsky-Prozesse. Ein Stück Geschichte wurde auf diesem Pariser Podium lebendig, von dem Zaungast aus der Bundesrepublik mit Staunen und wachsender Beschämung verfolgt. Da wurde zwar Bert Brecht als Zeuge gegen Faschismus und Stalinismus aufgerufen, aber aus dem Lande Brechts war keiner der eingeladenen Autoren gekommen, um zu erfahren, was ihre Kollegen aus anderen Ländern aufschreckt.
Inzwischen hat auch der Pariser Internationalismus sein Gesicht gewandelt. Protestierte die Pariser Intelligentsia Ende 1981 noch laut und einmütig gegen die Ausrufung des Kriegsrechts in Polen, ganz im Gegensatz zu den kaum vernehmbaren deutschen Intellektuellen, so ist sie allmählich ebenfalls fast ganz verstummt. 1983 beklagte sich der Regierungssprecher Max Gallo, selbst Schriftsteller von Beruf, über das »Schweigen der Intellektuellen« und erhielt, wenn überhaupt, patzige Antworten.
Im Jahr 1960 war es eine Gruppe von Intellektuellen um den Sartre-Schüler Francis Jeanson gewesen, die kompromißlos gegen die französische Kriegsführung in Algerien Stellung bezog und in ihrem »Manifest der 121« zur Desertion aus der Armee aufrief; der Staat antwortete darauf mit Verhaftungen und Prozessen. Im Jahr 1983 dagegen verlangten Pariser Intellektuelle, ehemalige Rebellen von 1968, mehr französische Präsenz in Afrika, insbesondere ein massives militärisches Eingreifen im Tschad, der ehemaligen Sahara-Kolonie. Im März 1985 erschien ein von Eugène Ionesco, Bernard-Henri Lévy, den Ex-Maoisten Claudie und Jacques Broyelle und anderen unterzeichneter Aufruf, der an den amerikanischen Kongreß appellierte, mehr Mittel für den Kampf gegen den »Totalitarismus« zu bewilligen, und zwar nicht gegen den großen, sprich sowjetischen, sondern gegen die »totalitäre Partei« der Sandinisten in Nicaragua.
Wer von solchen französischen Entwicklungen berichtet, erntet in der Bundesrepublik allenfalls Schulterzucken. Was an Frankreich interessiert, sind nicht Land und Leute und ihre Politik. Es ist etwas ganz davon Abgehobenes, das »französische Denken«.
Franzosentheorie
»Schließlich scheint sich der Präsident darüber zu freuen, daß Frankreich im Bereich der Ideen und der Philosophie eine aktive Zahlungsbilanz aufzuweisen hat«, hieß es nach dem Frühstücksgespräch zwischen Giscard d’Estaing und Intellektuellen aus dem Kreis der »Neuen Philosophie« im Nouvel Observateur. Ein schwacher Trost trotz allem, denn wenn die Bundesrepublik auch zu den Hauptabnehmerländern französischer Ideen zählt, so kann der gestiegene Ideenexport die negative Handelsbilanz auf dem Sektor prosaischer Waren gewiß nicht ausgleichen.
Was diese Franzosentheorie genau ist, die dem Kenner das Wasser im Mund zusammenlaufen läßt, weiß zwar niemand, aber was damit gemeint ist, weiß jeder: ein flottierendes, sich dem analytischen Zugriff entziehendes, blitzschnell die Farbe und die Paradigmata wechselndes Denken, das mit Namen wie Georges Bataille, Michel Foucault, Félix Guattari, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, dem späten Roland Barthes, Luce Irigaray, Hélène Cixous, Bernard-Henri Lévy, Paul Virilio, Jean Baudrillard und anderen verbunden ist, aber in deren Texten bei weitem nicht aufgeht. Selbst wenn ein Text von keinem dieser oder anderen französischen Autoren gezeichnet ist, erkennt man seine Zugehörigkeit zur Franzosentheorie sogleich an der signifikanten Häufung von Begriffen wie »Fluchtlinien«, »Diskurs des Begehrens« »Machtdispositiv«, »Mikrophysik des Wunsches«, »Subversion«, »Rhizom«, Deterritorialisierung«, »Dezentrierung des Subjekts«, »Kriegsmaschine«, »Wunschmaschine«, »Implosion«, »Entgrenzung«, »Entregelung«… Es ist immerzu etwas in Bewegung in diesen Begriffen, weg von allen »Positivitäten«: Das für die Franzosentheorie chrakteristische Präfix ist das »Ent …« Die Franzosentheorie ist in erster Linie eine deutsche Ent-Deckung.
Wie jeder Nachfrage, so liegt auch der in den siebziger Jahren enorm gestiegenen Nachfrage nach »französischem Denken« eine Empfindung des Mangels zugrunde: Neue Erfahrungen, die gemacht wurden, ließen sich durch die ausgedörrte westdeutsche Theoriedebatte nicht mehr vermitteln. Der Marxismus hatte sich nach dem Aufbruch von 1968 ins Universitätsseminar zurückgezogen und war in diesem Milieu verkümmert; andere Denkinstrumente, psychoanalytische oder semiologische, waren aus den Verwaltungspalästen der Theorie kaum jemals herausgeschmuggelt worden. »Ja nichts Unreines, ja nicht in anderen Feldern tätig werden«, umschreibt einer der wenigen deutschsprachigen Grenzverletzer, der Soziologe und Schriftsteller Urs Jaeggi, die deutsche Mangellage. Als 1974 die deutsche Übersetzung des Anti-Ödipus herauskam, als Produkt der Zusammenarbeit eines Psychoanalytikers – Félix Guattari – und eines Philosophen – Gilles Deleuze – schon eine Herausforderung an den Sinn für Disziplin, konnte selbst der Rezensent der FAZ seine Begeisterung für das ganz andere französische Theoretisieren nicht verbergen:
»Auf der Strecke geblieben ist vor allem die Vorstellung, daß Theorie etwas Wohlabgewogenes, Gegliedertes, Widerspruchsfreies und gleichbleibend Anspruchsvolles sein müsse; denn was Deleuze / Guattari mit ›Anti-Ödipus‹ vor allem anderen vorführen, ist das Experiment einer unzensierten theoretischen Rede, in der die obszöne Anspielung genauso Platz hat wie die assoziative Verkettung von wissenschaftlichem Vokabular und Alltagssprache.«
Der Verfasser dieser Zeilen heißt Lothar Baier.
So wie Hunger nicht unbedingt der beste Koch ist (in jedem Fall ein schlechter Abschmecker), so schärft das Mangelgefühl nicht den kritischen Blick: daß Anti-Ödipus, im Untertitel »Kapitalismus und Schizophrenie« apostrophiert, den marxistischen Anleihen zum Trotz eine durch und durch idealistische Anthropologie wiedereinführt, hatte ich damals nicht gesehen, weil ich es nicht hatte sehen wollen. Und weil Deleuze und Guattari gegen die Zensur unserer Theoriesprache verstießen, fiel nicht weiter auf, wie eng sie sich an ihre Zensurgebote hielten: Bei allem Furor gegen die Freudsche Psychoanalyse vermieden es die Autoren sorgsam, sich mit deren gesetzgebendem Propheten Jacques Lacan anzulegen; Guattari wollte Mitglied von Lacans Ecole Freudienne de Paris bleiben. Die Sprache der Entregelung folgt durchaus einer Sprachregelung, die ja nicht dadurch unwirksam wird, daß man sie von außen nicht erkennt, weil sie quer zum eigenen Code verläuft. Entgangen ist mir (wie anderen deutschen Bewunderern des Anti-Ödipus) auch die Komik der Rolle, in die Deleuze und Guattari als Nomaden auf dem Weg zum »schizoiden Pol« geschlüpft waren:
»Biedere Philosophieprofessoren, von denen man so etwas nie gedacht hätte, wurden plötzlich zu Propheten der Schizophrenie. Einstige orthodoxe Marxisten suchten, der Ökonomie zum Trotz, das Universum mit dem Libidostrom zu benetzen: eine Vielzahl von Schreibern, Opfer der midlife-crisis, denen sich endlich das ›Begehren‹ offenbart hatte.«
Der strenge Cornelius Castoriadis, der diese geharnischte Bemerkung macht, repräsentiert, obwohl Pariser Politologe und Psychoanalytiker, sicher nicht Franzosentheorie. Was genau ist die Franzosentheorie? In Frankreich wird man es kaum erfahren; jedenfalls habe ich dort noch niemanden getroffen, der sich auch nur annähernd etwas unter dem vorstellen konnte, was bei uns als Franzosentheorie gehandelt wird. Deleuze und Guattari sind eben Deleuze und Guattari, man kennt Traditionen, Schulen, Cliquen und Institutionen – die Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales favorisiert offenbar ein anderes Denken als die Universität von Vincennes, jetzt Saint-Denis, die Sorbonne ein anderes als das Collège de France –, aber daß es zwischen diesem Klüngel und jenem aus jener Schule eine Gemeinsamkeit geben soll, die sich in einer besonders neuen und französischen Theorie ausdrückt, das hat keinem meiner Pariser Gesprächspartner einleuchten wollen. Ich neige also zu der Ansicht, daß die Franzosentheorie nichts anderes als eine deutsche Erfindung ist – vor allem Erfindung der deutschen Übersetzer.
Nicht daß es schlicht an deren Unfähigkeit läge – obwohl der Merve Verlag, der Hauptimporteur für Franzosentheorie, das ärmliche Äußere seiner Franzosenbücher durch die Inkompetenz seiner Übersetzungen oft noch in den Schatten stellt. Um das Franzosendenken zu vermitteln, haben die Übersetzer eine ganz eigentümliche Sprache erfunden, die natürlich nicht französisch ist, aber auch nicht deutsch, eine Kunstsprache, die dann jenes fiktive Franzosentheoretische erst produziert, das die Autoren im Original keineswegs miteinander gemeinsam haben. Als Sprache zwischen den Sprachen läßt sich auf ein geheimnisvolles Zwischen-Denken schließen, das nicht genau sagt, was es meint, und dabei ahnen läßt, daß es das, was es meint, nur als Ungesagtes sagen kann.
»Das Dispositiv der Sexualität« – so ist der zweite Teil von Foucaults Sexualität und Wahrheit überschrieben. Was ist ein »Dispositiv«? Was Foucault damit meinen könnte, geht zwar aus dem Kontext hervor; aber zugleich deutet das deutsche Kunstwort »Dispositiv« an, daß die Sache, die es bezeichnet, etwas ganz Unerhörtes, Bedeutungsprengendes ist, das nach dem unerhörten neuen Wort verlangt. Im Französischen dagegen kann »le dispositif« den ganz banalen Alltagssinn niemals loswerden, der seinen Gebrauch in Foucaults Theoriesprache mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch rückkoppelt: Wenn etwa die Polizei ihre Schlägertruppen gegen Demonstranten aufmarschieren läßt, dann heißt es in der Nachrichtensprache, die Polizei habe »ses dispositifs« – ihre Vorkehrungen – getroffen. Aus den deutschen »Macht- und Sexualitätsdispositiven« ist jener Erdenrest getilgt, der den Reichtum des französischen Originals ausmacht.
Das gilt genauso für den »Diskurs«, das untrügliche Symptom für das Wirken von »Franzosentheorie«. »Le discours« mit »Diskurs« zu übersetzen, mag in den Fällen sinnvoll sein, in denen, etwa bei Foucault und Derrida, »le discours« in einem ganz präzisen Sinn, abgegrenzt von ›Text‹, ›Sprache‹, ›Denken‹ verwendet wird. Sonst aber zeugt »Diskurs« von der Denk- und Sprachfaulheit der Übersetzer, die sich die Suche nach deutschen Äquivalenten für die gewöhnlichen Bedeutungen von »discours« sparen und gleichzeitig vom Prestige einer elaborierten Theoriesprache profitieren wollen. Heraus kommt die pure Hochstapelei. In der deutschen Übersetzung der Schriften Laures, der Freundin Batailles, hatte die Franzosentheorie sogar bis in die dreißiger Jahre zurückgewirkt: Der Volksfront-Politiker Sarraut, heißt es dort, habe einen »Diskurs« gehalten. Ob er bei Foucault oder seinen Übersetzern in die Schule gegangen war?
»Sein oft sehr lebhaftes Unbehagen – das manchmal, nachdem er den ganzen Tag geschrieben hatte, bis zu einer Art Angst ging – kam daher, daß er das Gefühl hatte, einen doppelten Diskurs zu produzieren, dessen Modus gewissermaßen die Blickrichtung überschritt: denn das Augenmerk seines Diskurses ist nicht die Wahrheit, und dennoch ist dieser Diskurs assertiv.«
Was ist ein »assertiver Diskurs«, was unter einem »Modus« des Diskurses zu verstehen, der die Blickrichtung überschreitet? Statt den Text des Autors Roland Barthes zu übersetzen, hat der Übersetzer Franzosentheorie produziert, mit anderen Worten: eine Sammlung großer Worte angelegt, die, wie Barthes einmal gesagt hat, »lediglich die Löcher im Denken verstopfen«.
Die Kunstsprache der Franzosentheorie hat gegenüber anderen Sprachen den Vorzug daß man in ihr schreiben kann, ohne in ihr denken zu müssen, und diese Chance hat sich eine ganze Reihe deutscher Schreiber nicht entgehen lassen. So haben sich ordentlich beamtete Soziologie- oder Philosophieprofessoren in Verfertiger nomadisierender »Diskurse« verwandelt, die sich dann wie schlechte Übersetzungen aus dem Französischen lesen – wobei unglücklicherweise das Original verlorengegangen ist. Wie zu Heines Zeiten gibt es in Deutschland wieder eine »französische Partei«, die allerdings um so deutscher wirkt, je französischer sie sich auszudrücken glaubt; denn, wie gesagt, die Franzosentheorie ist made in Germany. Was die da drüben können, mag man sich gesagt haben, können wir im Lande Hegels und Nietzsches auch; der via Franzosentheorie rückübersetzte Nietzscheanismus wirkt aber nicht weniger schwerfällig als der in der DDR aus dem Russischen rückübersetzte Sowjetmarxismus. Wollten Alexander Kluge und Oskar Negt mit Geschichte und Eigensinn nicht ein bißchen den deutschen Anti-Ödipus schreiben? Das erklärt manches …
Die Franzosentheorie läßt aber nicht nur einheimische Buchreihen und Zeitschriften überleben, sie fördert auch eine neue Art von Paris-Tourismus. Ein ferner Bekannter, den ich vor Jahresfrist in der rue Soufflot traf, kam gerade von der Foucault-Vorlesung im Collège de France und war auf dem Weg zur Ecole Normale in der rue d’Ulm, um Jacpues Derrida zu hören, und unterwegs wollte er sich die neueste Nummer der Zeitschriften Traverses und Tel Quel kaufen, denn er war, wie er sagte, über Frankreich nicht mehr ganz auf dem laufenden. Warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, entsprechende Pauschalreisen zu organisieren. Händedruck von Baudrillard oder, ersatzweise, Glucksmann inbegriffen? Dem Kunden der Franzosentheorie-Tours sei allerdings empfohlen, möglichst wenig Sprach- und Landeskenntnisse mitzubringen; sie sind nur unnötiger Ballast und könnten den libidinösen Gewinn der Reise gefährden.
Sonst könnte es ihm wie dem allzu gut Französisch verstehenden Berliner Dozenten Oskar Sahlberg ergehen, der einige der Stars der Franzosentheorie zufällig dozieren hörte und später seinem Pariser Freund, dem Lyriker Alain Lance, Bericht erstattete:
»Der Professor zitierte mehrfach das 1936 erschienene Buch eines deutschen Theologen über die Tauftheorie, er sprach auch über Nietzsche und den Heiligen Augustinus. Auf einmal fiel mir die Vorlesung des anderen Professors mit Mallarmé und Proust, dem Adel und dem Ruhm wieder ein, der Gedanke der ewigen Wiederkehr ergriff von mir Besitz, und dann habe ich selbst einen Bruch, einen Rückfall verspürt, ein Gefühl des déjà vu überschwemmte mich: all das hatte ich schon einmal gehört, Mitte der fünfziger Jahre an der Münchner Universität, mitten in der Restauration, als die Literaturwissenschaft der reinen Kunst einen Kult darbrachte und die Philosophie die Theologie feierte.«
Oskar Sahlberg übertreibt vielleicht ein bißchen, und Cornelius Castoriadis urteilt für meinen Geschmack ein wenig zu streng, wenn er die Franzosentheorie ein Werkzeug nennt, »das dazu dient, die Ausgeflippten wieder einzufangen, die individuelle und gesellschaftliche Entfremdung zu befestigen, die immer wieder auflebende Kritik am Bestehenden in Sackgassen zu lenken.« Aber recht hat er, wenn er von ihrer »Leere der Signifikate« spricht: Das Wenige an Originaltext, das hinter der Franzosentheorie fabriquée en Allemagne steckt, hat mittlerweile jede Beziehung zu einem Signifikat verloren. In Paris haben die Paradigmata gewechselt: Die Modelle der Thermodynamik und der Gödelschen Mathematik scheinen die Dispositive und Mikrophysiken des Begehrens abgelöst zu haben. Nicht der »Diskurs« vom Ende der Geschichte, sondern die historische Forschung der Annales-Schule steht hoch im Kurs. Und, merkwürdig genug für unsereinen, Adornos Minima moralia und die Dialektik der Aufklärung, vor kurzem übersetzt, finden in Frankreich begeisterte Leser.
Die Franzosentheorie, die mit Frankreich so viel zu tun hat wie das Franzosenbrot aus dem deutschen Kaufhaus mit der Baguette aus meiner Boulangerie, sollte man, finde ich, vor allem mit Humor und Nachsicht behandeln; eine Theorie des Wunsches, hatte Guattari schon beim Erscheinen von Anti-Ödipus gesagt, »sollte sich nicht als etwas sehr Ernstes präsentieren«. Bei den Gesprächen mit Intellektuellen in Paris und Freunden in der französischen Provinz habe ich den Eindruck gewonnen, daß Leute mit den meinen vergleichbaren literarischen und theoretischen Interessen das alles nie sehr ernstgenommen haben. Jean Baudrillard zum Beispiel, der in süddeutschen Weinstuben als Pionier des zeitgenössischen Nihilismus gefeiert wird? Nichts weiter als ein frustierter Exkommunist, der sich dafür rächen will, daß er jahrelang im Dienst der KPF Frühschriften von Marx übersetzte. Ein bißchen mehr, denke ich, ist er schon, und ich kann auch nicht die oft gehörte Meinung teilen, daß Roland Barthes in seinen letzten Büchern zur Karikatur seiner selbst geworden sei; aber daß wir den Lärm aus der »ideologischen Blechschmiede von Paris« (Castoriadis) weit überschätzen, weil unser exotisches Bedürfnis nach schrillen Tönen verlangt, das ist mir im Umgang mit französischen Freunden klargeworden.
Was sie in den letzten Jahren beschäftigt hat, das ähnelt weit mehr unseren Debatten, als sich die deutschen Bewunderer des neuen französischen Denkens träumen lassen. Ging es in der Bundesrepublik um den Überdruß an der Theorie, wurde in Frankreich über die Anti-Denken-Kampagne gejammert, die die »Neue Philosophie« gestartet hatte. Literarische Restauration hier, literarische Restauration dort. Krise des Marxismus. André Gorz’ Abschied vom Proletariat, Diskussionsgegenstand hier wie dort. Nazinostalgie, Wiederaufleben des Antisemitismus, Psychoboom, Rassismus unter dem Deckmantel der Biologie. Dabei ist mir allmählich aufgegangen, an wie vielen Orten, in was für vielfältigen Gruppen und Initiativen gearbeitet, nachgedacht, geschrieben und gestritten wird – weshalb sich dann für ein paar Vorlesungen am Collège de France interessieren, nur weil sie mit etwa zehntausend Francs pro Stunde zu den bestbezahlten Pariser »Diskursen« gehören?
Die Ähnlichkeit war aber auch eine Illusion, denn sie hat die völlig gegenläufigen politischen Entwicklungen verdecken können. Die Franzosentheorie, um ein letztes Mal darauf zurückzukommen, hat erst recht in die Irre geführt. Am Schluß seines Essays Im Schatten der schweigenden Mehrheiten, abgedruckt in den beiden ersten Nummern der Zeitschrift Freibeuter, hatte Baudrillard großspurig verkündet:
»Trotzdem sollten wir der unglaublichen Naivität des sozialen und des sozialistischen Denkens ein gerührtes Andenken bewahren, daß es seine so total zweideutige und widersprüchliche, schlimmer noch: eine so residuale und imaginäre, ja noch schlimmer: eine schon jetzt in ihrer eigenen Simulation vernichtete ›Realität‹ wie das Soziale derart im Universellen hypostasieren und zum Ideal der Transparenz erklären konnte.«
Jean Baudrillard läßt sich heute nicht mehr gern daran erinnern, daß er vor 1968 nicht nur Marx, sondern auch die politischen Stücke von Peter Weiss übersetzt hatte. Er war auch mit gemeint, als Michel Foucault kurz vor seinem Tod im Juni 1984 schrieb: »Wir alle haben genug von diesen Konvertiten des Marxismus, die lärmend ihre Prinzipien und fundamentalen Werte auswechseln, aber im ›Figaro‹ von heute ebenso grob denken wie in der ›Nouvelle Critique‹ von gestern.«
»Man kann wieder atmen in Frankreich«
»In Frankreich haben WIR also gewonnen; so wenigstens empfinde ich das – ich war in der berühmten Nacht bei der Bastille. Ganz unbeschreiblich. Zurück in der fürchterlichen Schweiz, muß ich konstatieren, daß überhaupt nichts von dem, was jetzt in Paris und der Provinz passiert, in die deutschsprachigen Zeitungen dringt. Eine wirkliche Misere.«
So schrieb mir Niklaus Meienberg kurz nach Mitterrands Wahl und sprach damit auch meine Empfindungen aus: Ich hatte die Wahl zwar nicht in Paris, sondern in der Provinz miterlebt, aber auch dort hatte ich mich dem plötzlichen Klimawechsel nicht entziehen können. In den letzten Tagen vor dem entscheidenden zweiten Wahlgang waren die Klebekolonnen der Rechten übers Land hergefallen, hatten »Mitterrand – Mörder« an jede kleine Mauer gesprüht und an abgelegenen Feldwegen Giscard-Plakate aufgehängt, als müßten auch die Rebhühner und Wildschweine mobilisiert werden. Doch es hatte alles nichts genützt: Selbst »mein« Winzerdorf stimmte mit großer Mehrheit für Mitterrand. Und das Departement Ardèche, ländlich, fromm und seit jeher ein sicherer Hort der Rechten, war bis auf einen Wahlkreis im Norden nach links gekippt. Es regnete in Strömen an diesem Wahlsonntag: »Das sind die Tränen von Giscard«, sagte der kleine Sohn eines Bauern, noch bevor die Stimmen ausgezählt waren. Daß etwas in der Gesellschaft aufgebrochen war, fiel mir unterwegs im Zug und in Kneipen auf. Die Leute redeten miteinander, so ungezwungen und offen, wie ich es vorher nie erlebt hatte. An der Grenze waren die Verhältnisse ganz auf den Kopf gestellt: Nicht unsereinem galt wie üblich das Interesse der Zöllner, sondern den distinguierten Herren mit den Diplomatenköfferchen, die auf einmal wie potentielle Devisenterroristen behandelt wurden.
In den deutschen Zeitungen, die ich zu Hause nachlas, fand ich, wie Niklaus Meienberg, nichts von alledem wieder. Die Berichte über den Wahlsieg Mitterrands lasen sich, als wären sie nicht im Nachbarland, sondern irgendwo im amerikanischen Mittelwesten geschrieben worden. Die Zeit jener Woche zeigte Helmut Schmidt und Margaret Thatcher mit betretenen Gesichtern; ihr Gipfelgespräch über den EG-Haushalt, hieß es in der Bildunterschrift, sei von der Wahl François Mitterrands »überschattet« worden. Daß die Politiker es nicht mögen, wenn sich in ihrer Umgebung etwas ändert, und ginge es dabei auch um den Sturz eines faschistischen oder stalinistischen Diktators, an den man sich eben gewöhnt hat, versteht sich von selbst; nun aber benahmen sich auch die Journalisten wie kleine Kanzler, spielten den Machtwechsel in Paris zum beiläufigen Minister-Revirement herunter und taten im übrigen so, als seien sie mit Giscard d’Estaing persönlich befreundet gewesen. Bloß in den Artikeln der linken tageszeitung erkannte ich etwas von dem wieder, was ich nach der Wahl gespürt hatte: »Man kann wieder atmen in Frankreich«, hieß es dort kurz nach Mitterrands Sieg.
Gerade weil inzwischen längst wieder der Alltag eingekehrt ist mit seinen unveränderten Inflationsraten und Steigerungen der Arbeitslosigkeit, scheint es mir angebracht, den Alptraum in Erinnerung zu rufen, den der linke Wahlsieg in Frankreich unwiderruflich beendet hat. Die Reportage über die de-Broglie-Affäre vermittelt vielleicht eine Ahnung von der Realität, an der sich der giscardianische Alptraum entzündete. »Wir haben keine Berufsverbote wie bei euch«, sagte der Soziologe Alain Touraine in einem Gespräch mit der tageszeitung im Januar 1981, »aber wir haben dafür etwas anderes, was in dieselbe Richtung läuft. Die Reform des Strafgesetzbuches, die Maßnahmen gegen Gastarbeiter, die Zusammenarbeit von Polizei und Faschisten, der Antisemitismus etc.« Die von der Giscard-Regierung kontrollierten Medien schürten Ende der siebziger Jahre eine Bedrohungshysterie, um dann als Therapie eine neue Repressionspolitik unter dem Namen »Sicherheit und Freiheit« zu offerieren; ihre bevorzugten Opfer wären streikende Arbeiter, Autonomisten und AKW-Gegner gewesen. Nicht mehr der republikanische Begriff der »sûreté« wurde gebraucht, wenn von Sicherheit die Rede war, sondern der militärische der »sécurité«. Kritische Militärs wie der Admiral Sanguinetti beschuldigten Giscard d’Estaing, die Armee unter der Hand von einem Verteidigungsinstrument in eine Maschine zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit zu verwandeln: Große Truppenteile wurden aus den grenznahen Garnisonen abgezogen und überall im Land verteilt, zur Verhinderung sowjetischer Infiltration, wie es hieß. Auch eine Ahnung von Berufsverbot zog Ende 1980 durch Frankreich: Der Richter Bidalou wurde entlassen, als er seine Rechtsprechung offen sozial begründete.
Was für ein Aufatmen bei den französischen Freunden, als das Gespenst eines Giscardo-Pétainismus, den viele kommen sahen, am 10. Mai verjagt war – nicht nur aus Empathie, sondern auch im eigenen Interesse habe ich mit aufgeatmet. Seit der lange Arm der Bundesanwaltschaft nicht mehr gestreichelt wird, sondern eins auf die Finger kriegt, wenn er sich über die Grenze ausstrecken will, habe ich das Gefühl, daß es im Westen einen wirklichen Zufluchtsort gibt; die Schriftstellerin Katharina de Fries hat es schon zu spüren bekommen, daß sich etwas Entscheidendes seit der Zeit geändert hat, als Klaus Croissant und andere auf einen Wink aus Bonn hin ohne Federlesens ausgeliefert wurden.
Seit 1984 allerdings macht das Asylland Frankreich Anstalten, sich dem zu öffnen, was die Regierung Giscard d’Estaings vor 1981 den »europäischen Rechtsraum« nannte, mit anderen Worten, das Asyl für Europäer einzuschränken. 1984 wurden, begleitet von Protesten, drei in Frankreich festgenommene Basken, Mitglieder der ETA, an Spanien ausgeliefert. Robert Badinter, der, Anwalt vor seiner Ernennung zum Justizminister, seinerzeit gegen die Auslieferung seines Kollegen Croissant aufgetreten war, begründete den Bruch mit einer alten Tradition auf eine Weise, die fatal an das »Modell Deutschland« erinnert. Wer in einer demokratischen Gesellschaft Gewalt anwendet, erklärte Badinter nach der Auslieferung sinngemäß, hat, weil er dadurch die Demokratie selbst angreift, das Recht auf Asyl genauso verwirkt wie der Königsmörder von ehedem, der auch in der guten alten Zeit der russischen Revolutionäre und französischen Kommunarden kein Asyl erhielt.
Dem Justizminister, der seit seinem Amtsantritt als Vertreter einer laschen, viel zu weichen Justiz angegriffen wird, hat diese härtere Gangart trotz allem keinen großen Beifall eingebracht. Badinter, im Gegensatz zu vielen seiner Ministerkollegen seit Mitterrands Machtantritt im Amt, ist nach wie vor die bevorzugte Zielscheibe von Angriffen der Opposition, die eigentlich der gesamten Regierungspolitik gelten. Was hat die Franzosen damals, 1981, dazu bewogen, fragt sich der Außenstehende manchmal ratlos, eine Linke zu wählen, die heute als Inbegriff allen Übels verteufelt wird? An einen Sieg dieser Linken schien damals im übrigen kaum jemand geglaubt zu haben.
Von einer Aufbruchstimmung, wie sie der dann verlorenen Wahl von 1978 vorausging, war Anfang 1981 überhaupt nichts zu spüren gewesen. Ein Wahlsieg der Linken schien demnach nicht nur ausgeschlossen, er war eigentlich unerwünscht. Maurice Clavel, der Guru der »Neuen Philosophie«, hatte beispielsweise schon 1976 erklärt, daß es »kein besseres Regime für die Arbeiterklasse als das Regime von Giscard« gibt. In der Hauspostille der Linken, dem Nouvel Observateur, hat man nach Auskunft des Journalisten Olivier Todd zwar linke Reden geführt, insgeheim aber Giscard gewählt. Noch im Januar 1981 traute Alain Touraine im Gespräch mit der tageszeitung der Sozialistischen Partei, mit der er sympathisiert, alles mögliche zu, nur nicht den Sieg und die Regierungsfähigkeit. Wer sich auf die Gazetten verließ, mußte den Eindruck gewinnen, daß Frankreich dem Schicksal nicht entrinnen konnte, endgültig zu der von einem byzantinischen Klüngel regierten Giscardie zu werden.
Daß es Zeichen gab, die in die Gegenrichtung wiesen, fiel mir nicht auf, weil ich sie nicht als Zeichen wahrnahm. Um etwas zu merken, muß man allerdings auch merken, daß man etwas merkt; bei den Recherchen zu der de-Broglie-Reportage war mir zum Beispiel aufgefallen, in welch verächtlichem Ton Gesprächspartner, die durchaus zur herrschenden politischen Klasse gehörten, über das Giscard-Regime sprachen .. nein, es war mir eben nicht aufgefallen, ich hatte es nur registriert, ohne dabei etwas zu merken. Daß etwas nicht mehr stimmte, hätte ich spätestens zu dem Zeitpunkt merken müssen, als man in der rechten Kneipe im Dorf damit anfing, den Ton abzustellen, sobald Giscard d’Éstaing im Fernsehen erschien und dazu Grimassen schnitt. Aber ich wollte meinen Augen nicht trauen und lieber dem Pariser Gerede glauben. In ihm war allerdings auch eine Bemerkung untergegangen, die beizeiten, da 1974 niedergeschrieben, eines besseren hätte belehren können:
»Es hieße auch vergessen, daß es ein Land gibt, das die Theoretiker schon öfter überrumpelt und manches gelehrt hat, das Land, in dem die Klassenkämpfe jedesmal mehr als irgendwo sonst bis zur vollen Entscheidung geführt wurden, in dem der utopische Sozialismus geboren und der wissenschaftliche erprobt wurde, die wahre Heimat des Sozialismus – wir meinen Frankreich – und wo die Lösung des Rätsels eines Tages gefunden werden könnte.«
Régis Debray, der Autor dieser Zeilen, hat 1981 einen Beraterposten im Pariser Elysée-Palast angenommen und, etwa bei der Auslieferung Klaus Barbies aus Bolivien, seine alten Beziehungen spielen lassen. Ende 1984 jedoch hat er sich von Mitterrand verabschiedet. Verläßt eine Ratte das sinkende Schiff? Die Kämpfe in einem Land mit zweienhalb Millionen Arbeitslosen und einer negativen Handelsbilanz drücken sich zweifellos anders aus, als sich das ein französischer Sozialist wünschen kann. Ein französischer Sozialist weiß aber auch, daß er sich immer wieder überraschen lassen muß.
Blick zurück vom Zaun
Mit Mitterrand ist jenes gute alte Frankreich zurückgekehrt, scheint es, das wir aus der deutschen Misere heraus immer bewundert haben, das Frankreich der Erklärung der Menschenrechte und des aufgeklärten Laizismus der Dritten Repbulik; aber jenes andere, gute alte Frankreich, das uns insgeheim vielleicht noch mehr am Herzen lag, das ein wenig angeschmuddelte, umständliche, Nischen in der Modernität versprechende Frankreich, ist, mit oder ohne Mitterrand, im Verschwinden begriffen. Während die Bundesrepublik nach Beseitigung der Kriegstrümmer in einem Zug industriell und städtebaulich nach amerikanischen Patenten modernisiert wurde, schien Frankreich jahrzehntelang gegen diesen Amerikanismus resistent zu sein. Statt ganze Viertel abzureißen, renovierte man, unter dem bewunderten Kulturminister André Malraux, liebevoll die historischen Gebäude – allerdings stellte sich später heraus, daß eben unter Malraux und de Gaulle auch jene Pläne geschmiedet worden waren, nach denen die Seinequais inzwischen in Asphaltwüsten und die Pariser Randbezirke in Kopien von Atlanta/Georgia oder Columbus/Ohio transformiert worden sind.
In den siebziger Jahren sah es auf einmal aus, als sei ein Damm gebrochen und als ergieße sich eine seit langem angestaute Modernisierungswoge über das Land. Wenn man mehrmals im Jahr dieselbe Strecke fährt und sich, zur Strukturierung der langen Zeit, an einer Kette optischer Signale orientiert, registriert man empfindlich die geringste Veränderung: Waren bislang von einer bestimmten Hügelkuppe aus schon die Konturen der fernen kleinen Stadt zu erkennen gewesen, so versperrte auf einmal ein mitten in die Landschaft gesetztes Möbelkaufhaus den Blick. Als 1973 die LIP-Arbeiter mit Plakaten und Graffiti überall auf ihren Kampf um den Arbeitsplatz aufmerksam machten, verschonten sie bewußt die alten Mauern in Besançon; die Konzerne, die die Stadt am Doubs inzwischen mit ihren »Hyper-Markt«-Städten eingekreist haben, scherten sich einen Dreck um solchen historischen Respekt.
Die Fahrt über die Nationalstraßen ist für mich aber nach wie vor eine Erholung gegenüber der Fahrt auf den neuen Autobahnen: Sie gleicht einem Horrortrip durch ein Konglomerat aus Disneyland und Volkshochschule für Analphabeten. Zuerst signalisieren bunt angestrichene Betonröhren längs der Piste, daß der zahlende Kunde eine ästhetische Erziehung geboten bekommt, die von der glücklichen Vermählung der Kunst mit der Technik kündet. Dann beginnt die kulturgeographische Unterrichtung des Autofahrers: Fährt er zwischen Viehweiden hindurch, weisen ihn riesige Tafeln darauf hin, daß es sich um »Viehzucht« handelt; ragt auf der einen Seite eine Zementfabrik mit der Leuchtschrift »Ciments de Champagnole« auf, so erklärt das Schild auf der andere Seite, daß hier eine »Zementfabrik« arbeitet. Damit niemand die Obstplantagen des Rhonetals mit den Baumwollfeldern der amerikanischen Südstaaten verwechselt, wird klargemacht, daß hier »les fruits de la vallée du Rhône« wachsen – solche Klarstellungen sind allerdings auch nötig, denn die Architektur der Raststätten und Tankstellen könnte auch aus Alabama stammen.
Der Modernisierungsschub, dem der Ruf vorausgeht, den Ablauf des Alltagslebens schneller zu machen, verlangsamt ihn manchmal erst recht: Seit es schick geworden ist, bargeldlos zu zahlen, sind die Schlangen an den Kassen erheblich länger geworden, weil jetzt jeder erst seinen Scheck ausfüllt, um ein Paket Waschmittel und einen Salatkopf zu bezahlen. Noch koexistiert die avancierteste Großtechnologie mit der Schlamperei der Pionierzeit – wenn ich ein Stück vors Haus gehe, sehe ich die Dampffahnen, die aus der größten europäischen Urananreicherungsanlage aufsteigen; wenn jedoch der Mistral kräftig bläst, oder sich ein Gewitter entlädt, bricht die gesamte lokale Stromversorgung zusammen. Ich fürchte nur, daß über kurz oder lang eher Mikroprozessoren die Stromversorgung in Gang halten, als daß die Uranfabrik stillgelegt wird.
Modernisiert wird nicht erst seit 1981, der Superschnellzug TGV