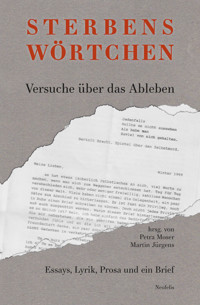11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In Südfrankreich – eine gute Autostunde von Avignon entfernt in einem Rhône-Seitental gelegen – hat ein Deutscher ein verfallenes Bauernhaus gekauft, das er allein und mühsam bewohnbar macht. Er hat sich die Frist von einem Jahr gegeben, um das nötige Handwerk zu erlernen und die wichtigsten Arbeiten zu bewältigen. Daheim vor allem mit Büchern beschäftigt, lernt er hier das Wetter und die Natur beobachten und, am Rande der Zivilisation, mit der Einsamkeit fertig zu werden. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Ähnliche
Lothar Baier
Jahresfrist
Erzählung
FISCHER Digital
Inhalt
Für Angela
1
Die Steine waren herausgefallen, als seien sie nur lose aufgeschichtet gewesen, und das, was ich für Mörtel gehalten hatte, war bei jedem Schlag mit der Spitzhacke zu feinem Staub zerfallen. Staub war durch die Ritzen der Tür in die Schlafkammer gedrungen, Staub bedeckte den Tisch und die Stühle und überzog alles mit einem schmutziggelben Film.
Am Vortag hatten zwei spanische Maurer eine Türöffnung aus der Mauer des Wohnraums herausgebrochen und einen Trümmerhaufen hinterlassen. Seit ich gesehen hatte, daß die Mauern des Hauses aus nichts anderem als aus spröden Kalksteinen und Staub bestanden, traute ich der Vorstellung von beruhigender Beständigkeit nicht mehr, die mich beim ersten Anblick überwältigt hatte und dann den Plan reifen ließ, in diesem Haus für lange Zeit Zuflucht zu suchen. Jetzt waren die Brücken hinter mir abgebrochen, und ich fand mich zwischen Mauern wieder, die ihre Verläßlichkeit nur simulierten.
Als ich draußen ein Stück den Hügel hinaufging und den Blick zurückwarf, schien wieder alles in Ordnung. Vom Haus war nicht viel mehr als das Dach zu sehen; die Sonne stand noch niedrig, und die römischen Ziegel warfen scharfe Schatten. Zwischen ihren Linien und den Farbabstufungen der hellen Ziegel entwickelte sich ein lautloses Leben, das dem Verfall im Innern des Hauses begütigend widersprach.
Der lange erwartete Augenblick war gekommen. Niemand war mehr im Haus außer mir, die Freunde waren längst wieder abgereist, und die Maurer hatten ihre Arbeit beendet. Alles war in greifbarer Nähe, das Alleinsein, die Arbeit am Haus und die Befreiung, die sie versprach. Jetzt aber schob sich eine Beklemmung dazwischen, die ich nur zu gut kannte: Womit anfangen im Angesicht der Masse von Steinen, Dreck und Gerümpel, die keinen Anhaltspunkt bot, an dem sich eine Wahl hätte festhaken können?
Ein anderer Anfang war bereits gescheitert. Um die großen Wassermengen zum Mörtelmischen nicht mehr Eimer für Eimer mit der Hand aus der Regenwasserzisterne ziehen zu müssen, hatte ich die alte gußeiserne Pumpe wieder in Gang bringen wollen, die zu den Hinterlassenschaften der früheren Hausbesitzer gehörte. Einen passenden zentnerschweren Elektromotor hatte ich bei einem Schrotthändler gefunden. Motor und Pumpe hatte ich auf ein Brett montiert, einen Keilriemen aufgelegt und eine neue Saugleitung angeschlossen. Der Motor setzte sich auch in Bewegung, als der Strom eingeschaltet wurde, und das große Schwungrad der Pumpe drehte sich gleichmäßig. Es schoß aber keine Wasserfontäne heraus, sondern es gurgelte nur dumpf in der Öffnung. Aus mehreren Rissen in der Pumpe quoll Wasser hervor und lief auf das Brett hinunter.
Der Frost mußte das Eisen gesprengt haben. Von der Vorstellung eines Südens verführt, der keinen Winter kennt, sondern nur einen ausgedehnten milden Herbst, hatte ich es unterlassen, die Pumpe vor dem vergangenen Winter zu entleeren. Einen ganzen Tag lang hatte ich mich damit abgemüht, die Risse mit einer Spachtelmasse abzudichten. Sie haftete aber nicht auf dem Guß, Wasser lief weiter an dem Gehäuse herunter, und die Pumpe saugte Luft durch die Risse an. Als dann die Maurer kamen, fluchten sie bei jedem Eimer, den sie aus der tiefliegenden Zisterne zogen.
Noch vor ihrer Ankunft hatte ich in Laville, der nächstgelegenen Kleinstadt, eine neue Pumpe gekauft, ein handliches leichtes Gerät, Motor und Pumpe in einem Block, mit Tragegriff und eingebautem Schalter. Die Pumpe stand noch immer verpackt in einer Ecke. Das rotlackierte Gehäuse, das die beweglichen Teile verbarg, machte mich irgendwie mißtrauisch, und beim Anblick der alten Pumpe mit den Speichen ihres Schwungrads verging mir die Lust, mich noch einmal mit der Wasserversorgung zu beschäftigen.
Den Schutt und den Dreck im Haus überließ ich schließlich sich selbst und kletterte auf das Vordach hinauf, das die Anbauten an der Nordseite des Hauses bedeckte. Ein kalter Luftzug strich über die Ziegel, aber die Vormittagssonne erwärmte schon ein wenig die Kleider. Auf dem flachen Hausdach ging ich zum First hinauf und sah mich um. Ein paar Meter nur über dem Boden, und das Gefühl, dem staubigen Verfall im Innern des Hauses ausgeliefert zu sein, war ausgelöscht. Ich sah mich um, und es kam mir vor, als ließe sich von dort oben alles doch noch beherrschen.
Im Osten, mit dem Gittermast auf dem höchsten Punkt, der Hügel, dessen Rückseite schroff in das Tal von Antras abfiel, davor die Linien der Hänge, die gemächlich ineinanderstürzten und sich in der gewundenen Schlucht verloren, die sich tief unterhalb des Hauses zu einem Tal erweiterte, am Hang gegenüber eine Ruine mit eingestürztem Dach, dahinter gestaffelte Kuppen und Kammlinien, aufgefangen von den Gebirgszügen, die den Horizont im Norden und Westen begrenzten. Auf der anderen Seite der wellige Höhenzug, auf dessen Ausläufern das Haus stand, von dem Muster der Terrassen und Steinwälle überzogen, dazwischen Wacholder- und Stechginstergestrüpp und das kahle Geäst der Mandelbäume, an deren äußeren Zweigen da und dort Blüten zum Vorschein kamen. Und dabei fiel mir ein, daß ich der einzige im Umkreis von mehreren Kilometern war, der in diesem Augenblick die noch wintergrauen Hänge, die kahlen Steineichenwälder, das Spiel der steigenden und fallenden Linien sah, und ich spürte etwas von der Euphorie heraufziehen, die ich mir vom Alleinsein versprochen hatte und die sich in Gegenwart der anderen nicht hervorwagte.
Ich fing dann damit an, die Ziegel von dem Dachrand zu lösen, unter dem die Wasserleitung verlegt werden sollte, und wunderte mich dabei, daß die Ziegel, die nur lose auf dem Lehmmörtel auflagen, nicht längst vom Wind heruntergerissen worden waren. Da der Anfang so leicht war, schleppte ich gleich die Werkzeuge und Materialien aufs Dach und begann mit der Arbeit an der Wasserleitung.
Die Kupferrohre ließen sich fast so leicht durchsägen wie ein Stück Holz. Wie es mir ein Klempner vorher gezeigt hatte, fettete ich die abgesägten Enden ein und steckte sie in einem Verbindungsstück zusammen. Mit der Flamme des Lötbrenners erhitzte ich das Metall, bis es sich verfärbte und das Fett qualmend verbrannte.
Es qualmte wieder, als das Lot das heiße Metall berührte und wegschmolz. Es tropfte bald auf die Ziegel herunter, aber ein dicker Kranz Lot war auf den Verbindungsstellen haftengeblieben.
Während das Metall abkühlte, sah ich befriedigt das Ergebnis der ersten Klempnerarbeit vor mir liegen. Nach einer Weile hob ich die Kupferrohre auf, um sie entsprechend der Mauerform am Dachrand zurechtzubiegen. Kaum hatte ich sie aber kräftig angefaßt, da sprang die Lötverbindung auseinander.
Irgend etwas hatte ich falsch gemacht, ich wußte nur nicht, was. Durch Überlegen kam ich nicht dahinter, ich mußte weiter probieren, hatte aber kein Programm und keine Methode. Es kam mir vor, als regte sich in den Dingen ein träger, aber wirksamer Widerstand, den sie dem ungeduldigen, schnellen Zugriff entgegensetzen und der selbst nicht zu packen war. Die Kupferrohre, die nicht zusammenhielten, unterschieden ungerührt zwischen richtig und falsch, und sie hatten falsch gesagt. Sie ließen nicht mit sich reden, sie waren nicht durch wortreiche Rechtfertigungen zu beeindrucken. Sie schienen mich durch lautlose Sabotage für die Anmaßung zu bestrafen, ohne Vorbereitung über sie triumphieren zu wollen.
Später, am Nachmittag, fing ich noch einmal von vorne an. Diesmal gelang der Versuch, aber es war nur ein glücklicher Zufall, denn die meisten der folgenden Versuche schlugen wieder fehl.
Als die Sonne hinter dem First verschwand, trieb mich die heraufziehende Kälte vom Vordach hinunter. Es war kümmerlich, was ich als Ergebnis des ersten Arbeitstages dort oben hinterließ. Bis die Wasserversorgung funktionierte, würden noch viele Arbeitstage vergehen müssen, ausgefüllt von Mißerfolgen und Enttäuschungen. Nachdem die Sonne ganz verschwunden war, hatte sich das Glücksgefühl, das aus der in sich ruhenden Umgebung hervorging, in einer schwächlichen Erinnerung an das Gefühl verkrochen. Die beherrschbar wirkenden Hügel entzogen sich heimtückisch meiner Verfügungsgewalt und tauchten in die Dunkelheit weg. Die Welt war nun auf ein großes, kahles Zimmer voll Trümmer und Dreck reduziert.
Allein in dem Raum sitzend, fiel mir zum ersten Mal die Häßlichkeit seiner Proportionen auf. Er war so lang wie das ganze Haus, für diese Länge aber viel zu niedrig. Jemand hatte vor nicht sehr langer Zeit Preßplatten unter die Deckenbalken genagelt, und vielleicht hatten die Maurer recht mit ihrer Vermutung, daß man auf diese Weise nur die verrotteten und vom Holzwurm zerfressenen Balken vor dem Blick der Kaufinteressenten hatte verstecken wollen.
Viele Male ging ich hinaus und leuchtete mit der Taschenlampe um das Haus herum. Ich sah die am Vordach angelehnte Leiter und sah im Lampenschein ein Stück Kupferrohr blitzen, und mir kam die Idee, dort hinaufzusteigen und die Nacht mit der Montage der Wasserleitung zu verbringen. Der kalte Wind blies aber noch stärker als am Tag, und die Taschenlampe hätte als Beleuchtung nicht ausgereicht.
Die Nacht hatte ein vielfältiges, geräuschvolles Leben wachgerufen, das nirgendwo zu greifen war. Es entzog sich, wenn ich seinem Ursprung nachgehen wollte, und rückte nahe heran, wenn ich es mir vom Leib zu halten versuchte.
Dann versuchte ich es zu übertönen. Ich schaltete das Radio ein und fing an, die aus der Wand gebrochenen Steine und den Dreck auf den Schubkarren zu laden und hinauszuschaffen. Das Kratzen der Schaufel auf dem Steinboden und das Poltern der Steine im Schubkarren verscheuchten die Nacht wirksamer als die Radiomusik, die ich wieder abstellte, weil sie neben den Arbeitsgeräuschen selbst zum Teil des schmerzenden Rauschens wurde. Als dann der Wohnraum ausgekehrt war und der Staub sich herabgesenkt hatte, schwappte die geräuschvolle Nacht wieder zurück, noch unentrinnbarer als zuvor.
Das Haus schützte nicht vor ihr. Wie wenn seine Mauern einen Resonanzboden bildeten, verstärkte es noch die Tierschreie und das Windgeheul und fügte seine eigenen Töne hinzu. Über den Preßplatten an der Decke rührten sich die Mäuse oder Siebenschläfer und schoben die Mandeln hin und her, die sie ins Haus geschleppt hatten. Es knackte in den Balken. Der Wind rieb einen Ast an den Ziegeln entlang, in unregelmäßigen Abständen.
Für viele Geräusche fand ich aber keine Erklärung. Vielleicht waren sie schon die ganze Zeit dagewesen; ich hatte sie nur nicht wahrgenommen, weil es keinen Grund gab, auf sie zu achten. Solange die anderen noch im Haus gewesen waren, konnte ich alles, was sich regte, in einen Zusammenhang mit ihrer Anwesenheit bringen. Nachts konnte einer aufgestanden sein, um zum Pinkeln nach draußen zu gehen. Was auf den Bretterboden über den Wohnraum polterte, konnte ein Glas gewesen sein, das jemand im Schlaf umgestoßen hatte.
Alle diese Erklärungen fielen jetzt aus. Nachdem sich die Geräusche nicht mehr auf einen bestimmten Ursprung zurückführen ließen, konnten sie alles bedeuten. Sie konnten zwar alles bedeuten, aber sie bezogen sich nur noch auf mich.
Ich fuhr zusammen, weil ich im Augenwinkel gesehen hatte, daß sich etwas in dem Raum bewegte.
Es war eine Haarsträhne, die über den Augenwinkel gefallen war.
Noch einmal ging ich nach draußen, zog den Zündschlüssel ab und versperrte alle Wagentüren, obwohl ich im gleichen Augenblick wußte, wie lächerlich es war, am Ende eines holprigen Feldwegs, der kilometerlang über verkarstete Hügel führt, außer Sichtweite einer befahrenen Straße, so zu tun, als könne man sich mit einem ordentlich abgeschlossenen Auto vor irgend etwas schützen.
Auch die Eingangstür schloß ich hinter mir zu. Das Haus war damit aber nicht versperrt. Durch die Maueröffnung, die die Spanier herausgebrochen hatten, fuhr ein Luftzug, der die Nacht mit sich schleppte.
In der Schlafkammer hinter dem Wohnraum lagen neben Kleidern und Werkzeugen ein paar Bücher. Solange die anderen noch mit mir im Haus waren, hatte ich sie nicht angerührt. Sie waren mir gleichgültig gewesen. Vor dem Feuer sitzen, reden und mit dem Redestrom dahinschwimmen, war verlockender als der stumme Dialog mit dem bedruckten Papier. Jetzt aber waren mir die Bücher willkommen, als Schutzwall, den sie bilden konnten gegen die in den Geräuschen herandrängende ungewisse Bedrohung. Ich hätte mir gewünscht, eine ganze Bibliothek um mich zu haben, hinter deren Büchermauern ich mich hätte verkriechen können.
Ich sah, wie ich meine Zeit verlor, das einzige, was mir wirklich gehörte. Aber wie alle Leute hatte auch ich zu wenig davon: ich werde sterben.
2
Wenn ich nach der Arbeit ins Bett gefallen war und die Anspannung sich löste, spürte ich etwas unter mir wie das Vibrieren einer Maschine.
Nachdem ich eine Zeitlang im Dunkeln dagelegen hatte, konnte ich die Maschine sogar hören. Es war ein Brummen von niedriger Frequenz, fast an der Schwelle der Hörbarkeit.
Ein paarmal war ich aufgestanden und vor das Haus gegangen oder den Hügel hinaufgestiegen. Aber draußen war nichts zu hören außer Blätterrascheln oder den nächtlichen Rufen eines Tiers, das aus der zugewachsenen Schlucht kam, eines Nachtvogels vielleicht oder eines Säugetiers.
Sobald ich im Haus das Licht ausgeschaltet und mich hingelegt hatte, war das Brummen wieder da. Es schien aus dem Boden unter mir zu kommen, wie wenn in einem Erdstollen ein schwerer Dieselmotor lief.
So könnte das Verrücktwerden anfangen.
Vor vielen Jahren war ich ab und zu bei einem reichen Junggesellen zum Essen eingeladen. Er lebte mit seiner Mutter und einer Haushälterin in einer riesigen Wohnung, die mit Möbeln und Blattpflanzen so vollgestellt war, daß es aussah, als hätten ein Blumenhändler und ein Gebrauchtmöbelhändler ihre Lager zusammengelegt.
Bevor das Essen auf den Tisch kam, mußte ich jedesmal eine Art Prüfung durchstehen. Während der Hausherr in der Küche nach dem rechten sah, fing seine Mutter an, leise, aber nachdrücklich auf mich einzureden.
Nach der ersten Einladung wußte ich schon, was mich jetzt erwartete, und ich wünschte mir nur, daß es schnell vorüberginge. Die alte Frau beugte sich dann zu mir herüber, wie um mir ein Geheimnis anzuvertrauen. Es war schließlich ein Geheimnis. – Da unten, sagte sie, graben sie wieder, tief unter dem Haus. Sie haben große Maschinen, hören Sie sie nicht, die Maschinen? Seit vorgestern graben sie wieder mit ihren Maschinen. Und dabei senden sie ihre Strahlen aus. Ich spüre, wie die Strahlen von unten auf meine Fußsohlen treffen. Spüren Sie denn immer noch nichts? Es ist schrecklich, ich kann nicht mehr schlafen, wenn sie mit ihren Maschinen graben und mir ihre Strahlen auf die Fußsohlen schießen. Haben Sie es immer noch nicht gemerkt?
Ich wußte nie, was ich darauf antworten sollte. Ich war nur froh, wenn endlich die Tür aufging und die Haushälterin das Essen auf den Tisch stellte.
Der Sohn warf seiner Mutter einen Blick zu, der eine nachsichtige Zurechtweisung enthielt. Er wußte natürlich, daß die alte Frau verrückt war, aber er behandelte sie ganz normal, wie man eine gebrechliche und schwerhörige Greisin behandelt.
Und jetzt war ich vielleicht an der Reihe. Die Maschine lief ohne Unterbrechung. Ich hätte nicht einmal sagen können, daß ich sie richtig hörte, noch daß ich sie allein mit dem Körper spürte. Die Wahrnehmung war etwas Drittes, auf der Schwelle zwischen Hören und Spüren, und gerade darum irritierend. Das Brummen und Vibrieren war immer da, ließ sich nicht wegdrängen, und ich fühlte mich ihm ausgeliefert.
Es könnte sich vielleicht nicht ungehindert breitmachen, wenn jemand anderes dabei wäre. Es könnte sein, daß es auch einem anderen auffällt, daß er es an der Grenzschwelle zwischen Hören und Spüren wahrnimmt. Man könnte dann gemeinsam überlegen, ob es möglich ist, daß sich die Vibrationen einer unterirdisch laufenden Anlage über größere Strecken fortsetzen. Etwa dreißig Kilometer östlich fraß sich ein Zementwerk in die Kalkberge am Rand des Rhonetals hinein. Im Westen, ungefähr gleichweit entfernt, stand ein Bergwerk, dessen weißer Förderturm sich deutlich von den Gebirgsflanken abhob. Es wäre denkbar gewesen, daß sich die Vibrationen der Maschinen, die dort das silber- und bleihaltige Gestein zerkleinern, auf den umgebenden Untergrund übertragen.
Nähme ein anderer aber nachts überhaupt nichts wahr außer den Windgeräuschen und den Tierschreien, dann wüßte ich wenigstens, daß es nutzlos ist, mir weiterhin über solche Ursachen den Kopf zu zerbrechen.
Die Maschine lief, und die Ungewißheit darüber, was ihr Laufen zu bedeuten hatte, ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Es war da, auch wenn ich mich tief unter die Decke verkroch. Nur wenn ich die trübe Birne einschaltete, die an ihrem Kabel über der Stuhllehne baumelte, zog es sich hinter die sichtbaren Gegenstände zurück. Da war der Stuhl, die Kiste mit den Büchern, der Kleiderhaufen, der Boden mit den quadratischen, rötlichen, stumpfgewordenen Fliesen, die steinerne Treppe, die nach unten in den Hauptraum führte, das wurmstichige, mit den Jahren schwarzgewordene Holz des Fensters, da waren die weißgekalkten, fleckigen Wände, die dem kleinen Zimmer das Aussehen einer Klosterzelle gaben.
Im Schein der Lampe war alles an seinem Platz und bildete einen Zusammenhang, in den kein Brummen und Vibrieren einbrechen konnte. Solange ich mich an dem Anblick des Fensters, des Stuhls, des Kleiderhaufens festklammerte, fühlte ich mich in Sicherheit. Manchmal schlief ich dabei ein, aber wenn ich beim Aufwachen die brennende Birne und die wie festgewachsenen Gegenstände sah, wollte ich sie um keinen Preis mehr aus den Augen verlieren. Ich wartete dann mit der gleichen Ungeduld auf den Tag, mit der ich mir sonst die Nacht herbeiwünschte, die mich vor den Zumutungen der Außenwelt abschirmte.
In den Nächten meldete sich immer unabweisbarer der Verdacht zu Wort, daß dieser ganze Fluchtversuch vergeblich war. In den Nächten holte mich etwas ein, was sich durch keine Entfernung und keine Isolation abschütteln ließ. Als ich in die Einöde fuhr, glaubte ich allen Arten von Verfolgern entkommen zu sein, und wußte noch nichts von den Verfolgern, die ich unerkannt mitgeschleppt hatte und die mir desto dichter auf den Leib rückten, je weiter ich mich von der gewohnten Welt entfernte.
Nach den ersten Wochen in dem alten Haus waren es kaum noch die nächtlichen Geräusche, ein Knacken im Holz, ein Vogelschrei vor dem Fenster, das Getrappel der Siebenschläfer im Zwischenboden, auch nicht das irgendwie schwächer gewordene Brummen und Vibrieren, was mich aufschrecken ließ und am Einschlafen hinderte. Es war jetzt der Schlaf selbst, vor dem ich zurückschreckte, weil er mich nicht mehr abschirmte, sondern ungeschützt dem Ansturm längst aus dem Bewußtsein entschwundener Gestalten preisgab. Sie überrannten mich und ließen mich gelähmt liegen. Sie zerrten längst abgesunkene Gefühle aus der Erinnerung heraus, Gefühle der Scham und der Schuld, Ängste und Erniedrigungen, und auch wenn sie sich wieder verzogen hatten, hinterließen sie Spuren, die sich mit dem Aufwachen nicht verwischten.
Frühere Erzieher und Ausbilder, an die ich seit vielen Jahren nicht mehr gedacht hatte, machten sich in den Träumen breit und spielten Szenen vor, die immer von der Ohnmacht handelten, und noch jenseits des Schlafs klang das Echo ihrer Stimmen nach. Seit langem aus dem Blickfeld entschwundene verstorbene Familienangehörige oder ehemalige Freunde und Geliebte drängten sich vor und erinnerten an Versprechen, die nicht gehalten worden waren, und an Zeichen verschlüsselter Zuneigung, die ich nicht hatte entziffern wollen. Und die Berufsverfolger waren zur Stelle, Militärs, die durch lange Flure brüllten, Polizisten, Grenzwächter, Staatsanwälte, sie alle verstellten mir den Weg und schnitten Grimassen, als verspotteten sie mich für die Vorstellung, durch den Rückzug in die Einsamkeit irgend jemandem entkommen zu können.
Es kam mir vor, als wäre mit dem Alltag, den ich hinter mir gelassen hatte, etwas wie eine Schutzschicht verlorengegangen, an der die Attacken der Vergangenheit auf meine Träume immer abgeprallt waren, als seien die Verfolger, die sich jetzt hervorwagten, vorher im Durcheinander der täglich wechselnden Nachrichten und Bilderfolgen steckengeblieben. Jetzt hatten sie das Terrain ganz für sich, das vorher von anderen, weniger bedrohlichen Gestalten okkupiert gewesen war. Noch Stunden nach dem Aufwachen waren sie mir so gegenwärtig, als sei ich ihnen gerade begegnet und als könnten sie jeden Augenblick zurückkehren.
Weil sich in der Einsamkeit die Abgrenzungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Traumerfahrung und Erlebnis gelockert hatten, fand auch die Umgebung leichter Durchschlupf. Sie rückte nicht mehr nur in den Tierschreien, im Windgeheul und den nächtlichen Geräuschen nahe an mich heran.
Als der Vollmond schien, verließ ich oft spät abends das Haus. Ich ging kreuz und quer über die versteppten Hügel und kam dabei oft ins Stolpern. Dann folgte ich wieder auf längeren Strecken den Steinwällen und breiten Terrassenmauern, die im Mondlicht hell aufleuchteten. Während sie am Tag das dunkle, graue Grundmuster bildeten, das die hellen Flächen der brachliegenden Felder und überwachsenen Wiesen aufgliederte, sah es in diesen Nächten so aus, als brächte das Mondlicht eine zweite Struktur der Landschaft zum Vorschein, die erst ihren wahren Anblick enthüllte.
Im Mondlicht lösten sich die abgestorbenen Bäume aus den Verbindungen, die sie bei Tag der heiteren Zeichnung der Hügellinien zuordneten, und traten in einen anderen, tagsüber unsichtbaren Zusammenhang ein, der sie in eine zu Ende gegangene Geschichte hineinzog. Die Mandelbäume waren nicht abgestorben, so wie alle Bäume irgendwann einmal absterben, nachdem ihre Wurzeln zu schwach geworden waren, um die Äste zu ernähren. Sie waren abgestorben, weil die Menschen, die sie einmal angepflanzt hatten, sie irgendwann wieder aufgaben, weil sie aufgehört hatten, sie zu pflegen, ihre Zweige auszudünnen und die Baumscheiben zu düngen. Die schwarzen, verstümmelten Äste, die das faule Zweigwerk längst abgeworfen hatten, sprachen nicht nur vom Tod der Bäume, sondern auch vom Absterben einer Geschichte, an der die früheren Bewohner dieser Hügel einmal teilzunehmen glaubten.
Während ich auf den Terrassenmauern entlangging wie auf den holprigen Stufen einer riesigen Freitreppe, begleiteten mich die Schatten der Leute, die alle diese Steine aus dem Boden gegraben und sorgfältig aufeinandergeschichtet hatten, damit die magere Kalkerde auf den Hügeln beisammenblieb. Sie gaben mir zu verstehen, daß ich es nichts anderem als ihrem Aufgeben und Verschwinden zu verdanken hatte, daß es jetzt die Einsamkeit der Hügel gab, in der ich mich ausbreiten konnte.
Ein mächtiger, auf die Mauer gestürzter Baum versperrte mir den Weg. Als ich mich zwischen den Ästen der geborstenen Krone hindurchzwängte, sah ich im Mondlicht an einem einzelnen Zweig weiße Blüten aufleuchten, und ich erschrak fast, wie ich beim Anblick eines Skeletts erschrocken wäre, das plötzlich einen fleischigen Zeigefinger hebt.
In diesen Nächten bot das Haus nur eine widerrufbare Zuflucht. Es hielt zwar die Schatten der Bäume und Mauern draußen, blieb aber durchlässig für die Invasion aus einer anderen Vergangenheit. Erst der Tagesanbruch setzte dem Spuk ein Ende. Sobald der erste Lichtschimmer zu sehen war, fühlte ich mich gerettet. In der Stunde, die vom leichten Verfärben des Himmels bis zum Sonnenaufgang verging, ließ sich beobachten, wie ein Tag zustande kommt, wie sich Stück für Stück eine Physiognomie bildet, die einen bestimmten Tag von allen anderen Tagen unterschied.
Es lag nicht nur an dem klaren Frühjahrslicht, daß ich den Tagesanbruch kaum erwarten konnte. Es lag auch daran, daß der Tag eine bisher unbekannte Verlockung in sich barg, deren Sog die nächtlichen Bilder verzehrte.
3
Nach ein paar Wochen des Tastens, Probierens, Planens und Anlaufnehmens war die Arbeit in Gang gekommen, wie wenn ein großes Schwungrad angelaufen wäre, dessen gespeicherte Energie den ganzen Apparat auch in antriebslosen Phasen in Bewegung hielt.
Seither hatte die Drohung der unaufhaltsam verlaufenden Zeit einer schwer greifbaren Anziehung Platz gemacht. Die Tage waren keine Monaden mehr, die für sich blieben und einzeln dem Gewicht der an sie gerichteten Erwartung standhalten mußten. Sie waren jetzt Teile eines beweglichen Kontinuums, das sich in die Zukunft hineinschob.
Mit der Arbeit war ich zu einem beharrlichen Frühaufsteher geworden, der es nicht mehr im Bett aushielt, sobald es hell wurde, gleichgültig, wie kurz oder wie schlecht der Schlaf gewesen war. Die Frage nach dem Anfang, die sonst ganze Tage von vorneherein zerfallen ließ, war schon beantwortet, weil sich ein Programm herausgebildet hatte, in dem sich ein Vorgang aus dem anderen, ein Handgriff aus dem anderen, ergab.
Seitdem ich über fließendes Wasser verfügte, war ich von morgens bis abends damit beschäftigt, Mörtel zu mischen und aufzutragen und damit die am meisten vom Verfall bedrohten Mauern zu befestigen.
Das auf dem Papier konzipierte Wassersystem funktionierte tatsächlich. Es hatte lange gedauert, bis alle Teile zusammenpaßten, bis die Rohre und elektrischen Leitungen richtig angeschlossen waren. Aber dann setzte im richtigen Moment das mahlende Geräusch der kleinen roten Pumpe ein, und das aus der Zisterne gepumpte Wasser lief in den auf dem Dachboden aufgestellten Behälter. Kräftig war der Wasserstrahl nicht, der unten aus dem Plastikschlauch kam, denn das Gefälle betrug nur wenige Meter. Es schien aber nicht mehr dasselbe Wasser zu sein, das tief unter der Erde in der großen Zisterne ruhte, undurchdringlich im Dämmerlicht. Nachdem es die Pumpe und die Rohrleitungen durchlaufen hatte, wirkte es gezähmt, geheimnislos und gereinigt, obwohl es immer noch den Dreck mitführte, den das Regenwasser aus der Luft und vom Dach in die Zisterne geschwemmt hatte.
Beim Mörtelmischen verwandelte sich das Wasser in eine alchimistische Substanz, die aus Sand und Zement eine formbare, Stunden danach erstarrende Masse entstehen ließ, die nicht mehr losließ, was sie berührte.
Nach Einbruch der Dunkelheit ging ich manchmal mit der Taschenlampe hinaus, um nachzusehen, in welchem Zustand sich der Mörtel befand, ob er sich noch mit dem Finger eindrücken ließ oder ob er sich schon der Festigkeit der Steine angeglichen hatte, die er zusammenhalten sollte.
Überall an dem Haus waren Steine herausgebrochen, an den Anbauten waren ganze Ecken eingestürzt und hatten ein Stück Dach mitgerissen. Ziegel lagen lose auf dem Dachrand, und der Regen konnte ungehindert in die tiefen Fugen der Fassaden dringen. Nicht nur die aus Bruchstein gebauten Mauern waren im Verfall begriffen, auch Balken und Türstürze, die tonnenschweres Gewicht zu tragen hatten, waren morsch, von Holzwurm und Holzbock zerfressen, von Wind, Regen und Sonne zermürbt. Es sah aus, als hätte überall die Rückkehr zum Zustand der Entropie begonnen: Das Haus wollte wieder ein Haufen von Steinen werden, das Holz Humus, der Mörtel Dreck.
Seit die Arbeit in Gang gekommen war, zeigte der Verfall nicht nur seine bedrohliche Seite, sondern enthielt auch eine Herausforderung. Der Wettlauf mit der Auflösung hatte begonnen, und es gab Chancen, ihn nicht zu verlieren.
Deshalb trieb es mich aus dem Haus, sobald es Tag wurde, deshalb drängte es mich, den noch reifbedeckten Sand mit Zement und Wasser zu mischen und die klaffenden Fugen zwischen den Steinen der Fassade zu verschließen, und da die Tage in diesem Frühjahr immer länger wurden, nahm auch die Zeit zu, die zur Verfügung stand, um den Verfall durch die Arbeit aufzuhalten.
Gleichzeitig wurde es aber auch immer schwerer, die Arbeit einmal ruhen zu lassen. Immer gab es einen Grund, doch noch ein Stück weiterzumachen, doch noch ein paar Steine hochzumauern oder einen Balken zuzusägen. Und wenn ich nach Einbruch der Dunkelheit im Haus am Kaminfeuer saß und mich umschaute, stieß ich immer wieder auf etwas, das nach einem Eingriff verlangte.
Da war die Öffnung, die die Spanier in die Mauer gebrochen hatten, zwar verputzt in der Zwischenzeit, aber es fehlte immer noch die Tür, und dann fing ich an, die Öffnung auszumessen und die Maße auf den Brettern einzuzeichnen, und auf einmal hatte ich begonnen, die Bretter abzusägen und zusammenzufügen, dann gab es kein Halten mehr, bis die Tür fertig war.
Es war nicht mehr nur der Kampf gegen den Verfall, der zur Eile antrieb und sie rechtfertigte, sondern es war auch etwas innerhalb der Arbeit selbst, das keine Ruhe gab. Vielleicht ging die Anziehung von ihrer Sichtbarkeit aus, im Gegensatz zu der gewohnten Arbeit mit Zeichen und Buchstaben, die Teil einer verborgenen Kette ist und ihr Resultat nicht herzeigen, sondern nur versprechen kann.
Die Arbeit an einem neuen Projekt kündigte sich manchmal mit einer Aufregung an, wie ich sie als Kind vor Beginn einer großen Reise verspürt hatte. Noch vor Sonnenaufgang ging ich hinaus, legte die Werkzeuge zurecht und sah dann nach dem Morgenhimmel. Seit ich allein war, herrschte strahlendes Frühlingswetter, so daß es mir zur Gewohnheit geworden war, morgens nicht mehr nach der Sonne selbst zu sehen, sondern nur noch auf die Strecke zu achten, um die sich der Sonnenaufgang nach Norden verschoben hatte.
Und dann eines Morgens das sonderbare Erstaunen, weil überhaupt keine Sonne aufgegangen war, weil Wolken tief über den Hügeln hingen und starker Regen fiel, der die Arbeit draußen unmöglich machte.
Obwohl ich mir nach einer anstrengenden Arbeit manchmal gewünscht hatte, schlechtes Wetter würde mich dazu zwingen, eine Pause einzulegen, hörte ich dem auf die Ziegel trommelnden Regen zu, als trommle er die Begleitung zu einer stillen Katastrophe.
Die Berge waren verschwunden, selbst die nächste Hügelkette löste sich im Regendunst auf. Daß es auch noch andere Beschäftigungen gab, befriedigte mich nicht. Die seit Wochen nicht mehr angerührten Bücher waren bereits verstaubt, ihre Umschläge sahen aus, als hätte sich trockener Schimmel auf ihnen niedergelassen. Unter dem Kalkstaub waren sie beliebige Dinge geworden wie die Tasche des Fernglases oder die alte, grüngestrichene Bürolampe mit dem biegsamen Arm. Als ich sie aber aufschlug, kam es mir vor, als wären sie lebendig, beschäftigten sich genau mit dem, womit ich mich beschäftigte, als errieten sie die Fragen, die sich mir genau in diesem Augenblick stellten, und gaben noch dazu die Antworten, nach denen ich vergeblich suchte:
… er wühlte in der krümeligen Erde, die zwischen seinen Fingern hindurchrieselte: er behielt einen Rest von Vertrautheit mit dem Boden, der vergaß nicht die bäuerlichen Bewegungen, die seine Vorväter ausgeführt hatten, er befriedigte bescheiden den Landbewohner, der er hätte werden können, der nicht ganz abgestorben war in ihm …
Während ich dem Wasserstrahl zusah, der über dem Fenster aus der schadhaften Dachrinne schoß, fragte ich mich, ob dieser Paul Nizan nicht das Geheimnis der Unruhe gelüftet hatte, die aus der aufgezwungenen Untätigkeit kam. Konnte es nicht sein, daß in dem Widerwillen, mit dem ich das Regenwetter verfolgte, sich Bewegungen aus einer früheren Zeit meldeten, wiedererwacht nach einem langen Schlaf? Bewegungen, tief eingegraben in Nerven, Sehnen und Muskeln, letzte Erinnerung an die Vorfahren, die sie als Bauern und Handwerker ausgeführt hatten.
Übernommen hatte ich von ihnen nichts als ein paar alte Werkzeuge, für die sich bei der letzten Haushaltsauflösung niemand interessierte. Einen wuchtigen Engländer und eine lange Rohrzange, Meißel, Bauklammern, einen schweren Vorschlaghammer und eine Schleifmaschine, ein gußeisernes Kunstwerk, dessen ineinandergreifende Zahnräder die Bewegung der Hand in eine unglaublich schnelle Drehbewegung übersetzten. Ich hatte die Werkzeuge mitgenommen, weil ich nicht wußte, was ich sonst mit ihnen anfangen sollte. Jetzt auf einmal verriet mir Pauls Roman einen neuen Verwendungszweck: vielleicht war es möglich, über die Bewegungen, die von den Werkzeugen verlangt wurden, etwas über diejenigen zu erfahren, die sie einmal benutzt hatten. Von meinen Vorfahren wußte ich fast nichts. Mein Großvater war Schmied und Schlosser gewesen, er war schon sehr lange tot und mir nur als Figur in den Geschichten begegnet, die uns Kindern erzählt wurden, damit wir lernten, in den Toten der Familie Beispiele für die eigene Zukunft zu erkennen.
Eine dieser Geschichten handelte von einer schweren alten Eichenkiste, die dem Großvater zur Reparatur gebracht wurde, eine jener Truhen, die von einer Generation an die andere weitervererbt wurden, damit sie mit der jeweiligen Aussteuer die Garantie für die Fortführung des Geschlechts aufbewahrten. Die Truhe war dem Großvater gebracht worden, weil das Schloß nicht mehr einrastete, ein Scharnier durchgerostet war und die geschmiedeten Beschläge beschädigt waren oder fehlten.
Der Großvater zögerte, als er sah, welcher Arbeitsaufwand ihn erwartete, doch er nahm den Auftrag an. Noch am selben Abend schleppte er die Kiste in die Werkstatt und fing an, die gebrochenen und verrosteten Eisenteile vom Holz zu lösen.
Laut der Geschichte verbrachte er die folgenden Tage ausschließlich mit der Arbeit an der Eichentruhe. Nur zum Essen ließ er sich von ihr weglocken, und er kehrte sogar nach dem Abendbrot wieder in die Schmiede zurück. Er formte ein Scharnier zurecht, bis es dem alten glich, schmiedete Stück für Stück die fehlenden Beschläge, nahm das Schloß auseinander und brachte es in Ordnung.
Der Truhenbesitzer war mit der Arbeit mehr als zufrieden. Als er sich nach dem Preis erkundigte, zuckte der Großvater mit den Schultern. Eigentlich, sagte er in der Geschichte, sei diese Arbeit unbezahlbar. Und eine unbezahlbare Arbeit habe keinen Preis. So durfte der Kunde die reparierte Eichentruhe ohne Bezahlung nach Hause mitnehmen.
Diese Geschichte wurde als Beispiel für die Großzügigkeit erzählt, zu der dieser Großvater trotz seiner Armut fähig gewesen war. Als Kind war ich beeindruckt, wie von irgendeiner Geschichte mit Anfang und Ende, die man gern wiedererzählt hört. Ihre Moral war leicht verständlich und zugleich unheimlich, denn die Geschichte enthielt wie alle Geschichten, die von der Welt der Erwachsenen handelten, eine stillschweigende Drohung.
Jetzt hörte ich etwas aus der Geschichte heraus, was mir als Kind entgangen war, etwas, das die Kindergeschichte neu erzählte. Es wurde mir auf einmal klar, daß sie nicht von der legendären Großzügigkeit und Tüchtigkeit der Vorfahren handelte. Der Großvater hatte nicht aus Tüchtigkeit die Abende in seiner Werkstatt verbracht, in der er ein Scharnier bearbeitete oder einen Beschlag formte, sondern weil er nicht aufhören konnte.