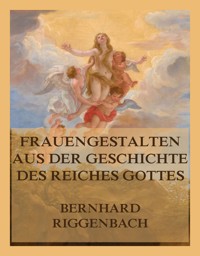
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Unter dem Titel "Frauengestalten aus der Geschichte des Reiches Gottes" hat der Theologe Riggenbach sieben Vorträge veröffentlicht, die in fesselnder Darstellung die Frauengestalten der Bibel sowie die bedeutsamsten Vertreterinnen christlicher Frauenideale im Leben und in der Geschichte der Kirche vom Altertum bis zur Gegenwart behandeln. Es sind dies keineswegs vollständige Biographien, sondern kleine Skizzen, die aber durchweg auf guten, selbstständigen, historischen Studien beruhen. Die Vorträge behandeln folgende Gegenstände: Die Mütter und Töchter des Volkes Israel, die Frauen im Leben Jesu, die Frauen der ältesten christlichen Kirche, die Heiligen des Mittelalters, die Gehilfinnen der Reformatoren, die Stillen im Lande und die Arbeiterinnen der inneren Mission.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Frauengestalten aus der Geschichte des Reiches Gottes
BERNHARD RIGGENBACH
Frauengestalten aus der Geschichte des Reiches Gottes, B. Riggenbach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682390
Textquelle: www.glaubensstimme.de
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort1
I. Die Mütter und Töchter des Volkes Israel.2
II. Die Frauen im Leben Jesu.17
III. Die Frauen der ältesten christlichen Kirche.32
IV. Die Heiligen des Mittelalters.49
V. Die Gehilfinnen der Reformatoren. 67
VI. Die Stillen im Lande.87
VII. Die Arbeiterinnen der inneren Mission.104
Vorwort
Diese Vorträge haben in einem engeren Kreise von Töchtern unserer Stadt eine so freundliche Aufnahme gefunden, dass ich hoffen darf, durch die Veröffentlichung nun auch einem weiteren Kreis Freude zu bereiten. Auf Vollständigkeit erhebt der Inhalt keinen Anspruch, wohl aber auf historische Treue, wenn gleich die gelehrten Anmerkungen fehlen.
Als Motto gebe ich dem Büchlein das schöne Wort des Dichters mit:
„Es sei der Frauen Leben so wie ein geistlich Lied,
Das nicht mit eitlem Brausen am Ohr vorüberzieht,
Das sich in festem Takte nur langsam fortbewegt
Und doch der Herzen viele mit sich zum Himmel trägt.“
Basel, den 25. Oktober 1883.
Bernhard Riggenbach.
I. Die Mütter und Töchter des Volkes Israel.
Es ist selbstverständlich, dass in Geschichte, Literatur und Kunst sich namentlich die Darstellungen von Frauengestalten und Frauenleben des weiblichen Interesses zu erfreuen haben. Freilich ist nicht jedes Interesse ein reines, und es gibt auch beim sogenannten schönen Geschlechte sehr unschöne, von Gefallsucht, Eifersucht und Tadelsucht entstellte Interessen. Auch fehlt es nicht an Geschichtsschreibern, Schriftstellern und Künstlern ersten, zweiten und dritten Ranges, welche, um Anklang und Absatz zu finden, mit kluger Berechnung der Einbildung und Eitelkeit schmeicheln und für den guten Geschmack, mit dem sie „das ewig Weibliche“ ins rechte Licht zu stellen wissen, denn auch richtig von zarter Hand gewundene Kränze ernten. Goethe, der die weibliche Natur auf Grund langjähriger Studien sehr genau kannte, hat in seinem hohen Alter in den Gesprächen mit Eckermann das bezeichnende Bekenntnis abgelegt: „Meine dargestellten Frauencharaktere sind alle gut weggekommen; sie sind alle besser, als sie in der Wirklichkeit anzutreffen sind.“ Und damit hat der psychologisch so feinsinnige und scharfsinnige Goethe keineswegs bloß sich selbst, sondern mehr oder weniger alle Poeten des klassischen Altertums und der klassischen Neuzeit treffend charakterisiert und zugleich Alles, was unter der klassischen Linie steht, gebührend verurteilt. Es besteht ja - von dem absolut Gemeinen gar nicht zu reden - zwischen Goethes Frauengestalten und denen eines Paul Heyse, zwischen Titians Venus und Gleyres Charmeuse, zwischen der Maria Stuart von Walter Scott und der Maria Theresia von Henriette Paalzow, zwischen Beethovens Fidelio und den Donnen des Don Juan ein gewaltiger Unterschied, aber vorwurfsfrei und vorurteilslos sind weder die Einen noch die Anderen, die Einen sind im Widerspruch mit der Wahrheit von Natur und Geschichte idealisiert, die Anderen, wenn auch nicht mit unlauterer, so doch mit unverkennbar pikanter Absicht realisiert.
Im Gegensatz zu all diesen Einseitigkeiten und Unvollständigkeiten menschlicher Darstellung und zu all diesen Schwachheiten und Torheiten menschlicher Absicht legitimiert sich die Bibel auch in Beziehung auf das weibliche Geschlecht als das Wort der Wahrheit, als das, wofür sie sich selbst ausgibt, wenn es im Brief an die Hebräer, Kap. 4, Vers 12 und 13, heißt: „Lebendig ist das Wort Gottes und kräftig und schneidender als ein zweischneidiges Messer und eindringend bis in die Fuge von Seele und Geist, Gelenk und Mark und kritisch für Gesinnungen und Gedanken des Herzens, und es gibt kein Geschöpf, das vor ihm verborgen wäre, alles ist bloß und offen gelegt für seine Augen.“ In der heiligen Schrift finden Sie weder eine schaumgeborene Venus umgeben von Amoretten, noch eine streitbare Pallas Athene mit ihrer Eule, dieser herrlichen Insignie des Blaustrumpfs, weder eine Kleopatra, der ein römischer Feldherr nach dem andern huldigt, noch eine Leonore von Este, welcher ein Tasso vorliest, weder Grazien noch Amazonen, dagegen enthält sowohl das alte als das neue Testament eine Reihe von herrlichen Frauengestalten und eine Fülle der anmutigsten Schilderungen weiblichen Wesens und Wirkens. Während die dichtenden und bildenden Künstler mit ihren reizenden Schilderungen das höhere oder niedrigere Triebleben des natürlichen Menschen in Anspruch nehmen, wird in der Bibel überall an Ihr edelstes Interesse appelliert, an das Sehnen des Geistes emporzukommen aus der Schwachheit in die Kraft, aus dem Verweslichen ins Unverwesliche, aus der Sünde in die Heiligkeit, aus der Welt ins Himmelreich. In der Schrift soll nichts dienen zu bloßer Unterhaltung und Belustigung oder gar zu falscher Beruhigung und Entschuldigung, sondern, was sie darbietet an weiblichen Typen, seien es Lichtbilder oder Nachtstücke, und an speziell den Frauen geltenden, zum Teil recht unliebsamen Weisungen oder Mahnungen, das ist Alles, wie der Apostel dem Timotheus (II. 3,16) so treffend schreibt: „nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung,“ mit einem Wort: zur „Erziehung in der Gerechtigkeit.“
Wenn wir daher die Ihnen Allen aus der biblischen Geschichte wohl bekannten Frauengestalten der heiligen Schrift zum Ausgangspunkt einer Reihe von Betrachtungen über den Anteil der Frauen am Bau des Reiches Gottes machen, so geschieht das nicht sowohl wegen der chronologischen Reihenfolge, sondern vornehmlich um an der für alle Geschichtsschreibung mustergültigen biblischen Darstellung unsern Geschmack und unser Urteil zu bilden und so das richtige Maß und Feingefühl zu gewinnen für die Auswahl und Behandlung des übrigen Stoffes und für die wahre Würdigung der Frauen, welche in der Geschichte der christlichen Kirche eine hervorragendere. Stellung eingenommen haben.
Es ist soeben von einem Anteil der Frauen an dem Bau des Reiches Gottes geredet worden. Steht diese Behauptung nicht im Widerspruch mit jenem bekannten Worte Pauli (1 Kor. 14,34): „Eure Weiber sollen schweigen in der Gemeinde; es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt.“ Werden hier nicht die Frauen von aller direkten Mitarbeit für das Reich Gottes ausgeschlossen? Keineswegs! In dem nämlichen ersten Korintherbrief finden wir (Kap. 4, V. 20) die köstliche Aussage: „Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft.“ Und von dem Empfang dieser Kraft sagt eben Paulus (Gal. 3,28): „Hier ist kein Mann noch Weib,“ d. h. die Kraft, um deren Ausübung es sich im Reich Gottes handelt, kann von dem Weib so gut erlangt und verwertet werden als vom Mann. Zum Reden und Lehren hat Gott von Anfang an vorzugsweise den Mann auserkoren, und warum, das liegt am Tag. Wo Rede und Lehre ist, da ist auch Gegenrede und Gegenlehre, und es sind mithin zur Verantwortung Wehr und Waffen erforderlich. Streitkraft aber ist dem Weibe nicht verliehen. Eine streitbare Frau wird im besten Falle mit dem beim Mann nicht unrühmlichen Namen eines Haudegens verpönt. Und das mit Recht, denn die natürliche Kraft der Frau ist nicht die Wehrkraft, sondern die Tragkraft. Und da das Reich Gottes auf Erden neben seiner aktiven jeweilen auch eine passive Form hat annehmen müssen, so sind ihm von jeher neben tatkräftigen Männern die tragkräftigen Frauen sehr gut zu Statten gekommen.
Zur Gehilfin des Mannes bestimmte Gott das Weib, ehe es erschaffen war (1. Mose 2, 18). Als Gehilfin sollte Adam, zu deutsch: der Mensch oder, wie die Wissenschaft zu sagen liebt: der Urmensch das ihm von Gott zugeführte Weib betrachten und für seine doppelte Bestimmung der Bevölkerung und Beherrschung der Erde (1. Mose 1,28) gebrauchen und respektieren, also nicht zur lastbaren Sklavin, zum Gegenstand der Lust oder zum Spielwerk der Laune herabwürdigen. In der biblischen Schöpfungsurkunde ist aber noch ein weiteres, lehrreiches Moment enthalten. Das Weib wird nicht besonders erschaffen, sondern dem Mann entnommen und daher zunächst Männin genannt (1 Mose 2,22. und 23); es soll also nur als Gehilfin des Mannes in Aktion treten und nicht unabhängig schalten und walten, nicht für sich, sondern an der Seite des Mannes sein (1 Mose 2,18). An der Seite des Mannes ist die Frau stark, um an ein neutestamentliches Gleichnis anzuknüpfen: wie die Gemeinde stark ist, wenn sie beim Herrn bleibt. Wie aber die Gemeinde der Verführung und dem Verberben anheimfällt, sobald sie ohne den Herrn, emanzipiert von seiner Autorität, von seinem Rat und Willen und also auch von seinem Beistand und Segen, einherschreitet, so wird auch die Frau beim ersten selbstständigen Auftreten betrogen und von der Arglist überwältigt. Es liegt nach dieser Richtung in der Geschichte des Sündenfalles ein unverkennbarer Wink für das weibliche Geschlecht und seine ihm von Gott angewiesene Stellung. Sowie das Weib, uneingedenk seines Abhängigkeitsverhältnisses, selbstredend und selbsttätig mit der Außenwelt sich einließ, musste es eine schmerzliche, und verhängnisvolle Erfahrung der ihm von Natur eigenen, geringeren Widerstandsfähigkeit machen. Der Mann aber, welcher die ihm anerschaffene Selbstständigkeit preisgab und gegen die göttliche Ordnung der Stimme des Weibes gehorchte, er und nicht das Weib wird mit Recht von Paulus (Römer 5,14 und 1 Kor. 15,22) für die Folgen verantwortlich gemacht. Ihm wird auch von Gott die härtere Strafe zuerkannt: die ganze kummervolle und mühselige Nahrungssorge. Freilich geht auch das Weib keineswegs frei aus: es muss sich die Demütigung gefallen lassen wegen des Missbrauchs der freieren Stellung einer Gehilfin hinfort das Joch der Unterwerfung zu tragen. Doch ist immerhin in der Prophezeiung besonderer Leibesplagen auch die tröstliche Hinweisung auf die bevorstehenden Mutterfreuden enthalten.
Als Eva, d. h. als Mutter aller Lebendigen soll sie, so lange menschliches Leben besteht, geehrt werden. Als Solche wird sie auch von Paulus selig gepriesen (1 Mose 3; vgl. 2 Kor. 11,4 und 1 Tim. 2, 13-15).
Ungleich höhere Ehre als die Menschenmutter Eva erfährt aber in der heiligen Schrift, welche immer das Natürliche dem Geistlichen unterordnet, Sara, die Mutter des Volkes Israel. „Schaut den Felsen an,“ ruft Jesaja (51,1 und 2), „davon ihr gehauen seid, und des Brunnens Gruft, daraus ihr gegraben seid, schaut Abraham an, euern Vater, und Sara, von welcher ihr geboren seid.“ Allein die große Verehrung, welche der Ahnmutter als solcher und wegen ihrer persönlichen Vorzüge gebührte, sie hinderte die israelitischen Geschichtsschreiber nicht, ein vollständig unbefangenes Lebensbild derselben zu zeichnen. Obgleich es nach dem mosaischen Gesetz (3 Mose 18,9) durchaus unzulässig war, dass Einer seine Schwester oder Halbschwester heiratete, wird dennoch (1 Mos. 20,2) ausdrücklich berichtet, Sara sei Abrahams Stiefschwester, eine Tochter, wenn auch nicht seiner Mutter, so doch seines Vaters Thara gewesen. Und mit der wiederholten Hervorhebung ihrer ungewöhnlichen Schönheit wird zugleich (1 Mose 12 und 26) die Erzählung verbunden, dass nur Gottes gnädige Leitung schwere Schmach von ihr abgehalten habe. Zweimal waren nämlich Abraham und Sara einig geworden, sich als bloße Geschwister auszugeben, damit nicht Abraham um seiner schönen Gattin willen von heidnischen Fürsten ermordet würde. Beide Male brachte Gott die Wahrheit zur rechten Zeit an den Tag, ohne dass Sara ein Opfer ihrer Menschenfurcht werden musste. Dagegen rächte sich eine spätere Machenschaft der Eheleute hart an Beiden. Weil ihnen die göttliche Verheißung nach ihrem Wortlaut unwahrscheinlich geworden war, hatte Sara eine Nebenehe Abrahams mit ihrer ägyptischen Sklavin Hagar gestiftet. Die nächste Folge davon war, dass Sara sich selbst zurückgesetzt fühlte (1 Mose 16) und später, als ihr eigener Sohn heranwuchs, auch für diesen wegen des gewandten Ismael Eifersucht empfand (1 Mose 21). Abraham aber musste (wiederum ein Mann, welcher für Nachgiebigkeit gegen seine Frau gestraft wird) schweren Herzens Hagar und Ismael verstoßen. Zwar verwandelte sich das spöttisch-ungläubige Lächeln der Sara noch in ihrem 90. Jahre in ein Lachen der Freude, aber der Name Isaak, zu deutsch: das Lachen, wird sie lebenslang an ihres Herzens Härtigkeit erinnert haben (1 Mose 18,12 und 21,6). Rührend ist es, welche Mühe Abraham sich gibt, seiner Sara d. h. Fürstin eine ihres Namens würdige Begräbnisstätte zu erwirken (1 Mose 23).
So wenig Sara, so wenig erscheint auch die zweite Patriarchin im Nimbus einer Idealfigur. Von Rebekka ist uns kein Lebenslauf in aufsteigender Linie überliefert, sondern es werden bei ihr mit zunehmenden Jahren die Schatten in bedenklicher Weise länger. Zuerst tritt sie vor uns in dem poetischen Duft vollendeter Liebenswürdigkeit. Nicht umsonst ist „die sehr schöne Dirne“ mit dem „Krug auf ihrer Achsel“ (1 Mos. 24) ein Liebling der Künstler. Lässt sich doch in der Tat nicht leicht ein anmutigeres Bild denken als eben diese „Rebekka am Brunnen“. Es ist ein wahrer Genuss, sich jene Szene zu vergegenwärtigen. Ahnungslos steigt sie vom Brunnen herauf und beeilt sich, dem greisen Fremdling den Labetrunk zu reichen; doch begnügt sie sich echt weiblich nicht damit, zu tun, was Elieser gebeten, und ihm wird nun, während er ihrer dienstfertig zuvorkommenden Geschäftigkeit zusieht, mit steigender Gewissheit klar: diese und keine Andere hat Gott dem Sohne meines Herrn bestimmt. Auch der fernere Verlauf der Erzählung ist äußerst reizvoll. An der schmutzigen Habgier ihres Bruders Laban, der nicht nach Gottes Willen frägt, sondern nur das Diadem an seiner Schwester Stirn und die schweren Spangen an ihren Armen in Erwägung zieht, hat Rebekka keinen Anteil. Bei der Verhandlung der Männer über die Heirat hat sie nach orientalischem Brauch, der noch heute bei den Juden zu Kraft besteht, nicht mitzureden. Und auch nachher wird sie aus ihrer Mutter Haus, d. h. aus Betuels Frauenzelt oder Frauengemach, nicht deshalb herbeigeholt, um zu entscheiden, ob sie Isaaks Frau werden wolle oder nicht, sondern nur, weil ihre Angehörigen wissen wollen, was sie zu der sofortigen Abreise sagen werde. So rasch sie sich hierzu entschließt, so gemessen benimmt sie sich bei dem Zusammentreffen mit Isaak. Aus Luthers Übersetzung (1 Mos. 24, 64: „und Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaak, da fiel sie vom Kamel“) könnte man ohne Kenntnis der morgenländischen Sitte und nach Analogie der Nervenschwäche moderner Bräute zu der Annahme verleitet werden, Rebekka sei vor Emotion in Ohnmacht gefallen. Solches gehörte in jener Zeit noch nicht zum guten Ton. Rebekka hatte übrigens Isaak noch gar nicht als Solchen, sondern bloß als vornehmen Mann erkannt, als sie, wie es die orientalische Höflichkeit noch heute von den Reisenden verlangt, zum Zeichen ihrer Ehrerbietung rasch von ihrem Reittier herabstieg. Und als Elieser auf ihr Befragen (V. 65) sie darüber belehrt hatte, wer der Herannahende sei, da „nahm sie den Mantel und verhüllte sich“, d. h. sie verschleierte sich, und Isaak bekam ihr Angesicht erst zu sehen, nachdem er sie in die Hütte seiner Mutter Sara geführt hatte. Soweit ist Rebekka eine sehr sympathische Erscheinung. Im weiteren Verlauf der Geschichte dagegen lernen wir sie als parteiische Mutter und als eine Frau kennen, die ihren Willen nicht nur mit resoluter Unliebenswürdigkeit, sondern auch durch Anwendung eigentlich schlechter Mittel durchsetzt. Den alten Mann hintergeht sie, indem sie mit seinem Gebrechen schnöden Missbrauch treibt, den eigenen Sohn bringt sie um sein Recht und seinen Segen und den Liebling ihres Herzens verführt sie zur Sünde gegen Vater und Bruder und häuft dadurch der Fluch solch sittlich korrumpierender Mutterschwäche unendlich viel Leid auf sich und ihn.
Rebekkas Vorliebe für den durch seine stillere und zahmere Art zum Muttersöhnchen geeigneten Jakob (1 Mos. 25,27 u. 28) wurde dadurch noch erhöht, dass der ohnehin unbändige Esau ihr auch noch zwei unbotmäßige kanaanitische Schwiegertöchter und damit viel Herzeleid ins Haus brachte (1 Mos. 26,34 u. 35). Dennoch lässt sich ihr Benehmen in keiner Weise rechtfertigen. Die Bibel versucht das auch gar nicht. Rebekka muss, gerade wie die ersten Sünder, die buchstäbliche Wahrheit des Wortes fühlen: „welchen Tages (Gott hätte auch sagen können: zu welcher Stunde) du davon isst, wirst du des Todes sterben“. Darauf deuten auch als feine Beobachter die beiden bekannten Bibel-Illustratoren, Schnorr und Doré, hin; sie lassen nämlich die Rebekka, voll Furcht, ihre schlaue Intrige möchte durch unvermutet schnelle Rückkehr Esaus noch im letzten Augenblick vereitelt werden, während Jakob den erschlichenen Segen empfängt, ängstlich Wache stehen. Bei Schnorr blickt sie scheu um sich, indem sie Jakob einen Wink gibt, es sei keine Zeit zu verlieren; bei Doré steht sie unter der Tür und hält die Hand auf das klopfende Herz. Das Gewissen reagiert sofort, und die Strafe folgt der Sünde auf dem Fuß. Den geliebten Jakob muss die Mutter selbst, um ihn vor Esaus Rache zu sichern, auffordern: „mache dich auf und fliehe zu meinem Bruder Laban in Saran.“ Sie tröstet sich zwar mit der süßen Hoffnung, dass sie ihn bald wieder werde heimrufen können und versucht die innere Unruhe mit dem Gedanken zu beschwichtigen, es sei besser, Jakob wandere aus, als wenn er bei ihr bliebe und ihr etwa auch durch eine Missheirat mit einer unartigen Hethiterin das Leben sauer mache (1 Mos. 27,43-46). Allein Jakob kam zu ihren Lebzeiten nicht mehr zurück. Fern von ihm, den nagenden Wurm im Herzen, dass sie die Ursache seiner Missgeschicke sei, musste sie ihre Tage bei den beiden von ihr so arglistig Hintergangenen, Isaak und Esau, beschließen und hat wohl noch oft seufzen müssen: „mich verdrießt zu leben mit den Töchtern Heths“, zu welchen Esau überdies später noch zwei Ismaelitinnen hinzufügte.
Für Jakob aber kamen als bittere Frucht seiner Hinterlist lange und prüfungsvolle Dienstjahre, wo nun er überlistet wurde. Zwar hatte er das Glück, noch bevor er Haran erreichte, seine Base Rahel anzutreffen, welche sämtliche Erfordernisse der Schönheit an sich vereinigte: einen schönen Wuchs und ein schönes Antlitz. Luther übersetzt: „Rahel war hübsch und schön“ (1. Mos. 29,17). Sofort verliebte Jakob sich in sie, und als Laban nach kurzer Frist einen Dienstvertrag mit ihm schloss, versprach ihm Jakob, sieben Jahre um sie zu dienen. Von ihrer älteren Schwester, der Lea, wollte er nichts wissen, dieselbe hatte nämlich, wenn auch vielleicht nicht, wie es bei Luther heißt, „ein blödes Gesicht“, so doch nach dem Grundtext jedenfalls glanzlose Augen, mithin einen im Orient, wo das Publikum nichts als eben die Augen zu sehen bekommt, besonders großen Mangel. Die sieben Jahre, nach heutigen Begriffen eine grausam lange Zeit, wurden dem Jakob durch seine Liebe zu Rahel und wohl auch durch ihre Liebe zu ihm so versüßt, dass es ihn dünkte, es seien nur sieben Tage (1 Mos. 29,20). Als sie aber im waren, bekam er nicht Rahel, sondern musste sich zunächst, freilich nur für eine Woche, mit Lea begnügen. Und auch dann gab ihm Laban die geliebte Rahel nur unter der Bedingung, dass er weitere sieben Jahre sein Knecht sei.
Das Verhältnis, in welchem nun die beiden Schwestern als Gattinnen des Patriarchen zu einander standen, war das der gewöhnlichsten Eifersucht. Zwar verlieh Gott der Lea als Entschädigung dafür, dass Jakob die Rahel lieber hatte, reicheren Kindersegen. Sie schenkte ihrem Manne sechs Söhne, Rahel nur zwei; und wenn auch Jakob den beiden Rahelssöhnen den Vorzug gab, so befanden sich dagegen unter denen der Lea die beiden, deren Nachkommen später unter dem Volk Gottes die größte Bedeutung gewonnen haben: Levi und Juda. Nicht die schöne Rahel, sondern die zurückgesetzte, aber gottesfürchtige Lea ist die Ahnmutter des großen Königs David und des noch viel größeren Davidssohnes, „aus Juda aufgegangen.“ Bei Gott ist kein Ansehen der Person, er brachte Lea zu Ehren, weil sie sich auf ihn verließ und nie vergaß, ihm auch dadurch zu danken, dass sie allen ihren Söhnen Namen von frommer Bedeutung gab (1 Mos. 29,32-35). Rahel dagegen mit ihren bloß äußeren Vorzügen wurde für die abergläubische Anhänglichkeit an die Hausgötzen ihres Vaters und für die unsaubere List, mit welcher sie bei deren Entwendung ihren listigen Vater noch überlistete (1 Mos. 31), schließlich auf die für sie empfindlichste Weise gestraft: sie musste erfahren, dass der von einem schwachen Jakob zum Israel erstarkte Mann die Unreinheit abgöttischen Wesens auch an ihr nicht duldete; höher als die liebende Treue, die Jakob seiner Rahel während sieben Jahren bewies, stellen wir mit der Schrift den Mannesmut, mit dem er auch dem. „Weibe in seinen Armen“ (5 Mos. 13,6) die Götzenbilder und die heidnischen Ohrenringe wegnahm und unter der Eiche bei Sichem vergrub (1 Mos. 35,4). Rahel starb bei Benjamins Geburt und wurde bei Bethlehem begraben. Lea dagegen wurde in der Patriarchengruft bei Hebron beigesetzt (1. Mos. 49,31).
Durch die merkwürdigen Schicksale von Rahels älterem Sohne Joseph kam Israel nach Ägypten, und durch einen Nachkommen der Lea, den durch Vater und Mutter von Levi stammenden Mose, wurde die zum Volk angewachsene Familie nach Kanaan zurückgeführt. Bei beiden Ereignissen brauchte Gott ägyptische Frauen zu Werkzeugen: dort die frivole Frau des Potiphar, hier die menschenfreundliche Tochter Pharaos. Dieser Letzteren sind wir schon darum eine dankbare Erwähnung schuldig, weil wir ihrem warmen Interesse für ein wimmerndes Kindlein die ältesten Stücke der heil. Schrift zu verdanken haben. Sie nämlich war es, die den glücklich geretteten und in ihrem Auftrag von der Mutter Jochebed und der Schwester Mirjam während der ersten Lebensjahre selbstverständlich treu besorgten Mose als ihren Adoptivsohn (2 Mos. 2,10) erziehen ließ und so unter providentieller Leitung diesen Sohn Israels weit über das Niveau seines in sklavischer Unwissenheit gehaltenen Volkes zu „aller Weisheit der Ägypter“ (Apostelg. 7,22), d. h. zur höchsten Höhe damaliger Bildung emporhob. Diese ägyptische Weisheit hat einerseits als der nicht zu unterschätzende menschliche Teil der Ausrüstung Moses ihn fähig gemacht, sein ganzes Volk auf die Dauer zu beherrschen. Und andererseits ermöglichte sie ihn, schriftliche Aufzeichnungen zu machen, welche ohne Zweifel einen ansehnlichen Bruchteil des Pentateuchs ausmachen, und um welcher willen derselbe den Namen der fünf Bücher Mose erhielt.
Unter den Töchtern Israels aus der Zeit des Auszugs ragt nur eine hervor: Moses Schwester Mirjam. Seine Frau, die Zippora, die nicht einmal seinem Volk entsprossen war, ist eigentlich erst in Folge ganz moderner Dichtungen überhaupt wieder genannt worden. Mose teilt in diesem Stück das Los vieler großer Männer. Unbeansprucht von geistigen Bedürfnissen in der eigenen Häuslichkeit, sollen solche Männer offenbar gänzlich dem großen Ganzen angehören. So ist es denn auch gewiss nicht von ungefähr, dass Mose eine höchst unbedeutende Frau hatte. Seine selbstständige Schwester Mirjam dagegen nahm teils als kräftige Hilfe, teils als heilsames Gegengewicht eine namhafte Stellung neben ihm ein. In ersterer Hinsicht sehen wir sie gleich nach dem Zuge durchs rote Meer mit der Pauke in der Hand den Reigen der Frauen ihres Volkes anführen und hören sie den Lobgesang anstimmen: „Lasst uns dem Herrn singen, denn Er hat eine herrliche Tat getan, Mann und Ross hat Er ins Meer gestürzt“ (2 Mos. 15,20.21). Aus diesem Vorgang bildete sich dann später ein im Alten Testament mehrfach erwähnter regelmäßiger Anteil der Frauen und Jungfrauen aus dem Stamme Levi am Tempeldienst und bei Volksfesten heraus, und es ist Mirjam somit als Begründerin dieses weiblichen Levitentums anzusehen. Um der begeisternden Wirkung willen, die sie in solcher Weise auf das oft sehr gedrückte Volk ausübte, wird sie (2 Mos. 15,20) eine Prophetin genannt und von Micha (6,4) in ehrender Weise neben Mose und Aaron als eine von Gott zur Erlösung des Volkes Gesandte bezeichnet. Als sie aber einmal auch in anderer Weise Prophetin sein und in törichter Selbstüberschätzung sich gegen Mose auflehnen und ihm gleichstellen wollte, da ließ zwar Gott Solches zu, um seinen treuen Knecht zu prüfen und zu läutern, über sie aber ergrimmte der Zorn des Herrn, und sie ward aussätzig wie Schnee. Welch große Liebe Mose dennoch zu ihr hatte, zeigte seine innige Fürbitte für sie. Und der Umstand, dass das Volk nicht weiter zog, bis die geheilte Mirjam mitreisen konnte, beweist am besten, wie sehr sie geschätzt war (4 Mos. 12).
Das mosaische Gesetz enthält zum Schutz des weiblichen Geschlechtes die schärfsten Strafbestimmungen. In Anlehnung an das fünfte Gebot und in unmittelbarem Anschluss an die zehn Gebote heißt es 2 Mos. 21,15 u. 17: „Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, der soll des Todes sterben“, und „wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben“. Neben der allgemeinen Einschärfung unbedingter Ehrerbietung gegen Vater und Mutter finden wir im ganzen Alten Testament die gehorsame und zärtliche Liebe zur Mutter mit besonderem Nachdruck gefordert. David z. B. weiß, um die Tiefe seiner Betrübnis und die Größe seines Elendes vor Gott zu bringen, in dem Gebet Ps. 35, V. 14 keinen plastischeren Ausdruck als den: „Ich ging traurig, wie Einer der Leid trägt über seine Mutter“; und Hesekiel (22,7) führt unter den ärgsten Gräueln der Vornehmen von Jerusalem mit größter Entrüstung auch den an: „Vater und Mutter verachten sie“. Den modernen Juden aber darf man das Ehrenzeugnis nicht versagen, dass sie in dieser Beziehung noch immer streng nach Gesetz und Propheten leben. Der großmächtigste israelitische Geldfürst unternimmt nichts von irgend welcher Wichtigkeit ohne den Segen seiner Mutter dazu geholt zu haben; die Mutter, und wenn sie das einfältigste Krämerweiblein wäre, sie und nicht die Frau, auch nicht die distinguierteste Fremde führt er zum Ehrenplatz an seinem Tisch und begrüßt sie vor Jedermann beim Kommen und beim Gehen mit unterwürfigem Handkuss. Wenn auch einige Ostentation dabei ist, was schadets? Vielleicht hat gerade diese Ostentation einen pädagogischen Wert, um die kindliche Ehrerbietung von Geschlecht zu Geschlecht fortzupflanzen. Mich wenigstens hat, als ich Solches im Hause eines Nürnberger Handelsherrn zum ersten Mal näher zu beobachten Gelegenheit hatte, beim Gedanken an manche sogenannte christliche Familien tiefe Beschämung ergriffen.
Auch zu Gunsten der Witwen finden sich im mosaischen Gesetz und bei den dasselbe bestätigenden Propheten eine Reihe schöner Bestimmungen. Den Witwen zu ihrem Recht zu verhelfen gilt im ganzen Alten Testament als eine Gott besonders wohlgefällige und auch in den Augen der Gemeinde ehrenvolle Sache, das Gegenteil aber, namentlich das Bedrücken und Auspfänden von Witwen, als entsetzliche Versündigung, welche Gott, der Richter der Witwen, rächen werde. Den Witwen kam auch die Einführung der Leviratsehe zu gut. Durch das diesbezügliche Gesetz (5 Mos. 25,5 ff.) verfügte nämlich Mose, dass wenn Einer ohne Kinder sterbe, sein Bruder die Witwe heiraten solle.
Was aber die mosaische Ehegesetzgebung anbetrifft, so wird darin die Frau unverhältnismäßig strenger behandelt als der Mann; jedenfalls wird die Sittenreinheit der Ehefrau aufs Unerbittlichste gefordert. Jedoch wird unleugbar schon im Alten Testament die Ehe Eines Mannes mit Einer Frau als das Richtige betont und auch im Allgemeinen innegehalten, auch wird der Familie, beziehungsweise dem Besitzer eines in seiner Ehre verletzten Mädchens das Recht eingeräumt, Entschädigung zu fordern.
Manches, was uns Christen und besonders dem christlichen Zartgefühl der Frau höchst anstößig ist, kommt im Alten Testament ohne Rüge davon; doch wird nirgends der Zuchtlosigkeit irgendwie das Wort geredet, und unter den vielen hervorragenden Frauengestalten der ganzen alttestamentlichen Theokratie ist nur eine Einzige, deren guter Ruf mit Recht kann angegriffen werden: jene Buhlerin von Jericho, Namens Rahab. Von ihr berichtet das Buch Josua (Kap. 2), dass sie durch die Kunde von den Machttaten Jehovas zur Überzeugung gekommen sei, der Gott Himmels und der Erde habe das Land Kanaan den Israeliten zu eigen gegeben, dass sie diesen Glauben durch ihre Mitwirkung bei der Eroberung betätigt habe und dass sie samt ihrer ganzen Familie zum Lohn dafür bei der Zerstörung Jerichos und der Vertilgung seiner Einwohner verschont worden sei. Das Neue Testament führt sie deswegen wiederholt (Hebr. 11,31 u. Jak. 2,25) als Beispiel dafür an, dass und in wiefern der wahre, durch Werke tätige Glaube eine rettende, seligmachende Kraft besitzen könne.
Aus der bewegten Zeit der Richter ist natürlich vor allen Anderen Debora hervorzuheben, welche sich selbst den Ehrennamen der „Mutter in Israel“ verleiht. Sie ist die einzige Frau, die wir als Führerin des Volkes Gottes auftreten sehen. An ihr ist zunächst das der Beachtung wert, dass sie nicht wie die Heldenweiber anderer Nationen, nicht wie die ihr wohl am ehesten vergleichbare Jungfrau von Orléans und Andere eine vestalische Jungfrau, sondern eine verheiratete Frau war. Auch darf nicht übersehen werden, dass sie sich nicht selbst an die Spitze des israelitischen Heeres stellte, sondern sie berief, nachdem sie durch ihre prophetischen Gaben zum richterlichen Ansehen gelangt war, den Barak als Feldherrn. Erst, als sie sah, dass es diesem an Glaubens-Mut fehle, gegen die gewaltige Heeresmacht des neugekräftigten kanaanitischen Königreichs im gläubigen Vertrauen auf die Hilfe des HErrn auszuziehen, entschloss sie sich den Kriegszug mitzumachen (Richter 4). Als es ihrem geistesmächtigen Anregen, Anfeuern und Anordnen gelungen war, die gegnerische Macht zu Boden zu werfen, da sang sie jenes herrliche Siegeslied (Richter 5), dessen glühender Patriotismus und schwungvolles Pathos noch heute die Bewunderung des einfachsten Volks-Mannes wie der größten Poesie-Kenner ausmachen. Der Gegensatz zwischen den tapferen Frauen und den erbärmlichen Männern jener Tage, welche sich sogar - man denke an Simson - von schönen Weibern der Philister überwinden ließen, dieser Gegensatz wird in der Geschichte der Debora dadurch noch verschärft, dass Debora nicht an Barak oder einem andern israelitischen Helden, sondern an einer nichtisraelitischen Frau Namens Jael die beste Hilfe hatte. Diese nämlich lud den kanaanitischen Feldhauptmann Sissera mit listiger Zutraulichkeit ein, in ihrem Zelte Rast zu halten, und schlug ihm dann während des Schlafs mit dem Hammer den Zeltpflock in die Schläfe. Es kommt im weiteren Verlauf des Richterbuches noch eine solche weibliche Figur wie Jael vor: jenes Weib, das Israel von dem Tyrannen Abimelech, dem Sohne und Nachfolger Gideons, befreite, indem es ihm von einem Turm herab die Hälfte eines Mühlsteins auf den Schädel warf (Richter 9,53). Wir spätgeborenen Menschenkinder mögen ob solchen alttestamentlichen Schreckenstaten schaudern, zumal wenn Frauen sie zu tun berufen werden. Allein, wenn wir dann am Ende einer solchen Erzählung Worte lesen von der Inhaltsschwere der Einen Zeile, mit welcher die Geschichte der Debora schließt: „und das Land war stille (hatte Frieden) vierzig Jahre“, so spricht der Erfolg so laut für diese gewaltigen Weiber, dass uns nichts Anderes übrig bleibt, als schweigend zu staunen.
Nicht so schrecklich dagegen, als Luther gemeint hat und als auch noch manche Zeitgenossen glauben annehmen zu müssen, ist die Geschichte von Jephtas Tochter (Richter 11). Da dieselbe auch ihnen vielleicht schon Mühe gemacht hat, so erlauben Sie mir mit einigen Worten darauf einzugehen. Jephta, einer der späteren Richter, hatte im Krieg gegen die Ammoniter das Gelübde getan: „wenn Gott gibt die Söhne Ammons in meine Hand, so wird Alles, was aus den Türen meines Hauses mir entgegenkommt, wenn ich als Sieger heimkehre, Gott angehören, ihm werde ich es darbringen als Opfer“. Jephta siegte; als er aber heimkehrte, wurden ihm nicht, wie gewöhnlich einem solchen Triumphator, die besten Beutestücke in feierlichem Zuge zuerst entgegengebracht, sondern gegen die Sitte der Zeit trat seine eigene Tochter voll Freude, den Vater wiederzusehen, zuerst heraus. „O meine Tochter“, ruft er da, „du hast mich tief gebeugt, du allein bist mein Bedränger; denn ich habe meinen Mund Gott geöffnet, ich kann nicht umkehren“. Und die Tochter ist nicht kleiner als der Vater, sie spricht: „so möge diese Sache mir geschehen, nur lass mich noch auf die Berge wandeln und weinen über meine Jungfrauschaft“. Dies Letztere zeigt deutlich, dass Jephta sie nicht getötet, sondern nur um seines Gelübdes willen zur Ehelosigkeit verurteilt hat. Die Ehelosigkeit aber galt der Tochter Jephtas als einer Tochter ihrer Zeit und ihres Volkes ärger als der Tod.





























