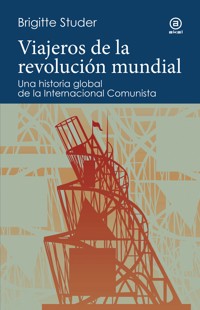Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hier und Jetzt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich", hiess es in der 1848 geschaffenen Verfassung des neuen Bundesstaates. Doch die Kämpfe waren lang und zäh bis zur Einführung des Frauenstimmrechts 1971. Es gibt viele Einzeluntersuchungen dieser Entwicklungsgeschichte, aber keine umfassende Darstellung, die den Bogen über den gesamten Zeitraum spannt und bislang unerschlossene Kantone integriert. Diese Lücke schliesst das Buch von Brigitte Studer und Judith Wyttenbach. Im historischen Teil werden unter anderem die vielschichtigen Ausschlussmechanismen analysiert. Und der juristische Teil greift erstmals jedes einzelne Urteil zur Frage des Frauenstimmrechts chronologisch und mit knapper Darstellung auf. In der Synthese zum Schluss zeigen die Autorinnen, weshalb der ganze Prozess in der Schweiz so lange gedauert hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Studie wurde im Auftrag des FRI –Schweizerisches Institut für feministische Rechtswissenschaftund Gender Law erstellt.
Frauenstimmrecht
Historische und rechtliche Entwicklungen 1848–1971
Brigitte StuderJudith Wyttenbach
Inhalt
Vorwort
Einleitung und Dank
Politische Aktion, Akteurinnen und Akteure, Argumente
Einleitung
Die politische Aktion
1848 bis 1872/74: die konzeptuelle Emergenzphase
Vor der Jahrhundertwende bis 1912: die organisationale und politische Konstruktionsphase
1916/17 bis 1921: das Opportunitätsfenster
Die Zwischenkriegszeit und die Kriegsjahre: Stagnation und Rückschläge
Die unmittelbare Nachkriegszeit: kurze Phase des Aufbruchs
Die langen 1950er-Jahre: die Suche nach Alternativtaktiken und der erste nationale Test
Die 1960er-Jahre: progressive Radikalisierung
Die Akteurinnen und Akteure
Eine kleine, organisierte Minderheit
Männer als Feministen
Lokale Eliten
Sittlich-soziales Engagement und Erwerbstätigkeit
Von den ledigen Lehrerinnen zu den verheirateten Juristinnen
Späte Auflösung der protestantischen Dominanz und vermehrtes parteipolitisches Engagement
Konstanz und Wandel über die Zeit
Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Gegnerinnen
Die Argumente
1917 bis 1921: Gerechtigkeit, Fortschritt und wahre Demokratie versus «die Frau gehört ins Haus»
Die Zwischenkriegszeit und die Kriegsjahre: weiblicher Beitrag versus unvergleichbare Schweizer Demokratie
Die unmittelbare Nachkriegszeit: Humanisierung des Staats versus Gleichheit nur für Gleiche
Die Botschaft von 1957: zweideutiger Bundesrat
Die Debatte in den eidgenössischen Räten 1957/58: Rückständigkeit versus Schadensbegrenzung
Die Westschweizer Debatten: der ökonomische Beitrag der Frauen versus alte Gegenargumente
Nach der Abstimmung 1959: Scheindemokratie versus Mehrheitsentscheid der Männer
Die 1960er-Jahre: staatspolitische Relevanz des Frauenstimmrechts versus Status quo
Die Debatte über die EMRK 1969: störende versus relevante Frauenorganisationen
Die Debatte 1970 über die Bundesratsbotschaft: Gleichstellung mit Differenz
Der Durchbruch 1971: Dank der «Grosszügigkeit des Männervolks»
Fazit
Politische Konjunkturen und internationale Kontexte
Die Geografie der politischen Auseinandersetzungen und Abstimmungen
Der Wandel der Zustimmungsraten
Die Palette der Entscheidungsmodi
Der Wandel der politischen Kräfteverhältnisse
Die Soziologie der Akteurinnen und Akteure
Das Kaleidoskop der Argumente
Anhang
Anmerkungen
Abkürzungsverzeichnis
Bibliografie
Kartenmaterial
Szenen und Objekte
Aktionsformen und Mobilisierungsmittel im Kampf um das Frauenstimmrecht
Abbildungsverzeichnis
Rechtlicher Diskurs und Handlungsinstrumente
Veröffentlichungen der schweizerischen Staatsrechtslehre und weitere juristische Publikationen
Staatsrechtslehre und juristische Literatur von 1848 bis 1873
Staatsrechtslehre und juristische Literatur von 1874 bis 1911
Staatsrechtslehre und juristische Literatur von 1912 bis 1939
Staatsrechtslehre und juristische Literatur von 1940 bis 1959
Staatsrechtslehre und juristische Literatur von 1960 bis 1971
Argumentationslinien in der juristischen Literatur
Würdigung der juristischen Debatte
Der Beitrag des Bundesgerichts zur Debatte bis 1971
Die Stellung des Bundesgerichts
Keine Chance für das Frauenstimmrecht vor Bundesgericht
Interpretationsweg bei der Anwältinnenzulassung – historische Interpretation beim Frauenstimmrecht
Würdigung
Staatsrechtsliteratur und verfassungsrechtliche Entwicklung in den Kantonen
Die Literatur zum Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene
Erste Forderungen zur politischen Gleichstellung: Schule, Kirche und Frauenstimmrechtsvereine
Das Männerstimmvolk und kantonale Eigenheiten
Die Rolle von Regierung und Parlament
Welche politischen Handlungsmöglichkeiten sah das Bundesverfassungsrecht vor?
Anfänge in den Kantonen
Bundesebene
Politische Rechte auf völkerrechtlicher Ebene bis 1971 – und die Schweiz?
Völkerrechtliche Standards im Bereich der politischen Rechte und der Nichtdiskriminierung vor 1971
Diskurs vor 1971 über die Frage der Menschenrechtsverletzung
Anhang
Anmerkungen
Abkürzungsverzeichnis
Bibliografie
Materialienverzeichnis
Das Frauenstimmrecht – weshalb es in der Schweiz so lange dauerte und weshalb es schliesslich dazu kam
Die «natürliche» Geschlechterordnung
Geschichte – Tradition – politisches System
Die soziale Dimension
Die wirtschaftliche Dimension
Die politischen Akteurinnen und Akteure
Die institutionelle Ebene
Föderalismus
Die internationale Ebene – transnationale Verflechtungen
Politische Konjunkturen
Autorinnen
Vorwort
Als Auftraggeberin der Forschungsarbeit von Brigitte Studer und Judith Wyttenbach hat die Stiftung FRI – Schweizerisches Institut für feministische Rechtswissenschaft und Gender Law das Privileg, der Studie einige Worte zum Hintergrund ihres Auftrags vorausschicken zu dürfen.
Recht und Gesetz wirken direkt und indirekt auf die Geschlechterverhältnisse und auf die Gestaltung des Lebens von Individuen aller Geschlechter. Deshalb ist ein kritischer, geschlechterbewusster Blick auf das Recht gefragt: Diesen will das FRI einnehmen und fördert deshalb die feministische Rechtswissenschaft und Gender Law. Das Institut geht auf die Initiative von feministischen Juristinnen in den 1990er-Jahren zurück und wird aktuell von einer Gruppe von Personen getragen, die was Geschlecht, Generation, Region und beruflicher Hintergrund angeht, vielfältig zusammengesetzt ist. So ist denn auch die Vernetzung von an Geschlechterfragen im Recht interessierten Forschenden und Fachleuten aus Rechtsanwendung, Politik und Gleichstellungspraxis ein wichtiges Anliegen. Das FRI ist ein Ort des Diskurses, der sowohl auf einer rechtspraktischen wie einer theoretischen Ebene geführt wird, und wo Wert auf den Dialog zwischen den beiden Ebenen gelegt wird. Das Institut behandelt die Geschlechterfrage als Querschnittsthema, das alle Rechtsbereiche betrifft. Visionen sind eine geschlechtergerechtere Welt, die Freiheit der Lebensgestaltung ohne einengende, auf die geschlechtliche und sexuelle Identität bezogene Normen und der Abbau von Herrschaft und Hierarchien.1
Mit diesen Zielen vor Augen hat das FRI die Professorinnen Brigitte Studer (Geschichtswissenschaft) und Judith Wyttenbach (Rechtswissenschaft) im Herbst 2019 mit der Ausarbeitung der vorliegenden Studie beauftragt. Beweggrund dafür war, dass das FRI das 50-Jahre-Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts im Jahr 2021 zum Anlass nehmen wollte, sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft zu blicken: Mit Blick auf die Vergangenheit stellt sich die Frage der tieferen Ursachen dafür, dass die Schweizer Staatsbürgerinnen im internationalen Vergleich erst sehr spät, im Jahr 1971, Zugang zu den politischen Rechten erhalten haben. Welche gesellschaftlichen und kulturellen Gründe können aus historischer Sicht ausgemacht werden? Welche rechtswissenschaftlichen Diskurse, Akteurinnen und Akteure haben zur Aufrechterhaltung des diskriminierenden Zustands beigetragen, welche haben den Wandel hin zur Demokratisierung befördert? Welchen Spielraum hatten die Entscheidungsträger in den politischen Behörden und Gremien? Und wie ist das vergangene Unrecht aus heutiger Sicht zu bewerten? Den Autorinnen ist es mit ihrem Forschungsteam gelungen, zu all diesen Fragen höchst interessante neue Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig bestehendes Wissen zu systematisieren und so besser zugänglich zu machen.
Die bessere Kenntnis der Vergangenheit ermöglicht uns heute, in die Zukunft zu blicken: Aus juristischer Sicht ist dieses Jubiläum insbesondere eine Gelegenheit, auf die Frage nach der Auslegung von Normen zurückzukommen und damit auch auf die Macht der verschiedenen politischen und rechtlichen Instanzen, Fortschritte im Bereich der Gleichstellung zuzulassen – oder auch nicht. Zur Erinnerung: Wenn es notwendig war, zu warten, bis die Schweizer Männer zustimmten, den Schweizer Frauen das Stimm- und Wahlrecht zu gewähren, dann deshalb, weil das Parlament es nicht wagte, eine Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte vorzuschlagen, die auf einer neuen Auslegung von Artikel 74 der Bundesverfassung von 1874 beruht hätte, wie Judith Wyttenbach darlegt. Diese Beobachtung beschränkt sich allerdings nicht auf die Frage der demokratischen Teilhabe: Generell bedeutet die tatsächliche Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern und im weiteren Sinne aller Menschen notwendigerweise, sich von der historischen Bedeutung der durch das patriarchalische System geprägten Normen zu lösen, um innovative Interpretationen vorzuschlagen. Zwar tun sich unsere Institutionen immer noch regelmässig schwer, diesen Schritt zu gehen – man denke etwa an das Urteil des Bundesgerichts von 2014, in dem es eine Universität dazu verpflichtete, eine Studentenverbindung anzuerkennen, obwohl diese Frauen ausschloss,2 oder an jenes von 2019, in dem es sich weigerte, Artikel 3 Absatz 1 des Gleichstellungsgesetzes auf eine homosexuelle Person anzuwenden, mit der Begründung, dass Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes falle, weil es ihm an Geschlechtsspezifität fehle.3 Umgekehrt wagte unser höchstes Gericht den späten Schritt weg von der historischen Auslegung im Jahr 1990, indem es den in der Verfassung des Kantons Appenzell Innerrhoden verankerten Begriff der «Landleute» gleichstellungskonform auslegte.4 Das Bundesparlament tat es ihm in jüngerer Zeit gleich, indem es der Ansicht war, dass eine systematische, völkerrechtskonforme Auslegung der Artikel 14 und 119 der Bundesverfassung den Verzicht auf eine Verfassungsrevision zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare wie auch den Zugang zur Fortpflanzungsmedizin für Frauenpaare ermöglicht.5
Was lehrt uns vergangenes Unrecht für die Zukunft? Perspektiven für ein geschlechtergerechteres Recht sehen wir in einer besseren Nutzung der bestehenden Rechtsinstrumente durch Anwältinnen und Anwälte, die verstärkt auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Gleichstellungsgesetzes, aber auch auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) oder die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zurückgreifen könnten. Expertise im Bereich des Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsrechts sollte zu einem wesentlichen Kriterium für die Wahl von Richterinnen und Richtern ans Bundesgericht werden. Lehrangebote im Bereich der feministischen Rechtswissenschaft und Gender Law wären an den Schweizer Rechtsfakultäten zu entwickeln. Ganz grundsätzlich ginge es schliesslich darum, anknüpfend an Vordenkerinnen wie Olympe de Gouges, Iris von Roten, Tove Stang Dahl oder Margrith Bigler-Eggenberger, den rechtlichen Kompass konsequent nach der Lebensrealität von Frauen zu richten, oder zeitgemässer formuliert, Gleichheit aus der Perspektive der von Unrecht Betroffenen zu denken.6
Für das FRI – Schweizerisches Institut für feministische Rechtswissenschaft und Gender Law
Véronique Boillet
Michelle Cottier
Sandra Hotz
Nils Kapferer
Zita Küng
Seraina Wepfer
Anmerkungen
1Vgl. zu den Aktivitäten des FRI die Website www.genderlaw.ch.
2BGE 140 I 201, E. 6.7.4.
3BGE 145 II 153, E. 4.
4BGE 116 Ia 359, E. 10c.
513.468 Parlamentarische Initiative «Ehe für alle». Bericht und Entwurf der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates vom 30. August 2019, BBl 2019, S. 8595, 8600, 8610f.
6Baer, Susanne: Gleichheit im 21. Jahrhundert, in: Kritische Justiz 53/4 (2020), S. 543, 549f.
Einleitung und Dank
«Es gibt nur einen einzigen Grund, gegen das Frauenstimmrecht zu sein – aus Angst, Macht zu verlieren», gab Nationalrat Alois Grendelmeier, Vertreter des Landesrings der Unabhängigen, 1951 in der nationalrätlichen Kommission zu Protokoll. Auch die Juristin Iris von Roten fand 1958, im Vorfeld der ersten Volksabstimmung, deutliche Worte: «Der Riesensäugling will seinen Schnuller.» Es gehe darum, dass man auf Kosten der Frauen mehr vom weltlichen Leben haben könne und nichts an Selbstachtung, Geld und Bequemlichkeit einbüssen wolle, denn die politische Gleichberechtigung würde die Lage der Frauen und Männer bis «in die alltäglichen Einzelheiten» bedeutend verändern. Statt über die Wahrheit zu reden, kämen jedoch einzig Vorwände zur Sprache. Wir befassen uns in diesem Buch mit den institutionellen Hürden der Schweizer Verhinderungsdemokratie, den politischen Entwicklungen, den Akteurinnen und Akteuren und den Diskursen auf dem Weg zum Frauenstimmrecht. Letztlich kommt aber der Angst vor Machtverlust, die Alois Grendelmeier bezeichnete, und der Kraft der Vorwände, die Iris von Roten erwähnte, die entscheidende Rolle zu, weshalb die Einführung des Frauenstimmrechts im System der Männerdemokratie Schweiz erst so spät erfolgte.
Im Herbst 2019 beauftragte uns das Schweizerische Institut für feministische Rechtswissenschaft und Gender Law (FRI), im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2021 eine Studie zur Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz zu verfassen. Die Studie sollte sich anhand konkreter Fragestellungen mit den gesellschaftlichen und rechtlichen Debatten vor der Einführung des Frauenstimmrechts auseinandersetzen: Zu welchen Zeitpunkten wurde die Einführung besonders intensiv diskutiert? Welche Akteurinnen und Akteure waren in diesem Prozess besonders wichtig? Wie verliefen die gesellschaftlichen Diskurslinien? Wie wurde das Frauenstimmrecht in der rechtswissenschaftlichen Debatte diskutiert? Inwiefern stellte der Ausschluss von den politischen Rechten aufgrund des Geschlechts vor 1971 eine staatliche Menschenrechtsverletzung dar? Welche Handlungsmöglichkeiten bestanden in Bund und Kantonen auf politischer und rechtlicher Ebene, und welche wurden genutzt? Und schliesslich: Weshalb war die Einführung zu früheren Zeitpunkten gescheitert, und warum gelang sie 1971? Der Auftrag führte zu einer interdisziplinär angelegten Studie mit einem historischen Teil, verfasst von Brigitte Studer, und einer Diskursanalyse aus rechtswissenschaftlicher und rechtshistorischer Sicht von Judith Wyttenbach und den Doktorandinnen an ihrem Lehrstuhl, Daniela Feller, Sanija Ameti und Laura Bircher. Die Studienanlage mit je eigenen Fragestellungen und Forschungsdisziplinen bringt mit sich, dass die Teile unterschiedlich aufgebaut sind und sich zum Beispiel auch die Belegung und Zitierweise unterscheiden. Aus der gemeinsamen Reflexion und Diskussion der beiden Teilstudien entstand die Synthese mit den übergreifenden Erkenntnissen, die den dritten Teil dieses Buches bildet.
Wissenschaft schreibt sich nie isoliert. Wir sind keine Ausnahme und möchten daher danken:
–dem FRI für den Auftrag, der uns dazu motivierte, mit einem interdisziplinären Blick und anhand konkreter Fragestellungen auf die spannende Geschichte des Frauenstimmrechts zu schauen;
–den Mitgliedern des Sounding Boards, die eine erste Fassung gelesen, kritisch kommentiert und uns wertvolle Hinweise gegeben haben (Caroline Arni, Michelle Cottier, Ruth Dreifuss, Irène Herrmann, Sandra Hotz, Regula Kägi-Diener, Claudia Kaufmann, Zita Küng, Andrea Maihofer, Lisa Mazzone und Yvonne Schärli);
–Regula Kägi-Diener und Werner Seitz, die sich das gesamte Manuskript zur Brust genommen, sehr detailliert kommentiert und uns auf Unstimmigkeiten hingewiesen haben;
–Lisia Bürgi, Eliane Braun und Sabrina Alvarez für ihre umfangreichen, akribischen und teilweise schwierigen Recherchen, die Erstellung von Übersichten und Tabellen und für die redaktionellen Arbeiten;
–Monika Wyss für die formale Durchsicht des rechtswissenschaftlichen Teils.
Eine Erklärung zur Begrifflichkeit: In der Schweiz wird umgangssprachlich und in den Quellen der Begriff «Frauenstimmrecht» verwendet, doch sind damit sowohl das Wahlrecht als auch das Stimmrecht gemeint. In den politischen Debatten wurde im Deutschen vielfach die Unterscheidung zwischen «aktivem» und «passivem» Stimm- und Wahlrecht gemacht (eine Unterscheidung, die teilweise auch auf Französisch übernommen wurde). Ersteres meint das Recht, sowohl abstimmen wie wählen zu dürfen, Letzteres nur die Wählbarkeit. In den historischen Debatten war auch der Begriff «integrales» Frauenstimmrecht in Gebrauch. Damit wurden diejenigen politischen Rechte bezeichnet, über die in der Regel seit 1848 auch die Schweizer Männer verfügten: Stimm- und Wahlrecht, Wählbarkeit von der Gemeinde über den Kanton bis zum Bund sowie eventuelle weitere mit der Aktivbürgerschaft verbundene Rechte. In den Debatten über das Frauenstimmrecht bezog sich jedoch das «integrale» Frauenstimmrecht manchmal auch nur auf Gemeinde und Kanton.
Neuenburg und Bern, im Februar 2021
Brigitte Studer und Judith Wyttenbach
Politische Aktion, Akteurinnen und Akteure, Argumente
von Brigitte Studer
Einleitung
1893 erhielten die Frauen Neuseelands das Wahlrecht. Einige amerikanische Gliedstaaten waren vorausgegangen; die ersten Staaten Europas führten es nach der Jahrhundertwende ein, 1906 zuerst Finnland, dann, nach dem Ersten Weltkrieg, gab es eine grosse Welle, nach dem Zweiten Weltkrieg eine kleinere, in der fast alle folgten. International noch kaum beachtet, hatten die zu Grossbritannien gehörenden Pitcairninseln das Frauenstimmrecht bereits 1838 eingeführt. Nur in der Schweiz dauerte es bis 1971; so spät erst wurde den Schweizerinnen der Status von politischen Rechtssubjekten gewährt.1
Der formale Ausschluss der Frauen aus der Politik ging der Legitimation dieses Ausschlusses voran. Benötigte die Französische Revolution vier Jahre, bevor sie die Frauenklubs schloss und die Jakobiner-Frauen damit aus der neu konstituierten öffentlichen Sphäre verbannten, erledigten dies die eidgenössischen Verfassungsgeber 1848 still und diskussionslos. Sie etablierten ein universelles Männerstimmrecht, das die kommenden 123 Jahre den Schweizer Stolz begründete, die «älteste Demokratie der Welt» geschaffen zu haben – eine Demokratie, die mit anderen inkommensurabel war. Für die Schweiz, meinen Brigitte Schnegg und Christian Simon, waren zur Zeit der Helvetischen Republik die grossen Kämpfe der Frauen bereits stellvertretend in Frankreich entschieden worden, die Männer waren gewarnt.2 Die entstehende bürgerliche Gesellschaft distanzierte sich von der in ihren Augen verweichlichten aristokratischen Gesellschaftsordnung und ihren geschlechtergemischten Geselligkeitsformen, wie sie in der Schweiz auch die urbanen patrizischen Oberschichten in Bern, Neuenburg, Genf und Lausanne pflegten. Das Geschlecht galt nun für das politische Partizipationsrecht als ausschlaggebend. Die schweizerische Aufklärung, angeführt vom Zürcher Kreis um Johann Jakob Bodmer, orientierte sich an den alten Schweizer Tugenden Wehrhaftigkeit, Sparsamkeit, Sittenstrenge, von Rousseau idealisiert und auch von den französischen Republikanern zum Vorbild gemacht. Neu kam die Vernunft hinzu, wie die Politik eine Männersache. Weiblichkeit galt als deren Gegensatz. Die Frauen hatten im Haus zu wirken, da konnten sie als Gattin und Mutter schalten und walten. Die Vertretung gegen aussen der als arbeitsteilige wirtschaftliche Einheit funktionierenden Familie fiel hingegen dem Mann zu. Er verkörperte das bürgerliche Rechtssubjekt. Wie Carole Pateman gezeigt hat, war die Geschlechterdifferenz für die Bildung der neuen politischen Öffentlichkeit im Liberalismus konstitutiv.3
Das ganze 19. Jahrhundert und beinahe das ganze 20. Jahrhundert bemühten sich Theoretiker, den Ausschluss der Frauen zu legitimieren. In einem kaum enden wollenden Redeschwall juristischer, philosophischer, literarischer und medizinischer Stellungnahmen und Schriften erklärten sie, dass diese Organisation der Gesellschaft der Geschlechternatur entspreche. Paradigmatisch formulierte es der Schweizer Staatsrechtler Johann Caspar Bluntschli: «Der Staat ist entschieden männlichen Charakters.» Im Endeffekt wurde ein soziales Konstrukt – die polarisierte bürgerliche Geschlechterordnung – naturalisiert. Dabei schrieben diese Theoretiker nicht nur gegen die seit der Aufklärung ertönenden feministischen Stimmen an, etwa einer Mary Wollstonecraft, sondern auch gegen einzelne Vertreter ihres eigenen Geschlechts, etwa einen Marquis de Condorcet, der sich zum Prinzip der Gleichheit aller Menschen bekannte und die politische Rechtlosigkeit von Frauen aufgrund einer wie auch immer verstandenen biologischen Differenz ablehnte.
Einigkeit herrschte im 19. Jahrhundert aber nur in Bezug auf das Verständnis der Geschlechterordnung, das die erst raren dissidenten Stimmen noch nicht zu erschüttern vermochten; sie dienten freilich als Warnung, dass dies nicht immer so bleiben könnte. Der Streit um politische Ordnungen hingegen, zwischen direkter Demokratie und Elitenherrschaft, zwischen Republikanismus und Liberalismus, zwischen Konservatismus und Radikalismus, zwischen Landsgemeinde und Parlamentarismus, zwischen Gemeindeautonomie und Zentralismus, löste sich nie ganz auf, auch wenn sich diese Elemente in der entstehenden eidgenössischen politischen Kultur allmählich vermischten. Es herrschte jedenfalls die Vorstellung vor, dass die politische Vertretung dem Familienhaupt zukam, und dieses war legal und habituell männlich. Frauen standen in vielen Kantonen bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts unter der männlichen Vormundschaft, die verheirateten mit dem Zivilgesetzbuch von 1912 de facto sogar bis 1988. Der Rückgriff auf eine mythologisierte Schlachtengeschichte, alimentiert durch die Offizialisierung der heroischen Vergangenheit, waren der Sicherung eines männerbündischen Gemeinwesens ebenso förderlich wie das Aufblühen einer exklusiven Männersoziabilität in patriotischen Vereinen, Berufsorganisationen und nicht zuletzt in der Milizarmee.4 Zum Ursprung und Kern des Schweizer Nationalkonstrukts wurde die Landsgemeinde stilisiert. Bis weit ins 20. Jahrhundert galt sie fälschlicherweise selbst Feministinnen als das Modell, das hinter der Verfassung des Bundesstaats stand.5 Das verlieh jenen Vertretern der Kantone eine Aura der Unantastbarkeit, wenn sie behaupteten, dass das Frauenstimmrecht mit der Schweizer Demokratietradition und ihren Formen nicht kompatibel wäre. «Wenn Sie uns unsere Landsgemeinden zerstören, zerstören Sie ein Stück Heimat», meinte 1966 ein Glarner Ständerat in Verteidigung seiner «Männergemeinde».6 Erst spät verlor der Erhalt des Schweizer «Männerstaats» – so ein Befürworter des Frauenstimmrechts in derselben Debatte – an Legitimität.7 Das Bekenntnis zur nationalkulturellen Selbstwahrnehmung stellte Gleichstellungsforderungen eine Falle, argumentiert Caroline Arni, bedeutete es doch ein Bekenntnis zu einem politischen Gemeinwesen, das ohne Frauen auskam.8
Der Weg, über die Erweiterung der zugewiesenen Rolle im häuslichen und karitativen Bereich, über die «domestication of politics»,9 Gleichstellung zu erreichen, führte daher nicht weit. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lösten sich einzelne Frauen von dieser Hoffnung, auf lokalpolitischer Ebene und dank ihres moralischen Auftrags zum Ziel zu kommen, und erhoben die Forderung von gleichen politischen Rechten. 1909, im selben Jahr übrigens, als in Frankreich die Union française pour le suffrage des femmes entstand, bildeten die Schweizerinnen dann ihre nationale Interessenorganisation für das «integrale» Stimm- und Wahlrecht, also für dieselben politischen Rechte wie die Männer.
Auch dieser Weg war lang, wie im Folgenden zu zeigen ist. Nicht zuletzt, weil die Ungleichheit der Geschlechter durch die Arbeit der Behörden und Parlamente, Parteien und Gewerkschaften immer wieder neu hergestellt und konsolidiert wurde.10 Dargestellt wird zuerst das politische Handeln der Stimmrechtsaktivistinnen und -aktivisten sowie ihrer Gegnerschaft in Kantonen und Bund. Danach richtet sich der Fokus auf die Akteurinnen und Akteure. Schliesslich wird nach den argumentativen Strategien in dieser langjährigen und virulenten politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Auseinandersetzung gefragt.
Die politische Aktion
Die Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz ist dicht und vielschichtig. Zwischen der Einführung des allgemeinen Männerstimm- und -wahlrechts 1848 und der gesamtschweizerischen Realisierung des Frauenstimmrechts 1990 durch einen Bundesgerichtsentscheid (Fall Rohner), der den Kanton Appenzell Innerrhoden zwang, seinen Widerstand gegen die politische Gleichberechtigung der Frauen aufzugeben, vergingen rund 150 Jahre. Dazwischen fanden über neunzig Abstimmungen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene statt.
Im Folgenden geht es darum, erstens eine Periodisierung vorzunehmen und die Momente des Wandels auf nationaler Ebene oder mit nationaler Bedeutung (Verfassungsrevisionen, nationale Abstimmungen und Petitionen, kantonale Abstimmungen mit nationaler Relevanz, parlamentarische Interventionen, Bundesgerichtsentscheide) zu analysieren. Inwiefern stellten sie Möglichkeitsfenster dar und welches waren die daran geknüpften Erwartungen der Befürworterinnen und Befürworter des Frauenstimmrechts? Und folgten darauf jeweils Phasen der politischen Stagnation oder des gesellschaftlichen Rückschritts? Zu fragen ist ferner, welche Taktiken die Befürworterinnen und Befürworter, aber auch die Gegnerinnen und Gegner verfolgten oder welches Aktionsrepertoire ihnen zur Verfügung stand, welche Allianzen welcher Art sie schliessen konnten und wie funktionstüchtig diese waren. Zweitens gilt es, den Blick auf die inter- und transnationale Ebene zu richten und zu fragen, welchen Einfluss die transnationalen Verflechtungen der Schweizer Feministinnen und Momente des Beitritts der Schweiz zu internationalen Organisationen oder Konventionen auf die Debatten rund um das Frauenstimmrecht hatten.
1848 bis 1872/74: die konzeptuelle Emergenzphase
1848 gilt gemeinhin als das Jahr, in dem der neue Bundesstaat das allgemeine oder universelle (Männer-)Stimmrecht einführte. Das stimmt so nicht. Es handelte sich nicht nur im Hinblick auf die Ausgrenzung des weiblichen Geschlechts um einen falschen Universalismus. Die Eidgenossenschaft liess zahlreiche Ausnahmen zu. Art. 74 der Bundesverfassung (BV) bestimmte lediglich, dass jeder Kantonsbürger auch Schweizer Bürger sei, denn die kantonale Niederlassungsberechtigung war Grundlage des Schweizer Bürgerrechts. Doch Frauen, Kinder, Entmündigte, Armengenössige, Konkursiten, Verbrecher oder Fremde blieben von den politischen Rechten ausgeklammert.11 Die Tagsatzungskommission nennt 437 103 Stimmberechtigte, die 1848 über die BV entscheiden konnten, was bloss zwanzig Prozent der damaligen Gesamtbevölkerung der Schweiz entsprach.12 Eine Schätzung beziffert den Anteil der effektiv Wahlberechtigten an der Gesamtbevölkerung bis 1910 auf höchstens einen Viertel.13 Im internationalen Vergleich war das zwar ein relativ hoher Wert, die «älteste Demokratie der Welt» war aber weit von «universellen» politischen Rechten entfernt.
Zu berichtigen ist ferner die Vorstellung, dass die verfassungsgebende Tagsatzungskommission 1848 eine direkte Demokratie verabschiedet hätte. Sie wählte im Gegenteil eine liberal-repräsentative Demokratie für die Bundesebene und liess den Kantonen weitgehende Freiheit in der Organisation ihres Wahlsystems. Die Tagsatzungskommission diskutierte zwar die Ungleichbehandlung der Juden im Bereich der Niederlassungsfreiheit, verlor aber kein Wort über die mindere Rechtsstellung der Frauen und ihren Ausschluss von den politischen Rechten.14 Die Schweizer Verfassungsgeber übernahmen die Ideen der Freiheit und Gleichheit des Naturrechts, interpretierten es aber wie die Gesetzgeber in anderen Ländern auch als Gleichheit für die Gleichen, Ungleichheit für die Ungleichen.15 Nur dem männlichen Geschlecht wurden im liberal-radikalen Weltbild die für die öffentliche Sphäre notwendigen Fähigkeiten zugeschrieben, Frauen hingegen wurden diese prinzipiell abgestritten. Doch während die Ausschlussgründe für die Männer zunehmend abgebaut und gleichzeitig die demokratischen Rechte erweitert wurden, blieben die Frauen von der politischen Teilhabe rund 120 Jahre (und kantonal sogar rund 150 Jahre) ausgeschlossen – freilich nicht ganz widerspruchsfrei.
Wiederholt vereinzelte Stimmen
Die rechtliche Gleichstellung der Frauen und das Frauenstimm- und -wahlrecht waren Mitte des 19. Jahrhunderts keineswegs unbekannte Forderungen. In Wirklichkeit entstand die feministische Kritik des weiblichen Ausschlusses von den bürgerlichen Rechten parallel zu diesem Ausschluss.16 Den modernen Auftakt während der Französischen Revolution machte Olympe de Gouges mit ihrer Forderung «la femme a le droit de monter sur l’échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune», was sich aber nur für den ersten Teil des Satzes bewahrheiten sollte. Als weniger folgenreich (persönlich und auch politisch) erwies sich eine Reihe späterer Interventionen, die ebenfalls den falschen Universalismus der politischen Repräsentation, wie ihn Demokratien reklamierten, anprangerten. Bekannt geworden ist die Forderung des Berner Gelehrten Beat von Lerber (1788–1849) in seiner Eingabe von 1830 an die Berner Regierung: «Das weibliche Geschlecht soll in allen Menschenrechten dem männlichen ganz gleich gestellt werden.»17 Während in der Schweiz die Verfassungsgründer stillschweigend über die Diskriminierung von Frauen hinweggingen, hatte sich in Deutschland und in Frankreich zur Zeit der 1848er-Revolutionen eine breitgefächerte Frauenbewegung formiert; in Grossbritannien ertönte die Forderung des Frauenstimmrechts im Chartismus und jeweils im Zuge der Wahlrechtsreformen (1832/1860er-Jahre).18 John Stuart Mill scheiterte allerdings 1867 im britischen Parlament mit seinem Antrag für politische Rechte für Frauen. In Wien forderten anonyme «Bittstellerinnen» 1848 in einer Flugschrift die «Gleichstellung aller Rechte der Männer mit den Frauen: oder: die Frauen als Wähler, Deputirte [sic!] und Volksvertreter».19 Im gleichen Jahr verlangten die in Seneca Falls im Bundesstaat New York versammelten Amerikanerinnen das Wahlrecht.
Im jungen Bundesstaat der Schweizerischen Eidgenossenschaft beanstandete ungefähr zur selben Zeit eine Gruppe Freiburgerinnen indirekt ihre fehlenden politischen Rechte. In ihrer am 5. Januar 1849 den Schweizer Bundesbehörden eingereichten Petition empörten sie sich, dass sie von der Freiburger radikalen Regierung als «auteurs et fauteurs du Sonderbund et de la résistance armée» zur Zahlung einer Strafsteuer verurteilt worden waren. Es sei unglaublich, dass Frauen für den Ausgang von Kämpfen und politischen Maximen verantwortlich gemacht würden, wenn das Gesetz sie gleichzeitig zu Minderjährigen erkläre und einer dauernden Vormundschaft unterwerfe. Ausserdem konnten sie nicht verstehen, dass man damit drohte, ihnen die politischen Rechte zu entziehen, über die sie gar nie verfügt hätten.20
Mit den Demokratisierungsbewegungen der 1860er-Jahre meldeten sich auch in der Schweiz vereinzelte Stimmen, die das Frauenstimmrecht forderten. Sie blieben ungehört. Bekannt ist die Petition der Sissacherinnen von 1862 aus dem Kanton Basel-Landschaft.21 Im Lauf der Arbeiten an einer neuen Zürcher Verfassung 1868 richteten «mehrere Frauen aus dem Volke» eine Eingabe an den Verfassungsrat mit folgendem Inhalt: «Soll die Losung des Züricher Volkes ‹Freiheit, Bildung, Wohlstand› zur That und Wahrheit werden, so müsste Jungfrauen und Frauen vom 20ten Lebensjahre an ein voller Antheil an allen bürgerlichen Rechten gewährt sein. Was wir nur aus diesem Grunde erbitten, was wir verlangen, das heisst: Wahlberechtigung u. Wahlfähigkeit für das weibliche Geschlecht in allen sozialen und politischen Angelegenheiten und Beziehungen.»22
Die Eingabe ging als Nr. 99 in die systematische Übersicht der Revisionswünsche ein. Es war nicht die einzige: Auch Theodor Zuppinger aus Männedorf setzte sich für das «Stimmrecht der Bürgerinnen» ein, während Diakon Heinrich H. Hirzel aus Zürich eine «Stimmberechtigung des Frauengeschlechtes in Kirchen- und Schulgemeindeversammlungen» verlangte. Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) kommentierte lakonisch: «Das Stimmrecht der Frauen, durch verschiedene Eingaben angeregt, fand in der Kommission keinen Anklang. Ein einziges Mitglied erklärte sich für die Emanzipation, verzichtete aber auf jede Antragstellung.»23 Bereits rund ein Jahrzehnt früher, 1857, hatte ein Neuenburger Grossrat anlässlich der Diskussion über die kantonale Verfassungsrevision kurz das Wahlrecht von Frauen eingebracht, allerdings nur für kirchliche Angelegenheiten und ohne dass die Sache weiterverfolgt worden wäre.24
Transnationale und transkantonale Vernetzung
Anlässlich der Vorarbeiten zur Revision der Bundesverfassung von 1872 erfolgten mehrere Interventionen zur rechtlichen Gleichstellung der Frauen im Zivilrecht und auf wirtschaftlicher Ebene, nicht aber zur politischen Gleichstellung.25 Federführend waren die Genferin Marie Goegg-Pouchoulin (1826–1899) und die Bernerin Julie von May (1808–1875).26 Goegg war die Gründerin der ersten feministischen Organisation der Schweiz, der transnational vernetzten Association internationale des femmes (1868). Die Limitation auf das Zivilrecht und auf ökonomische Rechte war taktischer Natur. Wie Goegg 1870 ausführte, zählte der Zugang zu den politischen Rechten schon nur aus Gründen der Gerechtigkeit ebenfalls zu den Zielsetzungen der Association. Denn solange die Frauen nicht am allgemeinen Stimmrecht (suffrage universel) partizipierten, sei der Begriff irreführend. Gefordert wurde das Stimmrecht ferner aus materiellen Gründen: als Mittel zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse.27 Goegg erreichte zwar, dass ab 1872 Frauen der Zugang zur Universität Genf prinzipiell offenstand.28 Doch weder ihre noch von Mays Petitionen und Schriften fanden bei den eidgenössischen Räten das nötige Gehör, um in die neue Bundesverfassung von 1872 respektive in die schliesslich verabschiedete von 1874 einzugehen.29 Der Ausbau der Volksrechte ging am weiblichen Geschlecht vorbei. Auch das 1912 in Kraft getretene Schweizer Eherecht war für die Frauen enttäuschend, wurden sie doch weiterhin der Vormundschaft ihres Ehemanns unterstellt.
Vor der Jahrhundertwende bis 1912: die organisationale und politische Konstruktionsphase
In der Schweiz ertönte die Frage der Geschlechtergleichstellung erst nach der Wachstumskrise Ende der 1880er-Jahre wieder zaghaft in der Öffentlichkeit. Die Frauenfrage wurde damals zur sozialen Frage. Das Studium stand Frauen nun an fast allen Schweizer Universitäten offen. Mit der revidierten Bundesverfassung war der Schulbesuch für alle Kinder obligatorisch geworden und kostenlos. 1882 bildeten die Frauen die Hälfte der Belegschaften in den Fabriken. Auch die Frauen aus der Mittelschicht begannen ins Erwerbsleben einzutreten, sei es am unteren Ende als Angestellte der Post oder am oberen wie Marie Heim-Vögtlin, die 1874 als erste Frau eine Praxis für Gynäkologie eröffnete.
Das Werden einer Forderung
Es waren aber vorerst immer noch einzelne, isolierte Stimmen, die sich zu Wort meldeten. Von der restlichen Schweiz unbeachtet, hatten 1892 anlässlich der kantonalen Verfassungsrevision vier Tessiner Grossräte beantragt, das Frauenstimmrecht einzuführen – erfolglos.30 Als erster Intellektueller verteidigte der Lausanner Philosophieprofessor Charles Secrétan (1815–1895) in seiner 1885 publizierten Schrift «Le droit de la femme» mit ähnlicher Argumentation wie Marie Goegg-Pouchoulin die politische Gleichheit. Der Zugang zu den politischen Rechten würde den Frauen ermöglichen, ihre Interessen zu verteidigen und mache die Frau erst zur juristischen Person. Am 1. Januar 1887 forderte die Bündner Aristokratin Meta von Salis (1855–1929) in einer Zeitung der Demokraten, der Züricher Post, das Frauenstimmrecht aus Gerechtigkeitsgründen. Wie neu und provokatorisch das Anliegen damals tönte, zeigt der Titel «Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau» sowie der redaktionelle Kommentar, dass es sich um eine Zuschrift handle und man diese aus Gründen der Meinungsfreiheit veröffentliche.31 Von Salis erfuhr aber bald, dass es Wege gab, unliebsame Frauen mundtot zu machen. Für ihre Stellungnahme für die Ärztin Caroline Farner wurde sie wegen Ehrverletzung angeklagt, worauf sie sich aus dem öffentlichen Leben zurückzog. Anders Emilie Kempin-Spyri (1853–1901), die erste Juristin der Schweiz und im deutschsprachigen Raum: Sie gründete in Zürich 1893 die Zeitschrift Frauenrecht und den progressiven Frauenrechtsschutzverein. Nach Abschluss ihres Studiums 1887 war sie wegen ihres fehlenden Aktivbürgerrechts nicht zur Advokatur zugelassen worden. Sie reichte beim Bundesgericht Rekurs ein, scheiterte jedoch mit ihrer Klage, wonach Art. 4 BV «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich» sich auf die politische Gleichberechtigung der Frauen beziehen liesse.32 Dieser BGE schuf einen folgenreichen Präzedenzfall.33
Die Forderung des Frauenstimmrechts war Ende des 19. Jahrhunderts noch umstritten, auch international. Selbst der International Council of Women, die erste Frauenorganisation, die sich ab 1888 transnational für die Menschenrechte der Frauen einsetzte, vermied es in den ersten 15 Jahren seiner Existenz, zu den politischen Rechten der Frauen Stellung zu nehmen.34 1899 wurde das Thema sogar kontrovers traktandiert. Das führte zur Spaltung und 1904 zur Gründung der International Woman Suffrage Alliance (IWSA), der Speerspitze des transnationalen Stimmrechtskampfs.
Der erste Schweizerische Kongress für die Interessen der Frau, der 1896 in Genf stattfand, traktandierte das Frauenstimmrecht noch gar nicht. Mehrere Redner behandelten das Thema gleichwohl. Die beiden Genfer Professoren Louis Wuarin (1846–1927) und Louis Bridel (1852–1913) sprachen sich beide für die Einführung des Frauenstimmrechts aus, allerdings mit jeweiligen Vorbehalten. Wuarin meinte, die Frauen müssten es sich zuerst durch Dienstleistungen an der Allgemeinheit verdienen; Bridel erwartete zwar eine moralische Besserung der Gesellschaft, plädierte aber für ein etappenweises Vorgehen in der Gleichstellungspolitik, beginnend bei der zivilrechtlichen Gleichstellung bis hinauf zur politischen.35 Der Kongress in Genf skizzierte einige der Pfade, die in den folgenden Jahrzehnten beschritten werden sollten: zum einen den meritokratischen Weg über den weiblichen Leistungsbeweis, zum anderen das schrittweise politische Vorgehen. Er zeigt im Übrigen die Rolle transnationaler Vorbilder für den politischen Lernprozess des Schweizer Feminismus auf. Die Organisatorinnen Julie Ryff (1831–1908), Helene von Mülinen (1850–1924), Emma Boos-Jegher (1857–1932), Pauline Chaponnière-Chaix (1850–1934) und Camille Vidart (1854–1930) folgten dem Muster der amerikanischen Feministinnen und ihrem Woman’s Building an der Weltausstellung von Chicago im Jahr 1893, zu deren Anlass diese den Weltkongress der Frauen durchführten. Auch die Schweizerinnen liessen ihren Kongress örtlich und zeitlich mit einem Grossereignis zusammenfallen und profitierten so von der öffentlichen Aufmerksamkeit, welche die Schweizer Landesausstellung generierte. Eduard, der Mann von Emma Boos-Jegher, der die Chicagoer Ausstellung besucht hatte, diente als transatlantischer Ideenübermittler.
Die Gründung einer nationalen Stimmrechtsorganisation am 28. Januar 1909 ging ebenfalls auf einen internationalen Impuls zurück. Bis dahin existierten einzig kantonale respektive lokale Verbände, beginnend 1905 in den Städten Neuenburg und Olten, 1907 in Genf und Lausanne, gefolgt 1908 von Gruppierungen in den Städten Bern und La Chaux-de-Fonds. In Zürich bestand seit 1893 der Frauenrechtsschutzverein, der 1896 mit dem Schweizerischen Verein für Frauenbildungsreform zur Union für Frauenbestrebungen fusionierte. Erst auf Einladung der Präsidentin der IWSA, Carrie Chapman Catt, an den internationalen Kongress vom Juni 1908 in Amsterdam formierten die Schweizerinnen den gemischtgeschlechtlichen Schweizerischen Verband für Frauenstimmrecht (SVF) mit 765 Mitgliedern.
In der Schweiz erhob 1897 mit Carl Hilty (1833–1909) erstmals ein gewichtiger Vertreter der Elite seine Stimme zugunsten des Frauenstimmrechts. In dem von ihm gegründeten «Politischen Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft» schlug der Professor des Bundesstaatsrechts und Völkerrechts an der Universität Bern, der bald darauf Vertreter der Eidgenossenschaft an der ersten Haager Friedenskonferenz und Mitglied des internationalen Schiedsgerichtshofs in Den Haag war, einen Verfassungsartikel vor, der allerdings den Kantonen die letzte Entscheidung vorbehielt.36 Hilty kritisierte zwar die herrschende Geschlechterordnung klar und deutlich als Machtausübung der Männer, die Frauen lieber ausgeschlossen haben wollten, doch in Bezug auf die politische Taktik blieb er zurückhaltend. Mit seinen föderalistischen Rücksichten legitimierte er ein etappenweises Vorgehen.
Partielle Rechte oder integrales Stimmrecht?
Die Forderung des Frauenstimmrechts gewann nach der Jahrhundertwende an Legitimität, beschränkte sich aber vorerst noch auf partielle Rechte. Die erste Abstimmung, am 4. November 1900 im Kanton Bern, war dank Eingaben durch den Berner Lehrerinnenverband und die Christlich-Soziale Vereinigung vom Regierungsrat veranschlagt worden, sie bezog sich aber nur auf die Wahl von Frauen in die Schulkommissionen. Fast siebzig Prozent der stimmberechtigten Männer lehnten ab. Der Berner Jura zeigte sich dem Anliegen gegenüber freundlicher gesinnt. Der Bezirk Freibergen stimmte sogar mit 632 zu 407 Stimmen zu.37
Während die bürgerliche Frauenbewegung um die Jahrhundertwende erst moderate Anliegen wie das passive Wahlrecht für die Schul- und Armenbehörden anvisierte, begann die Arbeiterbewegung nach und nach, das Frauenstimmrecht zu befürworten und engagierte sich allmählich auch dafür. Als erste Schweizer Organisation sprach sich 1893 der Schweizerische Arbeiterinnenverband (SAV) für das integrale Frauenstimmrecht aus. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) folgte 1904, die österreichische war bereits 1892 vorausgegangen. Am Kongress von Stuttgart 1907 wurden alle Parteien der Sozialistischen Internationale auf die Verteidigung der Forderung verpflichtet. Doch erst am Parteitag von 1912 folgten auf Druck von weiblichen Mitgliedern auch Taten seitens der Schweizer Parteigenossen.38 So reichte der St. Galler sozialdemokratische Grossrat Johannes Huber noch im selben Jahr die erste Motion zugunsten des Frauenstimmrechts ein.39 Gleichzeitig folgten die Arbeiterinnenvereine dem Beschluss der Sozialistischen Internationale und traten als Organisation aus dem Bund Schweizerischer Frauenvereine (BSF) aus, denn «sozialistische Frauenvereine dürfen nicht Kollektivmitglied bürgerlicher Frauenvereine sein».40 In Bezug auf die Frauenstimmrechtsvereine fehlte ein solcher Konsens. Als das Thema am Parteitag 1913 nochmals auf die Traktandenliste kam, wurde der Antrag, dass die Sozialdemokratinnen aus den «bürgerlichen» Stimmrechtsvereinen austreten sollten, abgelehnt. Eine Abgrenzung gegenüber der bürgerlichen Frauenbewegung blieb zwar bestehen, doch eine Zusammenarbeit war in Bezug auf das Frauenstimmrecht von Fall zu Fall möglich.41
Mit dem SAV, der SP und dem SVF, der nur Sektionen aufnahm, die sich für das integrale Frauenstimmrecht aussprachen, stand nun die Forderung nach politischer Gleichstellung der Frauen mit den Männern im Raum. Mittlerweile hatten mit Finnland 190642 und Norwegen 1913 auch zwei europäische Länder den Frauen das integrale Wahlrecht gewährt. Bis dahin drehten sich die Debatten fast ausschliesslich um beschränkte politische Rechte wie das passive Wahlrecht oder ein partielles Stimm- und Wahlrecht in Schul- oder Armenkommissionen oder kirchlichen Angelegenheiten. Auf diesem Gebiet – und nur diesem – waren erste rechtliche Erfolge zu verzeichnen (passives Wahlrecht in die Schulkommissionen in Genf; Armenpflege im Wallis 1898; Schulbehörden in Basel-Stadt 1903, St. Gallen 1905, Waadt 1906, Neuenburg 1908 etc., siehe Karten 1–3, S. 191–193). In der Praxis wurden aber nur wenige Frauen gewählt. In Genf wurde 1914 das aktive und passive Wahlrecht für die gewerblichen Schiedsgerichte durch eine Initiative sogar wieder abgeschafft.
1916/17 bis 1921: das Opportunitätsfenster
Die letzten Jahre des Ersten Weltkriegs, das Kriegsende und die unmittelbare Nachkriegszeit waren Umbruchzeiten, die von geopolitischen Neuordnungen, revolutionären Bewegungen, sozialen Konflikten und politischen Polarisierungen markiert waren. Es war auch eine Zeit des Wiederaufkommens und Erstarkens pazifistischer und internationalistischer Strömungen – und der Ruf nach mehr sozialer Gerechtigkeit und der Gleichberechtigung der Geschlechter wurde lauter. 1917 führte die Russische Revolution die formale Geschlechtergleichstellung ein. 1918 erhielten die Frauen in Deutschland, Österreich, Polen, Luxemburg sowie mit Einschränkungen in Ungarn, Grossbritannien und Kanada das Wahlrecht, 1919 folgten die Niederlande und Schweden, 1920 Island sowie mit Einschränkungen die USA und Belgien. Im Schweizer Generalstreik vom November 1918 erhob das Streikkomitee die Forderung des aktiven und passiven Wahlrechts der Frauen. Weniger als einen Monat später reichten die Nationalräte Herman Greulich (1842–1925) und Emil Göttisheim (1863–1938) je eine Motion zugunsten des Frauenstimmrechts ein. 1919 sprachen sich auch erstmals der BSF43 und sogar der Schweizerische Gemeinnützige Frauenverein (SGF) für das integrale Frauenstimmrecht aus.44
In dieser Phase sozialpolitischen Aufbruchs erfolgten zahlreiche politische Interventionen auf kantonaler Ebene. Letztlich kam es aber nur zu fünf Abstimmungen über die Einführung des integralen Frauenstimmrechts auf kantonaler und kommunaler Ebene. Sie gingen alle negativ aus.
Aufbruch in der zweiten Kriegshälfte
Der Erste Weltkrieg ertränkte vorerst jegliche progressive Reformbemühung unter einer Welle patriotischen Enthusiasmus. Doch bereits ab 1915 erwachte international wieder der Geist pazifistischen und antimilitaristischen Protests, zuerst bei den sozialistischen Frauen und der Jugend, die in der Schweiz internationale Kongresse abhielten. Wie vor dem Krieg waren es sozialdemokratische Parlamentarier, die erste Anträge zugunsten des Frauenstimmrechts einbrachten, so im November 1915 in Neuenburg, dann im Mai 1916 in Bern. In beiden Fällen sollte die Einführung des Frauenstimmrechts, in Neuenburg kantonal, in Bern kommunal, ohne Verfassungsrevision im Rahmen der Debatten über das Gesetz über die politischen Rechte geschehen. In beiden Fällen arbeiteten die Aktivistinnen und Aktivisten eng mit den Antragstellern zusammen. In Neuenburg war der Sozialdemokrat Charles Schürch (1882–1951), der auch Gründungsmitglied des Frauenstimmrechtsvereins von La Chaux-de-Fonds war, der institutionelle Vermittler einer Petition der kantonalen Stimmrechtsvereine. In Bern reagierte Eugen Münch (1880–1919) sehr wahrscheinlich auf das Anliegen des sozialdemokratischen Frauenvereins Bern, der ein Jahr zuvor den Antrag gestellt hatte, dass die SP eine Initiative auf Bundesebene lancieren sollte. Obschon er sein Vorgehen mit der Berner Stimmrechtsbewegung nicht abgesprochen hatte, wurde er von dieser durch die Lancierung einer Petition und anderen Aktionen sofort unterstützt.45 In beiden Fällen hatten die Anträge ebenso wenig Chancen wie zwei frühere Versuchsballone von zwei sozialdemokratischen Abgeordneten in den Kantonen St. Gallen und Bern.
1917 kam das Frauenstimmrecht in vier weiteren Kantonen auf die politische Traktandenliste. Im August verlangte eine Motion des Sozialdemokraten Greulich und 49 Mitunterzeichnern das integrale Frauenstimmrecht auf Kantons-, Distrikt- und Gemeindeebene im Kanton Zürich (später durch eine parlamentarische Initiative des Sozialdemokraten Otto Lang, 1863–1936, und 74 Mitunterzeichner ersetzt). Im November folgte eine Motion des Waadtländer Sozialdemokraten Anton Suter (1863–1942). Im Dezember war es am Basler Grossen Rat, die schon ältere Motion des sozialdemokratischen Anwalts Franz Welti (1879–1934) und Konsorten zu akzeptieren. In Genf hingegen kam dem Sozialdemokraten Jean Sigg (1865–1922) der Vertreter der Parti indépendant, Louis Guillermin (1845–1924), zuvor, allerdings mit einer beschränkten Formel: ein Stimmrecht nur auf Gemeindeebene und für Frauen über 25 (während Männer mit 20 Jahren abstimmen durften). Knapp zwei Wochen nach dem Landesstreik, am 28. November 1918, schlug im Kanton Aargau der freisinnige Anwalt Arthur Widmer (1877–1947), der auch im Nationalrat sass, ein «aktives und passives Wahlrecht und Stimmrecht in Kirchen-, Schul-, Armen- und Krankensachen» vor. Der Regierungsrat erklärte sich im Januar 1919 nur bereit, die Frage des Frauenstimmrechts als Anregung anlässlich einer Behandlung der Totalrevision der Staatsverfassung zu prüfen, womit das Problem auf unbestimmte Zeit vertagt war. Eine Petition mit 7327 Unterschriften der aargauischen Frauenorganisationen, die zum Ziel hatte, den Frauen wenigstens das aktive und passive Stimm- und Wahlrecht im Sozialbereich einzuräumen, blieb ungehört.46 Von den Grossräten abgeschmettert wurden auch die Motionen in den Kantonen Genf und Waadt. (Im Kanton Waadt allerdings erst am 15. Februar 1921, da der Regierungsrat die Behandlung des Anliegens bis dahin hinausgezögert hatte.)
Der SVF hatte sich inzwischen auf nationaler Ebene in eine Sackgasse manövriert. Am 13. Mai 1917 hatte die Delegiertenversammlung zwar die Lancierung einer Volksinitiative beschlossen, doch die Präsidentin, die Genferin Emilie Gourd (1876–1946), war bezüglich der Opportunität skeptisch und liess die Dinge liegen. Seit März 1918 hoffte der SVF stattdessen auf die Motion zur Totalrevision der Bundesverfassung des St. Galler Nationalrats Josef Scherrer-Füllemann (1847–1924) von der Demokratischen Partei. Als am 12. November 1918 der Generalstreik begann und das Neun-Punkte-Programm der Streikenden bekannt wurde, richtete Gourd sofort ein Telegramm an den Bundesrat,47 dass der SVF die Forderung des Frauenstimmrechts unterstützen würde, nicht aber die Methoden der Streikenden. Doch die Delegiertenversammlung vom 25. November desavouierte die Präsidentin mit 27 zu 17 Stimmen. Mit diesem Entscheid, sich von der Frauenstimmrechts-Forderung zu distanzieren, da sie von der falschen Seite kam, dürften die Aktivistinnen paradoxerweise das Gegenteil dessen erreicht haben, was sie wollten. Statt die Forderung zu entpolitisieren, politisierten sie diese: Das Frauenstimmrecht war nun keine parteipolitisch neutrale Forderung mehr. Als Scherrer-Füllemann am 3. Dezember seine Motion einführte, wurde zudem klar, dass er überhaupt nicht an das Frauenstimmrecht dachte. Am 4. und 5. Dezember folgten zwar die beiden Motionen Greulich und Göttisheim, doch wurden sie vom Nationalrat nur als unverbindlichere Postulate überwiesen. Beide verschwanden daraufhin für Jahrzehnte in der Schublade. Der damals im Bundesrat hegemoniale Freisinn verzichtete in den folgenden Jahrzehnten auf seine Handlungskompetenz, denn ansonsten hätte er seine beiden Verbündeten im bürgerlichen Machtblock vor den Kopf gestossen, so meine These: Die Katholisch-Konservativen und die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) waren die vehementesten Gegner.48
Es blieb also nur die kantonale Ebene.
Kantone als erste Kampffelder
In fünf Kantonen kam es in den Jahren 1919 bis 1921 schliesslich zu einer Abstimmung über das integrale Stimmrecht auf Kantons- und Gemeindeebene: in den Kantonen Neuenburg, Basel-Stadt und Zürich aufgrund sozialdemokratischer Motionen, in Glarus aufgrund einer Eingabe an die Landsgemeinde durch den Anwalt Léonard Jenni (1881–1967), Grütlianer und Sozialdemokrat, in Genf aufgrund einer Volksinitiative des Frauenstimmrechtsvereins. Alle gingen negativ aus.49
Die erste Abstimmung fand am 29. Juni 1919 in Neuenburg statt. Ihr kommt nicht nur Laborcharakter zu, sie kann auch als Beispiel für ein gut funktionierendes Zusammenspiel zwischen Stimmrechtsbefürwortern auf der institutionellen Ebene und Aktivistinnen und Aktivisten der Zivilgesellschaft dienen. Auslöser war 1916 eine neue Motion von Schürch, nachdem er ein Jahr zuvor aus formalen Gründen gescheitert war. Diesmal forderten er und seine acht sozialdemokratischen Mitunterzeichner eine Partialrevision der Kantonsverfassung. Ihre Motion wurde im November 1917 überwiesen, allerdings ohne verbindlichen Zeitplan. Um Druck auszuüben, verlangte die kantonale Sektion des SVF eine Unterredung mit dem Regierungsrat. Sie wurde ihnen am 9. März 1918 zwar gewährt, doch verlief sie ergebnislos. Daraufhin lancierten die Frauen eine Petition. Sie sammelten 9849 Unterschriften, eine Zahl, die etwa einem Viertel der erwachsenen Frauen des Kantons entsprach. Den Regierungsrat beeindruckte das nicht. Statt auf die weibliche Bevölkerung stützte er sich lieber auf die Kommunalbehörden des Kantons, die er zur Einführung des Frauenstimmrechts auf Gemeindeebene befragte. Da sich erwartungsgemäss nur fünf Gemeinden (darunter die sozialdemokratisch regierten Städte La Chaux-de-Fonds und Le Locle) uneingeschränkt positiv äusserten, kam er in seinem am 14. Februar 1919 veröffentlichten Bericht zum Schluss, dass eine Abstimmung verfrüht sei. Der Grosse Rat war anderer Meinung und verlangte einen Vorschlag für eine Verfassungsänderung. Die Kantonsregierung wechselte nun von der Verzögerungszur Dramatisierungstaktik. Sie lieferte ihren Bericht und Vorschlag für die Einführung des Frauenstimmrechts auf kantonaler und kommunaler Ebene binnen zwei Wochen, unterstrich die weitreichenden Konsequenzen eines solchen Schritts aber drastisch. Sie setzte die Abstimmung zudem äusserst kurzfristig an, was den Befürworterinnen und Befürwortern wenig Zeit für ihre Kampagne liess. Nur die Sozialdemokratische Partei gab die Ja-Parole aus und engagierte sich in der Abstimmungskampagne. Die beiden bürgerlichen Parteien, Freisinn und Liberale, optierten für die Stimmfreigabe. Unterstützung bot ein kantonales Männerkomitee mit 121 Namen aus einem breiten sozioprofessionellen Spektrum («pasteurs, professeurs, étudiants, commerçants, industriels, employés»).50 Ausserdem hielt der SVF seine Generalversammlung im Kanton ab. Das half alles nichts. Nur rund 30,8 Prozent der stimmberechtigten Männer legten ein Ja in die Urne. Das starke regionale Gefälle folgte einem Stadt-Land-Graben. In der Uhrenarbeiterstadt Le Locle, die einen der damals höchsten gewerkschaftlichen Organisationsgrade der Schweiz aufwies, fehlten zwar nur 30 Stimmen für eine Mehrheit, in La Chaux-de-Fonds betrug der Ja-Stimmenanteil 44 Prozent, doch auch in diesen beiden linken Städten konnte sich die sozialdemokratische Abstimmungsparole nicht durchsetzen.
Das relativ beste Resultat dieser fünf Abstimmungen wurde in Basel-Stadt mit 35 Prozent Ja-Stimmen erzielt, obschon Freisinn, Katholische Volkspartei und Bürger- und Gewerbepartei die Nein-Parole ausgegeben hatten, während die Liberalen sich für Stimmfreigabe und die Sozialdemokraten für die Ja-Parole entschieden hatten. Die SP war allerdings in der Stadt Basel die stärkste Partei; zusammen mit den Grütlianern und ab 1921 der Kommunistischen Partei (KP) verfügte sie zwischen 1920 und 1923 sogar über die Mehrheit. Ausserdem waren auch prominente Liberale wie der Chefredaktor der Basler Nachrichten Albert Oeri (1875–1950), langjähriges Vorstandsmitglied der Vereinigung für Frauenstimmrecht Basel und Umgebung, engagierte Vertreter des Frauenstimmrechts.
Das schlechteste Resultat dieser fünf Kantone wies Zürich mit weniger als einem Fünftel Ja-Stimmen (19,6%) auf. Dort hatte sich im Vergleich zu den Kantonen Neuenburg (60:33) und Basel-Stadt (63:34) bereits im Grossen Rat eine bedeutende Gegnerschaft gezeigt (103:90). In der Stadt Zürich sprachen sich 27 Prozent der stimmberechtigten Männer für das Frauenstimmrecht aus. Die Zustimmung in den Arbeiterquartieren, den Kreisen 3, 4 und vor allem 5, lag mit bis zu 36 Prozent höher, während sie in damals noch eher ländlichen Gemeinden wie Affoltern, Seebach und Schwamendingen (heute Kreis 11) mit 27 Prozent deutlich tiefer war. Die niedrigste Zustimmungsrate zeigten jedoch die bürgerlichen Kreise 2 und 7 und das Stadtzentrum mit zwischen 20 und 23 Prozent. Auch wenn lange nicht alle Arbeiter für das Frauenstimmrecht stimmten, korrelierte die Unterstützung doch mit der sozialdemokratischen Parteibindung.51
Im Kanton Glarus erfolgte am 1. Mai 1921 eine Abstimmung über das Frauenstimmrecht. Sie beruhte auf einem Vorstoss von Dr. iur. Léonard Jenni, der Ende 1920 im Namen von 60 Kantonsbewohnern (darunter 22 Frauen) einen Vorstoss einreichte. Die Landsgemeinde erteilte dem Anliegen, wie es der Landammann empfohlen hatte, «mit grossem Mehr» eine Absage.
Den Abschluss dieser ersten Reihe von Abstimmungen über ein kantonales und kommunales Frauenstimmrecht machte der Kanton Genf am 16. Oktober 1921. Erstmals lancierten die Stimmrechtsaktivistinnen eine Initiative, ein politisches Instrument, das sie auf eidgenössischer Ebene nie, auf kantonaler nur ganz selten ergreifen sollten. Die Genfer Sektion des SVF hatte am 4. Oktober 1920 eine von 2915 Stimmbürgern, also nur von Männern, unterzeichnete Initiative auf der Staatskanzlei deponiert. Sie verlangte die Ergänzung von Art. 21 der Kantonsverfassung, «les citoyens âgés de 20 ans révolus ont l’exercice des droits politiques», durch die drei Wörter «des deux sexes». Die Abstimmungskampagne verlief heftig und brachte nicht nur Gegnerinnen auf den Plan, sondern auch ein männliches Unterstützungskomitee. Doch nur 31,9 Prozent der Stimmbürger sagten Ja.52
Im Kanton Tessin erfolgten in dieser Zeit zwei Vorstösse auf Ebene der Legislative. 1919 akzeptierte der Grosse Rat die Möglichkeit, dass eine Frau, wenn sie einer grundbesitzenden Familie angehörte, anstelle ihres Mannes in ihrer Bürgergemeinde (patriziato) stimmen dürfte; das Referendum wurde nicht ergriffen. Neu konnten sich Frauen auch als Vertreterinnen ins ufficio wählen lassen, das heisst in die Exekutive der patriziati. Es handelte sich um ein Familienstimm- und Wahlrecht auf Zensusbasis. Auch wenn die Novität unter diesen Bedingungen eine weibliche Ermächtigung bedeutete, so folgte sie doch einer anderen Logik, denn im Tessin fehlte es wegen der starken Migration an Männern.53 Ein zweiter Vorstoss, diesmal für ein Frauenstimmrecht auf Gemeindeebene, also auf der Ebene der Wohngemeinde, wurde 1921 von der sozialdemokratischen Fraktion des Verfassungsrats mit Unterstützung durch persönliche Anträge mehrerer bürgerlicher Parteivertreter lanciert. Er scheiterte hingegen bereits im Grossen Rat.54 Die von der Zeitschrift Frauenbestrebungen geäusserte Hoffnung, dass die Tessinerinnen als Erste politische Rechte erhalten würden, erfüllte sich nicht.55
Die Aufbruchsphase war von kurzer Dauer. Im Vergleich zu ihren ausländischen Schwestern, die in zahlreichen Ländern das Wahlrecht erhalten hatten, waren die Schweizer Feministinnen ins Hintertreffen geraten, wie sie im Juni 1920 als Gastgeberinnen des Genfer Kongresses des Weltbundes für Frauenstimmrecht, der erste nach Kriegsende, enttäuscht konstatieren mussten.56
Die Zwischenkriegszeit und die Kriegsjahre: Stagnation und Rückschläge
Zwischen 1921 und 1940 wurde in der Schweiz nur ein einziges Mal über die Frage der weiblichen Partizipation auf Kantons- und Gemeindeebene abgestimmt. Am 15. Mai 1927 stimmten die stimmberechtigten Basler Männer über eine entsprechende Initiative der KP ab. Sie erreichte nicht einmal dreissig Prozent Ja-Stimmen, das Frauenstimmrecht wurde also noch höher verworfen als 1920.57 Zwei weitere Abstimmungen verliefen ebenfalls negativ, betrafen aber nur die Bezirks- und Gemeindeebene (Zürich 1923) und die Schul- und Armenkommission (Basel-Landschaft 1926).
Beschränktes Aktionsrepertoire
In einer Standortbestimmung analysierte der SVF 1921 seine Handlungsmöglichkeiten.58 Sie waren bescheiden. Zum einen fehlte den Frauen eine direkte Einflussmöglichkeit in den politischen Parteien, denn ausser der SP nahm keine der grossen Parteien Frauen auf. Zum anderen blieben ihnen die wichtigsten institutionellen politischen Handlungsinstrumente (Initiative, Referendum, parlamentarische Intervention) verwehrt; genutzt werden konnten sie höchstens über männliche Vermittler. Um sich Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern zu verschaffen, verfügten die Aktivistinnen für das Frauenstimmrecht nur über die Petition oder die Entsendung einer Delegation zu den Behörden, beides Mittel mit geringer Wirksamkeit. Auch öffentliche Versammlungen und die Vereinspresse waren wenig effektive politische Druckmittel. Obschon sich der SVF über die Beschränktheit seiner Handlungsoptionen im Klaren war, entschied er sich gleichwohl, auf militante Protestformen zu verzichten. Damals zur Diskussion gestanden hatten auch ein Steuerstreik, der Abbruch jedes weiteren sozialen oder philanthropischen Engagements und die Verweigerung von Spenden bei Geldsammlungen.59
Der SVF beschränkte sein Aktionsrepertoire Anfang der 1920er-Jahre ganz bewusst auf den Rahmen von Verfassungs- und Gesetzeskonformität. Bis zur ersten eidgenössischen Abstimmung von 1959 behielt er dies auch bei. Nur in Einzelfällen griff er zu expressiven Aktionen wie Demonstrationen, so 1928 anlässlich des SAFFA-Umzugs mit der überdimensionierten Schnecke, die den Fortschritt des Frauenstimmrechts symbolisieren sollte, oder am 13. Juli 1935 mit einer Protestkundgebung mit Automobilen durch die Stadt Genf, weil Frauen von der für die Zukunft der Demokratie entscheidenden Abstimmung über die Totalrevision der Bundesverfassung ausgeschlossen blieben.60 Initiantin war in beiden Fällen die dem egalitaristischen Feminismus zugehörige Emilie Gourd. Nach den Abstimmungsniederlagen Anfang der 1920er-Jahre verlagerte der SVF seinen Fokus von der formalen auf die faktische Gleichstellung, indem er sich für die Mutterschaftsversicherung und die Lohngleichheit engagierte. Parallel dazu verstärkte er seine Mobilisierungsanstrengungen sowohl intern als auch extern. Intern schuf er mit den Sommerferienkursen und der Präsidentinnenkonferenz neue Strukturen, die sowohl den Austausch und den Zusammenhalt zwischen den Aktivistinnen stärken als auch neues Wissen und eine gemeinsame praktische Erfahrung ermöglichen sollten. Extern galt es dank der Subventionen, welche die Amerikanerinnen ab 1924 jährlich an die Sektionen der IWSA verteilten, die noch für das Frauenstimmrecht kämpfen mussten, die Vereinspresse und die Propaganda aufzubauen.61
Dabei setzte der SVF weiterhin auf die bislang eingeschlagene Strategie der partiellen Verfassungsrevision. Erst Aussenstehende brachten mit der Idee der Verfassungsinterpretation eine davon abweichende Strategie ein. Am 5. April 1923 versuchte die Bernerin Hilda Lehmann, Angestellte beim Metallarbeitersekretariat in Bern, sich ins Stimmregister der Stadt eintragen zu lassen, scheiterte aber. Rechtsanwalt Jenni appellierte daraufhin beim Kanton und ging danach bis vor Bundesgericht. Er argumentiere mit der in Art. 4 BV festgehaltenen Rechtsgleichheit, doch sein Rekurs wurde zurückgewiesen. Ein zweiter, ähnlicher Versuch 1928 bei der höchsten Schweizer Gerichtsinstanz scheiterte ebenfalls.62 Der SVF distanzierte sich öffentlich von Jennis Vorgehensweise.63
Das Frauenstimmrecht galt in den 1920er-Jahren selbst bei Frauenorganisationen vermehrt als extrem und verlor an Unterstützung. Anlässlich der nationalen Ausstellung zur Frauenarbeit SAFFA, die vom 26. August bis zum 30. September 1928 in Bern stattfand und mit 800 000 Besucherinnen und Besuchern ein Publikumserfolg war, musste sich der SVF mit einer Ecke im Ausstellungsbereich Soziale Arbeit begnügen. Für die Mehrheit der Ausstellungskommission galt die Forderung nun als ein Sonderdesiderat. Die Katholikinnen, der konservative Flügel der Sittlichkeitsbewegung sowie Teile des SGF lehnten Werbung für das Frauenstimmrecht an der SAFFA ab. Die Ausstellung war als Leistungsschau der Schweizer Frauen gedacht und auf Konsens ausgerichtet; sie sollte in erster Linie die weibliche Erwerbstätigkeit legitimieren, ohne die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Zentralität der Mutterrolle infrage zu stellen. Problemfelder wie die weibliche Doppelbelastung und die Lohnungleichheit wurden daher nicht oder jedenfalls nur indirekt angesprochen. Vorherrschend war ein dualistisches Emanzipationsverständnis, wie es etwa Anna Louise Grütter (1879–1959), die Leiterin der Propagandaabteilung der SAFFA und Präsidentin des Stimmrechtsvereins Bern vertrat. Die promovierte Lehrerin erachtete nach den erfolglosen kantonalen Abstimmungen den egalitaristischen Feminismus als überholt, die radikalen Feministinnen hätten mit ihrem Gerechtigkeitspostulat und ihrem urbanen Habitus der Sache geschadet, besonders auf dem Land.64 Das Projekt des SVF, während des Grossereignisses eine Petition für das Frauenstimmrecht zu lancieren, wurde abgelehnt. Allerdings gelang es dem SVF dank Gourds Initiative, eine Riesenschnecke durch die Stadt Bern zu ziehen, dennoch auf das Frauenstimmrecht aufmerksam zu machen. Im Nachhinein entwickelte sich das Bild der Schneckenaktion zur feministischen Ikone. Doch an der SAFFA wurde das Artefakt in eine der hintersten Ecken verbannt.
Die Petition musste auf das Jahr 1929 verschoben werden. Mit nahezu 250 000 Unterschriften (wovon 78 800 von Männern) erlangte sie einen historischen Rekord, ohne dass dies ihre politische Wirkung gefördert hätte.
Erstens standen nur wenige Frauenorganisationen hinter der Petition: Neben dem SVF und einzelnen Berufsvereinen wie dem Lehrerinnenverein und dem Akademikerinnenverband engagierten sich die Freundinnen junger Mädchen sowie Friedens- und Abstinentenorganisationen. Daneben unterstützten die zwei Linksparteien SP und die KP sowie drei Arbeitnehmerorganisationen, der Verband des Personals der öffentlichen Dienste, der Verband evangelischer Arbeiter und Angestellter und der Schweizerische Gewerkschaftsbund, die Unterschriftensammlung. Nur dank der mobilisierungsfähigen und kampagnengeübten Linksorganisationen und Gewerkschaften kamen derart viele Unterschriften zusammen.
Zweitens stammten die Unterschriften hauptsächlich aus zwölf Kantonen: vor allem aus der reformierten oder vom Protestantismus geprägten Westschweiz. In Neuenburg unterzeichnete ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung (24,4%) und rund ein Drittel der Frauen, in Genf über ein Fünftel (22,4%) und im Kanton Waadt nahezu ein Fünftel (17,9%). Gut schnitten auch die stark urban geprägten Deutschschweizer Kantone Basel, Schaffhausen, Zürich, Bern und Solothurn mit 10 bis 15 Prozent Zustimmung ab. Wenig Sympathie fand die Petition in den übrigen, eher ländlichen und katholischen Kantonen. Die beiden Halbkantone Ob- und Nidwalden lieferten zusammen gerade mal 34 Unterschriften.65
Drittens hatte die Petition als politische Partizipationsform keine verpflichtende Wirkung für die Behörden. Sie wurde denn auch einfach schubladisiert.
Viertens aktivierte die Petition wieder die Gegnerinnen, deren Gewicht die Behörden hoch veranschlagten. Die von der Waadtländerin Susanne Besson (1885–1957) 1919 gegründete Ligue vaudoise féministe antisuffragiste, hervorgegangen aus der Ligue vaudoise pour les réformes sociales und im Jahr darauf zur hyperaktiven, doch kurzlebigen nationalen Ligue suisse des femmes patriotes ausgebaut, wurde nun als Schweizerische Liga gegen das politische Frauenstimmrecht mit Sitz in Bern wiederbelebt. Sie verfocht eine Mitsprache der Frauen ohne formales Stimm- und Wahlrecht. Ihre Eingabe wanderte zu den Akten der Petition – sozusagen als Gegengewicht.66
Verdüsterung am Horizont
An der Wende zu den 1930er-Jahren engagierten sich nur die beiden Linksparteien programmatisch und praktisch für das Frauenstimmrecht. Die Katholisch-Konservative Partei war strikt dagegen, die BGB noch vehementer. Der Freisinn verhielt sich uninteressiert. In ihrem Programm von 1931 hatte die Partei nur die «Mitarbeit der Frau an hiefür geeigneten öffentlichen Aufgaben» festgehalten.67 Mit der Wirtschaftskrise veränderte sich das politische Klima zusehends. In den 1930er-Jahren gerieten der Fortschrittsgedanke mitsamt den zwei grossen politischen Strömungen Sozialismus und Liberalismus und schliesslich sogar die Demokratie selbst in eine Krise. Auftrieb hatten dagegen nationalkonservative bis restaurative Tendenzen. In deren Gesellschaftsbildern stellte nicht mehr das Individuum den zentralen Referenzpunkt dar, sondern die Familie als sozusagen natürliche, organisch-hierarchische Einheit. Sie galt als die kleinste Zelle der Gesellschaft und des Staates. «Auf der Familie ruht der Staat», lautete ein Motto der Schweizerischen Landesausstellung von 1939, der Landi. Die vermeintlich durch die Frauenemanzipation, insbesondere die weibliche Erwerbstätigkeit, und die Verwerfungen der Moderne gefährdete Familie erhielt nun von rechts bis links politische Unterstützung. Weibliche Sonderdesiderate wie das Frauenstimmrecht wurden äusserst unpopulär. Das Spezifische hatte sich dem Gesamten unterzuordnen. Von den Frauen wurde erwartet, dass sie sich für das Allgemeinwohl, die «Volksgemeinschaft», engagierten und nicht durch Forderungen die Öffentlichkeit polarisierten. Im Rahmen der Diskussionen um eine ständestaatliche Verfassungsrevision reaktivierte der katholisch-konservative Vordenker Carl Doka die alte Idee der französischen katholischen Reaktion:68 das Familienstimmrecht. Gemeint war ein mehrfaches Wahlrecht, das der Staat einem Familienvorstand, Mann oder Frau, als Ausgleich für die durch die Sorge für eine Familie bedingten höheren Lasten verleiht.69 (Es handelte sich also nicht um dasselbe Prinzip, wie es 1919 im Tessin mit dem Familienwahlrecht in den Bürgergemeinden, den patriziati, eingeführt worden war.) Die Frauenbewegung musste sich nun für die Bewahrung der Demokratie engagieren, das System, das ihnen die demokratischen Rechte verwehrte.
Dieses verdankte es ihnen keineswegs. Als 1935 der sozialdemokratische Zürcher Nationalrat Hans Oprecht (1894–1978) den Bundesrat mit einer kleinen Anfrage an die hängige Frauenstimmrechtssache erinnerte, erwiderte die Schweizer Regierung, dass es zurzeit dringendere Probleme gäbe. Auch der Waadtländer Nationalrat Eugène Hirzel (1898–1972), ein Freisinniger, blitzte 1938 ab, als er sich erkundigte, was mit dem Memorandum des SVF geschehen werde, in welchem dieser das Parlament daran erinnert hatte, wie wichtig die Mitarbeit der Frauen in schweren Zeiten sei. In den 1930er-Jahren und im Krieg sah sich die Frauenbewegung in die Defensive gedrängt, bestenfalls konnte sie verhindern, dass Frauenrechte abgebaut wurden. Doch wurde die Legitimität der weiblichen Erwerbsarbeit mit der Kampagne gegen das «Doppelverdienertum» prinzipiell infrage gestellt; die Arbeitsgesetze im Krieg schützten die männliche Arbeitskraft, und die verabschiedeten Bestimmungen in der Sozialversicherung, so in der Arbeitslosenversicherung, diskriminierten die verheirateten Frauen. Nur in zwei Westschweizer Kantonen wurden in den 1930er-Jahren neue Vorstösse für die Einführung des Frauenstimmrechts eingebracht. Die zwei kantonalen Abstimmungen, die während des Kriegs in den Kantonen Genf (1940) und Neuenburg (1941) stattfanden, erzielten beide negative Resultate. Während die Zustimmung in Genf bei 32 Prozent stagnierte, verlor sie in Neuenburg mit 24,7 Prozent Ja-Stimmen sechs Punkte im Vergleich zur Phase des Aufbruchs nach dem Ersten Weltkrieg (obschon nur noch ein partielles Stimm- und Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten zur Debatte stand). In Genf war die Volksabstimmung durch eine Initiative der Genfer Sektion des SVF angeregt worden, in Neuenburg durch eine sozialdemokratische Motion, der eine Eingabe der lokalen Sektion des SVF vorausgegangen war. Es war jedoch das erste Mal, dass auch acht bürgerliche Parlamentarier eine sozialdemokratische Motion mitunterschrieben. Doch ihre Parteien folgten ihnen in ihren Abstimmungsparolen nicht: Freisinn und Liberale sprachen sich für ein Nein aus, die Parti progressiste-national verzichtete auf eine Parole (obschon die Partei anlässlich ihrer Gründung 1920 das Frauenstimmrecht in ihr Programm aufgenommen hatte). Auch die SP hatte ihre Wähler nicht mobilisieren können. Selbst in den Arbeiterhochburgen Le Locle und La Chaux-de-Fonds erreichten die Ja-Stimmen nur je 34 und 30 Prozent. Für die bürgerlichen, nicht parteigebundenen Zeitungen, die das Anliegen befürwortet hatten, war der Moment denkbar schlecht gewählt: ein Jahr nach der Genfer Niederlage und mitten im Krieg, als andere Sorgen dominierten. La Sentinelle, die sozialdemokratische Zeitung, enthielt sich jeden Kommentars zum niederschmetternden Resultat! Für Emilie Gourd waren auch das Desinteresse und die mangelnde Solidarität der Frauen daran schuld.70
Die unmittelbare Nachkriegszeit: kurze Phase des Aufbruchs
Das Ende des Zweiten Weltkriegs brachte einen neuen Demokratisierungsschub. Weltweit gewährten nun über drei Dutzend Länder den Frauen das Stimm- und Wahlrecht. Neu waren auch die Nachbarländer Frankreich und Italien dazugekommen. Mit der Charta von San Francisco, welche die Vereinten Nationen 1945 verabschiedeten, wurde das Prinzip der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau neu in einer internationalen Norm festgeschrieben – ein Grund zum Optimismus für die Schweizer Feministinnen. Zumal am 16. Juni 1944 ein Postulat von Hans Oprecht, des Präsidenten der Sozialdemokratischen Partei, und 51 Mitunterzeichnern den Bundesrat eingeladen hatte, zu prüfen, ob nicht verfassungsrechtlich das Frauenstimm- und -wahlrecht zu gewähren sei. Der Nationalrat behandelte es erst 18 Monate später, am 12. Dezember 1945, da vorher «dringendere Geschäfte» anstanden.71
Neuformation der Reihen
38 Frauenorganisationen hatten durch eine Eingabe an den Nationalrat das Postulat unterstützt, doch der SGF hielt sich nun zum «totalen» Frauenstimmrecht auf Distanz.72 (Angefragt worden waren 78 Organisationen.73) Zur Vorbereitung der kommenden politischen Kampagnen war unter der Ägide des SVF bereits im März 1945 ein Schweizerisches Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht gegründet worden, das im selben Jahr den eidgenössischen Räten eine Petition mit dem Titel «Zur Orientierung über das Frauenstimmrecht» einreichte und Kontakt zu befürwortenden Politikern hielt.74