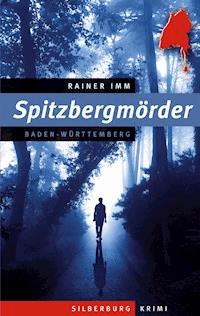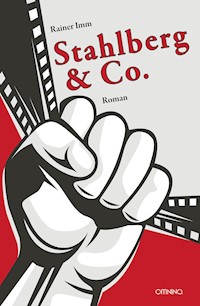12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Kind der Sozialbausiedlung, ein Mann der Akademikerwelt – und dazwischen ein Riss, der nie ganz heilt. In Free Solo erzählt Rainer Imm mit schonungsloser Präzision und großer literarischer Kraft vom Aufstieg aus einem Milieu, das von Härte, Loyalität und einem radikalen Gerechtigkeitssinn geprägt ist. Doch der Preis des sozialen Aufstiegs ist hoch: Identitätsverlust, innere Zerrissenheit und das Gefühl, nirgends ganz dazuzugehören. Free Solo ist ein etwas anderer Bildungsroman, ein existenzieller Balanceakt – intensiv, rau und tief berührend. Ein literarisches Protokoll darüber, wie unsere Herkunft uns prägt – und was bleibt, wenn man ihr zu entkommen versucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rainer Imm
Free Solo
Roman
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-95894-346-9 (Print)
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2025
Am Friedrichshain 22 / 10407 Berlin / [email protected]
www.omnino-verlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
„In den Netzwerken des Schmerzes und der Erinnerungen gibt es Kreuzungen, an denen einem plötzlich aufgeht, dass alles mit allem zusammenhängt und dass man sich deshalb um die Dinge kümmern muss.“
(W. G. Sebald)
„So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen, So sagten schon Sibyllen, so Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.“
(Johann Wolfgang von Goethe Urworte. Orphisch)
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 1
Ein Wunder, dass ich nicht schon früher zugeschlagen habe, dass ich nicht schon viel früher zu meinen Wurzeln zurückgekehrt bin. Wurzeln, die mein Leben mehr beeinflussen, als mir bewusst war. Die aber auch der Grund für den Stolz sind, es trotz allem geschafft zu haben. Wurzeln, die ich meinen Akademikerkollegen nicht unter die Nase reibe, das habe ich noch nie getan. Ich bin mir aber sicher, sie wissen davon, denn bei jeder Gelegenheit hebe ich mich ab von den verzogenen Rotzlöffeln aus gutem Hause, von diesen Einzelkindern, Prinzen und Prinzessinnen, denen von Schneepflugeltern Puderzucker in den Arsch geblasen wurde. Abgrenzung, voller Trotz, aber auch voller Neid – ja, ich gebe es nur ungern zu – und doch auch voller Gekränktheit. Immer noch. Immer noch auf der Suche nach Würde. Das Arbeiterkind ohne Chance und Zukunft. Die Kneipenbrut, die es allen zeigt. Auch jetzt noch. Es war nie weg: das Feuer, das Brennen und auch das Nicht-Genügen. All die Jahre. Das war mir bewusst, als ich zuschlug. Eine seltsame Ruhe, als ich die Faust ballte. Ein Stillstand fast. Superzeitlupe. Eine Klarheit, die ich vorher so noch nie erfahren hatte. Auch nicht in der Liebe. Nicht im Akt der Liebe. Nicht einmal mit Marlene. Nicht mal mit ihr. Ich würde sie verlieren, das war mir klar. Mit diesen wenigen Faustschlägen würde ich die Liebe meines Lebens verlieren. Nicht nur sie, auch meinen Sohn und meine Tochter. Vor allem meine Tochter. Gerade sie. Ich würde auch sie verlieren. Und doch: Ich hatte keine Wahl. Ein anderes Leben in zehn Sekunden. Ich habe mich selbst hineinkatapultiert, hineingeschlagen, am Tresen beim Feiern.
Semesterabschluss, ich kenne den Kollegen hinter mir gar nicht. Nur vom Hörensagen, es gab Gerüchte, warum er die Uni wechseln musste. Obwohl er abgewandt spricht, verstehe ich seine Worte, höre ihn prahlen. Diffamierend, herabsetzend, abfällig. Gerade so laut, dass ich kapiere. Ich kann mich nicht entziehen, vernehme Demütigungen, Widerwärtigkeiten und auch Triumphe und Eroberungen. Er geriert sich als findiger Gigolo, als potenter Lustbolzen, Aufreißer. Ich müsste mich nur lösen, den Platz aufgeben, mich mit meinen Studenten unterhalten. Aber ich kann nicht.
Dann höre ich ihren Namen. Vor- und Nachnamen. Ich habe mich sicher verhört, drehe mich weg und versuche ein Gespräch. Jetzt sein Lachen hinter mir. Laut und dreckig. Und nochmals ihren vollen Namen. Er ist ungewöhnlich und so unverwechselbar: Petterson. Der skandinavische Familienname meiner Frau. Und Lilly. Auf den Vornamen hatten wir uns schnell geeinigt. Lilly von Elisabeth, der Name der Mutter meiner Frau. Lilly, die Gottgeweihte, das war sie für mich von der ersten Sekunde an.
Ohne erkennbare namentliche Verbindung zu mir, Konrad Ritter, konnte meine Tochter unbelastet an dieser Uni studieren, Literatur, Englisch und Spanisch. Ich habe ihr zu einer anderen Stadt, einer anderen Universität geraten. Sie ist hartnäckig geblieben, und ich war dann doch über ihre Entscheidung froh. Sehr froh, denn so konnte ich mir vormachen, sie weiterhin beschützen zu können. Sie wirkt so mädchenhaft, vor allem körperlich, als habe die Pubertät sie nur gestreift. Lilly ist immer schon zart und verletzlich gewesen. Viel zu oft habe ich sie in die Arme geschlossen. Wie man einen Schmetterling mit seinen empfindlichen Flügeln behutsam in die hohlen Hände nimmt. Ihre bedingungslose Ehrlichkeit, ihr tiefer Wunsch, ein aufrichtiger Mensch zu sein, hat sie zuweilen zur Außenseiterin gemacht. Ihre Klassenkameraden waren cool und aufsässig, sie dagegen war anständig. Sogar während ihrer Pubertät unbeirrt. Jungs behandelten sie schlecht, weil sie keine leichte Beute war, vielleicht sogar gar keine, weil ihr die Rundungen fehlten, die ihnen den Sabber in die Mundwinkel und das Blut in ihren Schwanz treibt. Ein Funken Feingefühl, und sie hätten eine liebe, treue und auch humorvolle Freundin gehabt. Wenn sie sich wohlfühlt, dann ist sie witzig, schlagfertig und geistvoll. Ich weiß nicht, ob es je einen Jungen gab, der ihr Herz erobert hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, viel zu grob und einfältig sind die Kerle ihrer Umgebung.
„Frischfleisch … war leicht in die Kiste zu bekommen … so wunderbar unerfahren … musste sie zum Glück zwingen … duftete so jungfräulich … sie ließ dann doch alles zu … hatte ja keine Wahl … und mit ‚alles‘, meine ich alles.“
Jetzt Stille, ich nehme keine Geräusche mehr wahr, eine unerhörte Stille inmitten dieser Kneipenhektik. Ruhepuls, kein erhöhter Blutdruck, keine Wut, kein Zorn, nur Klarheit, extreme Klarheit. Ich weiß genau, was ich tue. Nicht mein vergangenes Leben zieht an mir vorüber, es ist mein zukünftiges, das ich sehe. Die unmittelbare und die ferne Zukunft. Seine gebrochene Nase, sein zerstörtes Jochbein, die geplatzten Lippen, die angeknacksten Knochen und sehr viel Blut. Und mein neues Leben mit Entlassung, Verlust von Familie und Freunden. Verlust von Ansehen und Status sowieso. Sogar Gefängnis ist drin, falls ich mich doch noch vergesse, mich nicht ganz im Griff haben sollte. Aber das wird nicht passieren. Das alles denke ich unverkrampft. Ein Gedanke nach dem anderen, alles wohlgeordnet. Eine große Freude, keine Rachegefühle in diesem Moment. Es ist die Freude daran, im Gegenwärtigen die Zukunft zu kennen und zu handeln, trotzdem zu handeln, entgegen allen Konventionen und aller vermeintlicher Vernunft. Richtig zu handeln.
Ich drehe mich um, packe mit der rechten Hand seinen Hemdkragen. Er trägt ein viel zu buntes Westernhemd, macht auf jungdynamisch. Lächerlicher Versuch. Ein scharfes, trockenes Geräusch, irgendetwas ist gerissen. Seine Reflexe sitzen, die Arme gehen hoch, doch ohne Erfolg. Viel zu unkoordiniert.
Jetzt tauchen doch Bilder bei mir auf. Lilly mit ihrem Stoffpinguin, an Puppen hatte sie nie wirklich Interesse. Ihr Pinguin Sammy, anfangs fast so groß wie sie selbst, teilte mit ihr sein Leben und ihre Geheimnisse. Sogar im Sommerurlaub saß er in der Hitze am Strand auf der Decke neben Lilly. Mit der Linken hole ich aus, balle die Faust und suche mir den Weg zwischen den fuchtelnden Armen hindurch. Immer habe ich mich gefragt, ob ich ihrem Bruder Mattis die gleiche Menge Liebe geben konnte. Und ja, Mattis, unser Himmelsgeschenk, bekam sie auch. Nicht diese körperliche Nähe, eher eine innige mentale Verbundenheit. Er eiferte mir nach und achtete auf seine kleine, zerbrechliche Schwester.
Ich werde meine Faust direkt auf die Nasenwurzel donnern, dort wo der Schmerz unerträglich ist. Den zweiten Faustschlag werde ich auf sein rechtes Jochbein setzen, so dosiert, dass es zwar brechen, aber sein Auge nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Reiner Selbstschutz. Ich weiß um die Folgen und ich weiß, was ein verlorenes Auge für mich bedeuten würde. Das wäre dann doch zu teuer. Eine gebrochene Nase, ein zerstörtes Jochbein, ein, zwei Zähne … das reicht. Zunächst. Denn ich werde ihn kurz diese Schmerzen spüren lassen, um danach noch seine Genitalien zu bearbeiten. Er soll bei jeder Morgenlatte an den Vater dieser wunderbar unerfahrenen, so jungfräulich duftenden Studentin erinnert werden.
Mit der Kindheit und Jugend von Lilly – seltsamerweise intensiver als bei Mattis – habe ich meine eigene Kindheit ein weiteres Mal durchlebt. Mein Vater hat mich sehr gemocht, genauso wie meine Schwester und meinen Bruder. Liebe? Eher hätte er die Holzspäne aus seiner Werkstatt in den Mund genommen als dieses Wort. Ungeschickte, viel zu grobe Backpfeifen und Klapse auf den Kopf reichten mir. Keine Liebeserklärung hätte größer sein können.
Ich verstand ihn. Noch mehr, als ich sah, wie er, der spätere Wirt, Streit in unserer Kneipe beendete. Nicht durch Schlichten oder durch Deeskalationsstrategien. Nein, durch Zuschlagen. „Wo der Karl hinschlägt, da wächst kein Gras mehr.“ Das geflügelte Wort seiner Stammgäste. Beim Schlagen verfolgte er einen seltsamen Ehrenkodex. Was auch immer passierte, er erhob nie, kein einziges Mal die Hand gegen eine Frau oder ein Mädchen. Das wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Weder meine Schwester noch meine Mutter schlug er. Noch nicht einmal eine Andeutung davon, auch nicht im größten Zorn. Nicht meine Schwester Lisa noch meine Mutter Frieda. Anders bei meinem Bruder Wolf und mir. Neben den Backpfeifen und Klapsen auf den Kopf, die als grobmotorische Liebkosungen durchgingen, setzte es manchmal harte Maulschellen, wie mein Vater Ohrfeigen nannte, oder Schläge auf den Po mit seiner bloßen Hand, besonders als wir Brüder noch jünger waren. Auch in unserer Kneipe hielt er sich an seine eiserne Regel. Sogar wenn er von betrunkenen und pöbelnden Frauen beleidigt und bespuckt wurde, beförderte er sie fast schon sanft, aber bestimmt aus unserer Wirtschaft hinaus.
Es war für ihn auch tabu, auf einen am Boden Liegenden einzuschlagen. Eine Selbstverständlichkeit. Auch wenn sein Gegenüber ihn weiterhin beschimpfte oder wüst beleidigte und andere an seiner Stelle voller Zorn weiter auf den Unterlegenen eingedroschen hätten, war mein Vater besonnen. Er wusste, wann sein Gegner verloren hatte. Ganz im Gegensatz zum Verlierer selbst, der chancenlos war, aber nicht ablassen konnte. Jeder weitere Schlag wäre eine Demütigung gewesen. So ließ mein Vater sogar im Konflikt dem Gegenüber seine Würde. Fast alle dieser arg ramponierten Streithähne kehrten irgendwann zurück und entschuldigten sich bei ihm. Schon als Kind empfand ich diese Situation als irritierend. Irgendetwas stimmte nicht daran, dass ein gestandener Mann mit einem blauen Auge, gebrochener Nase, mit frisch genähter Narbe, mit Kopfverband oder auch mit Gipsarm sich vor dem, der ihn so zugerichtet hatte, klein machte und ihn um Verzeihung bat. Als hätten sie es verdient, von diesem Mann verletzt worden zu sein. Sie akzeptierten damit ihre Strafe und seine Vorgehensweise, auch wenn sie einmal rückfällig wurden und mein Vater ein weiteres Mal zuschlug. Vielleicht sogar härter, weil er ihnen Manieren beibringen wollte. Seine Art von Manieren. Er mochte entschuldigendes Gewinsel nicht und brachte sie durch seinen Blick oder durch einen erhobenen Finger zum Schweigen. Versuchte jemand durch Umarmung Abbitte zu leisten, fast ausnahmslos Frauen, dann wurden sie wie von einem unsichtbaren, starkstromführenden Schutzzaun davon abgehalten. Die Hand schüttelte er gerade noch, mehr aber auch nicht.
Schlagen war nichts Außergewöhnliches, bei den Erwachsenen nicht und auch nicht bei uns Kindern. Auf dem Schulhof, auf dem Bolzplatz kein großes Ding. Es gehörte dazu, es war normal. Auch die Schmerzen, die dicke Lippe und das Veilchen. Keine Trophäe. Schlagen war Alltag, auch das schnelle Versöhnen. Jähzorn oder Nachtragen gab es nicht.
Erst als die Besseren, die Angestellten und Chefs des neu erbauten Bürokomplexes in unsere Gaststätte kamen. Mit diesen natürlichen Feinden der Arbeiter und der Gewerkschaft kam Unversöhnlichkeit und Zorn. Ihnen trug man sehr wohl nach. Sie passten nicht zu uns, kamen aus einer anderen, unguten, ja feindlichen Welt. Sie wollten uns an den Karren fahren, sie waren schuld an allem. Nach ihrer Pfeife sollten wir tanzen. Was war schon zu erwarten von Männern mit langfingrigen Bürohänden, die keine dreckigen Fingernägel kannten. Hatten sie doch noch nie richtig gearbeitet in ihrem Leben. Einer der Lieblingssätze meines Vaters. Einer der wenigen Sätze, die er überhaupt sprach.
Dann wurde ich selbst so einer. Ein Kopfarbeiter, der sein Geld nicht mit ehrlicher Arbeit, nicht mit den Händen verdient. Ein Haufen Geld mit Denken, Schreiben und Lehren. Von der Hauptschule zum Hirnfurzer. Ich höre es meinen Vater sagen. Die Generationen vorher und auch die jetzige: Meine Eltern, meine Geschwister, alle schwitzten sie beim Arbeiten, alle machten sich die Hände und den Kragen schmutzig. Und tun es immer noch. Ich nicht. Ich habe diese dünnhäutigen, hornhautlosen, sauberen Finger, die, geschützt mit Arbeitshandschuhen, gerade mal dazu taugen, ein Ikea-Regal aufzubauen. Wenn überhaupt. Ein Doktor, der noch nicht mal Kranken helfen darf. Meine Mutter hat das nie begriffen. Doktor? Für was? Doktor ohne Praxis? Der Stolz auf den Sohn, auf den Bruder ist der Ratlosigkeit gewichen. Ich besitze sogar eine Nagelfeile, bringe meine Fingernägel in Form und kratze den kleinsten schwarzen Dreck drunter hervor. Für meinen Vater eine unbekannte, nicht erstrebenwerte Welt. Und mein Hemdkragen wird nie Schweißränder haben. So ganz anders als früher, als ich ihm noch nacheiferte. Schläge statt Argumente. Später musste ich mich erst daran gewöhnen, dass Konflikte ohne Fäuste und mit Sprechen gelöst werden können. Aus Körperlichkeit ist Vernunft geworden. Ein Versuch.
Ich bin immer noch stark und zäh für mein Alter, auch ohne Muckibude. Mein Fitnesscenter ist der Wald. Ich liebe meinen offenen Kamin und das Vorbereiten und Schlagen des Holzes. Nie würde ich fertiges Kaminholz kaufen. Ich besitze kein eigenes Haus, keine Wohnung – ich wohne zur Miete –, aber ich habe ein paar Hektar Wald und einen offenen Kamin, wie ich ihn mir schon als Junge gewünscht hatte.
Fünf gezielte Schläge: Nase, Jochbein rechts, auf den Mund, Tiefschlag und einen auf das Schlüsselbein. Die Idee kommt mir spontan. Ein von oben geführter Schlag auf das linke Schlüsselbein. Zur Abwechslung links. Ich höre den Knochen brechen. Sonst keine Geräusche, keine Töne von außen. Nichts, nur seine jämmerlichen Schmerzensschreie. Seine Stimme überschlägt sich, als ich ihm an die Hose greife und zusammen mit seiner Versace-Boxershorts die Hoden quetsche. Lange her, aber ich weiß noch genau, wie das geht, ich mache das nicht zum ersten Mal. Er soll nie mehr Freude beim Vögeln empfinden und keine weitere eigene Brut in die Welt setzen können, falls er eine hat. Es wird doch teuer für mich werden. Macht nichts, ich habe ein dickes Konto. So viel Geld, wie meine Eltern zusammen ihr ganzes Leben lang nicht verdienen konnten. Kurz halte ich inne, stehe da, warte ab. Und sie kommt tatsächlich, diese Zufriedenheit, diese Gewissheit, diese Verbundenheit mit meinem Vater, die Verbundenheit mit den Meinigen.
Es gab keine Alternative. Auch jetzt, hier auf der Anklagebank, sehe ich keine. Meine Herkunft, meine Familie taugen vielleicht als Erklärung, aber nicht als Entschuldigung. Nicht im Gericht und nicht der Welt da draußen. Auch nicht, dass Probleme bei uns körperlich ausgefochten, ja gelöst wurden. Ich hatte es nur vergessen, verdrängt. Ich spüre keine Reue, kein Bedauern. Und ich würde wieder so handeln – für meine Liebsten, für meine Tochter. So ist das. So ist das bei uns.
Kapitel 2
Ich bin Akademiker, arbeite an einer Universität, und ich sitze im Knast. Diesen Satz hatte ich schon vor der Verhandlung im Kopf. Nicht im Traum male ich mir aus, dass es anders kommen könnte. Mein Anwalt hat mich bereits bei unserem ersten Gespräch darauf vorbereitet. Und auch meine eigenen Recherchen gingen in Richtung Gefängnis. Schwere Körperverletzung, geregelt im Strafgesetzbuch § 226 Absatz 1. Das Strafmaß liegt bei vollendeter Tat – ich mag diesen Ausdruck in diesem Zusammenhang so sehr, dass er immer noch ein wohliges Gefühl auslöst: vollendete Tat – bei einer Freiheitstrafe zwischen einem Jahr und zehn Jahren. Zwar keine Geldstrafe, aber ein Schmerzensgeld, das in einem anderen Prozess ausgehandelt wird, bei diesen Verletzungen können das bis zu 80.000 Euro sein. Wie gesagt, Geld ist mein geringstes Problem. Im Gegenteil, ich wundere mich, dass das Ergebnis, nämlich Zeugungsunfähigkeit und Erektionsprobleme, so preiswert zu bekommen ist.
Mildernde Umstände wie bei einem minder schweren Fall sind sicher nicht gegeben, und damit auch kein herabgesetztes Strafmaß. Zumal die Verletzungen des Opfers wahrscheinlich nicht reversibel sind und auch nicht vollständig abheilen werden. Das aber war genau meine Absicht. Auf eine Bewährung hoffe ich deshalb erst gar nicht, obwohl meine Sozialprognose wahrscheinlich günstig ist und ich nach Einschätzung des Gerichts bestimmt nicht noch einmal straffällig werde. Zudem bin ich nicht vorbestraft. Was ein Wunder ist. Wenn das Strafmaß über zwei Jahre liegt – und ich kann mir nicht vorstellen, dass es darunter liegen wird –, kann ich die Bewährung und damit den offenen Vollzug vergessen. Ich fange schon mal an, mich daran zu gewöhnen: Ich bin promovierter Akademiker und sitze im Knast.
Es läuft ab wie im Film, der Richter kommt mit den Schöffen rein, wir stehen alle auf, und als er sich auf seinen Stuhl niederlässt, setzen auch wir uns hin.
„Das Urteil ergeht im Namen des Volkes.“ Diesen Satz höre ich noch, dann schweife ich ab. So wie es mein Bewusstsein immer wieder schafft, mich vor dieser Wirklichkeit zu schützen. Es macht ganze Arbeit.
Ich bin dreizehn und stehe auf der Wiese hinter unserem Wohnblock, der letzte in der Reihe verschiedener heruntergekommener Klötze mit Sozialwohnungen. Wir wohnen im roten Kasten. Rot, weil irgendein von der Stadtverwaltung beauftragter Schmierfink, der sich Künstler nennt, unansehnliche rote Verzierungen im Eingangsbereich hingekleckst hat. Die anderen Blocks sind durch andere Farben verschandelt. Die Wohnungen sind zu klein, Reparaturen werden spät oder gar nicht gemacht, die Außenanlagen – wenn man überhaupt von Anlagen sprechen kann – verrotten nach und nach. Und zu allem Übel halten Architekten und städtische Planer uns für so blöd, dass wir wie zu trainierendes Vieh bestimmte Farben über den Eingang brauchen, um in unsere zugeteilten Dreckslöcher zurückzufinden. Die Stadt hat es schon längst aufgegeben, die Zerstörung der Malereien – wir nennen sie Verschönerungen – rückgängig zu machen. Wenn überhaupt mal einer von denen auftaucht, dann immer nur im Pulk, als ob sie sich allein oder zu zweit nicht in dieses Wohnviertel trauen würden. Aus den ursprünglichen Kreisen, Linien und Kurven der vermeintlichen Kunstwerke sind schon längst neue Bilder geworden – von richtigen Künstlern gesprayt, die wirklich etwas auf der Pfanne haben. In der ganzen Stadt sind das die einzigen Graffitis. Sobald eines in anderen Bezirken oder in der Innenstadt auftaucht, wird es sofort überstrichen. Nicht bei uns. Eine saubere Kommune, das war sie schon immer. Fassade ist alles.
„Was willst denn du hier? Zieh Leine, hier auf dem Platz hast du nichts zu suchen“, raunzt Edgar mich an. Edgar wohnt auch im roten Block, zwei Etagen unter uns. Er kann nicht kicken, spielt sich aber als der große Organisator auf, nur weil er ein paar Jahre älter ist. Eigentlich sollte er sich mit Gleichaltrigen rumtreiben. Bei denen hat er aber keine Chance, deshalb nervt er uns.
„Hast du das zu bestimmen, oder was?“ Mein älterer Bruder Wolf schiebt mich auf die Seite und berührt mit seiner Nase fast die von Edgar. Mein Bruder muss zwar ein wenig hochgucken, aber der Fettanteil seiner Köpermasse geht gegen null, ganz im Gegensatz zu Edgars.
„Der ist zu klein“, sagt Edgar und tritt ein wenig zurück.
„Na und? Im Gegensatz zu dir kann er kicken.“ Mein Bruder tippt mit seinem Zeigefinger auf Edgars Brust.
„Na ja, ich dachte …“
„Denk nicht und organisier hier diesen Kick. Die Aufstellung überlässt du denen, die davon eine Ahnung haben.“ Wolf packt mich am Kragen und zieht mich grob zu unserem Team Rot.
Edgar steckt auch diesen Rüffel weg, so wie er immer alle wegsteckt, und watschelt mit seiner grauen Jogginghose – der Hintern hängt in den Kniekehlen – und dem verwaschenen falschen Bayerntrikot Richtung Blaue, unsere Gegner heute. Edgar hat seinen Ball zwischen Arm und Hüfte geklemmt, ich boxe ihn weg und schieße ihn zu Toni, meinem besten Kumpel. Toni wohnt mit seiner Familie zwei Etagen über uns ganz oben, das Sahnestückchen im roten Kasten, mit herrlicher Aussicht über die anderen Schandflecke der Bronx. Wie alle anderen in unserer Mannschaft hat auch er irgendein rotes Shirt übergezogen. Edgar ist sauer, macht zwei Schritte auf mich zu, dreht aber schnell wieder ab, als ihn mein Bruder fixiert.
„Lass den Scheiß“, sagt Wolf zu mir und gibt mir eine mit, auf den Hinterkopf. Er weiß, dass er Edgar nicht ganz verprellen darf, schließlich gehört ihm der Ball. Edgar hat uns eigentlich in der Hand, hat das bisher aber nur ein einziges Mal ausgespielt. Normalerweise wechselt mein Bruder ihn ein, wenn das Match entschieden ist und Edgar nichts mehr verbocken kann. Beim Endspiel gegen die Grünen im letzten Jahr allerdings stand es bis zu kurz vorm Schluss unentschieden, und obwohl Edgar bettelte, ließ ihn Wolf nicht aufs Spielfeld. Edgar stürmte dann kurzerhand auf unseren Bolzplatz, schnappte sich den Lederball und lief trotzig davon. Es brauchte eine ganze Woche und viele Zugeständnisse, um ihn umzustimmen.
Es war Toni, der damals kurzerhand einen anderen Spielball aufgetrieben hatte, zwar einen peinlichen Gummiball, aber immerhin einen Ball. Typisch Toni, hatten die anderen gefrotzelt, wofür die Verbindungen zur Mafia doch gut seien. Die Scheiße muss er sich andauernd anhören, nur weil sein Vater Italiener ist und sein Nachname Rivera. „Wie Gianni Rivera, der berühmte Fußballspieler von AC Mailand“, hatte er immer gesagt. Und als er älter war: „Wie der mexikanische Maler Diego Rivera, der Mann von Frida Kahlo.“
Letzten Endes hatten wir doch verloren, im Elfmeterschießen, besser: im Siebenmeterschießen. Der Bolzplatz ist viel zu klein für normale Elfer. Es ist schwer genug, ihn einigermaßen bespielbar zu halten. Der Stadt geht das Grundstück am Allerwertesten vorbei. Vielleicht weil sie dort irgendwann weitere Rattenlöcher mit farbigen Eingängen für Aussätzige wie uns bauen will, wer weiß. Im Sommer, wenn das Gras hoch ist, leihen wir uns immer diesen mechanischen Handrasenmäher aus, den man mühsam vor sich herschieben muss, auf und ab, hoch und runter. Die Wiese ist alles andere als eben. Der Rasenmäher ist längst stumpf. Herr Schmitt, ein Bewohner der wenigen kleinen Einfamilienhäuser im Viertel, vergisst wahrscheinlich permanent, ihn zum Sperrmüll rauszustellen. Immer im Frühjahr und Sommer lässt er uns regelmäßig antanzen und ihn höflich bitten, damit er uns gönnerhaft seinen Schrottmäher überreichen kann. Keiner macht das freiwillig, denn seine Tiraden sind unerträglich. Als Wolf ihm einmal ins Gesicht gesagt hat, dass er ein verdammter Nazi sei, war erst mal nichts mehr mit Rasenmähen. Erst als mein Bruder dann unsere kleine Schwester Lisa im nächsten Jahr mit Geld bestochen und hingeschickt hatte, hatte der Nazi den Rasenmäher wieder rausgerückt.
Wir hatten uns vorsichtshalber in Sichtweite postiert, und wenn der alte Sack meine Schwester auch nur ansatzweise berührt hätte, hätten wir ihm die Fresse poliert. Er war klug genug, die Flossen von ihr zu lassen.
Die Blauen sind unsere Erzfeinde. Nur zu diesem Kick dürfen sie auf unser Territorium. Der Bolzplatz gehört uns. Heute ist noch mehr Zündstoff drin als üblich, denn mein Bruder hat etwas mit einer Braut aus dem blauen Wohnblock angefangen.
„Wie blöd muss man eigentlich sein?“ Ich würde mich nicht trauen, ihm das zu sagen. Ältere aus unserem Team schon. Zu allem Übel spielen auch noch zwei Brüder des Mädchens bei den Gegnern mit. Mit denen hatte Wolf schon vorher Zoff, jetzt wahrscheinlich noch mehr. In den letzten Wochen war er immer wieder mal angeschlagen nach Hause gekommen, hatte Schürfwunden, ein blaues Auge oder einen Verband um das Handgelenk. „Du solltest erst die anderen sehen“, so sein Standardspruch. So richtig überzeugend kam das allerdings nie rüber. Wie und warum er zu seinen Verletzungen gekommen war? Er hätte eher Glasscherben gelutscht, als es auszuplaudern.
Es kommt, wie es kommen muss. Beim Endspiel packt einer der Brüder die Blutgrätsche aus und holt Wolf unfair und vorsätzlich von den Beinen. Kaum knallt er auf den Rasen, steht er wieder auf und verpasst seinem unfreiwilligen Schwager einen Haken. Wolf trifft das Kinn nicht ganz, streift es nur. So kann sich sein Gegner einigermaßen auf den Beinen halten. Jetzt mischt sich dessen Bruder ein und nimmt Wolf in den Schwitzkasten. Das ist der Startschuss für die restlichen Spieler beider Teams. Auch die, die an den Außenlinien stehen, stürmen auf den Platz und prügeln aufeinander ein.
Solche Schlägereien laufen immer nach demselben Schema ab. Das habe ich schon sehr früh gelernt. Die ersten Schläge und auch die Verletzungen sind ziemlich heftig: geplatzte Lippen und ausgeschlagene Zähne. Dann teilen sich die Schläger über die Parteien hinweg in die Hitzigen, die trotz Blut, Schleim und Spucke einfach nicht aufhören wollen, und in die Zur-Vernunft-Kommenden. Ich gehöre wie Wolf zu den Ersteren, und Toni, ganz entgegen seines Mafia-Images, zu den Ausgleichenden. Die sind zwar auch lädiert, versuchen aber trotzdem, die Hitzköpfe, die im Blutrausch sind, auseinanderzuhalten. Irgendwann gelingt es ihnen tatsächlich, sie zu trennen – immer unterbrochen durch weitere kleine Scharmützel –, und die Parteien lecken ihre Wunden innerhalb ihrer Gruppe. Zum Arzt geht hier niemand, sogar gebrochene Nasenbeine werden vom Kameraden wieder so zurechtgerückt, dass sie einigermaßen gerade zusammenwachsen können. Irgendwann treten die Gegner dann Rache schwörend doch den Rückzug von unserem Bolzplatz an.
Wolf ist immer noch so aufgebracht, dass er dem Blutgrätscher, als er an ihm vorbeigeht, in die Kniekehle tritt, ich hinterher. Die jeweiligen Teamkollegen reißen die Streithähne zurück, beschwichtigen und beschimpfen sich gleichzeitig. Der Schwager in spe schwört Wolf Rache, er zeigt mit beiden ausgetreckten Armen und Zeigefinger auf ihn und brüllt: „Ritter, du bist tot.“ Irgendwann ziehen sie endgültig ab.
„Herr Ritter“, mein Anwalt lächelt mich breit an, berührt mich leicht an der Schulter und reißt mich aus meinem Film. „Ehrlich gesagt, hatte ich es heimlich gehofft. Dass es jetzt aber tatsächlich so gekommen ist …“ Er schüttelt ungläubig, aber glücklich den Kopf.
Ich bin verwirrt. Alle um mich herum packen zusammen, stehen auf und verlassen langsam das Gericht.
„Mensch, Herr Ritter, Bewährung!“ Er reißt die Augen auf, schüttelt mich, den Begriffsstutzigen, mit beiden Händen an den Schultern. „Bewährung, Herr Ritter, zwei Jahre auf Bewährung. Offener Vollzug. Verstehen Sie, was das bedeutet?“
„Kein Gefängnis?“, frage ich vorsichtig, obwohl ich es schon kapiert habe.
„Genau!“ Und während er das sagt, kehrt er schon wieder zurück in das normale, wellenlose Fahrwasser eines Juristen. „Allerdings stehen jetzt noch die Verhandlungen über das Schmerzensgeld an.“
Langsam begreife ich das Ganze: Ich bin Akademiker, promoviert, Uni-Angestellter, und ich sitze nicht im Knast. Alles andere ist mir im Moment egal, auch ein hohes Schmerzensgeld. Ich breche nicht in Freudentränen aus, mein Körper will nicht tanzen, und mein Glück muss ich nicht in die Welt hinausschreien. Es ist eine Wärme, die sich in der Magengegend breitmacht. Nicht gerade Schmetterlinge, aber so in der Art, ein noch besseres, profunderes Gefühl: das Emma-Gefühl meiner Kindheit. Diese angenehme Wärme, die ich spürte, sobald sie in der Nähe war. Als Junge dachte ich, Emma sei der Grund für mein Glück, aber es war das Gefühl im Magen, das ich immer wieder haben wollte. Erst viel später habe ich begriffen, dass sich dieses Gefühl auch bei einem erfolgreichen Torschuss, einem gut platzierten Faustschlag oder auch, und vor allem, beim Klettern einstellen kann.
Ich passe mich dem niedrigen Wellengang der Gefühle meines Anwalts noch mehr an und bitte ihn, sich mit der Gegenseite außergerichtlich auf ein Schmerzensgeld zu einigen. Die Summe ist mir egal. Dann frage ich ihn über die Bedingungen der Bewährung aus und gebe ihm einen weiteren Auftrag, denn ich will so schnell wie möglich weg aus Marburg.
Kapitel 3
Ich bin wahrscheinlich der unkomplizierteste Mandant, den mein Anwalt jemals hatte. So unkompliziert, dass er einen Beschützerinstinkt entwickelt. Erst jetzt gibt er zu, dass er oft ohne mein Wissen in meinem Namen verhandelt hatte.
„Um ehrlich zu sein, hat mich Ihr fehlender Ehrgeiz am Anfang genervt, bis ich begriffen hatte, dass Sie einfach mit sich und Ihrer Tat im Reinen waren und Sie nicht noch mehr rausholen mussten“, sagt mein überaus attraktiver Anwalt und schüttelt immer noch ungläubig den Kopf. Als Doppelgänger von George Clooney kann er sich bestimmt nicht vor weiblichen Mandantinnen retten.
„Durch Ihre … wie sage ich es am besten … durch Ihre allzu große Zufriedenheit, die ich als fehlenden Kampfgeist interpretiert habe, hatten Sie mich schnell am Wickel.“
Ich bin mir sicher, dass er diese Wendung „am Wickel“ nur deshalb benutzt, weil auch er ursprünglich aus dem Süden der Republik kommt und so demonstrativ unsere angebliche Verbundenheit feiern will. Was soll ich darauf sagen? Ich bin hier, um mich zu verabschieden. Und erst als ich hier im Süden Marburgs in die Gründerzeitvilla, in der sein Büro im ersten Stock liegt, gekommen bin, wurde mir so richtig klar, welch tolle Arbeit er abgeliefert hat und wie dankbar ich ihm bin.
„… so sehr am Wickel, dass ich zum Kampfhund wurde. Auch weil die Gegenseite so unverschämt war.“ Er lächelt mit tiefer Zufriedenheit wie nach einer gewonnenen Schachpartie vor sich hin. Jetzt verstehe ich: Das scheint doch eher sein Ding zu sein, sein persönliches Ding. Es ging hier nicht wirklich nur um mich und die Summe des zu zahlenden Schmerzensgeldes, sondern auch um die Feindschaft zu seinem Konkurrenten Möller und den Triumph über ihn.
„Aber egal. Wir können auf jeden Fall mit Ergebnis und Summe zufrieden sein.“ Er atmet tief durch, zentriert seine anwaltsblaue Krawatte vor weißem Hemdhintergrund und richtet sich in seinem sündhaft teuren Bürosessel auf. Damit signalisiert er mir, dass dieses Thema jetzt durch ist.
„Auch die Sache mit den Bewährungsauflagen – ich habe es Ihnen ja schon am Telefon gesagt – hätte nicht besser laufen können.“ Er nickt sich selbst äußerst zufrieden zu.
Ich hatte ihn gleich nach der Verhandlung vor vier Wochen gebeten, sich dafür einzusetzen, dass ich die Bewährungszeit an einem anderen Ort verbringen darf.
„Ja, das wär’s dann wohl, Herr Ritter“, sagt mein Anwalt, verlegen wie ein Teenager, der zum ersten Mal seine Angebetete zum Milchshake einlädt. Plötzlich tut sich ein Riss in seiner Juristenfassade auf, und es fällt ein Licht auf sein Clooney-Gesicht, das fast Herzlichkeit ausdrückt. Und obwohl ich nicht gerade die ganz große Verbundenheit zu ihm gespürt hatte, all diese Monate hindurch, so lässt mich dieser Gesichtsausdruck dann doch nicht unberührt.
Ich nicke, stehe auf und strecke meine Hand aus. „Vielen Dank für alles.“
Wir pressen beide unsere Lippen zu einem dünnen Strich zusammen und nicken uns mit dem guten Gefühl zu, gemeinsame Schlachten nicht nur geführt, sondern auch gewonnen zu haben. Im Film würden jetzt Streicher die Szene bedeutungsschwanger begleiten. Kamera auf Gary Cooper und Grace Kelly in Zwölf Uhr mittags. Bis mein Anwalt die Szene ruiniert und die Geigen jäh verstummen lässt: „Ich kenne ja Ihre neue Adresse und schicke Ihnen die Rechnung zu.“
Einmal Jurist, immer Jurist. Ohne weiteren Redebeitrag drehe ich mich um und gehe aus seinem Büro, nehme dann bei jedem Schritt mehrere Stufen der Treppe und trete aus der Villa ins Freie. Ich sehe Karl und Christoph („Sag einfach Charly und Stoffel zu uns.“) im 7,5-Tonner sitzen. Sie essen mit viel Genuss ihre Leberkäswecken, jeder mit einer Tube in der Hand. Vor jedem Biss platzieren sie eine große Portion Senf auf ihre Brötchen und beißen genau dort ab.
„Wo gibt’s denn die hier in Marburg?“ Ich bin ehrlich überrascht.
„Die haben wir mitgebracht“, sagt Charly, legt seinen Leberkäswecken zurück in die Tüte und startet den Transporter.
„Aus dem Allgäu mitgebracht?“, frage ich, noch überraschter.
„Logo, daf find einfach die beften“, sagt Stoffel mit vollem Mund, rutscht nach links und bedeutet mir, neben ihm Platz zu nehmen.
„Hier! Wir haben dir auch einen“, sagt Charly, zeigt auf eine zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe eingeklemmte Tüte. Er zieht blinkend aus der Parklücke auf die Straße, um schnell aus der Stadt auf die B3 und dann auf die Autobahn in die neue, alte Heimat zu gelangen, den Süden der Republik.
Gleich nach meiner Aktion – ich habe mir angewöhnt, Aktion und nicht Tat zu sagen – war ich aus unserem Haus ausgezogen und in ein Gartenhaus mit Strom und Wasser auf einem Grundstück außerhalb Marburgs eingezogen. Eine Kollegin – eine der wenigen, die zu mir hält – hatte es mir angeboten. Eine Wohnung war so schnell nicht zu bekommen, und da das Wochenendhäuschen komfortabler war, als ich