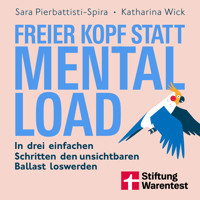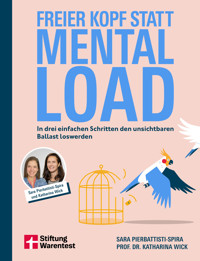
Freier Kopf statt Mental Load - Ihr Weg zu mehr Klarheit und mentaler Stärke E-Book
Sara Pierbattisti-Spira
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
In drei Schritten zum freien Kopf - Raus aus der Mental Load Falle In drei Schritten zum freien Kopf Mental Load, die Last der tausend Kleinigkeiten. Unzählige Alltagsaufgaben organisieren, Entscheidungen treffen und sich für alles verantwortlich fühlen – diese permanente Denkarbeit führt zu unsichtbarem Stress. Gesundheitliche Probleme wie Migräne, Tinnitus oder chronische Erschöpfung können die Folge sein. Betroffen sind vor allem Frauen. Wie es gelingt, die mentale Last sofort spürbar zu verringern und endlich wieder den Kopf freizubekommen, zeigt dieser Ratgeber Schritt für Schritt und mit alltagstauglichen Strategien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
FREIER KOPF STATTMENTALLOAD
SARA PIERBATTISTI-SPIRA · PROF. DR. KATHARINA WICK
INHALTSVERZEICHNIS
Kopf voll, Akku leer
Die Last der tausend Kleinigkeiten • Multitasking auf der Venus? Schluss mit Mythen! • Inventur im vollen Kopf • Veränderung ist immer möglich
Schritt 1: Chefin sein? Besser nicht
Die hohe Kunst, über Mental Load zu sprechen • Helfen ist gut, übernehmen ist besser • Verantwortung abgeben heißt auch loslassen • Die Last zu teilen ist erst der Anfang
Schritt 2: Mental Load entspannt managen
Meine To-do-Liste und ich: Eine Hassliebe • Die besten Tools, um alles im Griff zu haben • Prioritäten: Was ist (mir) wirklich wichtig? • Gelassen bleiben, wenn alles anders kommt
Schritt 3: Mental Load loswerden
Einfach links liegen lassen – eine Mutprobe • Gut genug reicht meistens völlig • Wagen Sie mehr Konflikte • Für Eltern: Besser glücklich als perfekt
Kopf frei – für Freizeit, Fokus, Flow!
Spaß und Entspannung, aber richtig • Keine Angst vor dicken Brettern • Mit Leichtigkeit zu mehr Wohlbefinden
Hilfe
Weiterführende Literatur • Register
Erklärung der Symbole
Jede farbige Textpassage bietet Ihnen spannende und besonders wissenswerte Zusatzinformationen. Diese Symbole zeigen Ihnen, was Sie hier erwartet.
Gut zu wissen
Achtung!
Verblüffendes
Eine kurze Anleitung
Aus der Forschung
KOPF VOLL, AKKU LEER
In Ihrem Kopf gibt es ein Sammelsurium von Aufgaben. Sie arbeiten sie ab – doch die Liste wird nicht kürzer. Wie konnte es dazu kommen? Und: Wie kommen Sie da wieder heraus?
Die Last der tausend Kleinigkeiten
Mental Load – das sind all die kleinen Aufgaben, die den Alltag am Laufen halten. Kaum sichtbar, aber deutlich spürbar.
Ist noch Milch im Kühlschrank? Bis wann muss die Versicherung bezahlt werden? Wann steht der nächste Kinderarzttermin an? Wer repariert den kaputten Wasserhahn? Passen die Hausschuhe in der Kita noch? Muss ich die Mülltonne heute rausstellen? Was schenken wir Oma zum Geburtstag? Wer besorgt es? Und bis wann muss eigentlich die Präsentation für die Arbeit fertig sein? Diese unendliche Liste an Aufgaben schwirrt Ihnen andauernd durch den Kopf und raubt Ihnen Energie. Das hat einen Namen: Mental Load. Gemeint sind die kleinen, unsichtbaren To-dos, die sich wie ein Schleier über Ihren Alltag legen und dafür sorgen, dass Sie ständig angespannt sind. Die Schwierigkeit ist dabei nicht nur, diese ganzen Aufgaben zu erledigen, sondern vor allem, rechtzeitig an alles zu denken. Aber was genau macht Mental Load so belastend? Und warum sind so viele davon betroffen – oft ohne es bewusst wahrzunehmen?
Sie haben dieses Buch in die Hand genommen, weil Sie ahnen, dass Mental Load in Ihrem Leben eine Rolle spielt. Vielleicht spüren Sie die Last dieser unsichtbaren Verantwortung bereits deutlich und wünschen sich, dass sich endlich etwas ändert. Dann lesen Sie unbedingt weiter. Denn wir schauen uns nicht nur an, wie Sie Ihren Mental Load fairer verteilen, sondern auch, wie Sie ihn entspannt managen und schrittweise reduzieren können. Doch bevor wir uns praktische Lösungen anschauen, sind Sie herzlich eingeladen, sich kurz Zeit für eine ehrliche Bestandsaufnahme zu nehmen: Wie oft haben Sie das Gefühl, dass Ihr Kopf nicht zur Ruhe kommt? Wie viele Aufgaben laufen unbemerkt im Hintergrund, während Sie versuchen, den Alltag zu bewältigen? Haben Sie den Eindruck, dass Sie für alles verantwortlich sind? Mental Load ist mehr als nur eine bloße To-do-Liste. Es ist das ständige Gefühl der Verantwortung, das Sie begleitet, und das oft, ohne dass es von anderen anerkannt oder überhaupt gesehen wird. Dieses Buch wird Ihnen helfen, Ihre persönliche Belastung greifbar zu machen, klar zu definieren und spürbar zu verringern. Damit Ihr Akku wieder voll wird und Ihr Kopf frei ist für die schönen Dinge des Lebens.
Mental Load – ist das neu?
Mental Load beschreibt die unsichtbare Denkarbeit, die im Alltag anfällt, und die kognitive und emotionale Belastung, die damit verbunden ist. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Arbeitspsychologie und wurde bereits in den frühen 1970er-Jahren verwendet, allerdings um geistige Überlastung im Job zu beschreiben. So, wie wir Mental Load heute verstehen – nämlich als Belastung bei der Organisation von Alltag und Familie –, wird der Begriff erst seit relativ kurzer Zeit benutzt. Dabei hat vor allem ein Comic der französischen Zeichnerin Emma mit dem Titel „Fallait demander“ geholfen, in dem es genau darum geht: die ungleiche Verteilung von Aufgaben im Haushalt zwischen Frauen und Männern. Der Comic ging 2017 viral und brachte viele Menschen dazu, über das Thema nachzudenken. In Deutschland hat dabei auch die Psychologin Patricia Cammarata geholfen, unter anderem mit ihrem 2020 erschienenen Buch „Raus aus der Mental Load-Falle: Wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt“. Inzwischen wird Mental Load nicht mehr nur als individuelles Problem oder reine Privatsache angesehen, sondern ist auch ein gesellschaftliches Thema geworden, das in Alltagsgesprächen genauso wie in politischen Diskussionen angekommen ist. Immer mehr Menschen erkennen, dass Mental Load eine strukturelle Herausforderung ist, die durch traditionelle Rollenbilder und ungleiche Machtverhältnisse verstärkt wird. Denn die, die diese unsichtbare Arbeit leisten, sind vor allem Frauen.
WILLKOMMEN IM ZEITALTER DES OVERLOADS! Unsere Welt ist schneller, komplexer und herausfordernder geworden. Ständige Erreichbarkeit und der unaufhörliche Informationsfluss verschärfen den Mental Load und lassen unseren Kopf selten zur Ruhe kommen – selbst in vermeintlich freien Momenten.
Der Alltag ist heute längst kein stabiles Gerüst mehr. Notbetreuung in den Kitas, Unterrichtsausfall in den Schulen, Streiks im öffentlichen Nahverkehr oder neue Anforderungen im Job sorgen regelmäßig dafür, dass wir flexibel bleiben und oftmals improvisieren müssen. Hinzu kommt, dass Arbeitsmodelle wie Homeoffice und Remote Work die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen lassen. Dann ist da noch diese Schnelllebigkeit im digitalen Zeitalter. Das Handy vibriert ständig: eine neue Nachricht, eine Erinnerung, ein Update. Zwischen E-Mails, Social Media und Gruppenchats gibt es kaum eine ruhige Minute. Und so springt der Geist von einer Aufgabe zur nächsten, ohne je wirklich abzuschalten. Diese permanente Erreichbarkeit und das Gefühl, immer auf dem neuesten Stand sein zu müssen, verstärken den Druck und tragen dazu bei, dass die mentale Belastung gefühlt ins Unermessliche steigt. Das ist spätestens der Zeitpunkt, um dem etwas entgegenzusetzen. Noch besser ist es aber, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen.
Sie leisten mehr, als Sie denken!
Im Alltag stehen die sichtbaren Ergebnisse oft im Vordergrund, wie zum Beispiel die gewaschene und gefaltete Wäsche im Schrank. Doch wie ist sie dahin gekommen? Was ist mit all den unsichtbaren Schritten, die davor passiert sind? Jemand hat daran gedacht, das Waschmittel zu kaufen, die Gummidichtung der Waschmaschine zu reinigen, das Flusensieb des Trockners zu leeren und das Lieblingsshirt des Sohnes auf links zu drehen, damit der Print nicht beschädigt wird. Ein weiteres Beispiel ist das Abendessen: Bevor Sie die Familie mit dem Satz „Das Essen ist fertig!“ zu Tisch rufen können, haben Sie viele kleine Aufgaben erledigt und verschiedene Dinge durchdacht: Sie haben sich überlegt, was es zu Essen geben soll. Was gab es gestern, was am Tag zuvor? Sie wollen die Familie schließlich abwechslungsreich ernähren. Die Geschmäcker der Familienmitglieder sind aber verschieden. Welches Gericht schmeckt allen gut? Wer isst mit – und reicht das Essen für alle? Sie überlegen, welche Zutaten Sie noch im Haus haben und was zügig verbraucht werden muss. Müssen Sie noch was einkaufen? Das Lieblings-Pesto der Familie ist alle. Das ist aktuell im Angebot, allerdings nur bei einem bestimmten Supermarkt. All das, bevor überhaupt gekocht wird. Sie spüren es wahrscheinlich: Diese unsichtbare Denkarbeit macht die Belastung aus. Sie tragen eine endlos lange To-do-Liste in Ihrem Kopf mit sich herum. Und trotzdem bleibt am Ende eines vollen Tages oft das Gefühl zurück, nichts wirklich geschafft zu haben. Doch kaum eine Aufgabe in der Familienorganisation ist „mal eben“ erledigt. Selbst die vermeintlich einfachen Aufgaben wie beispielsweise Essen kochen, Termine machen oder Geschenke kaufen erfordern im Vorfeld eine Menge Denkarbeit: Unzählige Kleinigkeiten wollen bedacht, organisiert oder delegiert werden, damit der Alltag rundläuft. Diese unsichtbare Last verdient Anerkennung.
FÜHREN SIE EINE TADAAA-LISTE! Richtig gelesen. Schreiben Sie am Ende des Tages statt einer To-do-eine Tadaaa-Liste: Notieren Sie darauf alles, was Sie am Tag erledigt haben – auch die Dinge, die nicht auf Ihrem Zettel standen. Medikamente besorgt, verschütteten Saft weggewischt, Kind getröstet ... Sie werden staunen, wie lang diese Liste ist.
DER UNSICHTBARE BERG
Viele denken, bei Mental Load geht es nur um Kleinigkeiten. Wer genauer hinsieht, erkennt aber: Die haben es in sich!
Wie ein Marathon ohne Ziellinie
Akuten Stress kennen wir alle. Er kommt auf, wenn ein wichtiger Vortrag ansteht, Sie den Zug fast verpassen oder ein Konflikt eskaliert. Diese Art von Stress hat einen klaren Anfang und ein Ende. Der Pionier der Stressforschung, Hans Selye, definiert dazu drei Phasen: Auf den Stressor (Auslöser) folgt zuerst die Alarmphase, in der der Körper mithilfe des vegetativen Nervensystems bereit gemacht wird, zu reagieren. Danach beginnt die Widerstandsphase: Sie dient dazu, den Stressor abzubauen. Und zum Schluss kommt die Erschöpfungsphase, wenn es geschafft ist. In dieser Phase regeneriert sich der Körper. Diese akuten Stressreaktionen helfen, kurzfristig Höchstleistungen zu erbringen. Sie sind wie ein Sprint: intensiv, zielgerichtet und zeitlich begrenzt. Bei Mental Load ist das anders. Er ist kein akuter, punktueller Stress, sondern eine dauerhafte, allgegenwärtige Belastung, die sich über den gesamten Tag erstreckt. Sie wird auch nicht weniger, wenn einzelne Aufgaben abgearbeitet werden. Denn ständig tauchen neue Herausforderungen auf – es kommt also nie zu einer richtigen Erholungsphase. Und das fühlt sich an wie ein Marathon ohne Ziellinie. Diese kontinuierliche kognitive Belastung wirkt ähnlich wie chronischer Stress. Denn während der Körper nach akutem Stress wieder in den Ruhezustand zurückkehren kann, fehlt bei Mental Load die Möglichkeit zur Regeneration. Stattdessen werden permanent Stresshormone ausgeschüttet, weil das Gehirn die ganze Zeit aktiv ist und Betroffene sich andauernd verantwortlich fühlen. Das alles kann auf lange Sicht zu gesundheitlichen Problemen führen. Kurz gesagt ist Mental Load eine unsichtbare Last, die sich schleichend aufbaut und zum dauerhaften Stress wird.
GUTER STRESS: Stress hat einen schlechten Ruf. Doch tatsächlich ist Stress nicht immer schlecht. Akuter Stress kann in gewissen Situationen sehr förderlich sein, weil wir dadurch leistungsfähiger werden. In einer Gefahrensituation ist das sehr wertvoll: Dann hilft uns unsere körperliche Reaktion auf den Stress, angemessen zu reagieren und die Gefahr zu bannen.
Sich immer für alles zuständig und verantwortlich zu fühlen nervt – vor allem, wenn es niemand zu sehen oder anzuerkennen scheint. Aber nicht nur das: Mental Load kann auch zu einer Gefahr für die Gesundheit werden. Als Krankheit gilt es zwar nicht, denn Mental Load taucht in keiner Liste der anerkannten Krankheiten auf und kann daher auch nicht von einem Arzt oder einer Ärztin diagnostiziert werden. Das heißt aber nicht, dass diese dauerhafte mentale Belastung nicht zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann, und zwar auf mehreren Ebenen. Zunächst reagiert unser Körper darauf, dass das Stresssystem andauernd aktiv ist: Der Cortisolspiegel (ein zentrales Stresshormon) steigt, und das vegetative Nervensystem, das viele lebenswichtige Funktionen unseres Körpers steuert, leidet. Erkennen können Sie das beispielsweise daran, dass Ihr Puls oder Blutdruck erhöht ist. Das macht eine Herz-Kreislauf-Erkrankung wahrscheinlicher. Auch die Cholesterinwerte und der Stoffwechsel können sich verändern, was wiederum Ihr Risiko erhöht, an Diabetes zu erkranken. Häufig sind auch psychosomatische Beschwerden zu beobachten, wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, muskuläre Verspannungen, Schlafstörungen, weniger Lust auf Sex oder andauernde Müdigkeit. Neben körperlichen kann Mental Load aber auch geistige Probleme bereiten: Viele Betroffene können sich schlecht konzentrieren und werden vergesslich, weil das unablässige Gedankenkreisen um anstehende Aufgaben sie mental überfordert. Dadurch können sie Probleme schlechter lösen und auch nicht mehr so gut und schnell Entscheidungen treffen. Auf emotionaler Ebene zeigt sich die ständige Belastung häufig in Stimmungsschwankungen, anhaltender Frustration und sogar in depressiven Verstimmungen. Dadurch fällt es vielen Betroffenen schwerer, positive Gefühle zu empfinden und das Leben zu genießen. Viele vernachlässigen auch ihre eigenen Bedürfnisse. Schließlich wirken sich die Belastungen durch Mental Load auch auf das Verhalten aus: Einige Menschen ziehen sich sozial zurück – ganz einfach, weil sie sich schon mit den alltäglichen Aufgaben überfordert fühlen und keine Zeit mehr für zusätzliche Dinge haben, etwa sich mit Freunden und Familie zu treffen. Andere kompensieren den anhaltenden Stress durch Suchtverhalten, beispielsweise Alkohol- und Zigarettenkonsum oder Essen. Außerdem kann es passieren, dass anstehende Aufgaben ignoriert oder systematisch hinausgeschoben werden – und das wiederum führt zu noch mehr Stress.
Burn-out der Mütter
Wenn Mental Load dauerhaft anhält und es keine Gelegenheit für echte Erholung gibt, kann das sogar zu einem Burn-out führen, also zu einem Zustand, in dem sich Betroffene körperlich und emotional erschöpft fühlen und immer weniger leisten können – bis irgendwann nichts mehr geht. In der Fachwelt wird Burn-out heute als arbeitsbezogenes Erschöpfungs- und Anpassungssyndrom verstanden. Zum Burn-out kommt es demnach, wenn der Stress im Job chronisch wird und nicht mehr erfolgreich bewältigt werden kann. Drei zentrale Merkmale sind typisch: starke, anhaltende Erschöpfung, eine zunehmende mentale Distanz zu den Aufgaben – oft begleitet von negativen oder zynischen Einstellungen – sowie eine spürbare Abnahme der Leistungsfähigkeit. Laut Definition geht es bei einem Burn-out zwar um beruflichen Stress, vergleichbare Erschöpfungszustände können aber auch außerhalb des Jobs auftreten, etwa im Haushalt oder in der Pflege – denn auch diese Tätigkeiten sind Arbeit, bei der anhaltende Überlastung und fehlende Unterstützung zu Burn-out-Symptomen führen kann. Dazu zählen etwa Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, ein Gefühl von Überforderung und das Gefühl, innerlich distanziert oder gleichgültig gegenüber Dingen zu sein, die einem früher wichtig waren. Davon betroffen sind im häuslichen Bereich vor allem Mütter. Die kontinuierliche, unsichtbare Denkarbeit (Planen, Organisieren, Erinnern) wirkt wie ein lang anhaltender Stressor. Ohne ausreichende Regeneration kann diese Belastung allmählich in einen Burn-out übergehen. Dieser ist dann das Endstadium einer chronischen Überforderung, ausgelöst durch Mental Load. Was genau passiert da? Es gibt verschiedene Modelle vom Verlauf eines Burn-outs, zum Beispiel das 12-Stufen-Modell von Herbert Freudenberger und Gail North: Es beschreibt den schleichenden Prozess, der oft mit dem Zwang beginnt, sich beweisen zu müssen. Angetrieben wird er von hohen Ansprüchen an sich selbst und Perfektionismus. Dabei geraten die eigenen Bedürfnisse mehr und mehr in den Hintergrund. Mit der Zeit können sich erste Warnzeichen bemerkbar machen: Konflikte im Arbeitsumfeld und in der Partnerschaft nehmen zu, die Frustration steigt, die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Die Anerkennung bleibt aus, Betroffene fühlen sich von ihrem Umfeld angegriffen, eine realistische Selbstwahrnehmung und Reflexion bleibt häufig aus. Die Betroffenen isolieren sich und mit der Zeit wird die emotionale und körperliche Erschöpfung so groß, dass selbst grundlegende Dinge des täglichen Lebens nicht mehr zu bewältigen sind. Solche Modelle können allerdings immer nur eine Annäherung sein, sie sind vereinfachte Darstellungen eines komplexen Prozesses, denn jedes Burnout verläuft unterschiedlich. In der Realität können Phasen ineinander übergehen, sich wiederholen oder individuell stark variieren.
EIN BURN-OUT IST KEINE TROPHÄE! Ein Burn-out wird von einigen missverstanden als etwas, das man erleidet, wenn man hart genug gearbeitet hat – also etwas, auf das man quasi stolz sein kann. Das hat auch damit zu tun, dass wir in einer leistungsorientierten Gesellschaft leben und in immer kürzerer Zeit immer mehr schaffen wollen und sollen. Um es klar zu sagen: Burn-out ist kein Erfolg, sondern ein deutliches Warnsignal.
Um Burn-out vorzubeugen, wäre es hilfreich, wenn Selbstfürsorge in unserer Gesellschaft einen höheren Stellenwert bekäme. Doch dafür, dass ein Mensch sich selbst etwas Gutes tut, gibt es oft nur wenig Anerkennung. Dabei profitieren nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihr berufliches und privates Umfeld, wenn Sie Ihre eigene Belastung erkennen und regulieren. Zahlen des Müttergenesungswerks zeigen: In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Mütter, die unter einem Erschöpfungssyndrom bis hin zum Burn-out leiden, um 37 Prozentpunkte gestiegen. Schätzungsweise ist jede fünfte Mutter betroffen. Dabei ist das Problem nicht nur die Belastung selbst, sondern auch der Zeitpunkt, zu dem viele Frauen Hilfe suchen: nämlich viel zu spät, wenn die Belastungsgrenze bereits überschritten ist. Mütter schieben ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten der Familie oft so lange beiseite, bis nichts mehr geht. Sie funktionieren weiter, weil sie glauben, stark sein zu müssen. Über 90 Prozent der Mütter, die eine Mutter-Kind-Kur oder eine Mütter-Kur gemacht haben, hatten bereits Symptome wie dauerhafte Erschöpfung bis hin zu Burnout, Schlafstörungen, Angstzuständen und depressiven Episoden.
Was heißt das nun für Sie? Keine Sorge, allein dass Sie zu diesem Buch gegriffen haben, bedeutet noch nicht, dass Sie gerade in einen Burn-out schlittern. Ganz im Gegenteil: Dass Sie Mental Load als Problem erkennen und vorhaben, dieses anzugehen, ist schon ein Zeichen gesunder Selbstfürsorge. Trotzdem ist es sinnvoll, das Phänomen „Burn-out der Mütter“ zu kennen – um Warnsignale zu bemerken, aber auch, um sich selbst (und vielleicht auch Ihren Gesprächspartnern) klarzumachen, dass nicht bloß Top-Manager hochbelastet und Burn-out-gefährdet sind. Die unzähligen vermeintlich kleinen Aufgaben des Alltags können die gleichen Folgen haben. Ein guter Grund, Mental Load ernst zu nehmen!
Das Lächeln und die Last dahinter
Es gibt Mütter – und natürlich nicht nur Mütter, sondern auch andere Menschen –, die wirken wie echte Multitasking-Wunder: Sie meistern ihren Job, bringen die Kinder pünktlich zur Schule, haben alle Termine im Blick und dabei noch ein Lächeln im Gesicht. Doch innerlich sieht es bei ihnen oft anders aus. Die Müdigkeit sitzt tief, die Gedanken kreisen, und jeder Tag fühlt sich schwer an. Wenn diese innere Erschöpfung ignoriert wird, kann sich daraus eine unerkannte Gefahr entwickeln – die sogenannte hochfunktionale Depression. Während Burn-out heute in Diagnosemanualen berücksichtigt wird (wenn auch nicht als eigenständige Krankheit), ist die hochfunktionale Depression nicht formal verankert und bisher kaum erforscht. Das macht es schwer, sie zu erkennen. Menschen mit einer hochfunktionalen Depression kommen all ihren Verpflichtungen nach und wirken gut organisiert. Anders als bei einer klassischen Depression gibt es keinen sozialen Rückzug oder Antriebslosigkeit. Sehr wohl kämpfen die Betroffenen aber innerlich mit ihrem Antrieb, fühlen sich emotional leer und spüren eine außerordentliche Erschöpfung. Auch sie selbst sehen oft nicht, was hinter ihren Symptomen steckt, und schreiben ihnen oft andere Ursachen zu. Die hochfunktionale Depression tritt häufig bei Menschen auf, die sich für alles verantwortlich fühlen und denen es schwerfällt, Grenzen zu setzen oder Aufgaben abzugeben. Kommt Ihnen das bekannt vor? Hier zeigt sich die Verbindung zum Mental Load. Insbesondere Frauen in Rollen mit hoher Verantwortung – sei es in der Familie, im Beruf oder beidem – sind gefährdet. Die dauerhafte mentale Belastung durch Planung, Organisation und Sorgearbeit kann die innere Leere verstärken und das Gefühl hervorrufen, in einem Kreislauf gefangen zu sein, aus dem es kein Entkommen gibt. Dieses Gefühl täuscht: Es gibt Wege aus diesem Tief, doch braucht es hier oft professionelle Hilfe.
Sie müssen es nicht allein schaffen
Sowohl für die hochfunktionale Depression als auch fürs Burn-out-Syndrom gilt: Wir wollen Ihnen an dieser Stelle keine Angst machen. Nur weil Ihnen Mental Load zu schaffen macht, heißt das nicht, dass Sie von diesen Phänomenen betroffen sind. Beim Lesen dieses Buches werden Sie feststellen, dass Sie zahlreiche Möglichkeiten haben, Ihre Belastung selbst spürbar zu verringern. Doch zur Wahrheit gehört auch: Es gibt Fälle, da reicht Selbsthilfe allein nicht aus. Es kann sein, dass Sie bereits so belastet sind, dass Ihnen die Kraft fehlt, die Schritte anzugehen. Oder Ihnen fehlt die Zuversicht, dass es besser werden kann. Wenn das auf Sie zutrifft – oder auch, wenn Sie viele der von Gert Kaluza formulierten Warnsignale auf der gegenüberliegenden Seite bei sich bemerken –, sollten Sie sich Hilfe holen. Eine gute erste Ansprechperson ist Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt. Wichtig dabei: Sie müssen gar nicht selbst entscheiden, ob Sie bereits ein Burn-out oder eine Depression haben. Schon das diffuse Gefühl, dass Ihnen alles zu viel wird, ist Grund genug, mit einer Fachperson darüber zu sprechen und zu überlegen, was helfen könnte. Wenn Sie möchten, können Sie die Maßnahmen aus diesem Buch ausprobieren und einen Folgetermin in einigen Wochen vereinbaren, um zu schauen, ob es Ihnen dann besser geht. So haben Sie ein „Sicherheitsnetz“, falls Sie allein doch nicht weiterkommen. In jedem Fall gilt: Suchen Sie sich lieber früher Hilfe als zu spät.
WIRD ALLES ZU VIEL?
Nicht alles kann man allein bewältigen. Achten Sie auf Warnsignale, die anzeigen, dass Sie sich Hilfe holen sollten.
KÖRPERLICHE SIGNALE
Herzklopfen/Herzstiche, Engegefühl in der Brust, Atembeschwerden, Einschlafstörungen, Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden, Magenschmerzen, Appetitlosigkeit, sexuelle Probleme, Muskelverspannungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, kalte Hände/Füße, starkes Schwitzen
EMOTIONALE SIGNALE
Nervosität, innere Unruhe, Gereiztheit, Ärgergefühle, Angstgefühle, Versagensängste, Unzufriedenheit/Unausgeglichenheit, Lustlosigkeit (auch sexuell), innere Leere, „ausgebrannt sein“
KOGNITIVE SIGNALE
Ständig kreisende Gedanken/Grübeleien, Konzentrationsstörungen, Leere im Kopf („Blackout“), Tagträume, Albträume, Leistungsverlust/häufige Fehler
SIGNALE IM VERHALTEN
Aggressiv gegenüber anderen („aus der Haut fahren“), Fingertrommeln, Füße scharren, Zittern, Zähneknirschen, schnelles Sprechen oder Stottern, andere unterbrechen, nicht zuhören können, unregelmäßig essen, Konsum von Alkohol (oder Medikamenten) zur Beruhigung, private Kontakte „schleifen lassen“, mehr Rauchen als gewünscht, weniger Sport und Bewegung als gewünscht
Multitasking auf der Venus? Schluss mit Mythen!
Frauen sind von Natur aus besser im Multitasking: Das ist ein Mythos, der vor allem dazu dient, unfaire Strukturen zu rechtfertigen.
Oft begegnen uns im Alltag Aussagen wie: „Mütter können sich von Natur aus besser um Babys kümmern.“ Oder: „Frauen können besser mehrere Dinge gleichzeitig tun.“ Sie klingen so vertraut, dass wir sie kaum hinterfragen und als gegeben hinnehmen. Vielleicht haben Sie diese Sätze sogar schon mal selbst gesagt oder zumindest gedacht? Dann müssen Sie jetzt ganz stark sein. Denn diese Annahmen sind falsch! Es gibt keinerlei wissenschaftliche Belege dafür, dass es so etwas wie einen angeborenen „Mutterinstinkt“ gibt oder Frauen von Natur aus besser mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen können. Vielmehr sind diese Vorstellungen das Ergebnis gesellschaftlicher Erwartungen und früh erlernter Rollenbilder.
Lassen Sie uns einmal genauer hinschauen: Oft heißt es, dass mit der Geburt des Kindes auch die Mutter geboren wird. Gibt es da eine Art geheimen Schalter, der sich umlegt, sobald das Baby da ist? Annika Rösler und Evelyn Höllrigl Tschaikner haben genau das hinterfragt und sich in ihrem Buch „Mythos Mutterinstinkt“ auf die Suche nach Antworten gemacht. Und, Überraschung: Die neurowissenschaftlichen Studien, die sie anführen, zeigen klar, dass es diesen sogenannten Mutterinstinkt so gar nicht gibt. Kein biologisches Naturgesetz macht Frauen automatisch zur perfekten Bezugsperson für ein Baby. Viel wichtiger für die emotionale Bindung und elterliche Intuition ist etwas ganz anderes, und zwar der enge Kontakt mit dem Kind. Das heißt: Wer sich um das Kind kümmert, ihm zuhört, es tröstet und mit ihm wächst, entwickelt diese Intuition. Sie ist nicht angeboren. Zum Glück! Elternwerden ist also kein exklusives Frauen-Ding. Es braucht keinen biologischen Bonus, sondern Zeit, Nähe und den Mut, sich auf die Reise einzulassen. Väter, nicht-leibliche Eltern oder Adoptiveltern – sie alle können emotionale Bindung und elterliche Intuition entwickeln und weiter wachsen lassen: mit jeder Windel, jedem Trösten und jeder kleinen Umarmung.
Aber wie kann es dann sein, dass sich diese Mythen so lange halten? Zumal wir doch genau das selbst tagtäglich in unserem eigenen Zuhause (und wenn nicht dort, dann doch im näheren Umfeld) beobachten können? Die Weichen für stereotype Rollenbilder werden schon früh gestellt. Jungs bekommen Baukästen, Autos und Abenteuer-Spielzeug, das ihre technische Neugier fördern soll. Mädchen dagegen werden mit Puppen, Spielküchen und Bastelsachen in die Welt der Fürsorge und Organisation geführt. Klingt erst mal harmlos, oder? Doch genau hier beginnt der Kreislauf. Diese kleinen Unterschiede pflanzen sich im späteren Leben fort, fast wie von selbst. Frauen übernehmen oft ganz automatisch die unsichtbare Arbeit. Das passiert nicht, weil sie es besser können, sondern weil sie es von Anfang an so gelernt haben – auch durch Vorbilder. Dieses früh angelegte Rollenverständnis ist wie ein unsichtbarer Anker, von dem man sich nur schwer lösen kann. Das schauen wir uns in diesem Kapitel genauer an.
Alles gleichzeitig? Kann niemand!
Es wird zwar allseits kommuniziert, dass Frauen angeblich ein besonderes Talent fürs Multitasking besitzen und dass berufstätige Mütter Kinder, Haushalt, Job, Partnerschaft und Hobbys mit Leichtigkeit und mühelos unter einen Hut bringen – aber: Es stimmt nicht. Eine schwedische Studie hat genau diesen Mythos widerlegt. Tatsächlich zeigt sich, dass Frauen objektiv nicht besser als Männer darin sind, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu jonglieren. Im Gegenteil: Forschende stellten fest, dass Männer ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen haben. Das hilft ihnen, komplexe Aufgaben und den zeitlichen Ablauf zu strukturieren. Auf diese Weise haben Männer einen kleinen geschlechtlichen Vorteil beim Multitasking. Aber auch dieser Vorteil scheint nicht angeboren zu sein. Vielmehr werden die Unterschiede im Gehirn von Mann und Frau durch Übung, kulturelle Einflüsse und Erziehung gefördert. Spannend ist, dass sich der Unterschied auch mit dem Zyklus der Frau verändert: Frauen, die sich in der Zyklusphase um den Eisprung befanden, schnitten in der Studie deutlich schlechter ab. Frauen in der Phase rund um die Menstruation schnitten nur leicht schlechter ab, was statistisch gesehen aber nicht bedeutsam war. Wir halten also fest: Frauen sind nicht besser im Multitasking, Männer könnten sogar einen Vorteil beim Multitasking haben – je nach Zyklusphase der Frau.
TRAINING MIT SUPER MARIO? Eine Studie zeigt, dass der Bereich des Gehirns, der für räumliches Denken zuständig ist, bei Männern deutlich ausgeprägter ist, wenn sie in ihrem Leben viel Zeit mit Videospielen aus den Bereichen Logik, Puzzle und Jump and Run verbracht haben. Ob es aber tatsächlich etwas bringen würde, gezielt Videospiele zu spielen, um besser im räumlichen Denken und damit auch im Multitasking zu werden, lässt sich daraus nicht ableiten.
Darüber hinaus zeigt die Forschung, dass echtes Multitasking – also das Erledigen mehrerer Aufgaben gleichzeitig – für alle Menschen eine Illusion ist: Denn in Wirklichkeit wechseln wir gedanklich schnell zwischen verschiedenen Tätigkeiten, statt alles auf einmal zu machen. Die Forscherin Shalena Srna aus Michigan hat das in einer Studie veranschaulicht: Alle Teilnehmenden sollten eine Tierdokumentation anschauen und transkribieren. Die erste Gruppe glaubte, sie führe gleichzeitig zwei Aufgaben aus: Lernen und Transkribieren. Die zweite Gruppe empfand dies als eine Aufgabe. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Teilnehmende, die dachten, sie würden Multitasking betreiben (Gruppe 1), tippten schneller, machten weniger Fehler und schnitten im Verständnisquiz besser ab. Jetzt könnte man denken: Super, dann forciere ich Multitasking und steigere meine Produktivität. Doch so simpel ist es nicht, wie Srna und ihr Team betonen. Die Ergebnisse zeigen vielmehr, dass es nicht das Multitasking selbst ist, das die Leistung steigert, sondern der Glaube an die eigene Fähigkeit. Unsere Wahrnehmung hat einen entscheidenden Einfluss – also das, was wir glauben, leisten zu können.
Es geht also gar nicht darum, ob Frauen objektiv besser Multitasking können. Ihnen bleibt nur öfter nichts anderes übrig. Das liegt auch daran, dass ihnen glaubhaft versichert wird, dass sie das schon schaffen, denn sie sind ja schließlich Frauen. Anstatt Frauen dafür zu feiern, dass sie all die Aufgaben parallel bewältigen, sollten wir uns lieber fragen: Warum sind die Frauen in dieser Falle gelandet, so viele Aufgaben gleichzeitig zu übernehmen – und wie kommen sie da raus?
Wie Frauen in die Rolle der Kümmerin rutschen
Partnerschaften fangen oft gleichberechtigt an: Beide Partner teilen sich die Miete, den Wocheneinkauf und das Streaming-Dienst-Passwort. Beide machen Karriere, feiern Erfolge im Job und denken sich: Wir haben das Leben im Griff! Und dann kommt das erste Kind – und plötzlich fühlt es sich an, als hätte jemand den Gleichberechtigungs-Karren gegen die Wand gefahren. Sie geht in Elternzeit und kümmert sich um den Nachwuchs und alles drum herum, er bekommt im gleichen Zeitraum vielleicht sogar eine Beförderung. Dass sie sich um die meisten Angelegenheiten im Haushalt und in der Familienorganisation kümmert, erscheint selbstverständlich. Dass sie in der Zeit nicht mal weiß, wie sie in Ruhe auf Toilette gehen, eine Mahlzeit ohne Unterbrechung essen oder einfach mal eine Sache in Ruhe zu Ende machen kann, während er geregelte Arbeitszeiten mit Mittagspause und einer Kantine hat, ist Nebensache. Sie kümmert sich um alles, denn er geht ja schließlich arbeiten. Der Gender Care Gap hat an dieser Stelle zugeschlagen – und zwar mit voller Wucht. Aber warum passiert das?
Frauen übernehmen den überwiegenden Teil der Hausarbeit. Das ist vor allem in Familien mit Kindern häufig der Fall. Doch wird das auch so wahrgenommen? Nein. 54 Prozent der Frauen haben das Gefühl, den Haushalt allein zu stemmen, während nur 22 Prozent der Männer das überhaupt bemerken. Denn wie soll man etwas wertschätzen, das man nicht einmal sieht? Die Zahlen stammen aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung zur Aufteilung des Haushalts in heterosexuellen Paarbeziehungen aus dem Jahr 2025. Die Studie bringt auch ans Licht, dass Männer sich in ihrer Rolle im Haushalt überschätzen. Wenn es nach den Männern geht, läuft das mit der Haushaltsaufteilung ziemlich fair ab. Über zwei Drittel der Männer (68 Prozent) sind überzeugt, dass beide sich die Arbeit im Haushalt zumindest meistens teilen.
Warum hält sich diese Ungleichverteilung so hartnäckig? Vielleicht liegt es an der stillen Macht der Erwartungen, die dafür sorgt, dass Frauen sich immer wieder für kleine, unsichtbare To-dos zuständig fühlen, während Männer zufrieden sind, wenn sie den Müll rausgebracht haben. Vielleicht, weil niemand merkt, wer den Müllbeutel gekauft und wer die Entsorgungstermine in den Familienkalender eingetragen hat. Genau diese unsichtbare Verantwortung ist es, die Frauen überlastet und Männer entlastet – und die letztlich darüber entscheidet, wer am Ende mehr Zeit für sich selbst hat.
Natürlich läuft die Ungleichverteilung im Haushalt nicht immer nur nach dem klassischen Geschlechterbild. In vielen Fällen ist es auch umgekehrt und die Männer übernehmen im familiären Kontext mehr Verantwortung, sei es bei der Kinderbetreuung oder im Haushalt. Allerdings gibt es auch einige Fälle, in denen sogar dann die traditionelle Rollenverteilung bleibt, wenn die Frau die Hauptverdienerin ist: Nicht selten übernimmt sie dann trotzdem mehr Care-Arbeit. Es ist sogar oft so, dass Frauen mit höherem Einkommen sich noch stärker dazu verpflichtet fühlen, mehr Haushaltsarbeit zu leisten. So wollen sie verhindern, dass Partner und Kinder das Gefühl bekommen, zu kurz zu kommen. Das zeigt sehr eindrücklich, dass Rollenbilder und Erwartungen so tief in uns verwurzelt sind, dass es sehr schwerfällt, sich davon zu befreien.
Die Scham, die uns antreibt
Genau hier setzen die Forschungsarbeiten der Sozialwissenschaftlerin Brené Brown an. Sie bringen eine wichtige Wahrheit ans Licht: Scham beeinflusst unser Verhalten viel stärker, als wir glauben. Sie ist subtil, aber mächtig und spielt eine große Rolle dabei, warum Care-Arbeit im Alltag so ungleich verteilt ist. Klar, äußere Strukturen spielen eine Rolle dabei, dass viele Frauen wie selbstverständlich den Großteil der unsichtbaren Aufgaben übernehmen, während Männer oft stärker auf ihre Karriere fokussiert sind. Dazu tragen aber auch ganz entscheidend tiefsitzende Scham-Glaubenssätze bei, die viele schon in Kindheitstagen erlernen. Für viele Frauen ist die größte Angst, dass sie als „unmütterlich“ oder „nicht fürsorglich genug“ wahrgenommen werden – oder kurz gesagt: dass andere denken könnten, dass sie keine gute Mutter sind. Vielleicht erkennen Sie sich in einem der Beispiele: die Mutter, die arbeitet und sich schuldig fühlt, weil das Mittagessen nicht selbst gekocht ist. Oder weil die Geburtstagsfeier der Kinder „nur“ im Indoor-Spielplatz stattfindet statt im liebevoll dekorierten Zuhause. Oder die Frau, die das Chaos in der Küche als persönliches Versagen empfindet, weil sie Ordnung mit Kontrolle und Stärke verbindet. Genau hier entfaltet die Scham ihre stille Macht. Sie sorgt dafür, dass Frauen oft noch mehr Verantwortung übernehmen, selbst dann, wenn sie schon am Limit