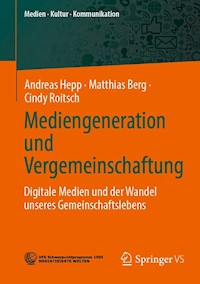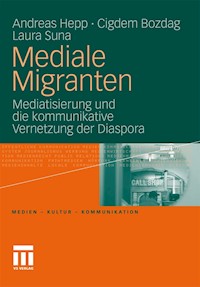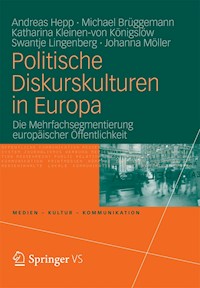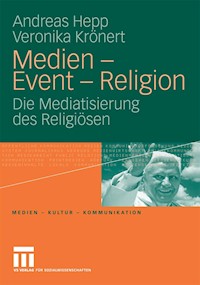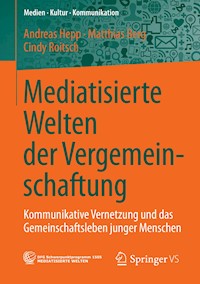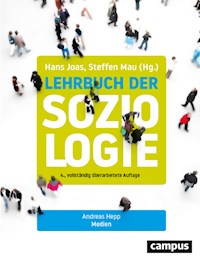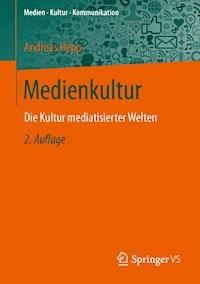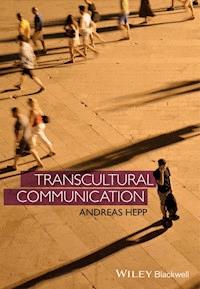Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Eigentlich flüchtet jeder“, sagt der afghanische Flüchtling Elyas Jamalzadeh. Ein spannendes und humorvolles Buch über seine tragische Fluchtgeschichte
„Stell dir mal vor, du bist dein Leben lang nervös, merkst alles, bist ständig auf der Hut. Ich wurde schon nervös geboren. Ich war illegal. Jedes Jahr, jeden Tag, jede Minute konnte es passieren.“ Die afghanischen Eltern von Elyas Jamalzadeh lebten schon im Iran, als er auf die Welt kam. Er wurde als Flüchtling geboren. 2014 macht er sich auf den gefährlichen Weg nach Europa. Mit beeindruckender Unmittelbarkeit wird hier eine Reise beschrieben, die man kaum überleben kann. Dass Jamalzadeh Humor und Ehrgeiz nie eingebüßt hat, hilft ihm beim Ankommen in einem fremden Land. Er lernt Deutsch, beginnt eine Ausbildung und verliebt sich. Ein tragisches, ein komisches Buch, ein Buch, das niemanden kaltlässt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Stell dir mal vor, du bist dein Leben lang nervös, merkst alles, bist ständig auf der Hut. Ich wurde schon nervös geboren. Ich war illegal. Jedes Jahr, jeden Tag, jede Minute konnte es passieren.« Die afghanischen Eltern von Elyas Jamalzadeh lebten schon im Iran, als er auf die Welt kam. Er wurde als Flüchtling geboren. 2014 macht er sich auf den gefährlichen Weg nach Europa. Mit beeindruckender Unmittelbarkeit wird hier eine Reise beschrieben, die man kaum überleben kann. Dass Jamalzadeh Humor und Ehrgeiz nie eingebüßt hat, hilft ihm beim Ankommen in einem fremden Land. Er lernt Deutsch, beginnt eine Ausbildung und verliebt sich. Ein tragisches, ein komisches Buch, ein Buch, das niemanden kaltlässt!
Elyas Jamalzadeh/Andreas Hepp
Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten
Paul Zsolnay Verlag
Der Herr Polizist kam gleich zur Sache.
»Wie heißen Sie?«
»نام شما چیست؟«
Eigentlich flüchtet jeder.
Das Neugeborene flüchtet aus der Mutter.
Der Schüler flüchtet vor der Prüfung.
»الیاس جمالزاده«
»Er sagt: Elyas Jamalzadeh.«
Der Erwachsene flüchtet vor der Verantwortung.
Der Herr Polizist notierte die Übersetzung.
»Woher kommen Sie?«
»شما اھل کجا ھستید؟«
Der Österreicher flüchtet vor dem Rundfunkgebühren-Inquisitor.
Der Sterbende flüchtet aus dem Leben.
Und ich? Ich flüchte. Vor? Nein, grundsätzlich.
»پدر و مادر من از پایتخت ما کابل هستند. سپس به ایران فرار کردند. من در ایران متولد شدم. سپس دوباره فرار کردیم. گفتم من افغان هستم. چون ایران هرگز چیزی به من نداده است. چرا باید احساس کنم پخشی از آن هستم؟«
»Er … sagt: Afghanistan.«
Born to flee.
Noch 2 Kapitel bis zu meiner Geburt
Dort, wo ich herkomme, sind manche Mädchen ohne Jungs Jungs, und Jungs Jungs.
Dort, wo ich herkomme, gehen hennafarbene Bärte mit ihren Männern spazieren.
Dort, wo ich herkomme, tanzen Kalaschnikows auf Hochzeiten. Im Ernst, schau auf YouTube, da gibt’s Videos davon.
Padar-jan, das heißt Vater, wurde mit zwei Händen, zwei Füßen und typisch vielen Haaren in einer reichen Familie in Kabul geboren. Beruf: Pfleger. Er war der, der sich um die Alten, Kranken und sonstige unwirtschaftliche Mitglieder der Gesellschaft gekümmert hat. Sein Bruder um deren Fernseher, Steckdosen und Stromleitungen. Söhne durften ja etwas lernen. Töchter nicht — klar, warum denn auch?! Die sollten zu Hause putzen, kochen, kindern.
Besucht hat meine Madar-jan die Schule trotzdem.
Besucht hat ihr Nachbar meinen Padarbozorg deshalb.
Padarbozorg, das ist der Vater meiner Madar-jan. Der Nachbar jedenfalls hat ihn netterweise und nachdrücklich darüber aufgeklärt, dass es peinlich sei, wenn seine Töchter zur Schule gehen. Ist doch immer wieder schön, so Hilfe von Nachbar zu Nachbar, oder?
Besucht hat Madar-jan die Schule danach nicht mehr. Beruf: Hausfrau.
Meine Eltern wurden verheiratet. Da war Padar-jan ein wenig jünger als Sebastian Kurz heute, und Madar-jan ein wenig jünger als Greta Thunberg. Neben der Tatsache, dass mein Beispiel sicher ein witziges Paar abgeben würde, überlasse ich das Rechnen dir. Ist nicht so meine Stärke. Und ja, das mit dem Verheiraten gibt’s echt noch. Auch bei den Afghanen, die schon in anderen Ländern leben. Hm, wie kann ich dir das erklären?
Vielleicht so: Eine afghanische Verheiratung läuft wie die österreichische Regierungsbildung ab. Die Eltern des Sohnes wären dann die stärkere Partei. Da sag ich jetzt lieber keine konkrete, da mach ich mir hier keine Freunde. Die haben jedenfalls die Initiative. Zuerst wird ein geeigneter Koalitionspartner sondiert. Den finden die afghanischen Eltern unter den Verwandten und Bekannten in der Stadt. Dann finden erste Gespräche statt. Die Alpenrepublik-Politiker haben da den Vorteil, dass schon jeder jeden entweder kennt oder zumindest mal bestochen hat. Meine Eltern kannten einander aber nicht. Deren Eltern regelten das untereinander.
Meine Madar-jan und mein Padar-jan hatten einander nie gesehen. Erst bei der Hochzeit. »Servus! Ah, du bist der, mit dem ich die nächsten fünfzig oder bis-zur-nächsten-Explosion Jahre verbringen soll? Cool! Nice to meet you!« So etwa stell ich mir das vor. Am Hochzeitstag standen sie nur da wie Puppen, in Anzug und Brautkleid. Und dann — Plopp! — waren sie auf einmal verheiratet. Plopp! Das macht auch der afghanische Reis im Kochtopf. Nicht schrecken, ist wie die Afghanen: explodierend. Haha.
»Weißt du, ich hatte trotzdem keine Angst vorm Heiraten.«
Das hat Madar-jan mir später erzählt. Sie hatte ihren Eltern vertraut, dass sie die besten Entscheidungen treffen würden. Aber sie wusste von einer Verwandten, die von ihrem Mann sehr schlecht behandelt wurde. Die waren nämlich verheiratet worden, und bei einer afghanischen Hochzeit sind beide sehr stark geschminkt. Als der Ehemann am nächsten Morgen seine Frau ohne Schminke gesehen hatte, war er erschrocken aufgesprungen und aus dem Zimmer gelaufen. Er hatte sie nämlich zu hässlich gefunden. Und was tust du klarerweise, wenn du deinen Partner ohne Schminke zu hässlich findest? Genau. Du heiratest einfach noch wen! Das gibt es in Afghanistan oft. Mit dieser zweiten Frau war der Mann dann spazieren, bei anderen zu Besuch oder hatte Sex mit ihr. Die erste Frau ignorierte er, sie musste ihr Leben lang für ihn putzen und im Haus bleiben. Das erlaubt die Religion, sagt man. Das erlaubt Mohammed. Der Prophet hatte selbst zehn Frauen, die jüngste davon war bei der Hochzeit erst sieben. Deswegen werden Mädchen oft sehr jung verheiratet.
Vielleicht denkst du jetzt: »Warum ist die Frau nicht weggelaufen oder hat sich scheiden lassen?« In der muslimischen Welt gibt es ein Sprichwort: Eine Frau kommt mit weißen Kleidern in die Ehe und verlässt sie auch mit weißen Kleidern. Der erste Teil vom Sprichwort meint das Brautkleid. Der zweite Teil meint das Kafan. Das ist ein großes weißes Tuch.
Das Kafan trägst du zum Beispiel in Mekka.
Und das Kafan trägst du, wenn du tot bist.
Also meint die Redewendung, es gibt keine Scheidung, nur den Tod. Aber der Mann darf, wie Mohammed, mehr Frauen heiraten. Heutzutage ist es schon ein bisschen anders: In modernen Gebieten und Städten kannst du dich scheiden lassen. In den ländlichen Gebieten, wo die Paschtunen wohnen, nicht. Oder wo die Taliban sind. Da gibt’s nur das Kafan. Punkt.
Afghanistan war 2018 auf Platz 187 von 189 auf dem Gender Development Index des UNDP. Ein Hoch auf die Frauenrechte!
Noch 1 Kapitel bis zu meiner Geburt
Oder wie meine älteste Schwester Mahbobeh von den Taliban entführt wurde und spurlos verschwand.
Der Herr Krieg migrierte so vor fünfunddreißig oder vierzig Jahren nach Afghanistan. Bekam leider von Beginn an eine Arbeitsbewilligung. Und werkelt dort heiter weiter bis heute. Hoffentlich kommt der Herr Krieg nie auf die Idee, auch in den Westen zu fliehen.
Damals kämpften die Taliban gegen die Regierung, so wie heute die Paschtunen gegen die Tadschiken. Wobei die Taliban ja heute auch noch kämpfen? Na ja, egal, Afghanistan — Plopp! — halt, jeder — Plopp! — kämpft. Die Taliban jedenfalls wollten die Schulen schließen und die Kinder in die Moschee zum Koranlernen schicken. Alles, was noch gelehrt wurde, war plötzlich nicht mehr auf Dari, sondern auf Paschtu, also in einer ganz anderen Sprache. Stell dir vor, du gehst in die Schule, und plötzlich dürfte niemand mehr Deutsch sprechen, sondern nur noch irgendein Chinesisch:
Du so: »Servus!«
Er so: »您好«
Du so: »Was?«
Er so: »拿枪«
Du so: »Hä?«
Er so: »圣战!«
Du so: »Ich versteh nix!«
Er so: »你是一个不信的人«
Du so: »Sorry, kein Plan.«
Er beginnt, dich zu schlagen.
Du so: »Au!«
So ähnlich war das. Den Jungs ab zwölf Jahren wurde ein Tuch um den Kopf befohlen. Und die Kleineren hatten dann alle so eine muslimische Art von Haube am Kopf. Unter uns gesagt: Die schaut exakt wie die Kippah der Juden aus. Erzähl das aber bitte nie den Taliban. Das hören die nicht so gern. Sonst machen die dich plopp.
Meine Eltern lebten noch halbwegs in Sicherheit. Der Vater meines Vaters war reich, Direktor der einzigen Schule im Viertel, und hatte in der Lokalpolitik die richtigen Freunde. Außerdem war Kabul vergleichsweise sicher und stabiler als der Rest unseres kriegszerrütteten Fleckens Erde. Aber unsere Familie hatte ein Problem: Madar-jan bekam vier Töchter hintereinander, und keinen Jungen.
Mädchen gelten nichts. Deshalb gibt es Bacha Posh. Heißt wörtlich »wie ein Junge gekleidet«. Das passiert häufig in Afghanistan: Eine Tochter wird als Junge verkleidet, benimmt sich wie ein Junge und hat auch die Rechte eines Jungen. Das ist ein Bacha Posh. Offiziell dürften sie nicht existieren. Aber ein erfundener Sohn ist besser als gar keiner. Im Volksmund munkelt man, dass das nächste Kind ein Junge werde, wenn ein Mädchen zu einem Bacha Posh wird. Außerdem kann sie beziehungsweise er am Bazar weit billiger einkaufen als ein Mädchen, selbst arbeiten und Geld verdienen, unbehelligt zur Schule gehen und seine Schwestern beschützen. Nicht nur, aber vor allem in ländlichen Gegenden dürfen Frauen ohne einen Mann nicht einmal das Haus verlassen. Und wenn du als Mädchen einen Bruder hast, der das besitzanzeigende Fürwort »meine« vor »Schwestern« setzen kann, lassen die anderen dich in Ruhe. Egal, ob »die anderen« nun pubertierende Burschenbanden, vereinzelte Sexsklavenhändler oder gar die Taliban sind.
Denn: Der männliche Besitzanspruch wird respektiert.
Deshalb wurde Asina, meine drittälteste Schwester, ein Bacha Posh. Das beschlossen meine Eltern, das beschloss die Familie. Anderer Name, andere Frisur, anderes Benehmen. So konnte auch Mahbobeh die Mädchenklasse besuchen, und sowohl die zweitälteste, Trina, als auch die jüngste, Khaledeh, durften gelegentlich mit »ihm« ins Freie.
Dabei weiß natürlich jeder, dass es die Bacha Posh gibt. Fast jede Familie hat einen Bacha Posh in der Verwandtschaft. Und umso älter sie werden, umso leichter sind sie zu erkennen. Jeder weiß es, keiner sagt es. Es wird stillschweigend akzeptiert, weil ganze Familien von einem Bacha Posh, seinem Einkommen und seinen Rechten abhängig sein können. Eine Zeit lang ging das für Asina noch gut. Die eiserne Regel allerdings ist: Ab zwölf muss »er« wieder zu »ihr« werden. Dann wird es ohnehin schwer, ein pubertierendes Mädchen als Jungen auszugeben. Und das Letzte, was du im Leben willst, ist, von den Taliban als Bacha Posh enttarnt werden.
Daran hielten sich meine Eltern. Asina wurde zwölf, blieb kurzfristig zu Hause, ließ ihr Haar wieder lang wachsen und wechselte in die Mädchenklasse. Der schützende Bruder in unserer Familie existierte nun nicht mehr, war wie ausgelöscht. Und so musste es leider auch bleiben. Zwar hatten meine Eltern nun schon zwei Söhne bekommen. Aber es war spät, zu spät. Hesam war erst drei, und Ramin vielleicht ein Jahr alt. Und Asina war wieder bloß Asina. Es gab keinen Bacha Posh mehr, der durch die Straßen stampfen und »meine« vor »Schwestern« setzen konnte. Weder vor die jüngere. Noch vor die beiden älteren. Unser männliches Possessivpronomen war verschwunden.
Mahbobeh ging eines Tages in die Schule.
Mahbobeh kam eines Tages nicht mehr heim.
Meine Eltern haben am ersten Tag nur bei den Verwandten gesucht und herumgefragt. Sie wollten kein Aufsehen erregen. Es wird als große Schande betrachtet, wenn ein unverheiratetes Mädchen bei Einbruch der Dunkelheit nicht zu Hause ist. Und Schande kann in dieser Kultur tödlich enden. Wer nämlich weiß, wo und bei wem sie ist …? #AfghanischeEhrkultur
Am nächsten Tag, als Mahbobeh noch immer nicht nach Hause gekommen war, gaben sie in der Moschee und vor dem ganzen Vorort von Kabul und der Polizei bekannt, dass ihre Tochter verschwunden ist. Doch niemand konnte sie finden. Meine Eltern wurden immer verzweifelter, fragten, schrien, weinten. Doch niemand konnte sie finden. Nach einigen Monaten, als der Krieg heftiger geworden ist, bekamen meine Eltern eine knappe Nachricht von den Taliban:
»Wir haben eure Tochter. Wir kommen und holen die anderen.«
Deshalb verheirateten meine Eltern Trina sofort. Wenn du in Afghanistan verheiratet bist, tut dir niemand was, weil der Mann auf dich aufpasst. Du bist quasi nur zu Hause, weil du nicht arbeiten oder in die Schule gehen darfst, aber du bist in männlich- und religiös-garantierter Sicherheit. Auch für Asina hatten meine Eltern bald einen Mann als Beschützer gefunden. Better married than dead. Als unsere Eltern bald trotzdem weitere Drohungen von den Taliban erhielten, flohen sie mit Familie zum Haus unseres Onkels außerhalb von Kabul.
Tags darauf wurde unser eilig verlassenes Haus von einer Bombe in die Luft gesprengt.
Meine Eltern wussten, dass die ganze Familie weiter in großer Gefahr schwebte, solange sie im Land blieben. Die Taliban wollten sie beseitigen: Erstens, weil der Vater meines Vaters eine wichtige Person für die lokalen Politiker war, die ein modernes Afghanistan schaffen wollten. Und zweitens, weil auch meine Eltern selbst zu progressiv waren und ihre Töchter in die Schule geschickt hatten. Was also konnten sie noch tun? Die Möglichkeiten für unsere Familie waren, positiv ausgedrückt, begrenzt. Den Taliban schien es mit uns recht ernst zu sein, und sie hatten Verbindungen in ganz Afghanistan. Deshalb sind meine Eltern mit meiner jüngsten Schwester Khaledeh und den beiden Kleinen, Hesam und Ramin, durch die Berge und die Wüste ein Monat lang zu Fuß von Kabul nach Teheran in den Iran geflohen.
Als sie endlich angekommen waren, machten sie sich große Hoffnungen. Sie waren froh, in einem Land zu sein, in dem die Religion und die Sprache fast dieselben wie vor der Flucht waren. Sie dachten: »Hier werden unsere Kinder eine bessere Zukunft haben. Alles wird gut.«
Mahbobeh blieb verschwunden.
Bitteschön, hier bin ich!
»Woher kommst du eigentlich?«
Ach ja, die Sache mit der Herkunft.
a) Meinst du, wo ich geboren wurde? Das war im Iran.
b) Meinst du, zu welcher Kultur ich gehöre? Afghanistan.
Oder c), meinst du, was auf meiner Geburtsurkunde steht?
Dann bin ich gar nichts. Ein Schatten. Staatenlos. Ich habe keine Geburtsurkunde. Wurde niemals offiziell registriert. Wie mein Bruder Edris, der zwei Jahre vor mir und direkt nach unserer Flucht geboren worden war. Auf Farsi gibt es für etwas wie uns ein Sprichwort.
Tschub-e do sar gohi.
Stock, an beiden Enden beschissen.
Keine Seite ist mehr deine Heimat. In Afghanistan verfolgt, im Iran verhasst. Wir waren nun bloß Fremde, bloß ein Stück oder ein Stock in der wabernden und klebrigen Masse illegaler Afghanen, denen es genauso ging wie uns, und von denen sowieso ein paar Millionen zu viel am Leben waren, wenn du den durchschnittlichen Teheraner auf der Straße gefragt hättest. Kein Krankenhaus und keine Hebamme konnten wir uns leisten. Das Hinterzimmer unserer engen Wohnung in Teheran war der einzige Geburtshelfer. Aber immerhin: Meine Mutter behauptet felsenfest, es habe am Tag meiner Geburt geschneit. Schnee im Iran? Das ist doch zumindest etwas, oder? #DingeFürDenLebenslauf
Ich wurde nie zum Flüchtlingskind.
Ich war immer ein Flüchtlingskind.
Ich war schon als Flüchtlingskind geboren worden.
Born to flee.
Die kleine Wohnung hatten wir überhaupt nur über eine Tante von mir bekommen, die offizielle Papiere im Iran besaß und somit einen Mietvertrag abschließen durfte. Niemand in unserer Familie hatte legale Aufenthaltsdokumente für den Iran. Deshalb hätten wir selbst, wir als Afghanen nicht einmal einen Platz zum Schlafen mieten dürfen. Nur auf dem Schwarzmarkt, wo du den dreifachen Mietpreis zahlen musst. Die wissen schließlich, dass du keine andere Wahl hast. Aber das musst du dir als Flüchtlingsfamilie mit kleinen Kindern und alten Eltern erstmal leisten können.
Warum erzähle ich dir das alles? Nicht, damit du Mitleid hast. Nicht, damit du sagst: »Oh, du armes Flüchtlingskind!« Vielen Menschen auf der Welt geht es gleich oder schlechter. Auch andere Menschen müssen leiden, flüchten, sterben. Ertrinken. Ich erzähle dir das nur, damit du verstehst, woher ich komme. Das mit der Herkunft halt.
Meine jüngste Schwester Khaledeh, die mit meinen Eltern und meinen Brüdern in den Iran geflohen ist, hat auch geheiratet. Ihr Mann war der Sohn meiner Tante, die für uns die Wohnung gemietet hat. Khaledeh ist bald darauf mit unserer Tante und ihrer neuen Familie zurück nach Afghanistan gezogen. Sie hatte ja nun einen, der sein »mein« vor sie setzte. Und ab da waren meine Eltern auf sich gestellt. Sie mussten sich eine eigene Wohnung und eine eigene Arbeit suchen, und eine Schule für uns Brüder.
Da wir allerdings keine Aufenthaltspapiere bekamen, konnten wir auch keine offizielle Schule besuchen und durften nichts lernen. Das ist Teil des Teufelskreises für Afghanen, die im Iran als Flüchtlinge leben und keine Dokumente erhalten. In dieser Zeit, als wir auf uns gestellt waren, ist uns auch immer mehr bewusst geworden, wie teuer das Leben im Iran für illegale Flüchtlinge ist. Als Afghane ohne Aufenthaltsgenehmigung ist so ziemlich alles unleistbar für dich. Wir mussten beispielsweise für Medikamente oder im Krankenhaus den doppelten Preis zahlen, weil wir Afghanen waren. So war es auch bei Miete, Kaution oder Betriebskosten für die Wohnung. Die Leute wussten, dass wir keine andere Wahl hatten. Wir mussten alles schwarz bezahlen, weil wir keine Rechte hatten. Aus diesem Grund hörte mein ältester Bruder Hesam im Schuhgeschäft auf und fing in einer Tischlerei an. Dort stellten sie hauptsächlich Sofas her, und Hesam verdiente mehr als vorher.
Ich bekam als kleines Kind von alldem noch nicht viel mit. Ich liebte es, rauszulaufen vors Haus und mit den anderen Jungs auf den weiß-schwarzen Lederball einzudreschen, der mit dem Älterwerden nur noch ein Drittel so groß, dann nur mehr ein Viertel so groß, dann schließlich nur noch ein Fünftel so groß wie ich war. In den umliegenden Wohnungen lebten dicht an dicht viele andere afghanische Familien. Viele von ihnen hatten keine Papiere, so wie wir. Wir hatten offiziell keine Rechte im Iran und würden mangels Papieren auch nie Rechte erhalten. Aber wir waren vorerst in Sicherheit. Hier gab es keine Leute, die dich oder dein Haus in die Luft sprengen wollten. Hier gab es keine Männer, die dich oder deine Schwester am helllichten Tag entführen. Hier konnten wir überleben, trotz aller sozialen oder wirtschaftlichen Nachteile.
Schließlich wurde ich sieben Jahre alt. In diesem Alter beginnen Jungs normalerweise, in die Schule zu gehen. Da wir schon seit etwa zehn Jahren im Iran gelebt hatten und ich im Iran geboren worden war, machte meine Mutter sich große Hoffnungen, dass ich aufgenommen werde. Sie wollte, dass zumindest ihr jüngstes Kind eine Schulbildung erhielt. Aber die Schule lehnte uns ab, da wir weiterhin keine offiziellen Dokumente besaßen. Meine Mutter durfte mich nicht anmelden. Voller Enttäuschung machten wir uns auf den Heimweg. Ich weiß noch, dass meine Mutter am Weg nach Hause nur geweint und geweint und geweint hat.
»Warum weinst du, Madar-jan?«
Ich hab das alles nicht verstanden:
Ich kann die Sprache perfekt sprechen.
Ich wurde in diesem Land geboren.
Meine Brüder und mein Vater arbeiten in diesem Land.
Und trotzdem darf ich die Schule nicht besuchen?
Wir wohnen am selben Ort.
Wir haben dieselbe Regierung.
Wir haben dasselbe Aussehen.
Und trotzdem darf ich die Schule nicht besuchen?
Wir haben denselben Glauben.
Wir haben dieselbe Religion.
Wir haben den gleichen Gott,
denselben Propheten
und den Koran.
Und trotzdem darf ich die Schule nicht besuchen?
Diese Frage beschäftigte damals meinen kleinen Kopf.
Diese Frage beschäftigt heute meinen etwas größeren Kopf.
Noch 8 Kapitel bis zum Mittelmeer
»Dorut, Fare-jan!«
Faredin war mein Nachbar.
Faredin war mein bester Freund.
Faredin war mein Einstieg in die Kinderarbeit.
Wir trafen uns oft und spielten am Abend zusammen Fußball. Zuerst hatte er Angst vor den älteren Jugendlichen in unserer Gasse, und deshalb kam er nicht gerne, wenn sie spielten. Wir lernten uns besser kennen, und nach einiger Zeit verlor Faredin auch seine Angst vor den älteren Jungs. Er war dann immer dabei und spielte mit uns, meistens in meiner Mannschaft.
Nachdem ich an der offiziellen, iranischen Schule abgelehnt worden war, war meinen Eltern klar, dass ich eine Alternative brauchte. Dass wir eine Alternative brauchten, eine finanzielle. Deshalb entschieden sie, dass ich auch arbeiten gehen sollte. Damals war ich sieben Jahre alt.
»RABENELTERN!«, schreist du jetzt vielleicht die Buchstaben vor dir an, »ENTSETZLICH! Einen Siebenjährigen arbeiten schicken!«
Ja stimmt, Sherlock Holmes, nicht ideal. Aber was ist besser für unseren hochverehrten Herrn Kindeswohl:
a) untertags Geld verdienen und dafür als Familie Essen und ein Dach über dem Kopf genießen oder
b) gelangweilt zu Hause sitzen, ohne Bildung, die Wucher-Miete nicht mehr zahlen können, obdachlos werden, und in Kriminalität und Drogenmissbrauch abrutschen wie ein großer Teil der ärmeren Jugendlichen im Iran?
Manchmal muss man sich im Leben zwischen zwei Übeln entscheiden. Manchmal kannst du nur zwischen Scheiße und Gülle wählen. Und heute denke ich, dass meine Eltern das geringere Übel gewählt haben, zum Wohl der Familie und deshalb auch zu meinem Wohl. Damit ich die Chance auf eine bessere Zukunft haben darf. Als ich Faredin erzählte, dass ich arbeiten muss, reagierte er recht gelassen.
»Du kannst mit mir kommen. Ich zeig dir alles.«
Das hat Fare-jan mehr im Spaß gemeint. Er dachte, ich mache wie immer nur einen Scherz. Ich mach nämlich oft Scherze. Heute noch. Fällt dir das auf? Meine Verlobte verdreht dann meistens die Augen, weil sie die Witze so blöd findet. Na ja. Als ich jedenfalls am nächsten Morgen wirklich vor Faredins Haustür stand, nahm er mich ernst. Wir fuhren also mit dem Bus zum ersten Mal gemeinsam los.
Als illegaler, afghanischer Flüchtlingsjunge im Iran hast du meistens nur eine Möglichkeit zu arbeiten: Verkauf etwas auf der Straße. Du kannst Kaugummis verkaufen, Schuhe putzen oder mit einer Waage am Wegrand sitzen und den Leuten anbieten, dass sie sich für ein paar Cent wiegen dürfen. Oder du verkaufst Fal-E, also sowas wie Omen. Das habe ich am Anfang gemacht, als mich Faredin mitgenommen hat. Fal-E sind im Iran beliebt. Das sind kleine Zettel in bunt gestalteten Umschlägen, auf denen ein Spruch aus persischen Gedichten für deine Zukunft steht. So ähnlich wie bei chinesischen Glückskeksen. Aber es steht immer etwas Positives drauf, damit die Leute es kaufen wollen. Und es muss möglichst allgemein formuliert sein, zum Beispiel: »Du bist eine nette Person, und du wirst viel schaffen« oder »Du wirst heiraten und bis dahin einige Schwierigkeiten überwinden«.
Mit dem Bus fuhren wir immer in der Früh los. Ins reiche Viertel. Dorthin brauchten wir pro Strecke so zwei bis drei Stunden. Wenn es keinen Stau gab und nicht so viele Leute unterwegs waren, dann waren wir schneller. Aber in Teheran sind die Busse immer überfüllt. Deshalb mussten wir bei fast jeder Haltestelle zehn Minuten warten, bis alle Leute aus- und eingestiegen waren. So ähnlich wie bei diesen Bildern von vollen Bussen und Zügen in Indien, die man im Internet oder in Schulbüchern sieht. Und einmal in der Woche mussten wir vorher noch zum Bazar fahren, um neue Fal-E zu kaufen, das dauerte dann noch länger.
Im reichen Viertel sind die Leute reich. Ja, ich weiß, kommt jetzt überraschend, die Aussage. Aber sie ist nichtsdestotrotz eine wichtige und uralte Erkenntnis für alle Straßenverkäufer. Dort sind viele Menschen, die Eis essen gehen, im Café sitzen und lesen oder in die Einkaufszentren shoppen gehen. So ähnlich wie hier bei uns. Denen kannst du viel verkaufen. Wir wechselten immer wieder unseren Standort. Meistens waren wir in Tehranpars-falak-e-aval, in Do oder Seh unterwegs, das sind die besseren Stadtviertel.
Ich hatte natürlich Angst, viel Angst vor dieser großen Gesellschaft und der Arbeit. Meine Mutter war auch jeden Tag nervös, ob ich am Abend wieder nach Hause komme. Es war gefährlich, weil die Polizei oft kontrolliert und Kinder erwischt hat, die nicht schnell genug weggelaufen sind. Außerdem wusste ich in der ersten Woche nicht, was ich machen soll, damit die Leute meine Fal-E kaufen. Faredin gab mir Tipps: »Du musst an den Leuten kleben und mitgehen, bis sie ein Fal-E von dir kaufen. Und du musst möglichst arm tun, ›Oh, ich hab nichts zu essen‹ und so.« Wir verkauften aber nicht nur Fal-E. Je nach Jahreszeit mussten wir die Waren wechseln. Im Winter verkaufst du besser Handschuhe, Hauben und Schals, im Sommer eher T-Shirts. In diesen Wochen und Monaten als Siebenjähriger habe ich gelernt, wie alles funktioniert in dieser Welt der Kinderarbeit.
Faredin passte immer auf mich auf. Er war ein bisschen älter und stärker als ich. Trotzdem gab es immer wieder Jugendliche, die unsere Waren oder unser Geld gestohlen haben. Sie kamen zum Beispiel zu dritt mit einem kleinen Messer und sagten: »Gib mir dein Geld!« Dagegen konnten wir nichts tun, wir konnten ja nicht zur Polizei gehen.
Außerdem wurde die Polizei selbst zu unserer größten Bedrohung. Je älter ich wurde, desto schwieriger war die Situation für mich. Wir Afghanen mussten immer weglaufen und uns verstecken, wenn die Polizei vorbeifuhr. Wir wussten: Wenn sie uns erwischen, sind erstens unsere Waren und zweitens unser Geld weg. Und wenn du älter bist und keine Dokumente hast, wirst du sofort nach Afghanistan abgeschoben. Deshalb versteckte ich mich immer, wenn die Polizei kam, in der Nähe hinter einem Baum oder unter einem Auto.
Wir hatten auch immer mehr Konflikte mit den Geschäftsleuten dort. Sie sahen ordentlich und gepflegt aus, also so mit Jeans und sauberen T-Shirts oder Hemden. Das waren meistens jüngere Männer so zwischen fünfundzwanzig und vierzig Jahren. Sie mochten es nicht, wenn wir vor ihren Geschäften Waren verkauften. Klar, wenn du dieselben Produkte wie die Geschäftsleute verkaufst, nur billiger, dann haben sie damit keine Freude. Wenn du klein bist, finden sie dich nur arm. Wenn du größer wirst, sehen sie dich als Konkurrenz. Das war schon immer so: Je größer du wirst, desto größer werden die Probleme. Die wachsen mit dir.
»Verschwindet, ihr Scheißstraßenköter!«
Oft beschimpften sie uns, wollten uns schlagen oder riefen die Polizei.
a) Was, glaubst du, haben wir Intelligenzbestien dann gemacht? — Genau! Wir haben aus dem Biomüll Tomaten oder Bananen oder alte Wasserflaschen genommen, auf die Auslage geworfen und sind weggelaufen.
b) Aber was, glaubst du, war dann für uns Intelligenzbestien das Problem? — Richtig! Wir konnten dort nichts mehr verkaufen. Sonst hätten wir richtig Ärger mit den Geschäftsmännern und der Polizei bekommen.
c) Und, glaubst du, haben wir Intelligenzbestien es trotzdem immer wieder getan? — Auf jeden Fall.
Und noch eine geniale Idee, die nur zwei speziellen Idioten wie uns einfallen konnte: Wir verkauften billige USB-Ladegeräte für Handys. Aber nicht einfach irgendwelche, sondern kaputte. Ein Bekannter von uns sammelte die in seinem Geschäft in einer großen Plastiktonne und gab sie uns fast gratis. Wir postierten uns an einer Ecke oder ein wenig abseits einer Einkaufsstraße und verkauften sie an die Passanten. Warum ein wenig abseits der Einkaufsstraße? Eigentlich unlogisch, weil dort weniger Kunden sind. Aber wir wollten vorsichtig sein, damit sie die Ladegeräte nicht sofort auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen konnten. Nach ein bis zwei Stunden wechselten wir den Standort und zogen ein paar Straßen weiter, damit uns die bald wütenden Kunden nicht mehr finden konnten. Wenn uns doch jemand wiedererkannte, dann hieß es: Lauf, so schnell dich deine betrügerischen Kinderbeine tragen!
Eines hat sich mir von damals noch eingebrannt, da war ich zehn oder elf. Von ihr habe ich mir einige Jahre danach ein Tattoo auf meinen rechten Fuß stechen lassen, das habe ich heute noch. Das war, bevor Banksy sein weltberühmtes Bild von ihr gekritzelt hat. Eines Tages war sie nämlich da und stand neben mir mit ihren Luftballons, die sie auf Plastikstangen gesteckt verkaufte. Sie war vier oder vielleicht fünf Jahre alt, auch aus Afghanistan. Und auch keine legalen Papiere. Sie hatte ein Kleidchen und eine Jeans an, aber ich sah, dass beides alt und dreckig war. Und sie hatte lange Haare, die sie aber nie unter ihrem Kopftuch versteckte. Ich glaube, sie hieß Mariam.
»Steh nicht neben mir«, sagte ich zu Mariam. »Was ist, wenn die Polizei kommt, und sie denken, dass du meine Schwester bist, und dich mitnehmen? Steh lieber hundert Meter weiter weg. Wenn die Polizei aus meiner Richtung kommt, dann warne ich dich, und wir laufen gemeinsam weg. Wenn die Polizei aus deiner Richtung kommt, dann machst du dasselbe für mich.«
Wir waren bald gute Freunde. Ich wollte auf Mariam aufpassen, damit ihr niemand etwas Böses tut. So wie Faredin auf mich aufgepasst hat, als ich neu war. Ich hatte schon einige Jahre Erfahrung, deshalb konnte ich Mariam manches über das Verkaufen beibringen. Und immer, wenn gerade wenig Leute auf der Straße unterwegs waren, kam sie wieder zu mir, und wir redeten.
Mariam hat gesagt, ihr Vater sei drogensüchtig.
Mariam hat gesagt, ihre Mutter sei krank.
Mariam hat nicht gesagt, welche Krankheit.
Mariam hat nicht gesagt, vielleicht Diabetes?
Mariam hat gesagt, sie ginge oft ins Krankenhaus.
Mariam hat gesagt, sie müsse für Madar-jan Tabletten holen.
Mariam hat gesagt, auch irgendwelche für den Vater.
Mariam hat nicht gesagt, ob Padar-jan auch krank sei.
Mariam hat gesagt, sie habe ein jüngeres Geschwisterchen.
Mariam hat gesagt, ein Baby.
Mariam hat nicht gesagt, wie ihr Vater die Drogen bezahlt.
Mariam hat nicht gesagt, wie ihre Wohnung aussah.
Mariam hat nicht gesagt, ob sie überhaupt noch Möbel hatten.
Mariam hat nicht gesagt, ob sie überhaupt ein Bett hatte.
Mariam hat gesagt, ihr Vater schlage sie.
Mariam hat nicht gesagt, sie laufe oft von zu Hause weg.
Mariam hat gesagt, sie bringe zu wenig Geld nach Hause.
Mariam hat gesagt, sie arbeite laut ihrem Vater zu wenig.
Mariam hat gesagt, sie spiele nur laut ihrem Vater.
Mariam hat gesagt, sie solle sich konzentrieren.
Mariam hat gesagt, sie wolle nicht zurück nach Hause.
Mariam hat gesagt, sie hasse diese Welt.
Mariam hat gesagt, sie wolle wegfliegen.
Mariam hat gesagt, mit ihren Ballons.
Mariam hat gesagt, sie hasse sie.
Mariam hat gesagt, diese Welt.
Mariam hat gesagt, sie wolle weg von dieser Welt.
Mariam hat gesagt, sie hasse diese Welt.
Mariam hat gesagt, sie wolle weg von der Kinderarbeit.
Mariam hat gesagt, sie hasse diese Welt.
Mariam hat gesagt, sie wolle weg von allem.
Mariam hat gesagt, sie hasse diese Welt.
Mariam hat gesagt, sie wolle weg.
Mariam hat gesagt, sie wolle weg.
Mariam hat gesagt, sie wolle weg.
Mariam hat gesagt, sie wolle weg.
Mariam hat gesagt, sie wolle weg.
Mariam hat gesagt, sie wolle weg.
Mariam hat gesagt, sie wolle weg.
Faredin und ich haben begonnen, Besteck und Geschirr zu verkaufen. Deshalb mussten wir das Viertel wechseln. Mariam blieb. Nach einigen Monaten kamen wir wieder an den Ort zurück. Mariam war weg. Ich fragte die Leute dort, was mit ihr passiert sei, suchte nach ihr und ihrer Familie. Aber niemand hat je mit ihr gesprochen, niemand hat auf sie geachtet, und niemand hat etwas gewusst.
Mariam war weg.
Einfach weg.
Weg.
Noch 7 Kapitel bis zum Mittelmeer
Eine Sache war am schlimmsten.
Als ich auf der Straße gearbeitet und Hunger gehabt habe und in schmutziger Kleidung herumstehen musste, damit ich meiner Familie Geld bringen konnte, gab es etwas, das war am schlimmsten für mich. Ich sah immer, wie manche Mütter ihre Kinder von der Schule abholten. Die hatten Schultaschen und eine Uniform und aßen manchmal Eis oder hielten ein Getränk in der Hand. Das Eis oder das Getränk war mir nicht wichtig, das hätte ich mir auch hin und wieder leisten können. Aber was mich gestört hat:
»Fare-jan?«
»Hm?«
»Warum dürfen sie in die Schule gehen und ich nicht?«
Obwohl das der größte Wunsch meiner Eltern war, und mein größter Wunsch. Ich wollte zwar meine Familie finanziell unterstützen, aber ich wollte nicht mein Leben lang Analphabet bleiben wie meine Mutter. Durch viel Nachfragen unter Freunden und Bekannten fand ich schließlich eine versteckte, afghanische Schule. Dort konnte ich gegen Bezahlung lernen. Aber es war keine große Schule. Unser Direktor, Herr Akbari, hatte einfach ein Haus mit ein paar Zimmern gemietet, wo afghanische Kinder lesen und schreiben lernen konnten. Leider wurde das Zeugnis von dieser Schule nirgends anerkannt. Die Schule selbst musste versteckt bleiben und war illegal. Ich war trotzdem überglücklich und dankbar, dass ich endlich auch Unterricht haben durfte.
Das Problem war, dass die Polizei nach einigen Monaten immer wieder vorbeikam und unsere Schule zusperrte. So hatten wir »frei«, bis Herr Akbari wieder ein Haus für uns gefunden hat, das wir als inoffizielle Schule benutzen konnten. Es war natürlich nicht leicht, ein Gebäude zu finden. Denn Herr Akbari musste den Vermietern viel Geld zahlen, damit diese erlaubten, dass seine kleine Schule dort stattfinden durfte. Noch dazu illegal. Und noch dazu Afghanen. Aus diesem Grund mussten wir Schülerinnen und Schüler auch viel zahlen, damit wir den Unterricht weiter aufrechterhalten konnten. So bekam ich das, was ich verdient habe, von meinen Eltern als Taschengeld zurück und zahlte es an die Schule. Meine Mutter war unendlich stolz auf mich, dass ihr kleiner Junge doch noch in eine Schule gehen konnte.
Aber es gab auch Konflikte. Ich konnte die feinen Jungs nie verstehen. Sie sind ihr Leben lang in die Schule gegangen und im Wohlstand aufgewachsen. Rückblickend war auch ich es manchmal, der sie provoziert hat. Damals fragte ich mich: Warum wollen die mir oder meinen Freunden beweisen, dass sie stärker sind als wir? Deshalb gab es auf der Straße oft Schlägereien zwischen uns. Irgendjemand ist immer mit einem Gesicht voller Blut nach Hause gekommen. Manchmal die anderen. Manchmal wir. Doch es war ein geiles Gefühl, etwas zu gelten. Endlich mal in etwas ebenbürtig zu sein mit denen, die alles im Leben hatten. Und nicht schon als Flüchtlinge geboren worden waren, so wie ich.
Bei diesen Schlägereien waren die Gegner meist gleich alt. Wir trafen uns für gewöhnlich nach der Schule auf der Straße. Meistens ging es los, weil einer zugeschlagen hat, dann hat der andere zurückgeschlagen. Und dann kommen die Freunde der einen Person und die der anderen, und dann wird daraus eine Gruppenschlägerei. Aber das musst du dir alles sehr schnell vorstellen, das dauert nicht stundenlang. Sobald du das Gefühl hast, dass der Gegner verletzt ist, läufst du weg. Meine Mutter musste sich danach immer bei den Eltern der anderen Kinder entschuldigen, dass ich so schrecklich sei und dass es ihr so leidtue: »Mahzerat mikham, das wird nie wieder vorkommen!«
Je größer ich wurde, desto größer wurden auch die Schlägereien. Ich war mit einigen der wildesten Iraner der Gegend unterwegs und ständig in Streitereien in den Gassen und Winkeln der Stadt verwickelt. Dort funktioniert das zwischen den Familien. Dort rufst du keine Polizei. Dort rufst du nur mehr Leute. In gewisser Weise wirkten wir gegen die ethnische Ungleichheit: Wir verprügelten sowohl Afghanen als auch Iraner, sowohl Paschtunen als auch Tadschiken. Und wir wurden verprügelt, sowohl von Afghanen als auch Iranern, sowohl von Paschtunen als auch Tadschiken. Wir provozierten Proleten wie Straßenkinder. Wir gaben Armen wie Reichen eins auf die Fresse, und Arme und Reiche gaben uns eins auf die Fresse. Sich beweisen — eine Dummheit, die Herkunft überdeckt. Sogar viele Afghanen in der Schule oder in meinem Viertel hatten Angst vor uns. Meine Brüder Edris und Ramin hatten zwar auch Kontakt zu der Gruppe gehabt, aber sie gingen rasch auf Distanz. Ich nicht. Manchmal prügelten wir uns. Manchmal verarschten wir andere. Manchmal spielten wir aber auch einfach Volleyball. Ja, sogar wir waren ab und zu friedlich.
Zu dieser Zeit hatte sich mein ältester Bruder Hesam selbstständig gemacht. Hesam war schon immer derjenige, dem zu jeder Zeit sieben neue Geschäftsideen im Kopf herumschwirrten. Er gründete mit einigen iranischen Freunden eine kleine Möbelfirma. Ramin und Edris begannen auch dort zu arbeiten. Damals ging es uns finanziell eine Zeit lang etwas besser. Trotzdem lebten wir mit dem Risiko, dass wir jederzeit nach Afghanistan abgeschoben werden konnten. Meine Mutter ist deshalb nach Afghanistan gefahren, um unser zerbombtes Haus wiederaufzubauen. Falls wir abgeschoben würden, hätten wir sonst wieder nichts. Natürlich war das ein Risiko für meine Mutter. Bei unserer Verabschiedung am Busterminal weinte ich, weil ich Angst um sie hatte. Ein Mann soll nicht weinen? Scheiß drauf, wenn deine Mutter nach Afghanistan geht, dann darfst du weinen. Zumindest war sie nicht allein, zwei entfernte Verwandte begleiteten sie. Sie hoffte, dass nach zehn Jahren schon genug Zeit vergangen war, dass die Gefahr nicht mehr so groß war, und es wäre ja nur für ein paar Wochen. Mit dem Geld, das wir hatten, konnte sie dort einige Tagelöhner bezahlen, mit denen sie die halb zerstörten Wände wiederaufbaute.
Wichtig war für uns, dass sie dort einen afghanischen Reisepass ergattern konnte. Das war ein Glücksfall für mich. Bei der afghanischen Botschaft im Iran konnten wir mit einer hohen Summe einen Beamten bestechen, damit mein Foto auf den Reisepass meiner Mutter dazugeklebt wurde. Dadurch konnte ich mich bei der iranischen Schule anmelden. Es war allerdings ein großes Risiko für mich: Falls jemand draufkommen sollte, dass mein Foto erst nachträglich hinzugefügt worden ist, würde ich wieder große Probleme mit der Polizei bekommen. Ich hatte Glück: Ich wurde schließlich an der iranischen Schule angenommen.
Der Stoff dort war schwer für mich, aber zumindest konnte ich bereits lesen und schreiben. Obwohl ich nebenbei arbeiten musste, schaffte ich es, die Schuljahre erfolgreich abzuschließen. Erfolgreich heißt nicht, dass ich die besten Noten hatte. Erfolgreich heißt, dass ich nicht durchgefallen bin und Vierer oder sogar Dreier geschafft habe. In den drei Monaten Ferien nach der Notenvergabe fuhren die meisten Kinder auf Urlaub. Ich ging im Sommer wieder zu Faredin auf die Straße und arbeitete weiter für mein Schulgeld und die Familie.
Aber auf der Straße haben wir zunehmend Scheiße gebaut. Fare-jan war auch mit uns unterwegs eines Abends, da kam Najib mit Tabletten daher. Meinte, er habe die schon öfter genommen, die seien einwandfrei.
»Richtig geil, du wirst lustig, bist gut drauf«, meinte er.
Und wir? Was sonst: »Komm, machen wir!«
So flanierten wir in den Park. Tramadol hieß das Zeug. Schmerztabletten. Die kannst du pulverisieren und konzentrieren. Dann hast du die hundert- oder tausendfache Wirkung, je nachdem, wie viel Geld du bei den Dealern einwirfst. Najib, Fare-jan und ich schluckten je eine Tablette. Warteten eine Minute. Fünf Minuten. Eine Viertelstunde. Die anderen beiden waren schon high.
»Ich spür nichts, gib mir mehr«, forderte ich von Najib.
Ich war zu high, um die Drogen zu fühlen. Er war zu high, um mich auf die verzögerte Wirkung hinzuweisen. Najib reichte mir wortlos die Packung. Und ich warf gleich noch zwei Stück von dem Zeugs ein. Ja, ich hab wie immer die besten Ideen.