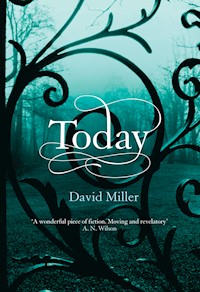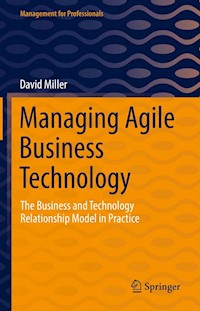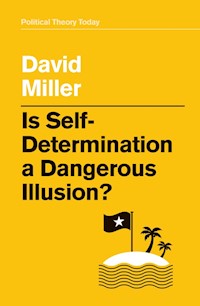21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Thema Einwanderung wirft gewichtige gesellschaftspolitische, moralische und ethische Fragen auf. David Miller bezieht eine Position zwischen einem starken Kosmopolitismus, der für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und offene Grenzen plädiert, und einem blinden Nationalismus, der oft in pauschale Ausländerfeindlichkeit und dumpfen Rassismus umschlägt. In ständiger Auseinandersetzung mit Gegenargumenten entwickelt er seinen Standpunkt, der die Rechte sowohl der Immigranten als auch der Staatsbürger berücksichtigen soll. Ziel von Millers Ausführungen ist eine Immigrationspolitik liberaler Demokratien, die so gerecht ist wie möglich und so realistisch wie nötig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
3David Miller
Fremde in unserer Mitte
Politische Philosophie der Einwanderung
Aus dem Englischen von Frank Lachmann
Suhrkamp
5Für Margaret, in Liebe
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
7Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Eins Einleitung
Zwei Kosmopolitismus, landsmännische Parteilichkeit und Menschenrechte
Drei Offene Grenzen
Vier Geschlossene Grenzen
Fünf Flüchtlinge
Sechs Wirtschaftsmigranten
Sieben Die Rechte der Einwanderer
Acht Einwanderer integrieren
Neun Schluss
Nachtrag:Die europäische Migrationskrise des Jahres 2015
Danksagung
Register
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
317
318
319
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
333
335
336
265
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
Eins
9Einleitung
Dies ist ein Buch über Einwanderung – darüber, wie wir über sie nachdenken und wie wir mit ihr umgehen sollten. Sollten wir Immigranten dazu ermuntern, in unsere Gesellschaften zu kommen, oder versuchen, sie fernzuhalten? Wenn wir einige von ihnen aufnehmen, andere aber abweisen, wie sollten wir dann darüber entscheiden, welche von ihnen wir aufnehmen? Oder hat ohnehin jeder prinzipiell ein Menschenrecht darauf, ins Land zu kommen? Was dürfen wir von den Immigranten verlangen, wenn sie einmal da sind? Sollte man von ihnen erwarten, dass sie sich assimilieren, oder dürfen sie mit Recht verlangen, dass wir Raum für die anderen Kulturen schaffen, die sie mit sich bringen? Und so weiter.
Viele stellen heute diese Fragen. Einwanderung ist zu einem heißen politischen Thema geworden, besonders in den westlichen liberalen Demokratien, in denen die Bürger oft das Gefühl haben, sie hätten keinen Einfluss mehr auf die Wanderungsbewegungen, die sich über die Grenzen der Staaten hinweg ereignen, in denen sie leben. Zudem ist sie ein hochgradig kontroverses Thema. Die Öffentlichkeit ist im Allgemeinen über die Folgen der Einwanderung besorgt und viel eher einer Senkung statt einer Erhöhung der Zahl der Neuankömmlinge zugeneigt. Allerdings bestehen diesbezüglich erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Nationen. In den europäischen Gesellschaften gibt es große Mehrheiten für eine verringerte Einwanderung. So kam eine Ende 2013 in Großbritannien durchgeführte Meinungsumfrage zu dem Ergebnis, dass 80 Prozent der Befragten die Nettozuwanderungsrate als zu hoch empfanden, dass 85 Prozent Einwanderung als zu große Belastung für die öffentlichen Dienstleistungen wie 10Schulen, Krankenhäuser oder das Wohnungswesen betrachteten und dass 64 Prozent der Meinung waren, die Zuwanderung des vergangenen Jahrzehnts habe der britischen Gesellschaft insgesamt nicht gutgetan.1 Sogar das seit langer Zeit etablierte Prinzip der Bewegungsfreiheit innerhalb Europas gerät zunehmend unter Druck. Eine 2014 in der Schweiz durchgeführte Volksabstimmung hatte zum Ergebnis, dass sich eine knappe Mehrheit der Stimmberechtigten für eine numerische Deckelung aller Arten von Einwanderung, auch aus Ländern der Europäischen Union, aussprach.2 Die öffentliche Meinung in den USA ist zwischen Zuwanderungsbefürwortern und -gegnern dagegen eher zweigeteilt. Im Jahre 2013 wollten 40 Prozent die Einwanderung auf dem bisherigen Stand halten, 35 Prozent wollten einen Rückgang und 23 Prozent ihre Zunahme – allerdings hat sich die Zahl derer, die weniger Einwanderer haben wollen, im letzten Jahrzehnt insgesamt immer zwischen 40 und 50 Prozent bewegt.3
Kritiker werden die Aussagekraft solcher Zahlen in Zweifel ziehen und anführen, dass die Menschen sowohl über die Zahl der ankommenden Einwanderer als auch über die Folgen der Einwanderung schlecht informiert sind. Was die Öffentlichkeit gern außer Acht lässt, ist besonders der wirtschaftliche Nutzen, den die Einwanderer mit sich bringen, sowie ihre Bereitschaft, wichtige Arbeitsplätze (wie etwa in der Landwirtschaft oder in der Altenpflege) zu besetzen, die nur wenige Einheimische anzunehmen bereit sind. Diese Kritiker werden außerdem darauf hinweisen, dass Einwanderer zu Sündenböcken für alle möglichen gesellschaftlichen Probleme wie etwa Wohnungsknappheit und schlechte Schulen gemacht werden, die wenig bis nichts mit der Einwanderung als solcher zu tun haben. Zudem stoßen wir häufig auf die Ansicht, dass eine einwanderungskritische Haltung sich letztlich aus Vorurteilen oder schlichtem Rassismus speise.
Die öffentliche Debatte über Einwanderung trägt also zwar wesentlich zur Erhitzung der Gemüter, aber kaum zur Erhellung der Lage bei. Einige Beobachter aus dem akademischen Bereich sind der Meinung, dass die Aufmerksamkeit, die der Einwanderung im Augenblick gewidmet wird, übertrieben sei. Es wird be11hauptet, Einwanderung sei einfach ein notwendiger Bestandteil des viel umfassenderen Prozesses der Globalisierung. Wir leben in einer Welt, die durch stetig anschwellende Kapital-, Güter-, Dienstleistungs- und Kommunikationsströme über nationale Grenzen hinweg gekennzeichnet ist – Ströme, deren Auswirkungen im Allgemeinen vorteilhaft sind. Wenn aber alles andere im Fluss ist, werden sich auch die Menschen bewegen. Und in der Tat müssen sie sich sogar bewegen, weil die anderen Bestandteile der Globalisierung nicht wirksam werden können, solange sie es nicht tun. Arbeitskräfte müssen sich zu den Büros und Fabriken begeben, wo ihre Fähigkeiten benötigt werden, Studierende zu den Universitäten, an denen Spitzenforschung betrieben wird, Unterhaltungskünstler an die Orte, an denen ihr Publikum auf sie wartet, und so weiter. Manche mögen nur vorübergehend ihren Aufenthaltsort wechseln, andere werden sich zum Bleiben entschließen. Die Frage, der wir uns widmen sollten, ist demnach nicht so sehr die, wie die Einwanderung durch eine Begrenzung der Zuzugszahlen kontrolliert werden könnte, sondern die, wie wir sie möglichst reibungslos und effizient gestalten können.
Eine andere skeptische Position besagt, dass es in der Geschichte immer wieder zu Bevölkerungsbewegungen gekommen ist und die weit überwiegende Zahl der Menschen nach wie vor in den Ländern leben, in denen sie geboren wurden, auch wenn die Zahlen der Auswanderer in den letzten Jahrzehnten größer geworden sein sollten. 2013 gab es 231 Millionen Migranten weltweit, was etwa drei Prozent der Weltbevölkerung entsprach.4 Diese Zahl verschleiert zugegebenermaßen einige große Unterschiede – so besteht, um ein Extrembeispiel zu nennen, die Bevölkerung des Emirats Katar zu bis zu 70 Prozent aus Einwanderern, die 94 Prozent der Erwerbstätigen ausmachen5 –, aber in den meisten Gesellschaften stellen Einwanderer nur einen kleinen Bruchteil der Gesamtbevölkerung dar. Warum also die ganze Aufregung?
Das Problem dabei, die Angelegenheit auf diese Weise herunterzuspielen, besteht darin, dass dieses Vorgehen auf einer Momentaufnahme der gegenwärtigen Situation fußt, also von Umständen ausgeht, in denen Migration meist ziemlich streng re12guliert ist, und nicht berücksichtigt, was in Zukunft geschehen könnte, falls diese Regulierungen entschärft oder gänzlich aufgehoben werden sollten. Die Dynamiken der Einwanderung sind recht komplex. Eine neuere Studie von Paul Collier deutet darauf hin, dass, weil Migranten von denjenigen Orten angezogen werden, an denen sie sich einer Gemeinschaft früherer Einwanderer anschließen können, die ähnliche kulturelle oder nationale Hintergründe aufweisen wie sie, die Größe der Diaspora sowie die Geschwindigkeit, mit der sie sich in die Aufnahmegesellschaft integriert, wichtige Faktoren darstellen.6 Vergrößert sich nämlich die (nichtassimilierte) Diaspora, dann steigt ihre Anziehungskraft und die Einwanderungsrate wird dazu tendieren, sich unbegrenzt zu erhöhen, wenn es keine wirksamen Kontrollen gibt. Dieses Szenario geht natürlich davon aus, dass sich möglicherweise sehr viele Menschen dazu entschließen würden, in eine der entwickelten liberalen Demokratien zu kommen, wenn sie die Chance dazu hätten. Diese Annahme ist allerdings plausibel, angesichts der schieren Größe der ökonomischen Kluft zwischen den reichen und den armen Ländern sowie der Jahrzehnte, die es (mindestens) dauern wird, um sie signifikant zu verringern – und das selbst dann, wenn die Weltwirtschaftsordnung reformiert und arme Länder Strategien zur Wachstumsförderung erfolgreich implementieren würden. Befragungen von Gallup kommen zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass 38 Prozent der Bewohner des subsaharischen Afrikas und 21 Prozent der Bewohner des Mittleren Ostens und Nordafrikas gerne dauerhaft auswandern würden.7 Wollen wir also eine Diskussion über Einwanderung führen, bei der alle politischen Optionen auf dem Tisch liegen (inklusive »völlig offener Grenzen« als einer Extremposition), dann müssen wir dabei auch die Möglichkeit mit in Betracht ziehen, dass die Einwanderungsströme um ein Vielfaches größer sein könnten, als wir es zurzeit beobachten.
An dieser Stelle lohnt es sich, uns etwas genauer zu vergegenwärtigen, warum Einwanderung bereits in einem recht geringen Umfang die Aufnahmegesellschaften vor Probleme stellen kann. Für die Wählerinnen und Wähler ist sie eines der wichtigsten po13litischen Themen, die ihnen Sorgen bereiten, und skrupellose Politiker können durch das Versprechen auf eine immer schärfere Regulierung der Aufnahmepolitik, besonders, was illegale Einwanderung angeht, und der verschiedenen Sozialleistungsansprüche von Einwanderern massive Unterstützung gewinnen. Ein Teil dieser Reaktion wird zweifellos einfach nur Vorurteile und eine Sündenbockmentalität zum Ausdruck bringen; um allerdings ein vollständigeres Bild von den Schwierigkeiten zu bekommen, vor die die Einwanderung uns stellt, ist es sinnvoll, einen kurzen Abstecher in die Geschichte zu machen, wo wir uns ansehen können, wie sich das Verhältnis von liberalen Staaten und Migranten über die letzten paar Jahrhunderte hinweg gewandelt hat. Wir werden unsere eigene missliche Lage besser verstehen können, wenn wir sie mit früheren Zeiten vergleichen, in denen die Einwanderung, wenn auch nicht gerade aktiv gefördert, so doch zumindest mit relativer Gleichgültigkeit angesehen wurde.
Wenn wir fragen, wie die Bürgerinnen und Bürger der liberalen Staaten in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts generell zur Einwanderung standen, dann lautet die Antwort, dass Staaten zwar als Inhaber eines uneingeschränkten Rechts auf Aufnahme oder Zurückweisung von Einwanderern betrachtet wurden, das man als eine Facette ihrer Souveränität ansah, es in Wirklichkeit aber oft zu unregulierten Migrationsbewegungen kam. Die Regulierung der Einwanderung wurde erst dann zu einem Thema, wenn die Zahl der Neuankömmlinge sehr groß wurde oder diese aus wirtschaftlichen, moralischen oder rassischen Gründen (oder Kombinationen daraus) als unerwünscht galten. In den Vereinigten Staaten wurden die ersten bedeutenden Einwanderungsbeschränkungen auf Bundesebene daher im Jahr 1882 erlassen, und zwar angesichts der chinesischen Einwanderer, von denen man befürchtete, die chinesischen Männer könnten mit den Einheimischen in Konkurrenz um Arbeitsplätze treten und die Frauen sich prostituieren.8 Der 1906 in Großbritannien erlassene Aliens Act richtete sich hauptsächlich gegen jüdische Auswanderer aus Osteuropa, zielte aber auch auf chinesische Seeleute ab.9 In beiden Fällen bedienten sich die Befürworter der Einwanderungskon14trolle einer Rhetorik, die die laxen Sitten der vermeintlich minderwertigen Rassen anprangerte. Das heißt: Einwanderer waren akzeptabel – oder, wie im Fall der Vereinigten Staaten, sogar willkommen –, solange sie von einer Art waren, die weder für die Moralvorstellungen noch für die ökonomischen Interessen der angestammten Bürger eine Bedrohung darstellte. Und man erwartete von ihnen, dass sie sich um sich selbst würden kümmern können. Der Staat übernahm keinerlei Verantwortung für die Versorgung der Einwanderer, die üblicherweise auf der untersten gesellschaftlichen Stufe um ihr Überleben kämpften. Die generelle Haltung der Aufnahmegesellschaft den Neuankömmlingen gegenüber brachte der chartistische Journalist Joshua Harney Anfang des neunzehnten Jahrhunderts anschaulich so auf den Punkt: »Dem Exilierten steht es frei, an unseren Küsten anzulanden, und auch, unter unserem trüben Himmel zu verhungern.«10
Eine weitere Implikation der Souveränitätsrechte des Staates war, dass dieser den Einreisewilligen alle möglichen Bedingungen auferlegen konnte, solange sich diese nicht zu einem brutalen Umgang mit ihnen auswuchsen. Der liberale Philosoph Henry Sidgwick konkretisierte die Rechte des Staates im Zuge einer recht knappen Diskussion der Einwanderungsfrage in seinem erstmals 1891 erschienenen Werk Elements of Politics.11 Er sah es als gegeben an, dass Staaten das Recht darauf hätten, zu entscheiden, ob sie überhaupt Einwanderer aufnehmen wollten – mit der einzigen Einschränkung, dass dies nicht für Staaten gelte, deren Grenzen große unbewohnte Gebiete umfassten –, und deshalb auch das Recht darauf haben müssten, über die Aufnahmebedingungen zu entscheiden:
Ein Staat muss klarerweise das Recht dazu haben, Fremde nach seinen eigenen Regeln aufzunehmen, ihren Zutritt an beliebige Bedingungen zu knüpfen oder Gebühren für ihre Durchreise zu erheben sowie sie allen möglichen rechtlichen Restriktionen oder Beschränkungen zu unterwerfen, die ihm angebracht erscheinen. Allerdings sollte er ihnen, nachdem er sie einmal eingelassen hat, nicht plötzlich und ohne Vorwarnung eine andere, harschere Behandlung angedei15hen lassen; da er sie aber legitimerweise auch gänzlich ausschließen darf, muss er das Recht haben, mit ihnen ganz nach eigenem Gutdünken zu verfahren, nachdem er ihnen dies angekündigt und ihnen ausreichend Zeit gegeben hat, sich zu entfernen.12
Sidgwick war auch der Auffassung, dass Staaten gute Gründe dafür hätten, bei der Auswahl derer, die sie aufnehmen, selektiv vorzugehen, weil sich »die Aufgabe des Staates, die moralische und intellektuelle Kultur zu fördern, durch den fortgesetzten Zustrom fremder Einwanderer mit ihren verschiedenen Sitten und Gebräuchen sowie religiösen Traditionen als hoffnungslos schwierig erweisen könnte«.13 Seine Schlussfolgerung lautete, dass, solange die Einwanderungspolitik aus der nationalstaatlichen Binnenperspektive des Aufnahmestaates betrachtet wird, es für diesen moralisch vertretbar sei, die wirtschaftlichen Interessen, die er an der Aufnahme besonders qualifizierter Einwanderer haben könnte, gegen die mögliche Bedrohung aufzuwiegen, die sie für »den inneren Zusammenhalt einer Nation« und die Aufrechterhaltung »eines angemessen hohen Niveaus des zivilisierten Lebens unter seinen Mitgliedern« darstellen könnten. Es bestand also, mit anderen Worten, keine Verpflichtung dazu, die Interessen der Einwanderer selbst zu berücksichtigen.14
Ich habe Sidgwick hier als Repräsentanten einer liberalen Haltung zur Einwanderung angeführt, wie sie sich ungefähr zu dem Zeitpunkt gestaltet hat, als Masseneinwanderung in Nordamerika und Europa zu einem politischen Thema wurde, um damit hervorzuheben, wie sich unser Denken in den etwa hundert Jahren, seit er dies schrieb, verändert hat. Einige dieser Veränderungen haben zu einer Stärkung der Ansprüche potentieller Einwanderer beigetragen, während andere diese eher zurückgedrängt haben. So sind wir zuerst zu Zeugen der Entstehung einer internationalen Menschenrechtskultur geworden, die Staaten eine viel weiter reichende Verantwortung in ihrem Umgang mit Einwanderern auferlegt, als es sich ein Philosoph zu Sidgwicks Zeiten je hätte vorstellen können. Heute werden Staaten als dazu verpflichtet angesehen, jene Menschen aufzunehmen, deren funda16mentale Rechte an ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort bedroht sind – vor allem Flüchtlinge. Und selbst im Falle derer, die nicht unter die besonderen Schutzbestimmungen für Flüchtlinge fallen, sind die Staaten durch internationales Recht in den Verfahren eingeschränkt, die sie zur Auswahl von möglichen Einwanderern sowie bei der Rückführung derjenigen, die zwar gekommen sind, aber die erforderlichen Kriterien nicht erfüllen, anwenden dürfen. Natürlich wird diesen rechtlichen Vorgaben in der Praxis nicht immer Genüge getan, aber dennoch sehen sich die Staaten dazu genötigt, es entweder zu verschleiern oder offensiv zu rechtfertigen, wenn sie mit ihrem Vorgehen gegen internationale Menschenrechtsvereinbarungen verstoßen, da diese eben für alle Menschen unabhängig von ihrer Nationalität gelten und damit auch für zureisende Migranten.
Zweitens profitieren die Einwanderer, die Aufnahme in liberalen Staaten finden, auch von der heutzutage viel größeren Toleranz Lebensweisen gegenüber, die vom gesellschaftlichen Durchschnitt abweichen; tatsächlich können sie einen positiven Nutzen aus dem Rückhalt ziehen, die multikulturalistische Politiken minoritären kulturellen Praktiken angedeihen lassen. Anders formuliert: Der Druck, sich an die Mehrheitsgesellschaft zu assimilieren, der ein Jahrhundert zuvor noch ziemlich groß war – jedenfalls für jene Einwanderer, die aus den Ghettos herauskommen wollten, die man ihnen ursprünglich zugewiesen hatte –, ist von gesellschaftlichen Normen abgelöst worden, die diverse kulturelle Blumen zum Blühen ermuntern und Behinderungen der Chancengleichheit für Angehörige von Minderheitenkulturen aus dem Weg schaffen möchten. In den heutigen liberalen Demokratien ist keine Idee so wirkmächtig wie die der Chancengleichheit. Wenn sich also der Staat einerseits dazu entschließt, kulturelle oder freizeitbezogene Aktivitäten zu fördern, dann muss er dies auf faire und gerechte Weise tun (bezuschusst er also beispielsweise Streichorchester, dann sollte er auch Steelbands und Mariachi-Ensembles fördern). Auf der anderen Seite sollen individuelle Berufschancen und Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg nicht vom kulturellen Hintergrund einer Person beeinflusst werden. Daher 17haben wir heute Antidiskriminierungsgesetze, ein Schulsystem, das entweder streng säkular ausgerichtet ist oder konfessionsgebundene Schulen für die Angehörigen von religiösen Minderheiten zulässt, und vieles mehr. All diese Veränderungen machen es Einwanderern leichter, in ihrer neuen Heimat zu leben, ohne ihre ererbte Kultur aufgeben zu müssen, oder sorgen sogar dafür, dass sie dazu ermutigt werden, ihre Kultur als Bestandteil eines multikulturellen Potpourris zu zelebrieren.
Andere, ebenso große Veränderungen in der politischen Kultur erschweren dafür die Lage der Einwanderer und vor allem die der Neuankömmlinge. Die erste davon ist die Bedeutung, die heute der Staatsangehörigkeit beigemessen wird. Die Menschen identifizieren sich zumeist politisch mit nationalen Gemeinschaften, die sich über die Generationen hinweg in die Vergangenheit und in die Zukunft erstrecken, und die Mitgliedschaft darin wird als eine lebenslange angesehen; sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Geburt und endet erst mit dem Tod. Wie nun sollen neu eintreffende Einwanderer damit umgehen? Soll man sie als Beitrittskandidaten betrachten, die sich in einem angemessenen Zeitraum zu integrieren haben und danach genauso behandelt werden müssen wie die angestammten Staatsbürger? Oder sollte man sie als temporär Assoziierte ansehen, als Einwohner, die sich nur kurz im Land aufhalten und etwas Geld ansparen wollen, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehren, oder als verzweifelte Menschen, die einen Zufluchtsort suchen, während ihre eigenen Länder vom Bürgerkrieg zerrissen werden? Für Gesellschaften, die ihren eigenen liberaldemokratischen Grundsätzen treu bleiben wollen, ist es untragbar, dass es innerhalb ihrer Grenzen eine Klasse von Menschen geben sollte, die dauerhaft einen zweitrangigen Status innehaben. All jenen Einwanderern, die zum Verbleib im Land bestimmt sind, muss daher die Chance auf einen legalen Aufenthaltsstatus und schließlich auch auf volle staatsbürgerliche Rechte gegeben werden, während die anderen zum Gehen ermutigt werden sollten, sobald es für sie günstig und sicher ist, dies zu tun. Der Staat kann nicht einfach eine Laisser-faire-Haltung einnehmen, wie er es möglicherweise noch vor hun18dertfünfzig Jahren hätte tun können. Mit Blick auf diejenigen, die sich auf dem Weg zur Erlangung der Staatsbürgerschaft befinden, hegt er außerdem ein vitales Interesse an ihrer politischen Bildung. Eine Bürgerin zu sein hat nicht nur etwas damit zu tun, über ein Bündel von Rechten wie das auf anwaltliche Vertretung bei Gericht oder das Wahlrecht zu verfügen, so wichtig sie auch sind. Damit gehen auch Pflichten und Normen einher, die definieren, wie Bürgerinnen sich verhalten sollten. So sollte ein Bürger zum Beispiel dazu bereit sein, mit der Polizei zu kooperieren, wenn es um die Einhaltung von Recht und Gesetz und die Verfolgung von Straftätern geht. In einer Demokratie gehört auch die Anerkennung von Mehrheitsentscheidungen als bindend dazu, sofern sie durch die richtigen Verfahren zustande gekommen sind, und zwar so lange, bis sie wieder aufgehoben werden. Wenn man ein Bürger wird, muss man also auch solche Pflichten akzeptieren und sich zu den entsprechenden Normen bekennen. Mehr noch, um als Bürger zu fungieren, muss man sich auch an das politische System anpassen, an dem man nun teilhat. Und um diese Rolle adäquat auszufüllen, muss man dessen Institutionen respektieren und zumindest einige der Überzeugungen anerkennen, die diesen zugrunde liegen.
Wie weit genau aber die neue Bürgerin bei ihrer Identifikation mit ihrem angenommenen Staat gehen muss, ist ebenso Gegenstand von Auseinandersetzungen wie die Art der ihr abverlangten Identifikation. Soll sie strikt politisch sein, im Sinne einer Anerkennung der Autorität eines Korpus von Regeln und Prinzipien wie denen, die in der Verfassung eines Staates aufgeführt sind? Oder erfordert sie eine umfassendere Identifikation mit der Nation, der der Einwanderer beigetreten ist, wozu die Achtung und Anerkennung nationaler Symbole, das Sprechen der Landessprache, die Akzeptanz einer Variante der »nationalen Erzählung« sowie die Anerkennung der herausragenden Stellung gehören wird, die einige kulturelle Eigenarten im nationalen Bewusstsein einnehmen, darunter möglicherweise auch eine bestimmte Religion? Dies sind Fragen, auf die wir im Verlauf des Buches zurückkommen werden. In der Praxis ist die Auffassung 19sehr verbreitet, dass Einwanderer zumindest dringend dazu angehalten werden sollten, eine Identität anzunehmen, die über eine im engen Sinne politische Identität hinausgeht. Ein Anzeichen dafür ist die wachsende Beliebtheit von Einbürgerungstests, die von den Bewerbern Kenntnisse der Geschichte und Kultur des Landes verlangen, in das sie gekommen sind. Natürlich können diese Tests per se die Einwanderer nicht dazu bringen, dieser Gesellschaft gegenüber irgendeine bestimmte Einstellung einzunehmen. Aber abgesehen davon, dass sie sie mit einigen praktischen Details darüber vertraut machen, wie die Gesellschaft funktioniert, besteht ihr eigentlicher Zweck darin, ihnen zu signalisieren, dass von ihnen eine kulturelle wie auch eine wirtschaftliche und soziale Integration erwartet wird.
Bei Einwanderern, deren kulturelles Erbe aus nichtliberalen Gesellschaften stammt, kann diese Erwartungshaltung innere Konflikte hervorrufen. Die politische Kultur der Aufnahmegesellschaft anzunehmen kann für sie bedeuten, einige ihrer tiefsten Überzeugungen aufgeben zu müssen. Die Reaktionen auf diese Herausforderung können sehr unterschiedlich ausfallen und von dem einen Extrem eines übertriebenen patriotischen Bekenntnisses zur neuen Gesellschaft bis zu dem anderen ihrer Ablehnung und der Entfremdung von ihr reichen. Das Problem wird möglicherweise noch drängender, wenn die Aufnahmegesellschaft an Konflikten in den Herkunftsregionen der Einwanderer beteiligt ist, wie es seit der Zeit des Irakkriegs mit Einwanderern aus dem Nahen Osten der Fall ist. Die Neuankömmlinge könnten sich unter solchen Umständen dazu genötigt fühlen, die Politik des Staates zu unterstützen, um nicht als illoyal oder gar als Bedrohung angesehen zu werden. Dass so etwas vorkommen könnte, mag vielleicht seltsam anmuten, weil sich Demokratien ja zum Recht auf freie Meinungsäußerung und zu einer offenen und kritischen Erörterung der Regierungspolitik bekennen sollten; diese Grundsätze gehen allerdings von der stillschweigenden Annahme aus, dass alle an der Diskussion Beteiligten sich mit der politischen Gemeinschaft identifizieren, deren Wohlergehen ihnen zudem am Herzen liegt. Einwanderer können nicht darauf vertrauen, dass 20diese Unterstellung auch in ihrem Fall gemacht wird. Für sie ist eine Kritik an der Regierung folglich mit Risiken behaftet, denen sich Einheimische nicht ausgesetzt sehen.
Der Punkt ist also, dass der Eintritt in eine nationale Gesellschaft für die Bürger in spe sowohl mit bestimmten Kosten als auch mit einem entsprechenden Nutzen verbunden ist. Wie ich angemerkt habe, blieben Einwanderer in früheren Zeiten sich selbst überlassen, solange sie kein illegales oder abweichendes Verhalten an den Tag legten. Was sie von ihrer neuen Gesellschaft hielten und ihr gegenüber empfanden, war nicht sonderlich von Interesse. Der demokratische Staat von heute kann keine derart passive Perspektive einnehmen; er will und muss von den Einwanderern verlangen, dass sie gute und aufrechte Bürger werden. Und dazu, dieses Ziel zu erreichen, könnte es auch gehören, sie darin zu bestärken oder es ihnen sogar abzuverlangen, dass sie einen Teil des kulturellen Erbes ablegen, das sie mit sich führen. Wie allerdings jenes Gleichgewicht zwischen der Bejahung eines kulturellen Pluralismus und der Sicherstellung eines Kernbestands an Überzeugungen, die praktisch alle teilen, genau hergestellt werden soll, ist eines der Hauptprobleme, denen Staaten mit großen Einwanderergemeinden gegenüberstehen. Im Fortgang dieses Buches werden wir uns einige der Knackpunkte genauer ansehen, an denen Multikulturalismus und staatsbürgerschaftliche Identität miteinander in Konflikt geraten.
Weil die meisten Demokratien der Gegenwart auch Wohlfahrtsstaaten sind (ganz gleich, ob sie diese Bezeichnung auf sich selbst anwenden oder nicht), die sich einer Politik der sozialen Gerechtigkeit verschrieben haben, ergibt sich noch ein zweiter Problemkreis. Einerseits versuchen sie, Chancengleichheit herzustellen, andererseits stellen sie aber auch Einkommensbeihilfen und eine Reihe sozialer Leistungen bereit, die alle Bürger mit den notwendigen Mitteln für ein Leben in Würde versorgen sollen. Zu den Nutznießern dieser Politik zählen auch Einwanderer; allerdings wird von ihnen auch verlangt, ihren Beitrag zu leisten, damit diese Politik funktionieren kann. Abermals kann diese Forderung eine Befolgung gesellschaftlicher Normen umfassen – zum 21Beispiel der, dass dem männlichen und dem weiblichen Nachwuchs die gleichen Bildungs- und Beschäftigungschancen eingeräumt werden –, die den kulturellen oder religiösen Überzeugungen mancher Einwanderer entgegenstehen mögen. Soziale Gerechtigkeit wird zudem normalerweise so verstanden, dass sie ein lebenslanges System der sozialen Kooperation umfasst, in dem die meisten Menschen zu bestimmten Zeiten ihres Lebens Nettozahler (qua Besteuerung) und zu bestimmten anderen Zeiten, nämlich etwa dann, wenn sie krank werden oder das Rentenalter erreichen, Nettoempfänger sind. Einwanderer treten üblicherweise inmitten ihres Lebens in dieses System ein, was die Frage aufwirft, ob sie sofort Anspruch auf die volle Bandbreite wohlfahrtsstaatlicher Leistungen erhalten oder sich ihre Mitgliedschaft in ihm erst durch eine Phase, in der sie Nettozahler sind, verdienen sollten. Das verbreitete Ressentiment Einwanderern gegenüber scheint oft von der tatsachenunabhängigen Wahrnehmung gespeist zu sein, dass sie ins Land kommen, um Leistungen in Anspruch zu nehmen, ohne zuvor einen angemessenen eigenen Beitrag geleistet zu haben.15 Auch dieses Problem wäre zu jenen früheren Zeiten nicht aufgetaucht, als der Staat seinen Bürgern kaum mehr als eine Grundsicherung bot. Heute müssen Einwanderer nicht nur als prospektive Staatsbürger, sondern auch als Mitglieder eines komplizierten Systems zur Ressourcenverteilung aufgenommen werden, das darauf basiert, dass seine Mitglieder sich den Prinzipien der Mitwirkung (etwa durch echte Bemühungen darum, eine Arbeit zu finden) und Gleichheit (zum Beispiel durch die Sicherstellung, dass Arbeitsstellen an die qualifiziertesten Bewerber ohne Ansehen von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion vergeben werden) verschrieben haben.
Mein Punkt lautet an dieser Stelle nicht, dass Einwanderer unfähig oder unwillig dazu wären, Mitglieder dieses Systems zu werden; es gibt keinen Grund dafür, so etwas anzunehmen. Vielmehr lautet er, dass der aufnehmende Staat aktiv Vorkehrungen dafür treffen muss, Neuankömmlinge zu integrieren, wenn das System nicht durch den Eindruck geschwächt werden soll, sie 22würden nichts zu ihm beitragen. Umverteilende Wohlfahrtsstaaten sind auf das Vertrauen der Bürger untereinander angewiesen, dass jeder von ihnen sich unter den Bedingungen dieses Systems fair verhält, ehrlich seine Steuern bezahlt und sich keine Vorteile erschleicht, die ihm nicht zustehen. Unglücklicherweise gibt es Belege dafür, dass dann, wenn Gesellschaften ethnisch oder kulturell vielfältiger werden, das Maß an Vertrauen tendenziell abnimmt;16 und dies macht es wiederum schwieriger, Unterstützung für Maßnahmen zu gewinnen, die in der Praxis einer Gruppe mehr nützen könnten als anderen, selbst wenn dies nicht in ihrer Absicht liegt.17 Im Ergebnis stehen wir möglicherweise einem Zielkonflikt zwischen mehr Einwanderung und der Schaffung oder Bewahrung eines starken Wohlfahrtsstaates gegenüber, vorausgesetzt, Letzterer ist eines unserer Ziele. Die Belege dafür sind nicht immer leicht zu deuten. In den vergangenen Jahrzehnten ist eine relativ große Einwanderung in die entwickelten Demokratien in einer Phase erfolgt, in der das Niveau der Sozialausgaben aus davon unabhängigen Gründen angestiegen ist, so dass die Frage nicht die ist, ob Einwanderung die Wohlfahrtsausgaben in absoluten Zahlen gesenkt hat, sondern die, ob sie ihren Anstieg verlangsamt hat. Eine Analyse der Sozialausgaben in achtzehn OECD-Ländern kam zu folgendem Ergebnis:
Die internationale Migration scheint für die Größe des Wohlfahrtsstaates von Bedeutung zu sein. Obwohl kein Wohlfahrtsstaat angesichts der sich beschleunigenden internationalen Bevölkerungswanderung tatsächlich geschrumpft ist, ist seine Wachstumsrate geringer, je offener eine Gesellschaft der Einwanderung gegenübersteht. Die typische Industriegesellschaft dürfte für Sozialleistungen um die 16 oder 17 Prozent mehr als heute ausgeben, wenn sie ihren Anteil von im Ausland geborenen Menschen auf dem Niveau von 1970 gehalten hätte.18
Die Belege, auf die hier Bezug genommen wird, geben Auskunft über die Gegebenheiten in der Vergangenheit. Sie schließen nicht aus, dass Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, um den 23dämpfenden Effekt der Einwanderung auf staatliche Wohlfahrtsausgaben zu verhindern. Ich möchte hier nur herausstreichen, dass es ein Problem gibt, das wir klar benennen müssen, wenn eine bedeutende Anzahl von Einwanderern in einen etablierten Wohlfahrtsstaat hineinkommt, vor allem, wenn kulturelle Unterschiede ein bestimmtes Misstrauen zwischen Einheimischen und Neuankömmlingen stiften. Vorhin habe ich Belege für weitverbreitete Ängste vor Einwanderung sowie die Ansichten von Kritikern wiedergegeben, die argumentieren, diese Ängste seien unbegründet. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass es einen Streit auszutragen gilt, ganz gleich, welche Seite sich am Ende als im Besitz der besseren Argumente befindlich erweist. Es ist eine echte Frage, wie die Einwanderung sich auf die Aufnahmegesellschaften auswirkt, wo das Gleichgewicht von Kosten und Nutzen liegt und auch wie die Kosten und der Nutzen für die Einwanderer in die Gleichung einfließen sollen. Sollen sie gleich gewichtet werden oder ist es legitim, die Waage zugunsten der existierenden Mitglieder der politischen Gemeinschaft ausschlagen zu lassen?
Dies sind schwierige Fragen (wären sie es nicht, dann bräuchte es dieses Buch nicht). In öffentlichen Foren wird die Einwanderungsdebatte oft in einem recht engen ökonomischen Sinne geführt. Die an dieser Debatte Beteiligten versuchen, den Nettoeffekt der Einwanderung auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Aufnahmegesellschaft abzuschätzen. Normalerweise erweist sich dieser als positiv, aber gering. Es scheint jedoch auch wichtig zu sein, die Auswirkungen der Einwanderung auf die relative Verteilung des Volkseinkommens zwischen verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft zu untersuchen, und hier spricht einiges dafür, dass Einwanderung zu verschärfter Ungleichheit führt, indem sie bei den Geringqualifizierten durch die größere Konkurrenz um deren Arbeitsplätze für sinkende Einkommen sorgt.19 Dieses Ergebnis hängt natürlich von der Verteilung der Fähigkeiten innerhalb der Einwandererkohorte ab; eine etwas optimistischere Position besagt, dass dort, wo Einwanderer auf Basis ihrer Qualifikationen ausgewählt werden, wie es in vielen OECD-Ländern der Fall ist, der wesentliche Effekt der Einwanderung aufgrund 24der Komplementarität von hoch- und geringqualifizierten Arbeitskräften in einer leichten Erhöhung der Löhne für ungelernte Arbeitnehmer bestehen wird.20 Wo die Ökonomen uneins sind, sollten nicht die politischen Philosophen entscheiden. Alle in der Debatte vertretenen Ansichten kommen darin überein, dass die Auswirkungen auf das Lohnniveau relativ gering sind. Darüber hinaus müssen wir selbst dann, wenn wir unsere Aufmerksamkeit allein auf die ökonomischen Folgen der Einwanderung richten, doch auch die Folgen für die Herkunftsgesellschaften bedenken, wo ihre Auswirkungen im Guten wie im Schlechten möglicherweise größer sind. Besteht die Gefahr, dass ein Braindrain den Gesellschaften, aus denen hochqualifizierte Personen abwandern, in der Folge ernsthaften Schaden zufügt? Und wenn ja, welches Gewicht sollten wir dieser Auswirkung dann beimessen? Diese letzte Frage führt uns unmittelbar über die Ökonomie hinaus und in die politische Philosophie hinein. Die von ihr aufgeworfenen Fragen sind nämlich zuallererst die, ob Staaten dazu verpflichtet sind, die Interessen aller Menschen gleichzubehandeln, wenn sie über ihre Politik befinden, oder ob es ihnen legitimerweise offensteht, die Interessen ihrer eigenen Bürger höher zu gewichten. Und sollten sie tatsächlich dazu berechtigt sein, sich primär um ihre eigenen Bürger zu kümmern, an welcher Stelle stößt diese Parteilichkeit dann an ihre Grenzen? Welche Lasten dürfen sie, wenn überhaupt, Außenseitern auferlegen, und was müssen sie aktiv unternehmen, um Nichtstaatsbürgern zu helfen, wenn deren Menschenrechte bedroht sind? Auf diese sehr grundsätzlichen Fragen müssen Antworten gefunden werden, bevor wir damit anfangen können, eine kohärente Perspektive auf die Ansprüche von Einwanderern zu entwerfen, und deshalb wird das zweite Kapitel dieses Buches sie in Angriff zu nehmen versuchen.
Auch die Ökonomen selbst mögen vielleicht einräumen, dass die zentralen Fragen der Einwanderung nicht im engeren Sinne wirtschaftlicher Art sind.21 Eine weitere disziplinäre Gruppe, die ein großes Interesse an ihnen hegt, bilden die Rechtstheoretiker und speziell die Menschenrechtsanwälte. Auf den ersten Blick ruft die Einwanderungspolitik, wie sie gegenwärtig betrie25ben wird, nämlich ernsthafte menschenrechtliche Bedenken hervor. Denken wir nur an die physischen Maßnahmen, die manche Staaten unternehmen, um Einwanderer am illegalen Betreten ihres Staatsgebiets zu hindern, beispielsweise die Praxis der Entsendung von Patrouillenbooten, die Flüchtlingsschiffe abfangen sollen, bevor sie die Küste erreichen – obwohl diese Schiffe häufig seeuntüchtig sind. Oder an die Art und Weise, in der Staaten versuchen, Flüchtlinge an der Einreichung eines Asylantrags zu hindern, indem sie Fluggesellschaften und andere Transportunternehmen davon abhalten, sie an die Grenzen zu befördern, wo sie dies tun könnten. Oder denken wir schließlich an die Lage derjenigen, die illegal einreisen und dann in Ermangelung des Schutzes, den Staaten üblicherweise bieten, zur Annahme von Arbeiten unter sehr unsicheren Bedingungen gezwungen sind. In den USA ergaben Recherchen von Associated Press, dass mexikanische Arbeiter in den südlichen und westlichen Bundesstaaten viermal so oft bei der Arbeit ums Leben kommen wie einheimische.22 In Großbritannien erinnern wir uns noch an die 23 ausgebeuteten chinesischen Arbeiter, die beim Muschelsammeln in Morecambe Bay von der Flut überrascht wurden und ertrunken sind.23 Blicken wir also allein aus menschenrechtlicher Perspektive auf die Einwanderung, dann gelangen wir sehr wahrscheinlich zu der Schlussfolgerung, dass die Staaten nicht nur mehr Migranten aufnehmen, sondern sich auch viel ernsthafter als im Moment um den Schutz ihrer Menschenrechte kümmern sollten. Die Sorge um die Menschenrechte muss vielleicht nicht bedeuten, dass man alle Grenzkontrollen abschafft, aber bedeutet sie möglicherweise eine merkliche Annäherung an dasjenige Ende des Spektrums, an dem offene Grenzen stehen?
Die menschenrechtliche Betrachtungsweise der Einwanderung leistet, genauso wie die ökonomische, einen bedeutenden Beitrag zu unserem Verständnis der Gesamtsituation, und ich werde in den späteren Kapiteln des Buches genauer auf die menschenrechtlichen Fragen eingehen, die von der Aufnahme von Flüchtlingen, von selektiven Einwanderungspolitiken, von Maßnahmen zur temporären Migration und so weiter aufgeworfen werden. Trotz26dem bleibt diese Perspektive beschränkt, insofern sie die anderen Werte nicht berücksichtigt, die in den Diskussionen über Einwanderung mit Recht eine zentrale Rolle spielen. Dabei handelt es sich häufig um kollektive Werte, die mit der grundsätzlichen Gestalt und dem Charakter der Gesellschaft zu tun haben, in die die Einwanderer einreisen wollen – wie zum Beispiel mit der Größe der Gesamtbevölkerung, der Sprache oder den Sprachen, die ihre Bewohner sprechen, oder mit ihrer tradierten nationalen Kultur. Diese Dinge sind für die angestammten Bürger oft von größter Bedeutung.24 Zwar wird es in Bezug auf sie kaum jemals zu einem allumfassenden Konsens kommen, aber es kann sich in demokratischen Gesellschaften durch den freien Meinungsaustausch in den Medien und in politischen Foren eben doch eine kollektive Präferenz herausbilden. Die Menschen möchten das Gefühl haben, dass sie die zukünftige Gestalt ihrer Gesellschaft mitbestimmen können. Sie haben ein Interesse an politischer Selbstbestimmung, wozu auch die Fähigkeit zu der Entscheidung darüber gehört, wie viele Einwanderer kommen dürfen, welche von ihnen ausgewählt werden sollten, wenn diese Anzahl überschritten wird, und was von denen, die aufgenommen werden, zu Recht erwartet werden kann. Eine Thematisierung der Einwanderung unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten kann solchen kollektiven Werten nicht gerecht werden. Eine Menschenrechtsanwältin kann zwar argumentieren, dass diese Rechte stets Vorrang haben und daher jede akzeptable Einwanderungspolitik die Menschenrechte potentieller Einwanderer wahren muss, ganz gleich, was die demokratische Mehrheit davon halten mag. Wie wir allerdings noch sehen werden, ist die Sache nicht so einfach. Erneut befinden wir uns auf dem Gebiet der politischen Philosophie – und dieses Mal sehen wir uns an, wie, wenn überhaupt, die Demokratie innerhalb des Staates mit den Menschenrechten derer, die sich außerhalb seiner Grenzen befinden, in Einklang gebracht werden kann.
Um uns ein klares Bild von der Einwanderungsproblematik zu machen, müssen wir also mit einigen grundlegenden Fragen der politischen Philosophie beginnen, sie dabei allerdings aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Ein solcher Perspektivenwechsel ist 27notwendig, da sich die politische Philosophie etwa seit Hobbes zum größten Teil mit den internen Beziehungen zwischen dem Staat und seinen Bürgern befasst hat. All die Fragen, die wir normalerweise stellen – unter anderem: Wie kommt die staatliche Autorität zustande? Welche Rechte haben die Bürger gegenüber dem Staat? Sollte die Regierung demokratisch oder oligarchisch verfasst sein? Was verlangt die soziale Gerechtigkeit? –, basieren auf der Annahme, dass wir bereits wissen, wer der politischen Gemeinschaft zuzurechnen ist. Alle sind der Autorität des Staates gleichermaßen unterworfen, selbst wenn sie (wie im Falle der Frauen) in der Geschichte von der vollen Staatsbürgerschaft ausgeschlossen waren. Entlang dieser reichen Tradition staatszentrierter politischer Philosophie zog auch noch ein schmalerer Strom der internationalen politischen Theorie dahin, der sich mit der Entwicklung von Prinzipien zur Regulierung des Verhaltens von Staaten untereinander befasst hat und der mittlerweile zu einer wahren Sturzflut angeschwollen ist, mit Arbeiten zum Kosmopolitismus, zur globalen Gerechtigkeit und zu verwandten Themenstellungen, die aus den Druckmaschinen nur so herauspurzeln. Allerdings ist keiner der beiden Theorietraditionen der Umgang mit dem speziellen Thema Einwanderung leichtgefallen. Der Gegenstand selbst taucht in den klassischen Texten der politischen Philosophie kaum jemals auf. So erfährt er beispielsweise weder in John Stuart Mills ausführlicher Studie zur Regierungsgewalt, den Betrachtungen über die repräsentative Regierung, noch in Hegels ebenso umfangreichen Grundlinien der Philosophie des Rechts irgendeine Erwähnung. Wir müssen bis ans Ende des neunzehnten Jahrhunderts weitergehen, bis wir auf einen Philosophen wie Sidgwick stoßen, der dem Thema Einwanderung eine kurze Passage in einem langen Buch widmet und dabei, wie gesehen, argumentiert, dass Staaten Migranten nahezu vollständig nach eigenem Belieben aufnehmen oder zurückweisen und die Bedingungen ihrer Aufnahme diktieren können.
Manchmal wird behauptet, dass Kant eine Ausnahme von dieser Regel darstellen würde, da er in seinem Essay Zum ewigen Frieden aus dem Jahre 1795 vom Prinzip des »Weltbürgerrechts« 28spricht, welches verlange, diejenigen, die das Territorium eines anderen Staates betreten, aufzunehmen, ohne sie feindselig zu behandeln.25 Dieses Erfordernis bezeichnete Kant als »Besuchsrecht«, und einige Kommentatoren haben diese Idee herangezogen, um auf ihrer Grundlage ein Plädoyer für offene Grenzen zu halten.26 Kant selbst zufolge hat dieses Recht nur einen eingeschränkten Anwendungsbereich: Im Wesentlichen läuft es auf die Freiheit hinaus, Beziehungen zu den Bewohnern eines Landes aufnehmen zu können, vornehmlich zu kommerziellen Zwecken, und darüber hinaus sind diese Bewohner auch dazu berechtigt, den Fremden abzuweisen, »wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann«.27 Es ist ausdrücklich kein Recht darauf, sich niederzulassen, was nach Kant einen besonderen Vertrag mit den Einheimischen erfordern würde. Kant nimmt daher kein allgemeines Recht auf Immigration an, obgleich er durchaus von der Vorstellung eines gemeinsamen Besitzes der Erde Gebrauch macht, um das Gastrecht zu begründen.28
Wenn wir einen Sprung in die jüngere Vergangenheit machen, stellen wir fest, dass John Rawls in Eine Theorie der Gerechtigkeit, dem einflussreichsten Werk der politischen Philosophie des späten zwanzigsten Jahrhunderts, der Einwanderungsproblematik gänzlich aus dem Weg geht, indem er annimmt, dass die darin verteidigten Gerechtigkeitsprinzipien auf eine Gesellschaft anzuwenden seien, deren Mitglieder bereits feststehen.29 Wie er es später formuliert hat, sollte sich seine Theorie auf eine »wohlgeordnete Gesellschaft« beziehen, die als »eine fortdauernde Gesellschaft, eine selbstgenügsame Vereinigung von Menschen, die, wie ein Nationalstaat, ein zusammenhängendes Territorium kontrolliert«, vorzustellen sei, als »ein geschlossenes System; es gibt keine wichtigen Beziehungen zu anderen Gesellschaften, und niemand tritt von außen bei, denn alle werden in sie hineingeboren und verbringen ihr ganzes Leben in ihr«.30 Und auch als er sich in seiner Spätschrift Das Recht der Völker den Grundsätzen zuwandte, die das zwischenstaatliche Handeln regulieren sollen, ließ er die Einwanderungsfrage beiseite und argumentierte, dass die Ursachen, die in der heutigen Welt Einwanderung im großen 29Maßstab hervorbrächten, in einer Welt, die den von ihm dargelegten Prinzipien folgte, nicht mehr existieren würden: »Das Problem der Immigration wird demnach nicht einfach offen gelassen, sondern als ernstes Problem durch eine realistische Utopie aufgelöst.«31 Rawls' Zurückhaltung bei diesem Thema ist recht einfach zu verstehen. Seine gesamte politische Philosophie war auf die Idee eines Gesellschaftsvertrags zwischen Menschen ausgerichtet, die zu ihrem gegenseitigen Nutzen miteinander kooperieren, einander als Gleiche behandeln und nach Prinzipien streben, auf deren Einhaltung sie sich alle einigen können. Einwanderer passen nicht in dieses Bild, da sich gleich die erste Frage stellt, ob ihnen überhaupt angeboten werden sollte, in diesen Gesellschaftsvertrag einzutreten. Es gibt keine selbstverständliche Art und Weise, die Prinzipien, die innerhalb »ein[es] System[s] der Zusammenarbeit, das dem Wohl seiner Teilnehmer dienen soll«,32 anzuwenden sind, auch auf diejenigen auszudehnen, die ihm noch nicht angehören.
Rawls schrieb vom Standpunkt der staatszentrierten Tradition der politischen Philosophie aus. Man könnte nun annehmen, dass diejenigen, die heute aus dieser Tradition ausscheren, um eine globale Perspektive einzunehmen, die Einwanderungsfrage als besser handhabbar ansehen würden, da eigentlich zu erwarten wäre, dass sie die Unterscheidung zwischen denen innerhalb und denen außerhalb des Staates für grundsätzlich moralisch irrelevant halten. Die spezifische Beziehung zwischen Einwanderern und Aufnahmestaat zu begreifen kann jedoch auch ihnen schwerfallen. Der Einwanderer ist nämlich nicht bloß ein Außenseiter. Jemand, der aktiv versucht, nach Großbritannien oder in die Vereinigten Staaten zu gelangen, ist nicht in der gleichen Position wie jemand, der beispielsweise in Bangladesch lebt und bestenfalls von einer allgemeinen gemeinsamen Verantwortung aller Bürger reicher Staaten profitiert, ihm Hilfe zu leisten. Durch seine Ankunft an der Grenze oder gar ihren illegalen Übertritt wird der Migrant aber vom Wohlwollen des Aufnahmestaates abhängig. Was als Nächstes mit ihm geschehen wird, wird in sehr hohem Maße von der Entscheidung des Staates abhängen – nämlich seinem Auf30nahmebegehren stattzugeben oder es zurückzuweisen und ihn in letzterem Fall an seinen Herkunftsort zurückzubringen oder an ein Drittland zu überstellen. Da er sich in dieser Hinsicht der staatlichen Macht ausgeliefert hat, verfügt er auch über moralische Ansprüche gegen den Staat, die seine Cousine, die in Bangladesch geblieben ist, nicht hat. (Diese These wird im Fortgang des Buches noch zu begründen sein.) Obwohl von einer kosmopolitischen politischen Philosophie also eigentlich zu erwarten wäre, dass sie zu Befunden kommt, die die Ansprüche aller (gegenwärtigen und künftigen) Migranten untermauern, könnte sie dennoch zu den spezifischen Fällen jener, die sich aktiv um Einwanderung bemühen, nur wenig zu sagen haben.
Dieser Punkt kann anhand von Joseph Carens' Buch The Ethics of Immigration, der ausführlichsten Behandlung, die die Einwanderungsfrage aus kosmopolitischer Sicht bis heute erfahren hat, verdeutlicht werden.33 Carens hat viel Wichtiges und Aufschlussreiches über die Behandlung zu sagen, die die Staaten den Einwanderern schulden, in die sie eingereist sind; um dies zu tun, klammert er seinen Kosmopolitismus allerdings für den Großteil seines Buches ein und nimmt an, dass Staaten dazu berechtigt seien, ihre Grenzen zu kontrollieren, diejenigen auszuwählen, die einreisen dürfen, und die bevorzugte Behandlung ihrer eigenen Staatsbürger zu verstärken. In den abschließenden Kapiteln wechselt er die Perspektive und plädiert für offene Grenzen auf kosmopolitischer Grundlage. Carens macht es sehr deutlich, warum er sich für diesen Ansatz entschieden hat: Um in einer Welt, in der die Staaten ihre Grenzen faktisch recht streng kontrollieren, überhaupt etwas Relevantes zur öffentlichen Politik sagen zu können, muss man, so Carens, innerhalb eines staatszentrierten Bezugsrahmens operieren. Trotzdem stoßen wir hier möglicherweise auf eine schwerwiegende Inkonsistenz.34 Hegt man nämlich tatsächlich kosmopolitische Grundüberzeugungen, dann wird es einem schwerfallen, die Begründungen ernst zu nehmen, die normalerweise zur Unterstützung von Maßnahmen wie verpflichtenden Einbürgerungstests für Einwanderer oder den ihnen abverlangten Loyalitätsbekundungen gegenüber dem Land, 31in das sie gekommen sind, angeführt werden. Man kann zwar untersuchen, wie schwierig diese Anforderungen sind, und auf dieser Grundlage über ihre Angemessenheit befinden, letztendlich wird man aber all solche Praktiken für ungerechtfertigt halten. Man stelle sich jemanden vor, der grundsätzlich gegen die Ehe eingestellt ist und den man um Hilfe bei den Hochzeitsvorbereitungen eines Freundes bittet. Es wird schwierig werden, hier Vorschläge zu machen, die nicht in irgendeiner Weise von dem Gedanken gefärbt sind, dass das Ganze ein Fehler ist. Im besten Fall wird der gegebene Rat auf eine Art Schadensbegrenzung hinauslaufen.
In Kapitel 2 diskutiere ich den Kosmopolitismus im Allgemeinen als einen der Hintergründe der Einwanderungsdebatte. Hier möchte ich einfach nur darauf hinweisen, warum dieser selbst dann für das Nachdenken über Einwanderung weniger hilfreich als vermutet sein könnte, wenn man von den allgemeinen Argumenten zu seinen Gunsten überzeugt ist – jedenfalls dann, wenn dieses Nachdenken nicht nur um die Frage »Sollten die Grenzen offen oder geschlossen sein?« kreist, sondern ein viel breiteres Spektrum von Problemen wie das der Auswahl von Einwanderern, die Behandlung von Flüchtlingen, die Integrationspolitik und so weiter umfasst. Über kosmopolitische Ansätze nachzudenken ist allerdings durchaus eine gute Möglichkeit, sich auf die Frage zu konzentrieren, was wir in der Einwanderungsdebatte als gegeben und was als veränderlich ansehen sollten. Wie realistisch oder idealistisch sollten wir sein? Sollten wir beispielsweise eine aus einzelnen Staaten bestehende Welt überhaupt als selbstverständlich annehmen? Oder unterstellen, dass die globalen Ungleichheiten in etwa so groß bleiben werden, wie sie heute sind? Wie könnte sich die gegenwärtige internationale Ordnung sonst noch verändern?
Das Argument dafür, hier eine gute Portion Realismus an den Tag zu legen, lautet einfach, dass die Einwanderungsproblematik in einer Welt, die bedeutend anders eingerichtet wäre als die unsere, entweder gänzlich verschwinden würde oder zumindest wesentlich weniger dringlich wäre. Nehmen wir an, es gäbe keine 32einzelnen Staaten, sondern nur Verwaltungsbezirke, die einer wie auch immer gearteten Weltregierung unterstünden. In diesem Fall gäbe es keine Einwanderung in dem Sinne, wie wir sie verstehen. Menschen würden sich immer noch von Bezirk zu Bezirk bewegen, so wie sie es heute in einem Bundesstaat von Region zu Region tun, und vielleicht wäre es auch nötig, Richtlinien zu haben, die diese Wanderungsbewegungen dämpfen oder verstärken würden, aber niemand würde kraft seiner Migration eine fundamentale Änderung seines Status erfahren. Oder nehmen wir an, dass zwar die einzelnen Staaten die primäre Quelle politischer Autorität bleiben, die Welt allerdings insofern »verteilungsgerecht« wäre, als die Lebensbedingungen – bürgerliche und politische Rechte sowie der materielle Lebensstandard – überall mehr oder minder gleich wären.35 Unter diesen Umständen gäbe es zwar immer noch Wanderungsbewegungen zwischen Staaten, wenn Menschen bestimmte Gründe dafür hätten, lieber in dem einen als in dem anderen zu leben, aber (1) wäre ihr Umfang in einer solchen Welt aller Voraussicht nach geringer als in unserer von schreiender wirtschaftlicher Ungleichheit verunstalteten Welt, und (2) wären solche Bewegungen von multilateraler und weithin reziproker Art, weil es keinen universellen Grund (von Klima und landschaftlicher Schönheit einmal abgesehen) dafür gäbe, den Aufenthalt in einem Staat dem in einem anderen vorzuziehen. In einer absolut gerechten Welt gäbe es keine Flüchtlinge und niemanden, der aus bitterster Armut zu entkommen versuchte. In dieser hypothetischen Welt gäbe es daher all jene Faktoren gar nicht, die Einwanderung für uns überhaupt erst zu so einer kontroversen Angelegenheit machen. Deshalb könnte man die Einwanderungsfrage dadurch »lösen«, dass man fordert, die Welt müsse sozusagen entstaatlicht werden oder sei nach den Maßstäben distributiver Gerechtigkeit zu organisieren, doch wie sehr würde dies zur praktischen Erhellung unserer jetzigen Problemlage beitragen?36
Der von mir verfolgte Ansatz wird auch noch in einem anderen Sinne realistisch sein. Diesen kann ich so erläutern, dass ich sage, dass dieses Buch eines zur politischen Philosophie und nicht 33zur Ethik sein wird. Es fragt nach den Institutionen und Strategien, die wir im Umgang mit der Einwanderung anstreben sollten, und ist nicht darum bemüht, einzelnen Menschen zu sagen, wie sie sich verhalten sollen. Um die Bedeutung dieses Punkts zu verstehen, können wir uns noch einmal die Belege für die Auswirkungen von Einwanderung und ethnischer Vielfalt auf die Unterstützung des Wohlfahrtsstaates vergegenwärtigen, auf die wir uns bereits früher in diesem Kapitel bezogen haben. Diese werden gemeinhin im Sinne eines sich verringernden Maßes an Vertrauen erklärt: Die Menschen vertrauen jenen, die sie als »anders« wahrnehmen, tendenziell weniger und sind deshalb auch weniger dazu bereit, soziale Dienste zu unterstützen, von denen sie annehmen, dass sie von diesen Gruppen in Anspruch genommen werden. Wie sollten wir mit diesen Belegen umgehen? Eine Möglichkeit wäre es, zu sagen, dass sie Vorurteile zum Ausdruck bringen. Die Leute unterstellen denen, die aus fremden Ländern kommen oder sich in ungewohnter Weise kleiden, etwas Negatives, und diese Unterstellung ist ungerechtfertigt. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Menschen, die anders aussehen und sich etwas anders benehmen als wir, deshalb weniger vertrauenswürdig wären. Wir sollten vielmehr alle Menschen gleichbehandeln, solange wir keine spezifischen Hinweise darauf haben, dass sie gegen die Vereinbarungen des Gesellschaftsvertrags verstoßen werden. Alle Schwierigkeiten, vor die die Einwanderung das Fortbestehen des Wohlfahrtsstaates gegenwärtig stellen mag, können daher durch die Verkündung einer Norm gelöst werden, der die Leute folgen sollen, einer, die aus moralischen Grundprinzipien hervorgeht. Dies verdeutlicht, was ich als eine ethische Herangehensweise an das Phänomen der Einwanderung bezeichne. Im Gegensatz dazu legt eine politische Herangehensweise ihr Hauptaugenmerk auf die Evidenzen über Einwanderung, gegenseitiges Vertrauen und die Unterstützung für den Wohlfahrtsstaat. Sie erkennt an, dass es sich um ein reales Problem handelt, welches durch eine politische Initiative oder einen institutionellen Wandel gemeinschaftlich gelöst werden muss. Diese Lösung kann verschiedene Formen annehmen: Sie kann 34eine Verringerung der Einwanderungszahlen, Einschnitte bei den Sozialleistungen oder die Suche nach praktischen Methoden zur Vergrößerung des zwischenmenschlichen Vertrauens in kulturell vielfältigen Gesellschaften umfassen. Um diesen Punkt zu verdeutlichen: Sich für die dritte Möglichkeit auszusprechen kann nicht einfach bedeuten, dass man den Leuten sagt, dass sie Fremden gegenüber weniger vorurteilsbeladen und stärker vertrauensselig sein sollen. Vielmehr kann es bedeuten, wohnungs- oder bildungspolitische Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, dass Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln, Einwanderer eingeschlossen, auf alltäglicher Ebene in engeren Kontakt zueinander treten können. Es ist eine separate empirische Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit solche Maßnahmen von Erfolg gekrönt sein werden. Die Einwanderung durch die Linse der politischen Philosophie zu betrachten heißt auch, die Frage zu stellen, wie unsere kollektiv befürworteten Prinzipien und Werte im Lichte der besten verfügbaren Erkenntnisse im Einklang miteinander umgesetzt werden können, inklusive solcher Erkenntnisse darüber, wie weit es möglich ist, individuelles Verhalten und die diesem zugrunde liegenden Überzeugungen und Einstellungen zu verändern.
Der Titel meines Buches spiegelt diesen Ansatz in bestimmter Weise wider.37 Manche Leser fanden ihn provozierend. Warum sollte man Einwanderer als »Fremde« bezeichnen und warum ein kollektives »Wir« postulieren, in deren Mitte sie verortet werden? Ich denke hingegen, dass er widerspiegelt, wie Einwanderung in sesshaften Gesellschaften, deren Mitglieder zum größten Teil das Gefühl haben, sie und ihre Vorfahren seien an einem Ort fest verwurzelt, zumindest auf den ersten Blick betrachtet wird.38 Die Einzelnen werden auf die Anwesenheit eines Fremden auf viele verschiedene Weisen reagieren, zum Beispiel so, dass sie der Möglichkeit, eine neue Lebensweise kennen- und verstehen zu lernen, gegenüber aufgeschlossen sind; andere werden beunruhigt sein und eher negativ reagieren. In jedem Fall wird es zu einem gewissen Aufbrechen eingespielter kultureller Muster kommen: durch neue Essgewohnheiten, neue Bekleidungsformen, 35neue Sprachen, neue religiöse Praktiken und neue Weisen, den öffentlichen Raum zu besetzen. Die Herausforderungen, vor denen wir damit stehen, müssen sich in der Art und Weise wiederfinden, in der wir über grenzüberschreitende Freizügigkeit nachdenken. Wie ich in diesem Kapitel behauptet habe, ist Einwanderung nicht nur eine Sache der Abwägung von ökonomischen Gewinnen und Verlusten oder der Wahrung der Menschenrechte. Sie wirft auch schwierige Fragen darüber auf, wie wir uns selbst als Mitglieder politischer Gemeinschaften mit ihren langen Geschichten und ihrem kulturellen Reichtum begreifen. Dies zu sagen heißt allerdings schon, eine Position in der laufenden Debatte über die Grundlagen der politischen Moral zu beziehen, die Kapitel 2 zu erkunden versucht.
Zwei
37Kosmopolitismus, landsmännische Parteilichkeit und Menschenrechte
Wenn man sich auf einem internationalen Flughafen der Passkontrolle nähert, dann wird man, wie jede erfahrene Reisende weiß, sehr wahrscheinlich auf zwei Warteschlangen treffen: Die eine ist kurz und bewegt sich rasch vorwärts, die andere ist viel länger und oft unerträglich langsam. Die kürzere ist für heimkehrende Staatsbürger vorgesehen, die nur zeigen müssen, dass ihr Gesicht mit dem Foto in einem gültigen Reisepass zusammenpasst, um die Kontrolle passieren zu dürfen; die längere ist für alle anderen, nämlich für diejenigen, deren Anspruch auf Einreise in das Land durch die eine oder andere Kategorisierung (als Touristin, Asylsuchende, vorübergehend Beschäftigte etc.) und durch das Vorzeigen von Visa und anderen relevanten Dokumenten gerechtfertigt werden muss, wobei sie unfreundliche Fragen von Einreisebeamten beantworten und vermutlich noch unangenehmere Kontrollen über sich ergehen lassen müssen. Hier werden wir Zeugen davon, wie der Staat sein Recht darauf ausübt, zwischen Menschen zu differenzieren; während wir uns pflichtgemäß in die richtige Schlange einreihen, nehmen wir es als gegeben hin, dass Staatsbeamte Menschen einfach deshalb sehr unterschiedlich behandeln dürfen, weil manche von ihnen Bürger des Landes sind und andere nicht. Die Langeweile des Wartens in der Ausländerschlange ist allerdings nur ein Anzeichen für die viel umfassendere Praxis, dass Staaten ihren eigenen Mitgliedern eine viel bessere Behandlung als Fremden angedeihen lassen, und das nicht nur, wenn sie durch die Passkontrolle gehen, sondern auch dadurch, dass sie ihnen eine Fülle von Rechten und Chancen zuteilwerden lassen, die Außenstehenden vorenthalten werden. Auch dies nehmen 38wir normalerweise als gegeben hin. Wie aber kann es gerechtfertigt werden? Wir können über die spezielle Problematik der Einwanderung nicht gründlich genug nachdenken, wenn wir nicht wissen, wie wir uns zu der umfassenderen Problematik verhalten, die in diesem Kapitel thematisiert werden soll und die lautet, ob und in welchem Maße Staaten darin gerechtfertigt sind, etwas an den Tag zu legen, was ich fortan »landsmännische Parteilichkeit« nennen werde – also die eigenen Bürgerinnen und Bürger gegenüber Außenstehenden zu bevorzugen.
Wir müssen diese ziemlich grundsätzliche Frage stellen, weil wir ohne ihre Beantwortung keine Möglichkeit haben, die Ansprüche zu beurteilen, die jemand, der einwandern möchte, dem Staat gegenüber haben könnte, dem er beitreten möchte. Stellen wir uns eine Person vor, die sich um Einreise in ein Land bemüht, weil sie darin einige Vorteile erblickt: eine neue Arbeitsstelle, ein angenehmeres Klima, ein anderes Spektrum an kulturellen Möglichkeiten. Erhält sie Zutritt, dann bekommt sie Zugriff auf ökonomische Chancen, die sie anderswo nicht hätte, und typischerweise auch auf diverse wohlfahrtsstaatliche Leistungen wie die Bereitstellung einer Unterkunft und die Gesundheitsversorgung; später dann kann sie sich um die volle Staatsbürgerschaft bewerben. Das heißt also, dass ihre Interessen von der Entscheidung, sie aufzunehmen oder ihren Zuzug abzulehnen, erheblich beeinträchtigt werden. Aber wie viel Gewicht sollte der Aufnahmestaat diesen Interessen beimessen? Ist er eine Demokratie, dann wird er davon ausgehen, dass er den Interessen all seiner Bürger die gleiche Berücksichtigung widerfahren lassen sollte. Muss er aber im Falle der Einwanderin ebenso verfahren oder ist es ihm erlaubt, deren Ansprüche zurückzustutzen, weil sie ja noch keine Staatsangehörige ist? Dürfte er ihre Ansprüche auch vollständig übergehen und seine Entscheidung über ihre Aufnahme einfach davon abhängig machen, inwiefern es den bereits existierenden Staatsangehörigen nützen oder schaden könnte, ihr den Zuzug zu erlauben? Und wie steht es zudem um die Folgen, die die Auswanderung für diejenigen Länder haben wird, aus denen die Einwanderer kommen; welche Bedeutung sollte diesen beigelegt wer39den, sofern sie überhaupt von Belang sind? Im Kapitel 1 habe ich mich auf das Problem des »Braindrain« bezogen – also auf die Möglichkeit, dass Migration manchen armen Ländern derjenigen gut ausgebildeten Kräfte berauben könnte, die sie brauchen, um sich wirtschaftlich zu entwickeln oder ihr Gesundheitssystem personell ausreichend zu besetzen. Doch warum sollte das die Staaten interessieren, die von der Migration profitieren? Erneut können wir diese Frage nur dann beantworten, wenn wir eine Position im Hinblick auf die generelle Thematik sozialer und globaler Gerechtigkeit bezogen haben, also zu der Frage, was politische Gemeinschaften ihren Angehörigen und denen, die keine sind, schulden.
In diesem Kapitel werde ich daher eine Auffassung von landsmännischer Parteilichkeit sowie von den externen Pflichten der Staaten formulieren, die den Hintergrund für die in den folgenden Kapiteln stattfindende Erörterung der Einwanderungsfrage bilden soll. Einige der Argumente, die ich hier präsentiere, sind andernorts ausführlicher dargelegt worden; an dieser Stelle versuche ich, die zentralen Ideen auf relativ konzise Weise zusammenzuführen.1