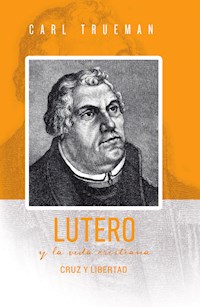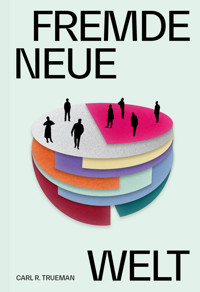
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbum Medien gGmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Welt, in der wir leben, ist kompliziert und vielen Menschen fremd geworden. Immer mehr Gruppen, von denen wir früher wenig bis nichts hörten, drängen in die Öffentlichkeit, um für ihre Anliegen zu werben oder gar der Gesellschaft vorzuschreiben, was sie zu tun hat. Wie kann der Erfolg dieser sogenannten Identitätspolitik erklärt werden? Und wie sollte die Kirche darauf reagieren? Der Historiker Carl R. Trueman zeigt in diesem Buch auf verständliche Weise, welche Einflüsse unsere Kultur in die Richtung eines expressiven Individualismus bewegt haben. Er skizziert die Geschichte des westlichen Denkens von der Romantik an bis hin zur heutigen Identitätspolitik, die stark durch das Thema Sexualität eingefärbt ist. Das hat enorme Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Religion, Redefreiheit und uns selbst verstehen. Carl Trueman fasst in diesem Buch wesentliche Punkte seines großen Werkes"Der Siegeszug des modernen Selbst"(2022) zusammen. Der Frage, wie wir Christen auf die Revolution des Selbst reagieren sollten, schenkt er besonders im letzten Kapitel viel Aufmerksamkeit. Eltern, Studenten, Lehrer, Pastoren oder einfach neugierige Christen können sich so mit den enormen Umwälzungen in unserer fremden neuen Welt vertraut machen und lernen, angemessen darauf zu reagieren. "Dieses Buch sollten alle lesen, die die rapiden Veränderungen verstehen wollen, die sich in unserer Gesellschaft gegenwärtig vollziehen. - Pfarrer i. R. Ulrich Parzany in seinem Geleitwort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Welt, in der wir leben, ist kompliziert und vielen Menschen fremd geworden. Immer mehr Gruppen, von denen wir früher wenig bis nichts hörten, drängen in die Öffentlichkeit, um für ihre Anliegen zu werben oder gar der Gesellschaft vorzuschreiben, was sie zu tun hat. Wie kann der Erfolg dieser sogenannten Identitätspolitik erklärt werden? Und wie sollte die Kirche darauf reagieren?
Der Historiker Carl R. Trueman zeigt in diesem Buch auf verständliche Weise, welche Einflüsse unsere Kultur in die Richtung eines »expressiven Individualismus« bewegt haben. Er skizziert die Geschichte des westlichen Denkens von der Romantik an bis hin zur heutigen Identitätspolitik, die stark durch das Thema Sexualität eingefärbt ist. Das hat enorme Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Religion, Redefreiheit und uns selbst verstehen.
»Dieses Buch sollten alle lesen, die die rapiden Veränderungen verstehen wollen, die sich in unserer Gesellschaft gegenwärtig vollziehen.«
PFARRER I. R. ULRICH PARZANY in seinem Geleitwort
FREMDE NEUE WELT
WIE PHILOSOPHEN UND AKTIVISTEN IDENTITÄT UMDEFINIERT UND DIE SEXUELLE REVOLUTION ENTFACHT HABEN
CARL R. TRUEMAN
Geleitwort von Ulrich Parzany Vorwort von Ryan T. Anderson
IMPRESSUM
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet unter dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Titel des englischen Originals: Strange New World: How Thinkers and Activists Redefined Identity and Sparked the Sexual Revolution © 2022 Carl R. Trueman Published by Crossway
Wenn nicht anders angegeben, wurde folgende Bibelübersetzung verwendet: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
© 2023 Verbum Medien gGmbH, Bad [email protected]
Übersetzung Frauke Bielefeldt
Buchgestaltung und Satz Annika Felder
Lektorat Ron Kubsch
Cover Samuel Hinterholzer, Annika Felder
1. Auflage 2023 Best.-Nr. 8652 077 E-Book 978-3-98665-078-0 DOI: 10.54291/o525538787
Sollten Sie Fehler in diesem Buch entdecken, würden wir uns über einen kurzen Hinweis an [email protected] freuen.
FÜR DAVID UND ANN HALL
INHALTSVERZEICHNIS
Geleitwort von Ulrich Parzany
Vorwort von Ryan T. Anderson
Vorwort von Carl Trueman
1Willkommen in der fremden neuen Welt
2Romantische Wurzeln
3Entfesselter Prometheus
4Psychologie sexualisieren, Sex politisieren
5Der Aufstand der Massen
6Formbare Menschen, flüssige Welt
7Die sexuelle Revolution der LGBTQ+-Bewegung
8Leben, Freiheit und das Streben nach Glück
9Fremde in einer fremden neuen Welt
Glossar
Fußnoten
Hinweise zur deutschen Ausgabe
Über den Autor
UNSERE IDENTITÄT ALS VOLK GOTTES STÄRKENGELEITWORT VON ULRICH PARZANY
Dieses Buch sollten alle lesen, die die rapiden Veränderungen verstehen wollen, die sich in unserer Gesellschaft gegenwärtig vollziehen. Selbstverständlich sind wir Christen daran beteiligt und davon betroffen. Wir schwimmen im gesellschaftlichen Klima wie Fische im Wasser. Wir denken selten darüber nach, warum wir denken, fühlen und handeln, wie wir es tun. Vieles ist uns allzu selbstverständlich.
Vor einigen Jahren las ich begierig die fast 1300 Seiten des Buches Ein säkulares Zeitalter, geschrieben von dem kanadischen Philosophen Charles Taylor.1 Er beantwortet darin die Frage, wie und warum sich unsere Weltsicht in den letzten Jahrhunderten so stark verändert hat. Er beobachtet den Wandel von »einer Gesellschaft, in der es praktisch unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, zu einer Gesellschaft…, in der dieser Glaube auch für besonders religiöse Menschen nur eine menschliche Möglichkeit neben anderen ist«2.
Charles Taylor gebraucht den Begriff des sozialen Vorstellungsschemas. »Das soziale Vorstellungsschema ist jene gemeinsame Auffassung, die gemeinschaftliche Praktiken und ein weitverbreitetes Gefühl der Legitimität ermöglicht.«3 Dabei geht es gar nicht um ausformulierte Gesellschaftstheorien, sondern um die Ansichten und Einstellungen, die die meisten Menschen in einer Zeit mehr oder weniger bewusst miteinander teilen.
Charles Taylor beschreibt unser heutiges soziales Vorstellungsschema als eine abgeschlossene Diesseitigkeit. Gott, Engel, Himmel, Hölle und Dämonen spielen keine Rolle. Alles dreht sich um uns Menschen. Ein anmaßender, selbstgefälliger Humanismus bestimmt unsere Einstellung zum Leben. Charles Taylor geht den langen Weg durch die Geschichte, um die Entstehung dieses heutigen sozialen Vorstellungsschemas in der westlichen Welt zu beschreiben.
Carl R. Trueman nimmt den Begriff des sozialen Vorstellungsschemas auf: »Ich bin der Überzeugung, dass die dramatischen Veränderungen und Verschiebungen, die wir heute in der Gesellschaft erleben, mit dem Aufstieg des expressiven individuellen Selbst zur kulturellen Norm zusammenhängen, wie dies besonders in den Schlagworten der sexuellen Revolution deutlich wird. Dass die Gründe dafür so tief in allen Aspekten unserer Kultur verankert sind, bedeutet, dass wir alle bis zu einem gewissen Grad Teil dessen sind, was wir um uns herum sehen. Um es ganz offen zu sagen: Das soziale Vorstellungsschema teilen wir alle mehr oder weniger« (S. 33–34).
Das expressive Ich steht im Mittelpunkt unseres sozialen Vorstellungsschemas. Trueman beginnt bei Descartes (Cogito ergo sum – Ich denke, also bin ich), zieht die Linie über Rousseau, die Romantik, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Wilhelm Reich und Herbert Marcuse. Er zeigt, wie der Siegeszug des expressiven Ichs vom Denken zum Gefühl geht, wie das Fühlen durch Sexualität bestimmt wird. Sexualität macht die Identität des Menschen aus und wird auf diese Weise zwangsläufig politisch.
Carl Trueman hat in dem vorliegenden Buch noch einmal konzentriert seine Sicht der Entwicklung dargestellt, die er vor kurzem umfangreicher in seinem Werk Der Siegeszug des modernen Selbst auf 500 Seiten beschrieben hat. Leider finden dicke Bücher nicht allzu viele Leser. Trueman folgte der Bitte von Freunden und schrieb diese kürzere Fassung. Er verband damit die Hoffnung, sein Anliegen zugänglicher zu formulieren. Das ist gelungen, finde ich. Leser, die ausführlichere Beschreibungen der Denkbewegungen suchen, finden im »großen Trueman« genug zusätzliches Futter und viele Fußnoten.
Wieso aber schreibt Trueman von einer »fremden neuen Welt«, wenn wir doch heute mehr oder weniger alle das gleiche Vorstellungsschema teilen? Das hängt wohl mit dem hohen Tempo zusammen, mit dem sich bisher Selbstverständliches ändert.
Es ist noch nicht so lange her, dass man unbestritten die Ehe als eine lebenslange Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau verstand. Mit einem Federstrich hat der Deutsche Bundestag das geändert. Und schneller, als man es sich hätte vorstellen können, beschlossen die Kirchenleitungen der evangelischen Kirchen, auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften als Ehen zu segnen. Wer das kritisiert, gilt plötzlich als unmoralischer Bösewicht.
Noch schneller vollzieht sich die Veränderung durch den Transgenderismus. Wenn ein 15-jähriger Junge sagt, er sei eigentlich ein Mädchen, nur im falschen Körper, soll diese Erklärung zur rechtlich anerkannten Änderung seiner Identität ausreichen. Wer ihn zum Arzt schicken will, macht sich dann möglicherweise strafbar.
Trueman macht klar, dass Sexualität heute keine moralische Frage ist. Es geht um die Identität des Menschen, also um die Frage: Wer bin ich? Das haben viele Christen heute noch nicht verstanden. Wie oft höre ich, wir sollten Sexualität nicht dauernd zum Streitthema hochspielen, sondern uns auf die Mitte des christlichen Glaubens, nämlich auf das Evangelium von Jesus Christus, konzentrieren. Genau das ist nötig. Was aber heißt das?
Trueman nennt es, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. In Jesus Christus hat sich der Schöpfer, Erhalter, Retter und Vollender der Welt offenbart. Alle Menschen sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Jesus Christus ruft Menschen aus ihrer Gottvergessenheit und Gottesfeindschaft zur Umkehr in die Gotteskindschaft. Die Identität des Menschen besteht darin, in der Gemeinschaft mit Gott unter seiner Herrschaft zu seiner Ehre zu leben. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen umschließt nach der biblischen Offenbarung die Polarität und Gemeinschaft von Mann und Frau. Diese Gottesoffenbarung bestimmt unsere Identität.
Truemann schreibt zu Recht: »Wir können also im aktuellen kulturellen Umfeld nur dann bestehen und die spezifischen Herausforderungen vor uns angehen, wenn wir tief und breit in Gottes Wahrheit gegründet sind« (S. 225–226). Dazu gehört auch, dass wir verstehen, was die Bibel über die Bedeutung des Leibes sagt, mit dem wir Gott preisen sollen (vgl. 1 Kor 6,20). Durch das gemeinsame Lob Gottes, wie es in den Psalmen Ausdruck findet, wird das soziale Vorstellungsschema des Volkes Gottes geformt.
Ich stimme Carl Trueman von Herzen zu: »Dies ist weder die Zeit für hoffnungslose Verzweiflung noch naiven Optimismus. Ja, lasst uns die verheerenden Folgen des Sündenfalls beklagen, die sich nun auf die spezifische Weise zeigen, die sich unsere Generation ausgesucht hat. Lasst uns die Klage zugleich zum Anlass dafür nehmen, unsere Identität als Volk Gottes und unseren Hunger nach der großen Vollendung zu stärken, die uns bei der Hochzeit des Lammes erwartet« (S. 235).
PFARRER I. R. ULRICH PARZANY Kassel, Frühjahr 2023
VORWORT VON RYAN T. ANDERSON
Ende 2020, als die Welt wegen Corona im Lockdown war, veröffentlichte Carl Trueman eines der wichtigsten Bücher der letzten Jahrzehnte. In Der Siegeszug des modernen Selbst knüpft er an Einsichten zeitgenössischer Denker wie Charles Taylor, Philip Rieff und Alasdair MacIntyre an. Er zeigt, dass moderne Denker und Künstler wie Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Charles Darwin, Percy Bysshe Shelley und William Blake eine Weltanschauung (in Taylors Worten: ein »soziales Vorstellungsschema«) zum Ausdruck brachten, die zur Grundlage für Argumente spätmoderner Theoretiker wie Sigmund Freud, Wilhelm Reich und Herbert Marcuse wurde, den Begründern der postmodernen sexuellen Revolution. Seine profunde Analyse über mehrere Jahrhunderte jüngster Geistesgeschichte macht deutlich, warum Menschen heute für Ideen empfänglich sind, die unsere Großeltern vor zwei Generationen noch rundweg abgelehnt hätten, ohne nach Argumenten oder Beweisen zu fragen.
Das Problem war nur, dass das Buch über fünfhundert Seiten dick ist. Außerdem haben die meisten Menschen von vielen der oben genannten Namen noch nie etwas gehört, geschweige denn sich näher mit ihnen beschäftigt. Der normale Leser hätte weder Zeit noch Lust, sich durch die vielen ausführlichen, differenzierten Besprechungen zu wühlen. Also schrieb ich Carl eine E-Mail, in der ich das Buch als unverzichtbare Lektüre für wissenschaftliche Experten pries, die sich damit auseinandersetzen, wie es dazu gekommen ist und was wir tun müssen, um zur Vernunft zurückzukehren. Aber ich schlug ihm auch vor, eine kürzere, verständlichere Version der grundlegenden Argumente für Nicht-Fachleute zu schreiben. Sie würden von der grundlegenden Darstellung der Entwicklung profitieren, um besser zu verstehen, an welchem Punkt in der Geschichte sie sich befinden. So könnten sie ihre Arbeit in der Gemeinde, in Kultur, Politik, Wirtschaft und – am allerwichtigsten – in Pädagogik und Erziehung der nächsten Generation entsprechend ausrichten. Dieses Buch hat Carl nun vorgelegt und es brilliert auf jeder Seite. In Ihren Händen halten Sie den Leitfaden, den jeder Amerikaner und jeder Mensch im westlichen Kulturkreis lesen muss, dem eine solide Anthropologie und eine gesunde Kultur am Herzen liegen.
Auf die Gefahr hin, Trueman zu sehr zu vereinfachen, würde ich den großen Bogen seiner Arbeit so zusammenfassen: Wie wurde die »Person« zum »Selbst« oder »Ich«? Wie wurde das Selbst oder Ich sexualisiert? Und wie wurde Sex politisiert? Natürlich kannten die Autoren der Psalmen, der Paulusbriefe und der Bekenntnisse des Augustinus auch ein »Selbst« im Sinne eines Innenlebens. Aber in der biblischen Tradition stand die Wendung nach innen im Dienst der äußeren Hinwendung zu Gott. Das Selbst, das in der westlichen Zivilisation bis vor wenigen hundert Jahren kultiviert wurde, war das, was der Harvard-Politikwissenschaftler und Philosoph Michael Sandel als »gebundenes« Selbst bezeichnet hat. Es stand im Gegensatz zum »ungebundenen« Selbst der Moderne.4 Die Person war ein Geschöpf Gottes, das sich in seinem Streben nach ewigem Leben der Wahrheit und objektiven moralischen Normen anzupassen suchte. Der moderne Mensch ist hingegen darauf ausgerichtet, »sich selbst treu zu bleiben«. Anstatt Gedanken, Gefühle und Handlungen an die objektive Realität anzupassen, wird das Innenleben des Menschen selbst zur Quelle der Wahrheit. Der moderne Mensch findet sich in einer Kultur des »expressiven Individualismus« wieder – so wie Robert Bellah sie beschrieben hat. Jeder versucht, seinem individuellen Innenleben Ausdruck zu verleihen, anstatt sich als in Gemeinschaften eingebettet und an natürliche und übernatürliche Gesetze gebunden zu sehen.5 Authentizität im Hinblick auf innere Gefühle statt Ausrichtung an transzendenten Wahrheiten ist zur Norm geworden.
Dieses moderne Selbst ist also nicht den Theologen Rechenschaft schuldig, die predigen, wie man sich nach Gott richtet, sondern den Therapeuten, die raten, wie man sich selbst treu bleiben kann. Genau das hat Philip Rieff als »Triumph des Therapeutischen« bezeichnet.6 Und es ist dieses therapeutische Selbst, das dann sexualisiert wird. Während für den größten Teil der Menschheitsgeschichte unsere sexuelle Verkörperung (engl. embodiment) eine eher uninteressante, schlicht gegebene Tatsache war, die es uns ermöglichte, uns in der Ehe zu vereinen und eine Familie zu gründen, rät die moderne therapeutische Ausrichtung, inneren sexuellen Sehnsüchten nachzugehen. Was früher einfach selbstverständlich war: dass ein Junge zu einem Mann heranwachsen sollte, um zu heiraten und die Verantwortung eines Vaters zu übernehmen, erfordert heute die Suche nach einer inneren Wahrheit über »Geschlechtsidentität« und »sexuelle Orientierung«, die auf Gefühlen und Willen beruht und nicht auf Natur und Vernunft. In der Geschichte wurde die eigene »Geschlechtsidentität« durch das körperliche Geschlecht bestimmt, ebenso wie die »sexuelle Orientierung«: Die »Identität« eines Mannes war männlich und er war von Natur und Vernunft aus »orientiert«, sich mit einer Frau zu verbinden, egal wohin seine (gefallenen) Begehrlichkeiten ihn treiben mochten.
Aber wenn unsere Sexualität unsere tiefste und wichtigste innere Wahrheit ist und es in der Politik um die Förderung dieser Wahrheit geht, dann musste Sex irgendwann politisch werden. Früher kultivierten die Kulturen die Tugenden, die für Familie und Religion förderlich waren, doch nun wurde die Rechtsprechung eingesetzt, um diese Institutionen zurückzudrängen, da sie der sexuellen »Authentizität« im Wege standen. Die Politik suchte indessen eine Welt zu schaffen, in der es sicher – und frei von Kritik – war, den eigenen sexuellen Wünschen zu folgen. Daher ging es bei dem Vorstoß, die Ehe gesetzlich neu zu fassen, nie wirklich um Besuchsrechte in Krankenhäusern und gemeinsame Steuererklärungen, sondern darum, Druck auf die Kirchen auszuüben, damit sie ihre Morallehren überarbeiten. Und es ging darum, Bäckereien zu zwingen, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu unterstützen. Die Bestätigung des sexualisierten Selbst ist der Schlüssel zu unserer neuen Politik – und zu unserer neuen Sprache. Was früher »geschlechtsangleichende Operation« oder »Geschlechtsumwandlung« hieß, wird heute »geschlechtsbestätigend« genannt. Und der amerikanische Staat wird Sie bestrafen, wenn Sie sich dagegen stellen.
Damit soll nicht behauptet werden, dass das Denken allein unsere gegenwärtige kulturelle Situation erklärt. Gäbe es nicht die plastische Chirurgie, um genitalähnliche Gebilde zu schaffen, und synthetisches Testosteron und Östrogen, um Körper zu »maskulinisieren« oder zu »feminisieren«, käme kaum jemand ernsthaft auf die Idee, dass das Geschlecht »neu zugewiesen« werden könnte – da es ja nie »zugewiesen« war. Wie wir verschiedene technologische Errungenschaften einsetzen und generell über Technik denken, wird zutiefst von Ideen beeinflusst; entweder bewusst (unter Intellektuellen), oder indirekt über das soziale Vorstellungsschema. Die Vorstellung, dass der Wille die Natur (Schöpfung) beherrschen sollte, ist nur unter bestimmten Umständen überhaupt plausibel.
Eine wirksame Antwort sollte also diese seit langem bestehenden Bedingungen sowohl intellektuell als auch kulturell in Frage stellen. Trueman ruft die Kirche dazu auf, mutig eine solide Lehre zu predigen, bewusst und in Abgrenzung zur herrschenden Kultur sich nach biblischen und liturgischen Maßstäben auszurichten, ein alternatives soziales Vorstellungsschema zu leben und zu fördern und die sexuelle Revolution sowohl von oben als auch von unten herauszufordern. Von »oben«, indem wir die verschiedenen fehlgeleiteten Voraussetzungen aufdecken, die die sexuelle Revolution erst plausibel machen. Von »unten«, indem wir die Wahrheit über den Menschen und seinen Leib aufzeigen, sodass die Spannung zwischen Glaube und Vernunft, Wissenschaft und Offenbarung gelöst wird. Vor allem aber ruft Trueman die Kirche auf, nicht nur Zeugnis von der Wahrheit abzulegen, sondern auch ein Ort der Zugehörigkeit für die Gestrandeten zu sein, Gemeinschaften zu bauen und in der Gesellschaft zu leben. Vor allem Familien müssen sich überlegen, was dies für die Erziehung ihrer Kinder bedeutet: Einfach nur jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, wird nicht mehr ausreichen (falls es das je hat). Es wird sich als wesentlich erweisen, gemeinsam so zu leben, dass etwas von den letzten Realitäten sichtbar wird.
2018 habe ich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment (dt. etwa: Als aus Harry Sally wurde – auf den Transgender-Moment reagieren). Der Titel sollte zwei Dinge andeuten: Dass die Transgender-Ideologie nicht die Wahrheit über den Menschen ist, sondern das Ergebnis verschiedener kultureller Kräfte, die diesen geschichtlichen »Moment« hervorbringen, und dass die Populärkultur innerhalb einer Generation von der Frage, ob ein Mann und eine Frau einfach Freunde sein können (wie im Film »Harry und Sally«), dazu übergegangen ist, es zum Bürgerrecht zu erklären, dass ein Mann eine Frau werden darf. In Fremde neue Welt deckt Trueman die tiefliegenden gesellschaftlichen und intellektuellen Kräfte auf, die erklären, warum sein Großvater eine solche Forderung ohne zu zögern abgelehnt hätte, während Präsident Biden erklärt: »Die Gleichstellung von Transgender ist die Bürgerrechtsfrage unserer Zeit.«7
Ich bewundere Carls allgemeinverständliche Artikel und akademische Bücher schon lange. Dieses Buch ist das Beste aus beiden Welten, denn es verbindet seinen verständlichen Schreibstil mit seinem tiefen Wissen. Ich bin zutiefst dankbar, dass dieses Buch seine erste größere Veröffentlichung als Mitglied (Fellow) am Ethics and Public Policy Center ist. Ich fühle mich geehrt, dass er mich darum gebeten hat, dieses Vorwort zu schreiben. Möge sein Buch reiche Früchte tragen.
RYAN T. ANDERSON Präsident des Ethics and Public Policy Center
VORWORT VON CARL TRUEMAN
Dieses kurze Buch ist keine präzise Zusammenfassung meines dickeren Buches Der Siegeszug des modernen Selbst, sondern beschäftigt sich mit dem gleichen Thema auf kürzere und (hoffentlich) zugänglichere Weise. Leser, die sich für die gesamte Argumentation samt detaillierter Fußnoten interessieren, sollten das längere Werk hinzuziehen.
Wie immer stehe ich in vielfacher Schuld. Ryan Anderson hat mich zuerst ermutigt, darüber nachzudenken, die Argumente des dickeren Buches in eine kompakte Form zu bringen, sodass sie für Mitarbeiter in Washington, die unter Druck stehen, hilfreicher sein könnten. Er hat ebenfalls das Vorwort beigesteuert. Wie immer waren Justin Taylor und die Mitarbeiter von Crossway eine unglaubliche Unterstützung für dieses Projekt. Besonderer Dank gebührt zudem Paul Helm für das Lesen und Kommentieren der Entwürfe von Kapitel 5 und 6 angesichts seiner hilfreichen Kritik am ersten Buch, und dem Institute for Faith and Freedom am Grove City College für die großzügige Finanzierung von gleich zwei Forschungsassistenten im Studienjahr 2020/21 – Emma Peel und Joy Zavalick. Deren ansteckende Begeisterung, sorgfältiges Lektorieren und die Erarbeitung der Gesprächsfragen und des Glossars (das ich Ihnen ans Herz legen möchte, wenn Sie auf einen unbekannten Begriff stoßen) haben das Endprodukt erheblich verbessert. Und wie immer danke ich meiner Frau Catriona, deren Unterstützung meiner Arbeit sich in diesen vielen Jahren als wesentlich erwiesen hat.
Das Buch ist David und Ann Hall für ihren treuen Dienst und ihre wertvolle Freundschaft gewidmet.
WILLKOMMEN IN DER FREMDEN NEUEN WELT
EINLEITUNG
Viele von uns kennen Bücher und Filme, in denen die Hauptfiguren in einer Welt stecken, in der alles anders ist, als sie es gewohnt sind. Klassische Beispiele aus der Kinderbuchliteratur sind Lewis Carrolls Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln. Aber auch in vielen anderen Stoffen ist dies ein gängiges Motiv. Die dystopische Verwirrung ist fester Bestandteil unserer Kultur – von Kafkas Prozess bis zur Matrix-Filmreihe.
Doch dieses Phänomen beschränkt sich inzwischen nicht nur auf die fiktionalen Stoffe unserer Zeit. Für viele Menschen ist die westliche Welt, in der wir heute leben, zutiefst verwirrend und oft beunruhigend. Dinge, die einst selbstverständlich und unumstößlich als Tugenden galten, sind in den letzten Jahren heftig kritisiert worden und wurden in einigen Fällen von vielen sogar als Laster angesehen. Dinge, die vorgestern noch von fast allen für unbestritten richtig gehalten wurden (z. B. dass eine Ehe aus einem Mann und einer Frau besteht), werden heute anscheinend als Irrglaube betrachtet, der nur von gefährlichen, verrückten Randgruppen vertreten wird.
Diese Probleme beschränken sich auch nicht auf die Welt »da draußen«. Oft zeigen sie sich am deutlichsten und schmerzhaftesten in den Familien. Eltern, die ihrer Familie traditionelle Ansichten über Sexualität beibringen, stoßen bei ihren Kindern auf Unverständnis, die von ihrem Umfeld ganz andere Ansichten übernommen haben.
Was ein Elternteil als liebevolle Reaktion auf ein Kind ansieht, das mit gleichgeschlechtlicher Anziehung oder Geschlechtsdysphorie kämpft, kann von dem Kind als hasserfüllt und fanatisch engstirnig empfunden werden. Das gilt nicht nur für die Gesamtgesellschaft, sondern auch für die Kirche. Die Kluft zwischen den Generationen spiegelt sich heute nicht nur in Mode und Musik wider, sondern auch in Einstellungen und Überzeugungen zu einigen Grundzügen menschlicher Existenz. So entsteht oft Verwirrung und manchmal auch Kummer, da viele der brutalsten Auseinandersetzungen in diesem Kulturkampf am Esstisch und bei Familientreffen ausgetragen werden.
Willkommen in dieser fremden neuen Welt! Vielleicht gefällt sie Ihnen nicht. Aber Sie leben in dieser Welt und deshalb ist es wichtig, dass Sie versuchen, sie zu verstehen.
Diese kulturellen Veränderungen und Verwerfungen sind zutiefst verunsichernd, vor allem für die ältere Generation, aber auch für die jüngere, da die Kluft zwischen dem, was ihre Altersgenossen denken, und dem, was ihre Eltern glauben, größer scheint denn je. Selbst die reflektierteren Angehörigen der älteren Generation fragen sich oft, ob die Meinungen, die sie seit ihrer Kindheit vertreten, wirklich richtig sind oder einfach das Ergebnis ihrer Erziehung. Haben nicht Generationen von ansonsten normalen Menschen Sklaverei für akzeptabel gehalten? Hat die Gesellschaft nicht früher die Todesstrafe für angemessen und gerecht gehalten, selbst für vergleichsweise geringfügige Straftaten? Heißt das nicht, dass auch die traditionellen Ansichten über Sex, Ehe und Geschlecht in unserer modernen, globalisierten und technologischen Gesellschaft ernsthaft falsch oder vielleicht überholt sein könnten? Angesichts vergangener Fehler in wichtigen moralischen Fragen sind solche Anfragen angebracht.
Die Herausforderung besteht darin, zu klären, wo man mit der Betrachtung anfangen soll. Ein Teil der Verwirrung kommt daher, dass so viele Bereiche des Lebens und der Welt gleichzeitig im Fluss zu sein scheinen, dass kaum etwas Solides oder Konstantes bleibt, das uns durch dieses Chaos steuern könnte. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass es etwas gibt, das die Veränderungen, die wir erleben, auf einen Nenner bringen kann und sie, wenn auch nicht völlig erklärbar, so doch zumindest weniger zufällig macht, als man meinen könnte. Das ist der Begriff des Selbst. Dieses Selbst steht in Verbindung mit drei anderen Begriffen, die für meine Darstellung wichtig sind: expressiver Individualismus, die sexuelle Revolution und das soziale Vorstellungsschema. Bevor wir also mit der eigentlichen Geschichte beginnen, möchte ich erklären, wie ich diese Begriffe verwenden werde.
WAS IST DAS »SELBST«?
Der Begriff »Selbst« bedarf einer Erklärung. Es gibt eine gängige Art, wie wir vom Selbst oder Ich sprechen, nämlich in dem Sinne, dass wir ein grundlegendes Bewusstsein von uns als Individuum haben. Ich weiß, dass ich Carl Trueman bin, ein Engländer, der in Amerika lebt, und nicht Jeff Bezos, der Amazon gegründet hat, oder Donald Trump, der einmal Präsident der Vereinigten Staaten war. Die beiden sind andere Individuen, andere Ichs, weil sie andere Wesen sind, die sich ebenfalls ihrer selbst bewusst sind, mit anderem Körper, Geist und Werdegang als ich.
Wenn ich in diesem Buch vom Selbst schreibe, dann meine ich nicht diese banale Art der Begriffsverwendung, sondern eine tiefere Vorstellung davon, wo das »wahre Ich« zu finden ist, wie das meine Sicht auf das Leben prägt und worin seine Erfüllung, sein Glück besteht. Vielleicht lässt sich dies am besten durch eine Reihe von Fragen ausdrücken. Bin ich in erster Linie durch meine Verpflichtungen und Beziehungen zu anderen zu verstehen? Besteht Erziehung darin, mich für die Anforderungen und Erwartungen der Gesellschaft auszurüsten und mich so auszubilden, dass ich der Gemeinschaft diene? Ist Erwachsenwerden ein Prozess, in dem ich lerne, meine Gefühle zu beherrschen, mich zurückzustellen und meine Wünsche denen der Gemeinschaft zu opfern? Oder soll ich mich so verstehen, dass ich in Freiheit geboren bin und meine eigene Identität erschaffen kann? Heißt Erziehung, mir beizubringen, meine Gefühle offen auszudrücken? Ist Erwachsenwerden ein Prozess, in dem ich nicht lerne, mich zurückzuhalten, sondern Gelegenheiten zu nutzen, mich zu zeigen? Ich glaube, dass das normative Selbst von heute (die typische Art, wie wir über unsere Identität denken) die letzten drei Fragen bejaht. Das moderne Selbst geht von der Autorität innerer Gefühle aus und definiert Authentizität als die Fähigkeit, diesen Gefühlen gesellschaftlichen Ausdruck zu verleihen. Es geht davon aus, dass die Gesamtgesellschaft dieses Verhalten anerkennen und bestätigen wird. Ein solches Selbst wird durch das bestimmt, was man expressiven Individualismus nennt.
WAS IST EXPRESSIVER INDIVIDUALISMUS?
Der Begriff »expressiver Individualismus« stammt vom amerikanischen Wissenschaftler Robert Bellah, der ihn so definiert:
»Dem expressiven Individualismus zufolge hat jeder Mensch einen einzigartigen Kern individueller Gefühle und Intuitionen, den es zu entfalten und auszudrücken gilt, wenn Individualität sich verwirklichen soll.«1
Auch der kanadische Philosoph Charles Taylor sieht in diesem expressiven Individualismus die maßgebliche moderne Vorstellung vom Selbst im Westen. Er bringt ihn insbesondere mit dem in Verbindung, was er als »Kultur der ›Authentizität‹« bezeichnet und dahingehend beschreibt, dass:
»… jeder seine eigene Art hat, sein Menschsein in die Tat umzusetzen, und … es wichtig ist, den eigenen Stil zu finden und auszuleben, im Gegensatz zur Kapitulation vor der Konformität mit einem von außen – seitens der Gesellschaft der vorigen Generation oder einer religiösen oder politischen Autorität – aufoktroyierten Modell.«2
Beim modernen Selbst wird also dadurch Authentizität erreicht, dass man nach außen hin in Übereinstimmung mit seinen inneren Gefühlen handelt. Wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden, ist diese Vorstellung inzwischen sehr tief in der modernen Kultur verwurzelt und hilft, eine Vielzahl interessanter Phänomene zu erklären. Zum Beispiel spiegelt die zunehmende gesellschaftliche Sensibilität gegenüber Kritik an der Wahl des persönlichen Lebensstils eine Weltsicht wider, in der jeder Mensch die Freiheit hat, sein Leben so zu gestalten, wie er möchte. Jeder Versuch, seine Missbilligung zum Ausdruck zu bringen, ist daher nicht nur ein Schlag gegen bestimmte Verhaltensweisen, sondern gegen das Recht dieser Person, so zu sein, wie sie möchte. Man könnte sogar sagen, dass die Rede von der »persönlichen Wahl des Lebensstils« ein Symptom für eine Gesellschaft ist, in der der expressive Individualismus die maßgebliche Art ist, über sich selbst und seinen Platz in der Welt nachzudenken.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass ich den expressiven Individualismus nicht durchweg für schlecht halte. Der Mensch hat ein Innenleben. Wir empfinden etwas. Wir sind emotionale Lebewesen. Menschen, die gar nicht transparent und emotional auftreten, erscheinen uns oft als weniger menschlich bzw. kalt und gleichgültig. Die guten und lobenswerten Aspekte des expressiven Individualismus will ich nicht verleugnen. Aber ich will zeigen, wie sein Triumphzug des normativen Selbst zu einigen der seltsamsten und für viele beunruhigendsten Aspekten unserer modernen Welt geführt hat.
Tatsächlich sind viele ausgesprochen nervös wegen der radikalen Veränderungen in den sexuellen Normen der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten, und noch mehr aufgrund des Aufstiegs der Transgender-Bewegung. Ich glaube jedoch, dass diese Elemente der »sexuellen Revolution« eigentlich Symptome dieser breiteren Hinwendung zum expressiven Individualismus im Westen sind. Die Priorität, die die LGBTQ+-Bewegung sexuellen Wünschen und inneren Gefühlen für die persönliche Identität einräumt, ist Teil dieser umfassenderen psychologischen Betonung in der westlichen Welt, die uns alle prägt. In diesem Buch will ich aufzeigen, dass im Hintergrund dieser Aspekte der allgemein so bezeichneten »sexuellen Revolution« der expressive Individualismus steht.
WAS IST DIE SEXUELLE REVOLUTION?
Wenn wir den Begriff »sexuelle Revolution« hören, werden viele daran denken, wie sich die Sexualmoral seit den 1960er-Jahren verändert hat, und darin eine Ausweitung des gesellschaftlich akzeptierten Sexualverhaltens sehen. Das trifft einen Teil dessen, was ich mit diesem Begriff meine. Beispielsweise leben wir heute in einer Zeit, in der Homosexualität nicht mehr wie früher mit sozialem Stigma verbunden ist, geschweige denn mit strafrechtlichen Folgen. Sex außerhalb der Ehe (und auch außerhalb jeder persönlichen Bindung) ist heute ebenfalls normal. Unsere sexuelle Welt ist einfach nicht mehr die unserer viktorianischen Vorfahren.
Dennoch wäre es ein Denkfehler, die sexuelle Revolution nur als Lockerung moralischer Grenzen zu verstehen, die mehr sexuelle Spielarten zulässt. Was die moderne sexuelle Revolution ausmacht, ist, wie sie sexuelle Phänomene wie Homosexualität und Promiskuität normalisiert hat und gar feiert. Die Revolution besteht also nicht darin, dass moderne Menschen schwulen Sex haben oder sich sexuell explizites Material anschauen, sondern dass schwuler Sex und der Konsum von Pornographie nicht mehr mit der Scham und dem sozialen Stigma von einst verbunden sind, sondern inzwischen zur Mainstream-Kultur gehören.
So ist die sexuelle Revolution nicht einfach ein Zuwachs an systematischen Überschreitungen traditioneller Sexualnormen oder eine bescheidene Erweiterung ihrer Grenzen. Weit gefehlt, denn es geht um die völlige Ablehnung solcher Maßstäbe. In bestimmten Bereichen wie Homosexualität und Transgender geht es sogar so weit, dass eine aktive Abkehr von traditionellen sexuellen Sitten für notwendig gehalten und das Beharren auf solchen Ansichten als lächerlich oder gar Zeichen ernsthaften geistigen oder moralischen Defizits angesehen wird. Das wird verständlich, wenn wir die sexuelle Revolution als besonders scharfe Ausprägung des expressiven Individualismus verstehen: Wenn die innere Identität des Einzelnen im sexuellen Begehren begründet liegt, dann muss er oder sie dieses Begehren ausleben dürfen, um authentisch sein zu können.
Natürlich gibt es in der westlichen Gesellschaft immer noch sexuelle Normen und gesetzte Grenzen (etwa bei Pädophilie, die in den Vereinigten Staaten nach wie vor strafbar ist). Aber diese Grenzen werden immer weniger durch die sexuellen Handlungen an sich definiert, sondern über die Einwilligung der Beteiligten. Auch dies ist eine Auswirkung der sexuellen Revolution: Sie hat uns dahin geführt, dass sexuelle Handlungen an sich keine moralische Bedeutung mehr haben, sondern ihre Bewertung sich allein aus der Einvernehmlichkeit ergibt.
WARUM DENKEN WIR SO?
Im Zentrum dieses Buches steht die Darstellung einer geschichtlichen Entwicklung, die die Ideen einiger Intellektueller nachzeichnet, von Jean-Jacques Rousseau und Mary Wollstonecraft bis hin zu Germaine Greer und Yuval Levin. Doch wenn meine These stimmt, dass der expressive Individualismus im 21. Jahrhundert zum Normalfall für unser Selbstverständnis geworden ist, drängt sich natürlich die Frage auf, wie es dazu kam, wenn so wenige Menschen heute von den besprochenen Denkern je gehört, geschweige denn etwas von ihnen gelesen haben.
Die Antwort ist, dass diese Denker den Aufstieg des modernen Selbst oder die sexuelle Revolution indirekt hervorbringen – so wie ein Ball, der auf ein Fenster prallt, die Scheibe zerschlagen kann. Viele andere Faktoren spielen eine Rolle, wie ich besonders in Kapitel 5 und 6 zeigen werde. Ich habe diese Leute ausgewählt, weil sie sich unter den Eliten als besonders einflussreich erwiesen haben. Rousseau hat zum Beispiel die moderne Pädagogik tiefgreifend geprägt, während Nietzsche (über die Arbeit von Leuten wie Michel Foucault) die Geisteswissenschaften tief beeinflusst hat. Aber ich habe sie auch deshalb ausgewählt, weil sie besonders prägnante und hilfreiche Beispiele von Menschen sind, die bewusst die Veränderungen in unserem Denken reflektiert haben. So können wir besser verstehen, welche Auswirkungen bestimmte Annahmen und Überzeugungen mit sich bringen, die wir vielleicht unreflektiert von unserem Umfeld übernommen haben. Doch die philosophische Entwicklung, die ich hier nachzeichne, liefert keinerlei erschöpfende Erklärung dafür, wie das moderne Selbst entstanden ist. Wie schon gesagt: Die Allerwenigsten haben ihre Werke je gelesen.
Wenn die Menschen also nicht Rousseau & Co. lesen, warum prägen dann so viele ihrer Ideen unser Denken über die Welt? Die Antwort ist, dass ihr Denken wichtige Aspekte dessen umfasst, was Charles Taylor das »soziale Vorstellungsschema« nennt. Dahinter steht der englische Begriff social imaginery – ein etwas ungeschickter Begriff, der das Adjektiv »imaginär« zum Substantiv macht; aber da er in der Literatur etabliert ist und ein wichtiges Konzept vermittelt, ist er für mein Projekt dennoch hilfreich.