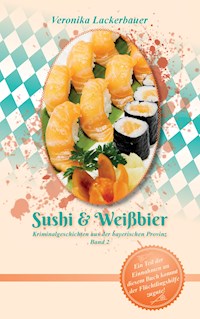Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gedichtwelten
- Sprache: Deutsch
Sie stand erhöht und hatte den Blick zum Himmel gehoben. Ihr Kleid umspielte locker ihre Hüften. Es strahlte in allen Schattierungen des Sonnenuntergangs: Orange, Rot, Purpur, Sonnengelb. Ihr Haar hatte die Farbe von Herbstlaub und es kräuselte sich, umrahmte ihr Gesicht und fiel ihr über die Schultern, den Rücken hinunter. Blitze durchzucken die Nacht, denen unmittelbar der dröhnende Donner folgt. Für einen Augenblick hebt sich der geschnitzte Drachenkopf so deutlich gegen den Himmel ab, als erwache er zum Leben ... Zwölf fantastische Geschichten entführen ihre Leser in fremde Welten - historische und zukünftige, manche an entlegenen Orten, andere wiederum fern unserer Welt. Der Stoff, aus dem sie gewebt sind, entspringt dem Fieberwahn sowie den schlimmsten Albträumen, aber auch Särgen und Gruften. Schaurige Gestalten treiben darin ihr Unwesen. Wehe dem, der es wagt, darin zu lesen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Teufelsurteil
An fremden Gestaden
Der Erlass der Königin
Santa Maria
Cirque Fantaisie
Road's end Inn
Vereist
Die Wiederkehr des Apophis
Zeitenwende
Elena
Gerufene Geister
Zum Schluss
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Werke der Autorin
Über die Gast-Autorin
Weitere Werke der Gast-Autorin
Teufelsurteil
Gastbeitrag von Christina Wermescher
„So, nun müsste ich alles haben“, murmelte Heidi nachdenklich, während sie den Inhalt ihres Korbes überprüfte. Mehrere große Gläser mit allerlei getrockneten Blüten und Blättern befanden sich darin. Am Rand steckten einige Cremetiegel und Fläschchen mit selbstgemachtem Kräuterlikör. Letzterer war bei ihren Kunden sehr beliebt und schnell zu ihrem Türöffner geworden. Oft wurden Händler gar nicht ins Haus gelassen, aber Heidis Kräuterschnaps sorgte dafür, dass sie überall gerne eintreten durfte.
Sie hängte sich den Korb über den Arm und spazierte los. Jeden Montagmorgen machte sie ihre Runde durch den Ort. Es waren zwar nur an die dreißig Häuser, doch da einige Gehöfte dazugehörten, die etwas außerhalb lagen, brauchte sie für ihren Spaziergang meist den ganzen Tag. Deshalb nahm sie sich, seit es wärmer geworden war, immer eine Flasche Brennnesseltee mit. Schließlich wollte sie am Abend ja noch aus ihren Schuhen herauskommen.
Sie war erst wenige Schritte gelaufen, da kam ihr der dicke Franz entgegen. Er wohnte im Nachbarort, und auch er war heute unterwegs, um seine Waren loszuwerden, wie sie wusste. Da er einen alten Karren und einen noch älteren Apfelschimmel besaß, war seine Runde jedoch um ein paar Kunden größer als Heidis.
Geflochtene Weidenkörbe und allerlei Krimskrams stapelten sich auf der Ladefläche. Er winkte ihr zu und brachte sein Gespann mit einem beherzten Ruck an den Zügeln zum Stehen. Am liebsten wäre Heidi einfach weitergelaufen. Schon lange hatte Franz ein Auge auf sie geworfen. Jeden Montag fing er sie auf ein Schwätzchen ab, bei dem er nicht mit Anzüglichkeiten sparte. Eine Weile lang hatte Heidi ihre Runde deswegen auf andere Wochentage gelegt, doch vor dem scheinbar allgegenwärtigen Franz schien es kein Entrinnen zu geben.
„Hallo, Schöne!“, rief er.
„Hallo, Dicker!“, antwortete sie prompt. „Bevor du mich wieder zu einem Kuss überreden willst, solltest du erst einmal diese eklige Blase an deiner Lippe behandeln. Ich hätte da eine Ringelblumensalbe. Für dich kostet sie das Doppelte, aber auf jeden Fall hilft sie, damit du nicht ganz so hässlich bleiben musst.“
Schallendes Gelächter dröhnte vom Kutschbock herunter. Heidi war klar, dass er ihre Bosheiten als kokettes Necken unter miteinander Anbandelnden deutete. Doch immer, wenn sie ihn sah, fielen ihr auf Anhieb so viele Beleidigungen ein, dass sie sie loswerden musste, egal wie sie bei ihm ankommen mochten.
Sie verkaufte ihm schließlich einen Tiegel Salbe für einen offensichtlichen Wucherpreis und entfernte sich – begleitet von Luftküssen, die er ihr lachend nachwarf. Erst, als sie hörte, wie das Klappern der Hufe immer leiser wurde, entspannte sie sich. Man hatte es nicht leicht als alleinstehende Frau.
Der Kontakt mit den Kunden im Ort verlief wesentlich erfreulicher. Sie wurde zu Kaffee und selbstgemachter Limonade eingeladen und erfuhr nach und nach den neusten Klatsch. Der Barbier betrog angeblich seine Frau mit Irmgard, der Hebamme, die vor nicht ganz einem Jahr seinen eigenen Sohn entbunden hatte. Und Richter Theobald warb inbrünstig um die jüngste Metzgerstochter Lisbeth.
„Na, wen wundert das. Das junge Ding sieht ja auch aus wie eine aus der großen Stadt“, ereiferte sich eine Kundin. „Die Haare immer fein hochgesteckt. Recht keck gibt sie sich mit den Mannsbildern. Zu fein für die Metzgerei scheint sie sich auch zu sein. Dort sehe ich immer nur ihre Schwestern arbeiten.“
Heidi seufzte. So interessant die Neuigkeiten aus dem Ort auch waren, die gehässigen und neidischen Weiber, die es bisweilen gratis dazugab, konnten einem schon auf die Nerven fallen.
An einem Montagabend, da wusste Heidi ihr kleines Häuschen am Waldrand, das etwas abseits lag und wohin sich nur selten jemand verirrte, immer besonders zu schätzen.
Es war bereits später Nachmittag, als sie den Hagnerhof, die letzte Station auf ihrer Runde, erreichte. Auf der kleinen Wiese vor dem Haus stand eine Kuh. Sie war offensichtlich trächtig. Vorsichtig näherte Heidi sich dem unruhigen Tier. Ihr Bauch war wesentlich dicker, als sie es von anderen trächtigen Kühen gewohnt war und sah seltsam deformiert aus.
Da trat die Hagnerin aus dem Bauernhaus heraus.
„Stimmt etwas nicht mit dem Tier?“, wollte Heidi wissen.
„Ja, das Kalb liegt falsch. Ich habe schon ein paarmal versucht, es zu drehen. Aber das will einfach nicht klappen. Gerade ist mein Mann los, um den Schäfer zu holen. Vielleicht kann der helfen.“
„Oh, sicherlich hat sie Schmerzen, die Ärmste.“ Vorsichtig streichelte Heidi der Kuh über den Hals, doch sie schien gar keine Gesellschaft zu wollen und zog sich deshalb in die hinterste Ecke der kleinen, eingezäunten Wiese zurück. Die Hagnerin bat sie anschließend herein und ließ sich einige Gläschen des Kräuterlikörs schmecken. Dann kaufte sie ein paar Portionen Lindenblüten- sowie Kamillentee und begleitete Heidi wieder hinaus. Als sie den Hof verließ, warf sie noch einmal einen mitleidigen Blick zur Kuh, die rastlos hin und her trottete.
Zu Hause angekommen, gönnte sie sich gerade noch eine kleine Brotzeit, wusch sich den Staub des Tages ab und ließ sich dann todmüde auf ihre Schlafstatt fallen. Sie hatte einen guten Teil ihrer Kräuter verkauft, von der Ringelblumensalbe war auch nur ein Tiegel übriggeblieben. Und den hatte der dicke Franz ja im Grunde schon mit bezahlt. Es war ein guter Tag gewesen.
Am nächsten Morgen erwachte sie, als gerade die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster schienen. Heute würde sie in den Wald gehen. Bärlauch und Waldmeister warteten darauf, von ihr geerntet zu werden. Und nach einem geschwätzigen Montag genoss sie die Stille des Waldes umso mehr.
Voller Vorfreude packte sie ihren Korb und trat von Vogelgezwitscher begrüßt hinaus. Der Wald, der direkt dort anfing, wo ihr kleiner Gemüsegarten aufhörte, empfing sie mit offenen Armen. Hier war sie zu Hause. Sie atmete tief die frische Frühlingsluft ein und lief rasch zwischen den Bäumen hindurch. Die Preiselbeersträucher kitzelten ihre Beine und hoch über sich hörte sie das Klopfen eines Spechts.
Nach einiger Zeit – ihr Korb war bereits mit etlichen Büscheln Bärlauch gefüllt – trat sie aus der Kühle des Waldes wieder hinaus auf eine Lichtung, die der Frühling in ein Meer aus Buschwindröschen verwandelt hatte. Lächelnd streifte sie ihre Schuhe ab und machte es sich auf dem weichen Bett aus Blumen bequem. Wenn die Natur einen so einlud, dann musste die Welt an sich eben warten.
Die Sonnenstrahlen liebkosten ihre Haut. Entspannt schloss Heidi die Augen.
Einige Zeit lag sie so zwischen den Buschwindröschen. Mehr und mehr kam sie zur Ruhe, und ihr Atem wurde gleichmäßig. Doch gerade als sie in einen leichten Schlaf hinüberdämmern wollte, da kitzelte etwas ihren nackten Fuß. Schläfrig blinzelte sie gegen die Sonne an, denn ihre Augen hatten sich schnell an die Dunkelheit hinter ihren geschlossenen Lidern gewöhnt. Da erblickte sie neben ihren Füßen eine große Kreuzotter, die sich durch die Buschwindröschen schlängelte. Heidi zog die Beine an, setzte sich auf und verschränkte die Arme um ihre angewinkelten Knie. Sogleich hielt die Schlange in ihrer Bewegung inne. Sie richtete ihre Augen auf Heidi, stellte den Kopf auf und züngelte ihr entgegen.
„Was willst du?“, schnaubte Heidi und zog mürrisch die Augenbrauen zusammen. Die Schlange verharrte mit immer noch aufgestelltem Haupt und schaute sie aufmerksam an. Wieder züngelte sie – fast so, als wolle sie Heidi etwas mitteilen – und verschwand dann so plötzlich wie sie aufgetaucht war wieder im Gras.
Heidi schaute ihr lange nach. Die Schlange war ein außerordentlich großes Exemplar, weshalb sie ihre Bewegungen noch weit in die Lichtung hinein verfolgen konnte, da sie Halme und Blümchen auf ihrem Weg erzittern ließ.
Sie verstand nicht, was diese Begegnung wohl bedeuten mochte. Doch es beschlich Heidi das dunkle Gefühl, dass sie nichts Gutes verhieß. Seufzend stand sie also auf, zog ihre Schuhe an und machte sich auf den Heimweg. Der Waldmeister würde noch einen Tag auf sie warten müssen.
Noch ehe sie aus dem schützenden Dickicht des Waldes heraustrat, hörte sie schon die Stimmen. Mehrere Männer mussten sich vor ihrem Häuschen aufhalten. Das dunkle Gefühl, dass sie seit dem Besuch der Kreuzotter nicht losgelassen hatte, verdichtete sich. Gerade als sie mit dem Gedanken spielte, sich einfach wieder in den Wald zurückzuziehen und den Stimmen von dort aus zu lauschen, tauchte ein Männergesicht auf und schaute um die Hausecke herum.
„Da ist sie!“, rief er und deutete mit dem Finger auf Heidi. Auf sein Kommando hin kamen sogleich mehrere bewaffnete Männer zum Vorschein – gefolgt von Hermann Theobald, dem Richter. Heidi bemühte sich, die Geringschätzung, die sie für Theobald empfand, nicht zu zeigen. Der Mann war ein selbstgerechter, hochnäsiger Mensch, der mehr Leid als Gerechtigkeit über diesen Ort gebracht hatte.
„Was kann ich für die Herren tun?“, fragte Heidi laut und energisch. Sie würde nicht vor diesem Aasgeier kuschen, auch wenn sie schon ahnte, dass er vorhatte, sie in den hiesigen See zu werfen.
„Adelheid Kramer, du wirst beschuldigt, der alten Weberin die Pest gebracht zu haben. Außerdem ist nach deinem Besuch gestern auf dem Hagnerhof eine trächtige Kuh samt Kälbchen jämmerlich verendet.“
„Die Weberin?“, stammelte Heidi betroffen. Die gutmütige, alte Frau hatte sie am Vortag noch zu selbstgemachter Limonade eingeladen. Gerne hatte Heidi dies angenommen, denn mit ihr konnte man sich immer gut unterhalten. Sie war weise und hatte mit den gehässigen Weibern vom Markplatz nichts gemein.
„Spar dir deine Betroffenheit für dein eigenes Schicksal, Kramerin. Mich täuschst du nicht.“ Der Richter trat vor. Er war etwa einen Kopf größer als Heidi und beugte sich zu ihr herunter, sodass sein Gesicht direkt vor ihrem war. Am liebsten wäre sie zurückgewichen, doch sie zwang sich, ihm fest in die Augen zu sehen und seinen zwiebel- und biergeschwängerten Atem mit steinerner Miene zu ertragen.
„Werft mich ruhig in den Weiher. Ich habe keine Angst vor dem Gottesurteil. Ich bin unschuldig“, sagte sie mit ruhiger Stimme. Theobald kam noch näher an sie heran.
„Du bekommst dein Gottesurteil, Kramerin. Wart nur ab.“ Etwas Bedrohliches schwang in seiner Stimme mit, und Heidi bemerkte aus dem Augenwinkel heraus, wie die Wachmänner unruhig von einem Fuß auf den anderen traten und betroffen zu Boden schauten.
„Legt sie in Ketten“, befahl der Richter.
„In Ketten?“ Heidi verfiel in ein lautes, gackerndes Lachen. „Haben fünf starke Männer so viel Angst vor einem Weib, dass sie es in Ketten legen müssen?“
Mit einem geringschätzigen Blick wandte Theobald sich ab. Als zwei der Wachmänner an sie herantraten, hielt sie ihnen bereitwillig ihre Hände entgegen.
„Tut mir leid, Heidi“, murmelte einer von ihnen kaum hörbar. Dem Richter würde es auch noch leidtun, so wahr sie Adelheid Kramer hieß.
Die traurige Prozession, die Herrmann Theobald erhobenen Hauptes anführte, lockte schnell die Leute aus dem Ort an. Aus jedem Haus, das sie passierten, kamen sie mit unverhohlener Neugier heraus, gafften und tuschelten und riefen weitere Schaulustige herbei. Bis sie die Arrestzelle erreicht hatten, hatte sich längst ein Menschenauflauf gebildet, der wie eine wogende Traube hinter Heidi her waberte. Der Richter wandte sich den Leuten zu, die die Weite des Marktplatzes sogleich nutzten, um einen Halbkreis zu bilden. Theobald genoss sichtlich die Aufmerksamkeit und reckte stolz sein Kinn vor, während er seinen Blick langsam über die Menge gleiten ließ. Dann hob er gebieterisch den Arm und die Menschen verstummten.
„Adelheit Kramer ist angeklagt, die trächtige Kuh des Hagnerbauern samt Kälbchen mit ihren teuflischen Hexenkünsten getötet zu haben.“
Ein Raunen ging durch die Menge.
„Damit hat sie nun endgültig den Zorn des Herrn auf uns gelenkt. Die Gottesfürchtigen unter Euch haben es sicher kommen sehen, und jetzt ist es passiert. Er hat uns die Pest ins Dorf geschickt, um uns dafür zu bestrafen, dass wir die Hexe so lange in unserer Mitte geduldet haben!“
Einige der Zuhörer schlugen sich erschrocken die Hand vor den Mund. Aus großen Augen blickten sie erwartungsvoll zu Heidi und verfolgten ihre Reaktion. Die seufzte demonstrativ, um zu zeigen, wie müßig sie die ganze Situation fand.
„Das stimmt natürlich nicht“, sagte sie.
Was für ein Theater, dachte sie bei sich. Der Richter würde sicherlich gleich ein Gottesurteil fordern, sie würden zum Weiher am Ortsrand pilgern, er würde sie gefesselt hineinwerfen, feststellen, dass sie unterging – wie es eben die Gesetze der Natur erforderten – und dann würde man sie schnell wieder herausziehen, bevor sie zu viel Wasser schluckte. Sie wäre durchnässt, der Mob befriedigt und ihr Ruf wiederhergestellt. Wenn diese einfältigen Menschen dieses Spektakel unbedingt brauchten, dann sollten sie es eben bekommen.
„Gott wird uns zeigen, ob du schuldig bist oder nicht“, rief Theobald erwartungsgemäß. „Doch diesmal wird es keine Wasserprobe geben.“
Verdutzt schaute Heidi auf. Damit hatte sie nicht gerechnet. Was hatte Richter Theobald vor? Nach dem boshaften Funkeln in seinen Augen zu urteilen, konnte es nichts Gutes sein.
„Heute Abend wirst du eine Feuerprobe machen, Kramerin. Und wenn dein Gewissen so rein ist, wie du behauptest, dann wird Gott dich schützen und die Flammen werden dir nichts anhaben können.“
Wieder tuschelte und raunte die Menge. Vermutlich freute sich der ein oder andere sogar über diese überraschende Wendung, die der Langeweile des tristen Alltags für heute ein Ende setzte. Heidi war sich sicher, dass keiner im Ort die Feuerprobe verpassen würde.
Da sah sie am anderen Ende des Marktplatzes den dicken Franz, wie er sich mit mitleidigem Blick abwandte und kopfschüttelnd entfernte, statt zu geiern und zu glotzen wie die anderen. Und für einen kurzen Moment lang vergaß Heidi wie zuwider er ihr immer gewesen war.
Ein triumphierendes Lächeln umspielte Theobalds Lippen, als er die Zellentür hinter ihr verschloss. Heidi fühlte sich benommen. Er hatte sie völlig überrumpelt. Ihre Selbstsicherheit musste diesen Schlag erst einmal verdauen.
Langsam ließ sie sich auf dem kalten Boden der Zelle nieder und dachte fieberhaft nach. Hermann Theobald durfte nicht gewinnen. Das war sie nicht nur sich selbst schuldig.
Nur wenige Stunden würden Heidi bis zur bevorstehenden Feuerprobe bleiben. Vermutlich waren die Männer des Dorfes bereits dabei, einen Reisighaufen aufzuschichten. Oder würde sie über glühende Kohlen laufen müssen? Schon allerlei dieser grausigen Varianten waren Heidi im Laufe der Zeit zu Ohren gekommen.
Sie mochte es sich zwar nicht eingestehen, doch sie fürchtete sich vor dem, was ihr bevorstand. Vor ihrem geistigen Auge sah sie Richter Theobald, wie er schmunzelnd ihre Zellentür verschlossen hatte. Sie würde sich für seine Grausamkeit und seine Hinterlistigkeit an ihm rächen. Diese Gedanken an Rache gaben ihr Ruhe und besiegten schließlich Heidis Angst.
Als die Wachmänner, die sie hergebracht hatten, zurückkehrten, um sie zu holen, hatte sie sich wieder so weit unter Kontrolle, dass sie ihnen entgegenlächelte. Ja, sie würde leiden müssen, daran hatte sie keinen Zweifel, doch Hermann Theobalds Leid würde das ihre in den Schatten stellen. Dieser Narr hatte sich mit der Falschen angelegt.
Neben dem Weiher, in dem sonst immer die Wasserproben stattfanden, hatten sie tatsächlich einen Haufen aus Reisig und trockenem Blattwerk aufgeschüttet. Die Flammen leckten bereits an den unteren Ästen und machten sich daran, den Haufen zu erobern. Daneben stand Theobald mit zufriedener Miene, und auch zahlreiche Schaulustige hatten sich eingefunden.
Heidi wurde direkt zum Richter geführt. Als sie die Selbstgefälligkeit in seinen Zügen sah, senkte sie ihren Kopf und schaute zu Boden. Noch musste sie Ruhe bewahren.
Von irgendwoher drangen in unregelmäßigen Abständen Peitschenhiebe an ihr Ohr. Sie musste nicht aufsehen, um zu wissen, dass einige einfältige Geschöpfe wohl damit begonnen hatten, sich selbst zu geißeln, um Gottes angeblichen Zorn zu besänftigen und die Pest wieder aus dem Dorf zu scheuchen.
Traurig dachte sie an die Weberin. Egal wie es heute mit Heidi ausging, die nette alte Frau war verloren. Während Heidi so im Nachhinein über ihre letzte Begegnung nachdachte, musste sie zugeben, dass sie geschwächt gewirkt hatte. Doch an eine mögliche Pestinfektion hatte sie natürlich nicht gedacht. Spätestens der Aderlass hätte allerdings die letzte Kraft aus ihrem Körper geholt und sie dahingerafft.
Da fiel Heidis Blick auf das Hemd, das Theobald in seinen Händen hielt: Es war gelb, fleckig und der Stoff stand nahezu starr in seiner Form. Der Richter bedeutete den Wachleuten, Heidi die Fesseln abzunehmen. Die Hände der Männer zitterten.
„Zieh dich bis auf den Unterrock aus“, befahl Theobald, während sie sich die schmerzenden Handgelenke rieb. Überrumpelt wich Heidi einen Schritt zurück.
„Los, zieh dich aus!“, rief der Richter erneut. „Statt deines Kleides wirst du dieses Wachshemd tragen.“
Da erkannte Heidi schaudernd, dass das Leinen des Hemdes mit Bienenwachs getränkt war. Es würde brennen wie Zunder – und sie mit ihm.
„Das kann doch nicht Euer Ernst sein!“, schrie sie. Die Verzweiflung, die sie in ihrer Zelle nur mühsam besiegt hatte, war zurück.
„Vertrau auf Gott“, antwortete er kühl. „Bist du unschuldig, wird er nicht zulassen, dass dir ein Leid geschieht.“
Fassungslos packte Heidi den Stoff ihres Kleides, als wolle sie es festhalten. Doch auf Theobalds Zeichen hin, waren die Wachmänner zurück. Sie hielten ihr die Arme auf den Rücken gepresst fest. Sogleich zückte der Richter ein Messer und schnitt Heidis Kleid auf, um sie vor den versammelten Dorfbewohnern zu entblößen. Sensationslüstern glotzten sie auf Heidis nackte Brüste. Und Theobald ließ sich Zeit, ihr das Wachshemd überzustreifen.
Heidi wand sich im Griff der Wachmänner, bis sie sie endlich losließen. Schwer atmend schaute sie in die Runde. Sie suchte ein bestimmtes Gesicht – ein Gesicht, das ihr helfen würde, ihre Rache zu üben. Und gerade als sie es erblickte, hörte sie Theobald wie auf ein Stichwort hin rufen: „Willst du noch etwas sagen, Kramerin, bevor du dein Leben in Gottes Hände legst?“
„Ja, das will ich.“ Heidi stellte sich in die Mitte des Halbkreises, den die Menge bildete, sodass jeder sie gut sehen konnte.
„Jeder ist, was er ist. So auch ich.“
Die Zuschauer schauten gebannt auf die kleine Frau im Wachshemd. Sie hatte die volle Aufmerksamkeit.
„Ja, ich bin eine Hexe!“, schrie Heidi so laut sie konnte. „Und ich danke Lisbeth, meiner Meisterin, von ganzem Herzen, dass sie mich zu einer gemacht hat. Ohne sie hätte ich die dunklen Künste niemals kennengelernt!“ Mit einer theatralischen Geste verneigte sie sich in die Richtung, in der sie die schöne Metzgerstochter erblickt hatte.
Schnell drehten sich die Umstehenden zu Lisbeth um, die erschrocken die Augen aufriss und die Hände hob, als wolle sie Heidis verleumdende Worte abwehren. Doch Heidi richtete all ihre Konzentration auf Lisbeth. Als diese die Lippen öffnete, um sich zu rechtfertigen und sie der Lüge zu bezichtigen, da ließ Heidi statt Worten dicke Maden und Kakerlaken aus ihrem Mund quellen.
Angewidert und geschockt wichen die Menschen vor ihr zurück. Männer fluchten, Weiber kreischten und die Kinder flohen unter die Röcke ihrer Mütter. Das Antlitz der schönen Metzgerstochter war von Ekel und Fassungslosigkeit verzerrt. Immer mehr Maden quollen hervor, schüttelten den würgenden, zarten Körper, sodass sie sich kaum auf den Beinen halten konnte. Kakerlaken krabbelten in ihren Haaren und Röcken herum und bedeckten bald den Boden zu ihren Füßen wie ein wuselnder Teppich.
Nur mit Mühe unterdrückte Heidi ein Grinsen, als sie sich wieder dem Richter zuwandte. Krumm und gebückt stand der eben noch allzu selbstsichere Mann da, die Wangen hohl und sein Blick trüb. Er schien in den letzten Sekunden um Jahre gealtert zu sein, und Heidi meinte gar, das Krachen seines brechenden Herzens hören zu können.
Die Dorfbewohner rannten kopflos durcheinander und Lisbeth war zitternd zu Boden gegangen. Ihre wohlgeformte Silhouette war unter dem Haufen an Insekten, die sich auf ihr tummelten, kaum noch zu erkennen.
Einige Bauern überwanden ihre Panik und griffen zu Kerzen und Fackeln, die beim Entzünden des Feuers übriggeblieben waren, und machten sich daran, Lisbeth mit samt ihres Maden- und Kakerlakenbetts anzuzünden. Richter Theobald schrie krächzend auf und seine Stimme ähnelte mehr der eines Tieres als der eines Menschen. In wilder Raserei stürzte er sich auf die Bauern und war schon bald in eine Keilerei verstrickt, wie man sie sonst nur auf dem Jahrmarkt zu sehen bekam.
Gerne hätte Heidi noch länger zugesehen und ihren Triumpf ausgekostet, doch plötzlich hörte sie jemanden ihren Namen rufen. Sie erkannte die Stimme ihres Geliebten sofort, obwohl sie nur leise durch den Lärm des Tumults an ihr Ohr drang. Sie erblickte ihn mitten in den Flammen, die inzwischen zu einem stattlichen Feuer angewachsen waren und hoch in den Himmel loderten. Ruhig stand er da, streckte ihr seine glühende Hand entgegen und rief sie zu sich.
Langsam näherte Heidi sich dem Feuer. Seine Hitze schlug ihr entgegen, und sie hob schützend den Arm vors Gesicht. Da packte der Geliebte Heidis Handgelenk. Der Griff seiner Feuerhand brannte sich in ihr Fleisch und der Schmerz drohte sie um den Verstand zu bringen. Dennoch zog er sie erbarmungslos an sich, hüllte sie ein in Feuer und Pein. Das Wachshemd brannte sofort lichterloh und Heidis langes Haar ging in einer einzigen großen Stichflamme auf. Heidi schrie wie sie noch nie in ihrem Leben geschrien hatte, während das Feuer gierig an ihrem Körper leckte und ihre Haut begann, Blasen zu werfen.
Doch inmitten dieses infernalen Chaos' wiegte ihr Geliebter sie in seinen Armen hin und her, wie eine Mutter ihr Kind. Und als sie sich ihm – von Schmerz und Erschöpfung übermannt – hingab und aufhörte, gegen die Qualen anzukämpfen, da spürte sie das Feuer plötzlich nicht mehr.
Heidi streifte ihren verkohlten Körper ab wie ein altes Kleid. Sie überließ ihn den Flammen und tanzte mit ihrem Geliebten leicht und frei in die hereinbrechende Nacht.
An fremden Gestaden
Sie stand erhöht und hatte den Blick zum Himmel gehoben. Ihr Kleid umspielte locker ihre Hüften. Es strahlte in allen Nuancen des Sonnenuntergangs: Orange, Rot, Purpur, Sonnengelb. Ihr Haar hatte die Farbe von Herbstlaub und es kräuselte sich im Wind, umrahmte ihr Gesicht und floss ihr über die Schultern den Rücken hinunter. Unter ihren Schuhen – dort, wo ihre Füße eigentlich den Boden berühren sollten – lagen aufgeschichtete Holzscheite.
Der Scheiterhaufen brannte bereits. Die Flammen züngelten nach ihr, begierig darauf, sie zu verzehren. Sie griffen nach dem Saum ihres Kleides und fügten seinem Farbenspiel den Rotton von Feuer hinzu. Sie stand ganz still, bewegte sich nicht. Nur ihr Blick senkte sich. In der Tiefe ihrer smaragdgrünen Augen war Verzweiflung zu lesen.
Die Flammen fraßen sich durch den feinen Stoff. Sie versengten die zarte weiße Haut. Es zischte, als sie die darunterliegenden Schichten freilegten. Von ihrem Fleisch genährt, schlug das Feuer höher. Sie trübten die Sicht auf ihr Antlitz, das – immer noch reglos – keinen Schmerz verriet. Nur durch ihre Augen sprach sie. Ihr Blick schrie.
Liams Magen zog sich vor Hunger zusammen. Der Vater stellte einen fast leeren Topf auf den Tisch. „Mehr gibt's nicht“, konstatierte er überflüssigerweise.
Missmutig begann Liam, die dünne Brühe aus Kartoffelschalen aus seiner Schüssel zu löffeln. Abfälle, die sie früher den Hühnern gegeben hatten, dienten ihnen nun schon eine Weile selbst als Nahrung. Die Suppe schmeckte fad. Um zumindest ein bisschen satt zu werden, zerteilte Liam den trockenen Brotranken, den ihm der Vater noch zugeteilt hatte, und weichte die Brocken in der fast klaren Suppe ein.
Sie saßen um einen alten Holztisch. Über ihnen hing eine Öllampe und spendete ihr schwaches Licht. Liams Hände waren rau, die Nägel schwarz von der Erde. Er hatte sich seit er vom Torfstechen hereingekommen war noch nicht gewaschen. Sein Rücken schmerzte.
Liam und sein jüngerer Bruder Glyn aßen schweigend. Der Vater hungerte. Er nahm einen Teil der Suppe und brachte ihn hinüber in die Nische, in der im Halbdunkel auf dem Strohsack die Mutter vor sich hin dämmerte.
„Du musst etwas essen“, hörte Liam den Vater sagen. „Du musst doch wieder zu Kräften kommen.“
Das Baby begann zu wimmern. Auch das jüngste Kind des Torfstechers, gerade erst ein paar Tage alt, litt schon Hunger. Der Vater nahm das schreiende Bündel hoch und trug es ein wenig herum. Er schaukelte das Baby unbeholfen. Mehr konnte er nicht tun.
Liam äugte besorgt hinüber zur Bettstatt. Wenigstens hatte die Mutter sich etwas aufgerichtet und schlürfte die dünne Suppe aus der Schüssel.
„Wie soll das nur weitergehen?“, murmelte Liam leise vor sich hin. Er hatte nur für sich sprechen wollen, doch der Vater hatte ihn gehört.
„Was soll schon werden, Junge?!“, fuhr er ihn an. „Was aus uns wird, schert nicht einmal den Teufel!“
„Aber jemand muss doch ...“
Der Vater blieb stehen und seine dunklen Augen funkelten Liam an. „Niemand wird etwas tun. Zur Hölle oder nach Connacht – so war das schon immer. Ob wir hier leben oder verrecken, das juckt die feinen Herren in Dublin kein bisschen. Merk dir das!“
Es war nun schon das dritte Jahr in Folge, in dem die Ernten fast vollständig ausgefallen waren. In London, vor allem aber in Dublin, sprach man bereits von der größten Hungerkatastrophe, die Irland jemals erlebt hatte. Hier, im Westen der Insel, redete man längst nicht mehr – die Fischer, Bauern und Torfstecher von Connacht kämpften um ihr nacktes Überleben.
Und jeden Tag verlor ein anderer diesen Kampf.
Über den kleinen Friedhof hinter der Kirche Sankt Patrick pfiff der eisige Wind. Einer nach dem anderen schob sich die kleine Trauergemeinde an Liam, seinen Geschwistern und dem Vater vorbei. Die meisten der Nachbarn und Dorfbewohner schüttelten dem Vater schweigend die Hand.
„Mein Beileid, Donnellan. Die hat's hinter sich.“ Burke, ebenfalls Torfstecher und Nachbar von Liams Familie, klopfte ihm auf die Schulter. Fast schien es, er bedauere die Lebenden mehr als die Toten.
Seine Frau beeilte sich zu sagen: „Brauchst du was, Donnellan? Was ist mit den Kindern?“
Sie waren die Letzten zwischen den schiefen Kreuzen und alten Steinen. Die Totengräber machten sich bereits an ihre Arbeit, den dunklen Haufen Erde in das Loch zurückzuschaufeln. Ein paar Schneeflocken wirbelten durch die kalte Luft.
Der Vater brummte: „Wird schon. Danke.“
„Was für ein Elend“, seufzte die Nachbarin noch.
Der Vater zuckte nur die Schultern.
„Sei bloß froh, dass das Kleine gleich mitgegangen ist. Stell dir mal vor, du hättest jetzt auch noch einen Säugling zu versorgen“, fuhr die Frau fort. „Die Mäuler, die du zu stopfen hast, reichen auch so.“
Der Vater nickte trübe.
Liam hielt das Gespräch nicht mehr länger aus.
„Sie war meine Mutter!“, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Der Wind und die Verzweiflung trieben ihm die Tränen in die Augen.
„Natürlich war sie das, Junge“, versicherte die Nachbarin rasch und wollte ihm die Wange tätscheln, doch Liam drehte rasch den Kopf zur Seite.
In der Nacht nach dem Begräbnis der Mutter begannen die Albträume.
Liam sah eine junge Frau: Wunderschön und von eleganter Gestalt. Ihr Haar war feuerrot und fiel ihr in wilden Kaskaden über den Rücken. Ihre Haut war weiß wie Milch und wirkte so weich wie Seide. Frauen von solcher Anmut und Schönheit gab es nicht in dieser Gegend. Eine schönere Erscheinung hatte Liam nie gesehen. Eine Prinzessin, oder gar eine Göttin vielleicht!
Dann wandte sie ihm das Gesicht zu. Liam sah die Qual in ihrem Blick. Sie brannte. Ihre Kleider standen in Flammen. Sie leckten an ihrer makellosen Haut und griffen nach den Locken. Plötzlich war das Feuer überall. Es zischte und knisterte.
Liam wollte die Schöne retten, doch der Qualm und die Flammen ließen ihn nicht zu ihr vordringen. Hilflos musste er mit ansehen, wie das Feuer sie verzehrte. Sie schrie nicht.
Während die lodernden Massen ihr das Fleisch von den Knochen lösten, blickte sie Liam unverwandt an. Nur ihre Augen sprachen von den Schmerzen, die sie litt. Dann fraßen die Flammen auch ihr Gesicht.
Schweißgebadet schreckte Liam hoch.
Es war schwarze Nacht. Das Feuer war verschwunden. Und doch tanzten die züngelnden Flammen noch vor seinem geistigen Auge. Sein Atem ging flach und stoßweise.
Neben ihm wälzte sich der Vater auf dem Strohsack herum. „Was ist?“, murmelte er verschlafen.
Liam stand noch ganz im Bann der entsetzlichen Bilder, die ihn heimgesucht hatten. Er war unfähig zu antworten. Wie sollte er in Worte fassen, was er eben gesehen hatte?
„Schlaf!“, wies ihn der Vater an, der ihm ansehen musste, was los war. „Du hast sicher bloß geträumt.“
Liam legte sich wieder hin. Doch er fand keine Ruhe. Sobald er die Augen schloss, kamen die Bilder zurück.
Von da an sah er sie jede Nacht. Wenn der Vater das Licht in der Stube löschte und die Geschwister sich aneinander kuschelten, dann drang das schöne Mädchen wieder in Liams Sinne. Und jede Nacht sah er sie aufs Neue im Feuer sterben.
Als die Tage länger wurden, der Frühling über das Land kam und die frische Saat die Felder mit einem zarten Grün überzog, schöpften die Menschen auch in Connacht wieder Hoffnung. Sie hatten den Winter überlebt. Vielen anderen war dieses Glück nicht vergönnt gewesen.
Während des Sommers schlief Liam traumlos. Er hatte die schöne Frau so lange nicht mehr in seinen Träumen gesehen, dass er begann, sie zu vermissen. So grauenhaft die Träume gewesen waren, so sehr sehnte er sich nach dem inzwischen so vertrauten Gesicht, ihrer zarten Haut und den wilden Locken. Einmal würde es ihm gelingen, sie zu retten, dachte er.
Er versuchte die Erinnerung an sie wachzuhalten, indem er sie malte. Mit einem dünnen Ästchen zeichnete er ihr Antlitz in den losen Sand, mit einem Messer schnitzte er es in die Rinde eines Baumes. Doch sie kam nicht zu ihm zurück.
„Was machst du denn?“, fuhr der Vater Liam an. „Träumst du am helllichten Tag?“
Liam sah ihn erschrocken an. Da er wieder an die schöne Rothaarige dachte, hatte er darüber ganz seine Arbeit vergessen.
„Entschuldige ...“, murmelte er.
Der Vater stützte sich auf den Schaufelstiel und streckte den krummen Rücken durch. „Nimm das Stecheisen und mach die Sode fertig“, wies er Liam an.
Glyn zerrte gerade den leeren Torfkarren heran. Seufzend griff Liam nach der Stieke und nahm die Arbeit wieder auf. Als der Karren voll war, warf er das Werkzeug obenauf und sie setzten sich in Bewegung zurück ins Dorf. Glyn konnte vor Erschöpfung keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Liam hob ihn deshalb auf den Karren, und obwohl ihn selbst alle Glieder schmerzten, zog er den Wagen mit seinem Bruder zum Trockenplatz und lud den frischen Torf ab.
Dann kam der Herbst und mit ihm die Gewissheit, dass es wieder keine gute Ernte geben würde. Viele Bauern hatten keine Kartoffeln mehr setzen können, weil sie die Saatknollen im Winter hatten essen müssen. Was auf dem Feld gelandet war, verfaulte in der Erde. Irgendetwas befiel die Knollen.
„Ich hab so Hunger“, flüsterte Glyn.
„Ich weiß“, erwiderte Liam. „Ich auch.“ Trotzdem schob er den Rest seines Brotes dem Jüngeren hin.
Der Vater zog die Jacke an – das einzige wirklich warme Kleidungsstück, das er besaß.
„Wo gehst du hin?“, fragte Liam.
„Zu den O'Flaterys hinüber. Vielleicht kann ich noch ein paar Kartoffeln von ihnen erbetteln.“
Liam wusste, wie viel Überwindung es den Vater kosten musste, auf dem Gutshof um Almosen zu bitten.
Er erhob sich. „Lass mich das machen.“ Damit nahm Liam dem Vater entschlossen die Jacke aus der Hand und warf sie sich über. Der Vater ließ ihn gewähren.
Draußen lag ein wenig Schnee. Der volle Mond beleuchtete die Landschaft. Liam lief querfeldein. Die O'Flaterys bewirtschafteten den größten Hof in der Gegend. Liam stellte sich vor, dass es in dem Gutshaus Kerzen aus Wachs geben musste und einen Tisch mit einem weißen Tuch darauf. Auf diesem würden Schüsseln voller Speisen stehen, genug für alle, die an dem großen Rund Platz nahmen. Liam malte sich Fleischberge und riesige Schüsseln voller Kartoffeln aus, und alles troff nur so von fettiger Soße. Sein hungriger Magen zog sich beim Gedanken daran zusammen.
Doch als er den Hof der O'Flaterys erreichte, zerplatzte sein Wunschtraum jäh. Der Leichenwagen stand im Hof. Im Näherkommen sah Liam den Dorfarzt aus dem Gutshaus kommen. Er hielt sich ein Taschentuch vor Mund und Nase. Liam duckte sich in den Schatten der Hauswand.
„Verbrennen Sie alles, was mit dem Körper der Toten in Berührung gekommen ist. Und dann beten Sie. Mehr können wir nicht tun“, hörte er den Arzt sagen, bevor er in die Dunkelheit davoneilte. Die Leichenträger brachten einen in Leinen gewickelten Körper aus dem Haus und luden ihn hinten auf den Wagen auf. Dann fiel die Tür ins Schloss.
Liam zögerte noch, ob er hingehen und klopfen sollte, da schnappte er das Gespräch der Leichenträger auf. „Das war jetzt die dritte Fuhre diese Nacht. Mir reicht's. Wenn das so weitergeht, dann gibt's bald keine O'Flaterys, Burkes und O'Shaughnesseys mehr in der Gegend.“
„Das ist erst der Anfang, wart's nur ab. Das Fieber verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Es gibt jetzt schon mehr Tote als Lebendige hier.“ Der Sprecher zog die Plane über die Leiche und zurrte sie fest. Dann schwang er sich zu seinem Kameraden auf den Kutschbock und schnalzte mit der Zunge. „Heija! Zieh an, Braune. Machen wir, dass wir von hier wegkommen.“
Liam sah ihnen hinterher, wie sie durch das Tor schaukelten und in der Nacht verschwanden. Er wagte es nicht mehr, bei den O'Flaterys zu klopfen. Mit hängendem Kopf kehrte er nach Hause zurück.
Der anhaltende Regen verwandelte die Wege in Morast. Die Kälte kroch durch alle Ritzen bis hinein in die Stube. Das Fieber, das die O'Flaterys heimgesucht hatte, breitete sich tatsächlich weiterhin in der Gemeinde aus. Man sah schon bald den Dorfarzt und den Leichenwagen vor jedem Haus halten.
Der Vater hatte seine Söhne auf den Markt geschickt, um Torf feilzubieten, während er selbst versuchte, das Dach auszubessern, durch das der Regen in die kleine Kate drang. Nass bis auf die Haut, mit klappernden Zähnen und knurrenden Mägen, kehrten die Brüder zurück. Sie hatten kaum etwas verkaufen können. Lebensmittel fehlten an allen Ecken und Enden, Torf hingegen gab es in Connacht genug.
Der Vater schürte das Feuer im Kamin und wies die beiden an, die nassen Sachen auszuziehen und sie in die Nähe zu hängen. Im Kessel kochten ein paar Rüben zur Suppe.
„Die Burkes können die Pacht nicht mehr bezahlen“, brummte der Vater.
Liam sah ihn erschrocken an. „Und was passiert jetzt mit ihnen?“
„Was schon? Sie verlieren den Hof. Erst lässt man uns hungern und dann jagen sie uns davon.“ Der Vater setzte sich, um die nassen Stiefel aufzuschnüren. „Wir müssen die Tür in der Nacht gut verriegeln. Es ziehen bereits zu viele Vertriebene herum.“
Liam stellte den Kessel auf den Tisch und scheuchte Glyn auf seinen Platz. Als sie die Hände falten wollten, um das Tischgebet zu sprechen, herrschte der Vater die Brüder an: „Lasst das! Gott hat Irland längst verlassen.“
In der Nacht kehrte Liams Traum zurück. Soweit er blicken konnte, sah er nichts als lodernde Flammen. Rot, Orange und Gelb. In ihrer Mitte, dort wo ihre Zerstörungskraft am stärksten war, stand sie wie eine lebende Fackel umgeben von bläulich gleißendem Weiß. Liam konnte nichts tun. Sie war verdammt dazu, in seinen Träumen immer wieder aufs Neue aufzuerstehen, nur um dann erneut in der Höllenglut zu verbrennen.
Als er erwachte, spürte er die Hitze der Flammen immer noch. Doch es war nicht das Feuer aus seinem Traum, von dem die Hitze ausging. Es war Glyn. Der Jüngste glühte vom Fieber. Die ganze Nacht versuchten Liam und sein Vater verzweifelt, das Fieber zu senken. So sehr sie sich jedoch auch mühten, die Hitze mit kalten Umschlägen und Wickeln zu lindern, sie ließ sich nicht bezwingen. Glyn warf sich im Delirium von einer Seite zur anderen. Liam wachte am Bett des Bruders und als ihm kein anderer Rat mehr einfiel, begann er heimlich zu beten.
Erst als ein fahler Morgen über dem kleinen Haus des Torfstechers dämmerte, fiel Liam wieder in einen unruhigen Schlaf. Sofort waren die Flammen zurück. Die Rothaarige streckte die Arme nach Liam aus. Ihre Haut war aufgeplatzt. Die Augen flehten ihn an, ihr zu helfen.
Schwer atmend und schwitzend fuhr Liam wieder aus dem Schlaf hoch. Da fand er den Bruder leblos neben sich liegen. Liam packte ihn bei den Schultern und rüttelte ihn. Seine Haut fühlte sich feucht und kühl an. Das Fieber war fort, wie überhaupt jede Wärme dem kleinen Körper entwichen war. Sein Herz hatte aufgehört zu schlagen.
Nach Glyns Tod träumte Liam jede Nacht von der Rothaarigen. Er sah sie brennen, mühte sich darum, das Feuer zu löschen und die Flammen zu ersticken, doch sie loderten immer wieder von Neuem auf. Nacht für Nacht musste er mit ansehen, wie ihr Haar Feuer fing, bis ihr ganzer Kopf einer Fackel gleich aufleuchtete und die feinen Gesichtszüge der jungen Frau zur Fratze verkohlten. Selbst am Tag glaubte er noch das Knacken und Knistern des Feuers zu hören.
Die Trauergemeinde auf dem Friedhof war klein, als der Leichnam des jüngsten Torfstechersohns der Erde übergeben wurde. Von den einstigen Nachbarn ließ sich niemand mehr blicken. Sie waren entweder fort oder hatten selbst genug Tote zu beklagen. Der Priester schlug das Kreuzzeichen, nickte Liam und seinem Vater kurz zu, dann hastete er davon – er hatte noch weitere Gräber zu versehen.
Der Vater verfiel in verbittertes Schweigen. Es war jetzt leerer und leiser in der Stube als je zuvor. Sie verrichteten ihre Arbeit, weil sie nicht wussten, was sie sonst tun sollten. Noch einmal packte Liam den Karren voll und fuhr damit zum Markt.
Als er von dort zurückkehrte, wo er vergeblich versucht hatte, für den getrockneten Torf Lebensmittel einzutauschen, erkannte er sofort, dass etwas an der kleinen Kate, die er nun mit dem Vater allein bewohnte, nicht stimmte: Rauch stieg auf, aber nicht aus dem schiefen Kamin, sondern vom Reetdach.
Liam ließ den Karren stehen und rannte nach Hause. Es war zu spät. Eine Meute Verzweifelter, die – da sie sowieso schon außerhalb des Gesetzes standen – keine Gerichtsbarkeit mehr fürchteten, war in den kleinen Hof eingefallen. Und da sie nichts Essbares oder Wertvolles finden konnten, hatten sie wohl kurzerhand alles in Brand gesetzt.
Das Feuer fraß sich rasend schnell durch das Torflager und das trockene Strohdach. Den Brand zu löschen war unmöglich. Es war, als wäre Liam am helllichten Tage in seinen Albtraum hinein katapultiert worden. Er suchte den Vater, doch er konnte ihn nirgends finden. Wie von Sinnen schrie er nach ihm. Hatten sie ihn mitgenommen und verschleppt?
Weil er ihn draußen nicht entdeckte und er auf sein Rufen nicht reagierte, schützte Liam Mund und Nase mit einem feuchten Lappen von einer Regentonne im Hof, dann stürmte er in das brennende Haus. Dort fand er den Vater. Erschlagen in seiner Blutlache.
Das kleine Haus brannte restlos nieder. Nur ein paar verkohlte Balken zeugten noch davon, dass hier irgendwann einmal eine Familie gelebt hatte.
Liam saß lange hinter den glimmenden Resten seines Elternhauses und starrte vor sich hin, nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Die Kälte, die ihm in die Glieder kroch, holte den Jungen schließlich ins Hier und Jetzt zurück. Plötzlich wurde ihm bewusst: Wenn er nicht verhungern oder erfrieren wollte, musste er fort – fort aus Connacht, fort sogar aus Irland!
Queenstown, die Stadt der Königin, war noch viel größer, als er sie sich vorgestellt hatte. Und die Häuser am Hafen waren aus Stein! Liam dachte, dass es hier anders sein musste. Bestimmt gab es noch ausreichend zu essen, hatten die Menschen doch ein gut geregeltes Auskommen. Vielleicht war es gar nicht nötig, dass er das Land verließ, seine Heimat, alles, was er kannte. Vielleicht könnte er einfach hierbleiben?
Dann sah er den alten Mann. Er musste auf allen Vieren kriechen; ihm fehlten beide Unterschenkel. Die brandigen Stümpfe hatte er nur notdürftig in Lumpen gewickelt. Als er Liam ansichtig wurde, streckte er die rechte Hand zu ihm aus. Mit der linken stützte er sich auf dem lehmigen Boden ab. „Cuidich“, bat er. Hilf mir!
„Ich hab nichts“, sagte Liam und seine Hand umklammerte instinktiv den Beutel an seinem Gürtel fester. „Wirklich. Ich hab selber nichts.“
Die knochige Hand des Alten schloss sich mit erstaunlicher Kraft um seinen Knöchel. „Cuidich“, wiederholte er.
Liam sah, dass er kaum noch einen Zahn im Mund hatte. Ein fauler Geruch von Verwesung entströmte dem geschundenen Körper. Es war Liam, als blicke er durch die glasigen Augen des Bettlers direkt in sein eigenes Grab.
Panisch riss er sich los und rannte die Straße hinunter zum Pier. Er hatte sich geirrt. Queenstown war genau wie alle anderen Städte Irlands: Sie war verflucht. Der Hunger, das Elend, der Tod – sie lauerten überall. Liam konnte nirgends sicher sein. Er musste auf eines der Schiffe; koste es, was es wolle.
Der Blick des Kapitäns glitt zweifelnd an der ausgehungerten Gestalt des Jungen hinunter. „Was soll ich denn mit dir?“, fragte er halb belustigt, halb verärgert.
„Ich kann arbeiten“, beharrte Liam. Er legte mehr Überzeugung in seine Worte, als er derzeit selbst empfand.
„Das können andere auch“, erwiderte der Kapitän ungerührt. „Weißt du, Bürschlein, wie viele Freiwillige ich derzeit rekrutieren könnte? Jeder will weg. Und du, du bist ja noch ein halbes Kind!“
Liam richtete sich zu seiner vollen Größe auf. „Ich bin kein Kind mehr. Ich habe schon siebzehn Sommer gesehen. Und drei vermaledeite Winter ohne Essen!“ Er hatte sich älter gemacht, als er war, um dem Kapitän die Stirn zu bieten.
„Siebzehn, hm?“, brummte der gelangweilt. „Und was willst du in Amerika?“
„Sie sagen, dort kann ein Mann sein Glück machen, wenn er ...“, begann Liam, doch das schallende Gelächter des Seemanns ließ ihn sofort verstummen.
„Dein Glück willst du machen? Für euch irisches Bettelpack gibt es kein Glück zu machen. Weder hier noch anderswo!“
So wie bei seinem ersten Versuch, eine Überfahrt nach Amerika zu bekommen, erging es Liam noch öfter. Keiner hatte Lust, einen Jungen – eine Waise, halbverhungert und ohne einen Penny in der Tasche – auf sein Schiff zu lassen. Doch eines hatte Liam gelernt: Er war zäh. Am Ende gelang es ihm doch, anzuheuern. Das Schiff war ein kleiner Schoner namens Phoenix, alt und in keinem besonders guten Zustand, aber Liam war nicht wählerisch.
Die Überfahrt erwies sich schlimmer als alles, was Liam sich ausgemalt hatte. Tagelang durften sie nicht an Deck. Oben heulte der Sturm um die Masten und riss an der Takelage. Es regnete unaufhörlich – so als ob der Himmel all seine Schleusen geöffnet hätte, um die Sintflut über sie auszukippen. Die erfahrensten Matrosen konnten nur ihrer Arbeit nachgehen, indem sie sich mit einem Strick um den Leib sicherten.