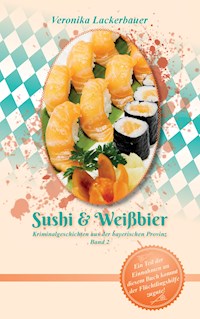Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Licht und Schatten - Band 1
- Sprache: Deutsch
Die wechselhafte deutsche Geschichte von der Kaiserzeit, über die beiden Weltkriege, bis in das geteilte Deutschland durchlebt der Leser an der Seite der Schokoladenfabrikanten von Konsigny aus München. Band 1 beginnt in der Silvesternacht 1899 und begleitet die Familie bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
München, Silvester 1999
TEIL 1 - Kein schöner Land in dieser Zeit (1899–1918)
Grünwald, Silvester 1899
München, Mai 1904
München, Februar 1906
Berlin, Oktober 1907
Grünwald, Dezember 1912
München, Juni 1914
An der Westfront, November 1914
München, Februar 1916
München, März 1918
TEIL 2 - Tanz auf dem Vulkan (1920–1933)
München, Februar 1920
München, Januar 1923
München, Oktober 1923
München, Frühjahr 1928
München, Januar 1931
TEIL 3 - Deutschland erwache! (1933–1945)
Berlin, Februar 1933
München, Februar 1936
München, Oktober 1938
München, September 1939
München, November 1942
München, September 1944
München, Herbst 1945
Epilog
München, Silvester 1999
Bibliographien
Danksagung
Die Autorin
„Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln:
Erstens durch Nachdenken – das ist der edelste,
zweitens durch Nachahmen – das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung – das ist der bitterste.“
(Konfuzius)
Prolog
München, Silvester 1999
Ich stand am Fenster meiner Münchner Wohnung und sah hinaus auf die Stadt. Es war kurz vor Mitternacht. Gleich würden die Glocken das neue Jahr einläuten.
Das neue Jahr und gleichzeitig das neue Jahrtausend.
„Millennium ...“, murmelte ich verächtlich. „Was für ein Getue! Was für eine Farce!“
In diesem Augenblick begannen die Glocken zu schlagen. Viele verschiedene waren von meiner Wohnung aus zu hören. Ich konnte sie nicht unterscheiden. Also griff ich nach meinem Glas, in das ich mir den Sekt bereits eingeschenkt hatte.
„Prosit Neujahr!“, sagte ich zu mir selbst.
Über der Stadt brach das Feuerwerk los. Aus allen Richtungen konnte man Raketen sehen. Gleichzeitig begann es zu schneien. In dicken, schweren Flocken fiel der Schnee auf die umliegenden Dächer.
Ich hatte genug.
Mit beiden Händen packte ich die Vorhänge und zog sie energisch vor das Fenster. Ich setzte mich auf die Couch und knipste den Fernseher an, um das Raketen- und Böllerknallen zu übertönen. Doch wohin ich auch zappte, überall feierten und tanzten und sangen die Menschen ins neue Jahr.
Ich schaltete wieder ab und schleuderte die Fernbedienung auf den Tisch. Während anscheinend der Rest der Welt glücklich und vor allem gemeinsam den Jahreswechsel feierte, war ich hier mutterseelenallein.
Voller Selbstmitleid schniefte ich: „Ich habe alles falsch gemacht ...“
Ich konnte die Tränen, die mir den ganzen Abend in den Augen gebrannt hatten, nicht mehr zurückhalten und überließ mich meiner Verzweiflung, schluchzte hemmungslos wie ein kleines Kind.
Als ich mich endlich wieder beruhigt hatte, waren die Glocken und die meisten Böller draußen verstummt. Lediglich vereinzeltes Knallen war zu hören. Die Uhr auf dem Receiver zeigte 1:15. Eigentlich, überlegte ich, konnte ich genauso gut ins Bett gehen, ich hätte gar nicht erst bis Mitternacht aufbleiben müssen.
Doch ich wusste, dass ich nicht schlafen würde können. Ich schenkte mir noch einmal Sekt nach. Wenn ich die ganze Flasche trank, würde das vielleicht den ersehnten Schlaf bringen. Es war fast halb zwei. Aber meine Tochter hatte nicht angerufen.
„Ich hätte Jessica auch anrufen können“, murmelte ich nachdenklich vor mich hin. „Oder ihren Vater.“
Auch mein Mann hatte sich zu Silvester nicht gemeldet. Pardon, mein Ex-Mann, nun waren wir ja geschieden. Pünktlich zum neuen Jahr.
„Der ist wahrscheinlich auch viel zu beschäftigt. Wahrscheinlich sitzt er mit seiner Neuen irgendwo in einer schicken Schihütte. Oder irgendwo unter der Sonne.“ Als ich so an meinen Verflossenen und seine Neue dachte, und an unsere Tochter, überfiel mich wieder dieses ohnmächtige Gefühl.
Auf dem Couchtisch stand ein Korb mit allerlei Leckereien. Eine Aufmerksamkeit der Schokoladenfabrik. Der Korb kam jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Er stand immer noch genauso da, wie ich ihn vor Weihnachten auf den Tisch gestellt hatte. Ich zog die Schleife auf und schlug die Geschenkfolie zur Seite.
„Schokolade“, seufzte ich angewidert. „Immer Schokolade! Als gäbe es sonst nichts auf der Welt.“
Achtlos schob ich den Korb weg. Daneben lag ein abgegriffenes Fotoalbum. Automatisch begann ich darin zu blättern. Es war das erste Album, das ich von meiner Tochter Jessica angelegt hatte: im Krankenhaus gleich nach der Entbindung, dann die ersten Tage zu Hause, Jessica im Kinderbettchen, Jürgen mit Jessica auf dem Arm, ganz der stolze Vater, Jessica mit ihren Großeltern ...
Fotos aus glücklichen Tagen. Auf ihnen sah alles so einfach aus: eine junge Familie. Ich selbst wirkte jung und strahlte auf den Bildern, und Jürgen war verliebt in seine schöne Frau und seine süße, kleine Tochter.
Resigniert klappte ich das Album zu. Was hatte es für einen Wert, noch in der Vergangenheit zu stochern, wollte man sich nicht selbst Schmerzen verursachen?
Stattdessen hob ich den Korb aus der Geschenkverpackung. Es steckten mehrere Tafeln Schokolade darin: dunkle mit Nuss, weiße mit Crispies und die unvermeidliche Rum-Traube-Nuss. Ich hasste diese Schokolade, weil ich keine Rosinen mochte, trotzdem war sie jedes Jahr wieder dabei.
Ich zog die weiße Tafel heraus und strich gedankenverloren über das Papier. Das Logo der von Konsignys. Immer noch das alte. Es war nie geändert worden, obwohl die Marke inzwischen nicht mehr den Namen von Konsigny trug: Das verschlungene K mit dem goldenen Vögelchen.
Früher war die Fabrik im Familienbesitz gewesen. Meine Oma Louise war noch eine geborene von Konsigny, hatte den Aufstieg und den Fall der Schokoladenfabrik hautnah erlebt. Seit fast hundert Jahren!
Nächstes Jahr wurde Oma Louise immerhin auch schon ein stolzes Jahrhundert alt. Wie anders musste die Welt ausgesehen haben, als sie das Licht der Welt erblickt hatte? Und wie hatten wohl ihre Eltern damals ins neue Jahrhundert gefeiert? Sicher mit einem rauschenden Ball.
Gedankenverloren öffnete ich die Packung und aß ein Stückchen. Sie schmeckte wirklich köstlich. Auch ich kaufte am liebsten diese Marke, weil ich ja irgendwie auch verwandt mit ihr war – auch wenn sich die Firma schon lange nicht mehr im Familienbesitz befand.
Der alljährliche Geschenkkorb war nur eine höfliche Geste der neuen Eigentümer. Wir bekamen alle so einen. Auch Oma Louise in ihrem Alterssitz.
Dort hätte ich sie schon längst wieder einmal besuchen sollen, schoss es mir durch den Kopf. Irgendwie schob ich es immer vor mir her, obwohl ich mich früher so gern mit ihr unterhalten hatte. Aber die alte Dame hatte ihre Erinnerungen verloren, oft erkannte sie einen nicht einmal mehr.
Eine Weile hatte sie zumindest noch von früher erzählt, von ihrer Kindheit. Hatte manchmal geglaubt, ihre Eltern und Geschwister wären noch am Leben. Inzwischen war auch darüber der Schatten ihrer Demenz gefallen.
Ich fasste einen Entschluss, während ich die zweite Rippe Schokolade abbrach und in den Mund steckte: „Ich fahre zu Louise. Gleich morgen früh.“
Ich hatte schlecht geschlafen, trotz des Sekts und der Schokolade. Als der Wecker endlich sieben Uhr anzeigte, stand ich auf. Es war noch dunkel draußen und inzwischen lag eine dünne, weiße Schneeschicht über der Stadt. Ich packte ein paar Sachen zusammen.
Gegen halb neun machte ich mich auf den Weg. Die Straßen waren noch wie ausgestorben, die Feiernden von gestern Nacht schliefen ihren Rausch aus.
Auf dem Schnee lagen teilweise ganze Teppiche aus Konfetti, Luftschlangen und den Überresten der Raketen und Böller. Ich lenkte meinen BMW aus der Stadt hinaus Richtung Süden. Oma Louise wohnte im Seniorenheim der Schwesternschaft des Roten Kreuzes in Grünwald.
Kurz vor neun Uhr erreichte ich die Seniorenresidenz. An der Pforte saß eine dicke, schlecht gelaunte Schwester.
„Morg'n“, nuschelte sie, als ich mich räusperte. „Und?“, herrschte sie mich an. Offensichtlich machte sie mich persönlich dafür verantwortlich, dass sie am Neujahrstag arbeiten musste. Fast bereute ich bereits, hergekommen zu sein. Doch da ich nun schon einmal hier war, wollte ich auch nicht unverrichteter Dinge wieder gehen. „Charlotte Kramer. Ich möchte zu Frau Marie-Louise Herbst.“
Die Dicke kehrte ihrer Zeitschrift den Rücken zu und klickte an ihrem Computer herum. Dann nahm sie den Telefonhörer ab und wählte eine Nummer. Das Ganze geschah, als wäre ich gar nicht anwesend.
„Hmm … Pforte hier. Eine Frau Kramer. Mhm … Ja … Zur Frau Herbst. Ah … Mhm … Hmm.“ Sie legte auf.
Zu mir gewandt sagte sie: „Zur Heimleitung. Da lang.“ Anschließend vertiefte sie sich wieder in ihre Zeitschrift, die auf der Titelseite damit warb, die ultimativen Partyideen für die große Millenniumsfeier parat zu haben.
Ich ging an ihrem Empfangstresen vorbei, in die Richtung, die sie mir gewiesen hatte. Das Heim war modern und freundlich eingerichtet. Anders, als die Empfangsdame vermuten ließ. Die hohen Fenster wiesen in einen Park hinaus, der sehr gepflegt aussah – zumindest der Teil, den man sehen konnte. Auf dem Flur standen große Tontöpfe mit Pflanzen, die Wände waren aprikosenfarben gestrichen.
Sehr nett, dachte ich. Kein Wunder, dass Louise sich hier so wohlfühlte. Sie hatte immer schon schöne Orte und Dinge geliebt.
An der letzten Tür hing ein Schild mit der Aufschrift Heimleitung. Ich klopfte. „Herein.“
Ich fand mich in einem sauberen, gemütlichen Büro wieder. Beim Schreibtisch, in einem breiten Ledersessel, saß die Heimleiterin. Eine resolute Dame, deutlich über fünfzig.
Sie hatte von ihren Unterlagen aufgesehen, als ich eingetreten war. Ich wunderte mich, dass auch sie am Neujahrsmorgen schon im Dienst war.
„Frau Kramer, bitte nehmen Sie doch Platz.“
Wir gaben uns die Hand. Dann setzte ich mich der Heimleiterin gegenüber.
„Wir hatten Sie nicht erwartet. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte Sie sofort anrufen sollen.“
Ich sah mein Gegenüber fragend an.
„Es tut mir sehr leid. Ihre Großmutter ist gestern Nacht verstorben. Mit ihrer Gesundheit stand es lange nicht zum Besten, und bedenkt man ihr Alter ...“
Ich nahm die weiteren Worte der Frau gar nicht mehr wahr. Oma Louise war tot. Der letzte Mensch, von dem ich immer sicher gewesen war, dass er mich liebte. Wie betäubt saß ich auf dem Stuhl.
„Frau Kramer, ist Ihnen nicht gut? Möchten Sie ein Glas Wasser?“ Ohne meine Antwort abzuwarten, stand die Heimleiterin besorgt auf und brachte mir ein Glas. Doch ich rührte es nicht an.
„Hat sie gelitten?“, fragte ich nur.
Die Heimleiterin schüttelte den Kopf. „Nein. Sie ist einfach eingeschlafen.“
„Wo ist sie? Kann ich sie sehen?“
Sie nickte. Anschließend ging sie voraus. Ich folgte ihr zögernd aus dem Büro. Ich kannte Louises Zimmer, es lag im ersten Stock mit dem Blick zum Park.
Ein kleiner Balkon gehörte dazu, auf dem die alte Frau immer gerne gesessen hatte. Alles sah aus wie immer: die Spitzendeckchen auf den Kommoden, die Bilder, schwarz-weiße Aufnahmen aus Louises langem Leben. Die bestickten Sofakissen ordentlich nebeneinander aufgereiht. Auf dem Bett lag Louise so, als schliefe sie bloß. Sie trug ein einfaches schwarzes Kleid mit einem sauberen gestärkten Kragen. Genauso kannte ich sie. Ihr Haar war frisiert und mit Kämmen zurückgesteckt.
Unter ihrem Kinn klemmte ein zusammengerolltes Handtuch. Louises Haut war wächsern, sie sah aus wie eine Puppe aus dem Wachsfigurenkabinett. Ihre Hände lagen entspannt auf ihrer Brust. Die Schwestern hatten ihr einen Rosenkranz zwischen die Finger gelegt.
Auf dem Nachtisch brannte eine Kerze. Ich bemerkte, wie mager sie geworden war. Sie sah aus, als würde sie beinahe nichts wiegen. Ihre Augen waren geschlossen, die Verwirrtheit und Unsicherheit der letzten Jahre war aus ihrem Gesicht verschwunden. Ihre Gesichtszüge waren ruhig, fast friedlich. Und sie lächelte. Ich ließ mich auf einen Stuhl neben dem Bett sinken. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Aber ich konnte nicht weinen.
„Ich lasse Sie einen Augenblick mit ihr allein. Kommen Sie wieder in mein Büro, wenn Ihnen danach ist. Wir haben noch etwas für Sie.“ Die Heimleiterin schloss leise die Tür hinter sich.
Ich blieb eine ganze Weile bei Louise. Ich wusste selbst nicht, wie lange ich so bei ihr gesessen hatte. Ich weinte nicht. Ich fühlte mich unendlich leer. Fast, als läge ich dort und nicht Louise.
Wieso war sie tot? Einfach nicht mehr da? Nie wieder?
Ich fühlte mich so allein wie noch nie in meinem Leben. Warum konnte ich nicht auch einfach die Augen schließen und vergessen?
Wozu war ich noch da? Und Louise nicht mehr?
Ich saß nur da und starrte ins Leere. Es fühlte sich an, als stünde ich vor einer Wand. Endstation. Hier geht es nicht mehr weiter. Mein ganzes Leben steckte in einer Sackgasse. Ich war doch hergefahren, um wieder in die Spur zu kommen. Stattdessen fühlte ich mich jetzt noch mehr allein gelassen.
Aber ich lebte noch. Ich musste irgendwie weitermachen. Also erhob ich mich, küsste die Tote ein letztes Mal auf die Stirn und strich ihr über die gefalteten Hände.
Dann kehrte ich zurück ins Büro der Heimleiterin, wie mir geheißen.
„Mein aufrichtiges Beileid, Frau Kramer. Leider muss ich Sie noch mit einigen bürokratischen Dingen aufhalten, obwohl Sie sicher dafür im Augenblick keinen Kopf haben. Wir haben ein Testament gefunden und weitergeleitet. Darin ist auch verfügt, wo Ihre Großmutter beerdigt werden möchte.“
„Hier in Grünwald im Familiengrab, nehme ich an“, ver - mutete ich.
„Ja, das ist richtig. Und sie hat Ihnen speziell auch noch etwas hinterlassen, das nicht im Testament steht.“ Die Heimleiterin bückte sich und zog einen Karton unter ihrem Schreibtisch hervor. Es war eine einfache graue Pappschachtel ohne Aufschrift.
„Was ist das?“
„Machen Sie sie auf“, ermutigte die Heimleiterin mich.
Ich hob neugierig den Deckel von der Schachtel. Darin steckten ordentlich nebeneinander viele kleine, schwarz gebundene Büchlein. Ich sah die Heimleiterin fragend an, aber die machte nur eine weitere auffordernde Geste. Also zog ich eines der Büchlein heraus.
Es war etwa halb so groß wie ein DIN A5-Blatt und in Leder gebunden. Ich klappte es auf. Die Seiten waren liniert und mit Louises feiner, gleichmäßiger Handschrift beschrieben – Blatt für Blatt in engen Zeilen, hauptsächlich mit den altdeutschen Sütterlin-Buchstaben, vermischt mit moderner Schrift.
Vorsichtig blätterte ich hin und her.
„Ein Tagebuch.“ Was eine Feststellung hätte sein sollen, klang mehr wie eine Frage.
Die Heimleiterin nickte. „Die ältesten Bücher stammen noch von Frau Herbsts Mutter. Die meisten sind aber von ihr selbst.“
Ich strich ehrfürchtig über die vielen kleinen Folianten. „Ich wusste gar nicht, dass sie Tagebuch geschrieben hat.“
„Fast ihr ganzes Leben lang. Am Ende ließ sie sich gern daraus vorlesen. Es brachte ihre Erinnerungen zurück, hat sie gesagt. Sehr interessante Literatur. Ich hatte selbst ein paar Mal das Vergnügen, für sie zu lesen.“
Willkürlich nahm ich noch einige Bücher aus der Schachtel und blätterte. „Ich kann das gar nicht lesen“, gestand ich. „Sie schrieb ja ihr Leben lang Sütterlin. Können Sie das entziffern?“
Die Heimleiterin nickte. „Am Anfang ist es schwierig. Aber man gewöhnt sich daran. Sie hatte eine sehr saubere Handschrift.“
Die Heimleiterin fasste über den Tisch und zog gezielt zwei Bücher aus dem Karton, die anders aussahen als die restlichen. Sie waren dicker und der Einband war aus Stoff, nicht aus Leder.
„Die hier sind von ihrer Mutter. Anscheinend hat Frau Herbst diese Leidenschaft von ihr übernommen. Den Rest hat sie selbst geschrieben. Wir haben sie chronologisch geordnet, damit wir ihr gezielt vorlesen konnten, was sie hören wollte. Hier geht’s los.“
Fasziniert sahen wir beide auf den Karton, der ein ganzes Leben beinhaltete.
„Sie hat vor langer Zeit gesagt, dass wir Ihnen diese Tagebücher einmal geben sollen. Wir haben sonst noch niemanden verständigt, sollen wir … oder möchten Sie ihre Familie informieren?“
„Ich mache das schon, vielen Dank. Vielen Dank für alles …“, hörte ich mich murmeln.
Ich verabschiedete mich von der Heimleiterin. Den Karton nahm ich mit. Inzwischen waren die Bestatter eingetroffen. Ich begegnete den schwarzgekleideten Herren am Eingang, blieb aber nicht, um zuzusehen, wie die Schwestern ihnen Louises Leichnam übergaben.
Ich hatte geahnt, dass sich die Neuigkeiten über den Tod von Oma Louise nicht lange würden verbergen lassen. Prompt hatte ich meinen Ex, Jürgen, am Telefon, kaum, dass ich angefangen hatte, den Rest der Familie zu informieren.
„Ja, das ist richtig. Aber was geht dich das an?“, blaffte ich ungehalten. Es fiel uns immer noch schwer, normal miteinander umzugehen.
„Machst du Witze? Du weißt sehr wohl, wie gern ich sie gemocht habe“, schoss er sofort zurück.
Es folgte ein Schlagabtausch nach dem üblichen Muster:
„Sie ist meine Großmutter, wenn ich dich erinnern darf. Beim Unterzeichnen der Dokumente hast du dich auch von ihr scheiden lassen. Also. Es geht dich nichts an.“
„Sie hätte sich sicher gefreut, wenn sie gewusst hätte, dass ich zu ihrer Beerdigung kommen möchte.“
„Sie hätte sich auch gefreut, wenn du sie mal besucht hättest, solange sie noch gelebt hat!“ Ich wusste, wie frustriert und zynisch ich klang, aber es war mir egal.
„Tu doch nicht so. Die Musterenkelin warst du auch nicht. Jessica wird auch kommen wollen. Hast du es ihr schon gesagt?“ Damit traf Jürgen einen wunden Punkt.
Ich hatte es meiner Tochter gesagt. Oder besser, ich hatte es versucht. Aber ich hatte nur Jessicas Anrufbeantworter dran gehabt und sie noch nicht zurückgerufen.
„Selbstverständlich. Das Kind kann aber allein kommen. Sie braucht dich nicht dazu.“
„Sie wird auch wollen, dass ich dabei bin. Nach allem, was passiert ist … Ihr habt ja nicht mehr das beste Verhältnis, seit …“
„Es reicht. Das höre ich mir nicht länger an. Du kannst tun und lassen, was du willst, du bist ein freier Mann. Aber auf der Beerdigung meiner Großmutter dulde ich dich nicht.“ Damit knallte ich den Hörer auf die Gabel.
Auch wenn durch die Scheidung unsere Angelegenheiten eigentlich geregelt waren, auch wenn ich mir jedes Mal vornahm, dass ich mich nicht reizen lassen würde, es endete immer gleich. Wie wir uns einmal hatten lieben können, war mir schleierhaft; das musste unendlich lange her sein. Jetzt herrschte zwischen uns immer dieselbe Stimmung: Verbitterung auf meiner Seite und Gereiztheit auf seiner. Und obwohl wir das beide hatten vermeiden wollen, stand Jessica immer zwischen uns und wir zerrten beide an ihr. Kein Wunder, dass sie nichts mehr mit unsren Streitigkeiten zu tun haben wollte.
Seltsamerweise hatte sie ihrem Vater bereitwillig verziehen, auch wenn dieser jetzt eine neue Familie hatte. Ich dagegen war ihr ein ständiger Dorn im Auge. Vielleicht, weil ich es nicht schaffte, endlich loszulassen, weil ich einer Zeit nachhing, die unwiederbringlich vorbei war. Oder weil ich durch unsere Trennung zu einer biestigen, alten Jungfer geworden war. Es störte mich selbst und eigentlich war ich viel wütender auf mich selbst als auf Jürgen. Natürlich wusste ich, was Jessica mir in Wahrheit vorwarf. Aber daran mochte ich nicht denken. Jürgen, so wie auch meine eigene Mutter, ließen immerhin keine Gelegenheit verstreichen, mich daran zu erinnern. Für sie alle war ich die eigentliche Schuldige, mir allein fiel ihr gerechter Zorn zu.
Immer noch innerlich kochend, ließ ich mich im Wohnzimmer nieder. Vor mir stand der Karton. Ich wollte abschalten. An etwas anderes denken. Nicht an die bevorstehende Beerdigung, nicht an Jürgen und an Jessica, mein verkorkstes Leben und meine gescheiterte Ehe.
Ich schenkte mir ein Glas Wein ein und nahm das erste Büchlein aus dem Karton. Fast ein bisschen ehrfürchtig hielt ich es in der Hand. Auf der ersten Seite stand 1899.
So lange her. Einhundert Jahre. Was in dieser Zeit alles geschehen war ...
Wenn ich recht überlegte, wusste ich gar nicht so viel über die Anfänge des vorigen Jahrhunderts. Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Zweiter Weltkrieg, diese groben Eckdaten kannte ich aus dem Geschichtsunterricht. Aber sonst?
Wenn ich ehrlich war, erinnerte ich mich vor allem an nicht enden wollende Ausführungen über irgendwelche Feldzüge von den alten Griechen bis zu Napoleon. Die neueren Jahrzehnte waren in meinem Geschichtsunterricht irgendwie nie wirklich vorgekommen, geschweige denn, dass mir eine Vorstellung über diese Zeit vermittelt worden wäre. Und mein Abschluss lag ja nun auch schon eine ganze Weile zurück. Seitdem hatte ich für mein rudimentäres Zeitgeschichtsverständnis auch nichts Wesentliches mehr getan.
In welche Zeit war meine Oma Louise da eigentlich hineingeboren worden?
Ich legte das Tagebuch noch einmal zur Seite und holte einen dicken Wälzer aus dem Bücherregal, der dort schon seit vielen Jahren vor sich hin staubte. Chronik des 20. Jahrhunderts, stand darauf. Ich würde mich erst einmal in die Geschehnisse zur Jahrhundertwende einlesen.
TEIL 1
Kein schöner Land in dieser Zeit (1899–1918)
„Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter.
Der Mensch beherrscht die Natur,
bevor er gelernt hat,
sich selbst zu beherrschen.“
(Albert Schweitzer)
I.
Grünwald, Silvester 1899
„Champagner schwemmt mitunter
so mancherlei hinunter,
drum lassen weise Fürsten die Völker niemals dürsten.
Stoßt an! Stoßt an!
Und huldigt im Vereine
dem König aller Weine!“
1899. Das Jahr, in dem Spanien zuerst die Herrschaft über Kuba und später durch den deutsch-spanischen Vertrag auch noch einen Teil seiner Kolonien im Pazifik verlor. Das Jahr, in dem im Sing-Sing-Gefängnis von New York Martha M. Place als erste Frau durch den elektrischen Stuhl hingerichtet und Henry Bliss als erster Amerikaner in einem Autounfall getötet wurde.
Aber auch das Jahr, in dem der Wirkstoff Acetylsalicylsäure im Deutschen Reich eingeführt und die Marke Aspirin von der Bayer AG eingetragen wurde, die Söhne Adam Opels mit der Produktion der ersten Opel-Automobile begannen und Kaiser Wilhelm II. den Dortmund-Ems-Kanal einweihte.
Auch dieses Jahr 1899 endete, wie alle anderen zuvor, am 31. Dezember, und mit ihm das alte Jahrhundert.
„Ist es schon Mitternacht, Herr Kommerzienrat?“
„Vielleicht will unser guter Herr Kommerzienrat Schokoladenfabrikant am Champagner sparen?“
Die Umstehenden lachten herzlich und der Angesprochene ließ sich nicht lange bitten. Er winkte den Hausdiener heran und ließ Champagner ausschenken. Im großen Salon der Villa im Münchner Süden brannten hunderte Kerzen und erleuchteten den hohen, stuckverzierten Saal mit ihrem in den hohen Spiegeln tausendfach reflektierten Schein. Das Herrenhaus lag in einem großzügigen Parkgelände, das dreigeschossige Haupthaus mit dem breiten Walmdach wurde zu beiden Seiten von einem sechseckigen Turm flankiert. Die Villa stammte aus dem 17. Jahrhundert und war bereits seit mehreren Generationen der Landsitz der von Konsignys.
Im ländlichen Charme von Grünwald ließ es sich nach getaner Arbeit gut ausspannen – oder feiern, so wie heute, an diesem denkwürdigen Silvesterabend zum Jahrhundertwechsel.
Die gesamte Industriearistokratie Münchens tanzte und feierte ausgelassen ins neue Jahrhundert. Das alte klang ruhig aus, seit mehr als dreißig Jahren war kein bayerischer Soldat mehr im Krieg gewesen. Nach dem mysteriösen Tod des Märchenkönigs Ludwig im Starnberger See waren die Bayern ihrem neuen Herrscher erst einmal skeptisch gegenüber gestanden. Doch der Prinzregent Luitpold entpuppte sich als ein Monarch, wie die Bayern ihn sich wünschten. Der legere Luitpold liebte die Jagd und die Malerei, beides typische Wittelsbacher Traditionen. Er sprach die Sprache des Volkes und gab sich volksnah und kommod. Wenn ihnen schon kein Märchenkönig vergönnt war, so war der inzwischen fast achtzigjährige Würzburger die beste Alternative.
Natürlich wurde auch in der Residenz Silvester gefeiert. Nach seiner üblichen Morgenausfahrt hatte der Prinzregent die Paraden abgenommen, den Gottesdienst in der Hofkirche besucht und die Neujahrsgratulationen der übrigen deutschen Herrscher und des Kaisers entgegengenommen und erwidert. Auf die Neujahrscour waren siebenhundert Gäste geladen, darunter auch der zum Kommerzienrat erhobene Schokoladenfabrikant von Konsigny. Aus Rücksicht auf seine Gemahlin hatte er jedoch abgesagt und stattdessen ein eigenes Bankett organisiert. So kurz vor ihrer Niederkunft sollte Eleanor von Konsigny lieber in den eigenen vier Wänden bleiben.
Schokoladenfabrikant Theodor von Konsigny hatte allen Grund dazu, euphorisch in die Zukunft zu blicken. Kürzlich vom Kaiser persönlich zum Kommerzienrat ernannt, war der erst sechsundzwanzigjährige Unternehmer bereits ganz oben angekommen.
„Schade, dass mein Vater das nicht mehr erleben durfte“, flüsterte er seiner jungen Frau zu.
Eleanor von Konsigny lächelte. „Er wäre sehr stolz auf dich.“ Ein Korsett konnte die Hochschwangere schon lang nicht mehr tragen, dennoch war die Dame des Hauses zu diesem festlichen Anlass nach der neusten Mode gekleidet. Der Kommerzienrat begrüßte seine Gäste zu dieser Abendgesellschaft nach alter Tradition im Frack.
Ein plötzlicher Schmerz durchzuckte die junge Frau und sie krümmte sich reflexartig, bevor sie die Schwäche vor ihrem Mann verbergen konnte.
Besorgt griff der ihr sofort unter den Arm und führte sie zu einer Sitzgelegenheit. „Fühlst du dich nicht wohl, Liebling?“
Trotz ihrer Schmerzen lächelte Eleanor tapfer. „Nichts, Theo. Es geht gleich wieder.“
Ihr an sich mädchenhafter Leib war dick geschwollen und unförmig. Obwohl sie kurz vor der Niederkunft ihres ersten Kindes stand, hatte die Hausherrin die Vorbereitungen für den großen Silvesterball zur Jahrhundertwende an niemanden delegieren wollen. Schon seit halb sechs war sie auf den Beinen. Beunruhigt ließ der werdende Vater seinen Blick über die fröhlich feiernden und tanzenden Menschen gleiten.
Unter den illustren Gästen waren Franz Strauss und sein Sohn Richard, die beide gerade ein Engagement an der Hofoper hatten, der Freund des Hauses Franz von Lenbach mit seiner Gattin sowie der Verleger Albert Langen. Zwischen Letzteren war soeben ein handfester Streit entbrannt, ob man nun wirklich die Dämmerung eines neuen Jahrhunderts feierte.
„Der Beginn des neuen Jahrhunderts ist der erste Januar 1901, das liegt doch auf der Hand!“, ereiferte sich Langen. „Wenn Sie ein Schock Eier kaufen, dann erwarten Sie doch auch, dass man Ihnen volle sechzig gibt und nicht nur neunundfünzig.“
Lenbach schüttelte eigensinnig den Kopf. „Sie können mir gar nichts, werter Freund. Der Kaiser höchst selbst hat das neue Jahrhundert begrüßt. Wollen Sie etwa dem Kaiser widersprechen?“
Theodor von Konsigny hastete an den beiden vorbei. Irgendwo unter den Gästen musste auch der Hausarzt der Familie, Medizinalrat Marquardt, sein. Der alte Mediziner hatte nämlich bereits Theodor selbst in die Welt geholfen. Es hätte den Fabrikanten etwas beruhigt, wenn er ihn in der unmittelbaren Nähe gewusst hätte. Statt des Arztes bahnte sich jedoch Eleanors Schwester Margaret einen Weg durch die Feiernden, direkt auf die Schwangere zu, die sich erschöpft auf einer Récamière niedergelassen hatte.
„Geht es dir gut? Eleanor, Schätzchen, du siehst ganz blass aus. Ist dir unwohl?“
Eleanor lächelte. „Danke, Gretchen, es geht schon wieder. Nur ein kleines Unwohlsein.“
„Du solltest das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Du gefährdest das Kind“, schalt Margaret sie.
Bestürzt sah Eleanor ihre Schwester an. „Nein, das möchte ich nicht. Vielleicht hast du recht. Ich leg mich noch einen Moment hin, bevor es Mitternacht schlägt.“
Margaret half ihrer Schwester auf die Beine und führte sie hinaus.
Theodor kam schlecht vorwärts, überall sprach man ihn an, wollte ihm gratulieren und mit ihm anstoßen. Als er es dann doch irgendwann geschafft hatte, fand er endlich den Arzt.
„Bitte, Sie müssen nach meiner Frau sehen. Die Schwangerschaft setzt ihr sehr zu. Sie fühlt sich unwohl und sie hat Schmerzen, auch wenn sie das vermutlich nicht zugeben wird.“
Der Medizinalrat nickte. Er kannte die junge Frau von Konsigny und begleitete ihre erste Schwangerschaft von Anfang an.
„Es ist bald soweit, Herr Kommerzienrat. Da kann es schon vorkommen, dass sie eine Schwäche befällt. Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen. Das ist Ihr Abend heute! Ich sehe gleich nach ihr.“
Der Arzt fand die Schwangere im Nebenzimmer. Ihre Schwester hatte sie genötigt, die Beine hochzulegen. Eleanor sah matt und erschöpft aus.
Der Arzt nahm ihre Hand und prüfte mit routinierter Geste ihren Puls. „Ganz schön hoch. Wie geht es Ihnen? Ihr Gatte sagt, es sei Ihnen übel?“
Eleanor nickte. Die Schmerzen waren zu stark, sie konnte ihnen nichts mehr vormachen.
Margaret sah den Arzt erschrocken an. „Was ist es, Herr Doktor? Doch nichts Ernstes?“
Der Mediziner lächelte. „Ich denke nicht. Aber wir werden die junge Frau besser hinauf in ihr Schlafzimmer begleiten.“
„Oh Gott, so sprechen Sie doch! Was ist es?“ Vor Schreck brachte Margaret nur noch ein Flüstern hervor.
Marquardt hatte Eleanor bereits hochgezogen und ihren schlaffen Arm um seinen Hals gelegt. Als wiege die Hochschwangere nicht mehr als ein Sack Zucker, hob er sie hoch und trug sie hinauf, wo er ihr Schlafzimmer wusste. Margaret beeilte sich, ihnen zu folgen. Auf der Treppe setzte sie noch einmal an: „Herr Doktor, ich bitte Sie, schonen Sie mich nicht. Was passiert mit meiner Schwester?“
„Wenn sie sich beeilt, hat sie zum Jahrhundertauftakt schon ihr Kind im Arm.“
Da endlich begriff Margaret.
„Oh nein, es geht los? Aber wieso sagen Sie das denn nicht gleich? Ich lasse die Hebamme kommen. Was brauchen Sie? Wasser? Tücher?“
Margaret war die Treppe schon wieder halb hinunter gehastet. Unten stieß sie mit einem Hausmädchen zusammen. „Trine! Schnell, lauf. Hol die Hebamme! Setz heißes Wasser auf. Es geht los. Es geht los!“
Der grauhaarige Hausarzt schmunzelte in sich hinein. Es war doch immer wieder dasselbe. Er brachte die Schwangere in ihr Schlafzimmer und legte sie dort auf ihr Bett. In diesem Bett hatte er vor mehr als sechsundzwanzig Jahren bereits die alte Frau von Konsigny von Theodor entbunden.
Es würde auch heute alles gut gehen. Er wusste es.
Es war kein Tag für Katastrophen.
Das Jahr 1900 begann, wie das alte geendet hatte: friedlich und beschaulich. Die Wöchnerin erholte sich rasch von der Geburt und der kleine Alexander gedieh prächtig. Sein holländisches Kindermädchen zeigte sich ganz vernarrt in den Säugling. Sogar vom Prinzregenten persönlich kam eine Note mit Glückwünschen zur Geburt des ersten Kindes. Während der Sohn heranwuchs, ging Theodor von Konsigny seinen Geschäften nach und baute im ersten Jahr des neuen Jahrhunderts seine Fabrik nach den Plänen aus, die sein Vater angefertigt, jedoch nie realisiert hatte. Damals hatte das Geld gefehlt. Jetzt konnte der stolze Sohn die Pläne seines Vaters verwirklichen.
Abends war das Ehepaar von Konsigny selten zu Hause. Sie erhielten Einladungen zu allen gesellschaftlichen Ereignissen in München: Eröffnungen, Ausstellungen, Soireen und natürlich Theater. Eleanor von Konsigny fiel es schwer, ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen an der Seite ihres Mannes nachzukommen. Sie verbrachte nämlich am liebsten den ganzen Tag bei Alexander. Doch sie wusste, was sie ihrer Stellung und auch ihrem Mann schuldig war. So verging auch das Jahr 1900 schneller als erwartet.
„Die Mutterschaft steht Ihnen gut, liebste gnädige Frau“, schmeichelte der alte Lenbach. Der angesehene Maler trotzte mit seiner traditionell verankerten Kunst der neuen Welle der Sezessionisten, angeführt von seinem alten Gegner von Stuck. Schon seit einer Dekade warf ihm die Presse vor, er hemme die Entwicklung der Kunstszene in München und halte an Altem fest, statt Neuem die Tür zu öffnen. Franz von Lenbach zählte inzwischen vierundsechzig Jahre, doch er sprühte immer noch vor Elan und Tatkraft.
„Vielen Dank, werter Freund. Ich weiß dieses Kompliment zu schätzen. Vor allem, da meine Taille nie mehr in die Korsetts passen wird, die ich vor Alexanders Geburt getragen habe.“
Die von Konsignys waren zu einem privaten Diner in der Villa Lenbach geladen, direkt gegenüber dem Königsplatz mit seinen klassizistischen Propyläen – ein Standort, den Lenbach nicht zufällig für sein, wie er immer sagte, Zentrum der Kunst in München gewählt hatte.
„Ich gedenke mir einen Palast zu bauen, der das Dagewesene in den Schatten stellen wird“1, hatte er selbst 1885 in einem Brief über sein Bauprojekt erklärt, das er gemeinsam mit dem Architekten Gabriel von Seidl 1890 verwirklicht hatte. Ringsum ließen sich bald andere Künstler und Kunstmäzene nieder, wie Adolf Friedrich von Schack oder Paul Heyse zum Beispiel.
Erst 1900 wurden das Atelier und das Haupthaus mit einem Zwischentrakt verbunden, der die Harmonie der italienischen Renaissance aufgriff und an die Residenz des Malers Rubens in Antwerpen erinnerte. Dazwischen lag ein Garten mit streng gegliederten Beeten und Brunnenanlagen. Die Innenausstattung bildete die exquisite Kunstsammlung Lenbachs, bestehend aus antiken Skulpturen, Wand- und Bodenteppichen, Malereien und allerlei Kopien antiker Kunstwerke.
Mit am Tisch saß zu diesem Abendessen der Literat Wilhelm Busch, ebenfalls ein Freund von Lenbach. Lenbachs Tochter aus erster Ehe, die hübsche Marion, und seine zweite Frau, von allen nur Lolo genannt, waren ebenfalls mit von der Partie. Die neunjährige Marion war ein aufgewecktes Mädchen mit langen blonden Locken. Sie war ein beliebtes Modell ihres Vaters, der sie vergötterte.
Nach dem Abendessen begaben sich die Herren zu Zigarren und Cognac in den Salon, lauschten Herrn Busch, der einige seiner Gedichte zum Besten gab, und schwadronierten über Politik, während sich die Damen in den Wintergarten zurückzogen.
„Wie ich hörte, wird im August endlich das neue Prinzregententheater eröffnet“, teilte Lolo von Lenbach ihren weiblichen Gästen mit. Ihre Stieftochter Marion spielte einstweilen eine Sonate auf dem Flügel.
„Das neue Theater?“, wiederholte Eleanor. „Darauf freuen wir uns schon den ganzen Sommer. Es sieht vielversprechend aus, von außen.“
„Das stimmt. Es erinnert an das Bayreuther Festspielhaus. Kennen Sie dieses, gnädige Frau?“
„Nein, leider nicht“, sagte Eleanor. „Wir waren noch nie in Bayreuth.“
Lolo von Lenbach erhob sich und brachte ihrem Gast die neuste Ausgabe der Münchner Illustrierten Wochenschrift.
„Sie lesen diese Gazette, werte Freundin?“, tadelte Eleanor lächelnd. „Ist dieses Blatt nicht etwas zu revolutionär für die Frau des traditionsbewussten Franz von Lenbach?“
Lolo grinste spitzbübisch. „Was er nicht weiß ...“ Dann schlug sie die Zeitschrift auf und blätterte darin herum, bis sie den Artikel fand, den sie suchte. „Hier.“
Sie hielt Eleanor die Zeitschrift hin. „Da steht’s. Ein Richard-Wagner-Haus im Sinne des verstorbenen Königs Ludwig soll es sein. Er war wohl ein großer Bewunderer des Komponisten. Mir ist Wagner ja immer ein bisschen zu schwer.“
„Ich mag ihn eigentlich ganz gerne“, bekannte Eleanor.
„Und da waren Sie noch nie in Bayreuth?“, sagte Lolo. „Welche Schande! Ich werde Franz bitten, dass er Sie nächstes Mal mitnimmt, Sie und Ihren Mann, zu den Festspielen. Wir sind fast jedes Jahr dort.“
Wenige Wochen später traf man sich zur Eröffnung des neuen Theaters auf der Bogenhausener Höhe. Um der Widmung Rechnung zu tragen, gab man zur Premiere Wagners Meistersinger. In der Pause kam die Gesellschaft wieder auf die Festspiele zu sprechen und Lolo von Lenbach wiederholte die Einladung. Also fuhren die Ehepaare von Lenbach und von Konsigny schon kurz darauf gemeinsam nach Bayreuth.
Es war das erste Mal, dass Eleanor ihren Sohn mehrere Tage alleine ließ. Es war ihr nicht wohl dabei, denn der Einjährige fieberte gerade ein bisschen, obwohl Medizinalrat Marquardt darin keinen Grund zur Beunruhigung sah. „Sie können völlig unbesorgt sein, gnädige Frau. Ihrem Sohn fehlt es hier an nichts. Und ich werde selbstverständlich nach ihm sehen.“
So verbrachte das Ehepaar von Konsigny einige unbeschwerte Tage in Bayreuth. Sie besuchten mehrere Vorstellungen. „Oh, ich hatte schon befürchtet, Lohengrin nähme gar kein Ende mehr“, seufzte Theodor von Konsigny erleichtert. „Dieser Wagner verlangt von seinem Publikum ordentlich Sitzfleisch.“
Die anderen lachten. Eleanor beeilte sich zu sagen: „Bitte entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass mein Mann so ein Parvenü ist.“
Es war eine laue Sommernacht. Die beiden Paare verzichteten auf eine Droschke und flanierten zu Fuß zurück zum Hotel. Auf halbem Weg blieb Eleanor unvermittelt stehen. Sie schwankte, dann sackte sie ohne Vorwarnung in sich zusammen. Theodor und Franz konnten sie gerade noch auffangen, bevor die Ohnmächtige auf das Pflaster aufschlug.
Lolo rief erschrocken aus: „Mein Gott, was hat sie nur? War ihr übel? Hat sie etwas gesagt?“
Theodor schüttelte den Kopf. Er hob seine bewusstlose Frau hoch. Lolo fächelte ihr mit ihrem Fächer Luft zu, während Franz von Lenbach zur Hauptstraße zurücklief und eine Droschke aufhielt. Sie brachten Eleanor ins Hotel. Dort kam sie wieder zu sich.
Theodor sagte erleichtert: „Hast du uns einen Schrecken eingejagt! Liebes, geht es dir wieder besser? Wie fühlst du dich?“
Theodor und Lolo saßen an Eleanors Bett. Franz wartete in der Halle, um den Arzt in Empfang zu nehmen, der jeden Moment eintreffen sollte. Der Portier hatte sofort nach jemandem geschickt, als sie die ohnmächtige Frau ins Hotel getragen hatten.
„Hast du was Falsches gegessen?“, fragte Theodor seine Frau.
Sie flüsterte: „Wir haben dasselbe gegessen, erinnerst du dich nicht?“
Es klopfte. Franz von Lenbach trat mit dem Mediziner ein.
„Darf ich Sie bitten, mich mit der Patientin allein zu lassen?“, bat der.
Lolo erhob sich eiligst und folgte ihrem Mann hinaus. „Theodor soll hier bleiben“, verlangte Eleanor matt, als dieser ebenfalls Anstalten machte, der Aufforderung des Arztes nachzukommen.
„Wir warten unten im Salon“, sagte Lolo und zog die Tür leise von außen zu.
Der Arzt untersuchte Eleanor schweigend. Dann nahm er das Stethoskop ab und sah die junge Frau aufmerksam an. „Sie sind nicht krank, gnädige Frau. Darf ich fragen, wann Sie Ihre letzte Blutung hatten?“
„Soll das heißen, ich bin schwanger?“, fragte Eleanor.
Theodor sah seine Frau überrascht an. „Schwanger?“
„Ja, ich denke, Herr Kommerzienrat, Ihre Frau erwartet ein Kind.“
Eleanor setzte sich auf. „Aber das kann doch gar nicht sein!“
Der Mediziner wiegte den Kopf hin und her. „Ich denke, sie sind bereits ungefähr im dritten Monat. Ich höre die Herztöne ganz deutlich.“
Eleanor sah an sich hinunter. Ihre Figur war noch nicht wieder ganz so schlank wie vor ihrer ersten Geburt, aber schwanger sah sie nicht aus.
„Es besteht kein Zweifel“, wiederholte der Arzt.
Theodor umarmte seine Frau stürmisch. „Das ist doch wunderschön, Eleanor!“
Die junge Frau nickte benommen. „Aber so schnell ... ich wollte erst ein bisschen nur für Alexander da sein. Und jetzt?“
Der Arzt packte seine Sachen in seinen schwarzen Koffer zurück. „Ich lasse Ihnen ein paar Tropfen da. Die werden gegen die Übelkeit helfen und Sie wieder ein bisschen zu Kräften kommen lassen.“ Damit verabschiedete er sich.
Theodor brachte ihn hinunter in die Lobby und ging dann die von Lenbachs suchen. Er fand sie im Wintergarten in ein Gespräch vertieft. Als er hinzukam, brachen sie ihre Unterhaltung ab und sahen ihn erwartungsvoll an. „Was ist es? Doch hoffentlich nichts Ernstes?“
Theodor schüttelte den Kopf. „Nein, nein.“ Er wandte sich einem Ober zu, der eben durch die Tür kam, um zu sehen, ob er dem Neuangekommenen etwas anbieten durfte. „Herr Ober, bitte eine Flasche Champagner und drei Gläser.“
Lolo und Franz blickten verständnislos zu Theodor auf.
„Meine Frau erwartet wieder ein Kind!“
Lolo sprang auf und klatschte begeistert in die Hände. „Aber das ist ja wunderbar! Wie schön. Ich werde gleich einmal nach ihr sehen.“
Theodor und Franz sahen ihr nach, wie sie mit raschelnden Röcken hinaus in die Lobby stürmte.
Theodor ließ sich in dem frei gewordenen Korbsessel nieder. „Leider ist sie selbst nicht ganz so begeistert wie wir.“
Franz von Lenbach zuckte die Achseln. „Das gibt sich, Sie werden sehen. Es kam ein wenig überraschend, nicht? Geben Sie ihr ein bisschen Zeit.“
1www.lenbachhaus.de/sammlung/franz-von-lenbach/, 02.02.2015
II.
München, Mai 1904
„Heil dir im Siegerkranz,
Herrscher des Vaterlands,
Heil, Kaiser, dir!
Fühl in des Thrones Glanz
die hohe Wonne ganz,
Liebling des Volks zu sein.
Heil, Kaiser, dir!“
In Europa bildeten sich Anfang des neuen Jahrhunderts eine ganze Reihe von Bündnissen und Pakten heraus, die dafür gedacht waren, den Frieden der beteiligten Länder zu sichern.
Am 8. April 1904 unterzeichneten Frankreich und Großbritannien den Vertrag der Entente cordiale und legten damit ihre seit Jahrzehnten andauernden Streitigkeiten um die Kolonien in Afrika, schwerpunktmäßig in Ägypten und Marokko, bei. Russland war zu diesem Zeitpunkt ganz mit Krieg beschäftigt und kümmerte sich noch wenig um die Allianzen der übrigen europäischen Großmächte. Dieser Krieg begann im Februar 1904 mit dem Angriff der Japaner auf den russischen Hafen Port Arthur und sollte bis 1905 dauern und mit der russischen Niederlage enden.
In München wurde das Stadtbild noch immer von Pferdekutschen und Droschken beherrscht, doch zunehmend spielte auch das moderne Eisenbahn-, Tram- und Postwesen eine Rolle im Straßenverkehr. Dieser Entwicklung trug das Kabinett mit der erstmaligen Berufung eines Ministers für Verkehrsangelegenheiten Rechnung.
In der Zwischenzeit stand den von Konsignys wieder ein bereits bekanntes Ereignis ins Haus: die Geburt eines weiteren Kindes.
„Wann darf ich denn hinein, Vater? Wieso können wir nicht hinein?“, quengelte der vierjährige Alexander. Aus dem Silvesterbaby war ein strammer kleiner Junge geworden und inzwischen hatte Alexander noch eine kleine Schwester. Die Zweijährige saß mit großen Augen auf dem Schoß ihrer Tante. Der Vater war extra aus der Fabrik ins Stadthaus der Familie herüber geeilt, um der Geburt seines dritten Kindes beizuwohnen. Der Schokoladenfabrikant hoffte auf einen zweiten Sohn, damit die Fabrik, inzwischen noch einmal expandiert, nach seinem etwaigen Ableben auf sicheren Füßen stehen würde. Zwar war nicht damit zu rechnen, dass der Patriarch so schnell das Zeitliche segnen würde, immerhin hatte man im vorigen Jahr erst seinen dreißigsten Geburtstag gefeiert, aber Vorsorge treffen gehörte zu Theodor von Konsignys Strategien.
Die Stadtresidenz der von Konsignys flankierte die Einfahrt zum Fabrikgelände. Das schmucke Palais überspannte den Torbogen mit einem rechteckigen Anbau. Das Haupthaus mit dem breiten Erker beherbergte im unteren Bereich einige Verwaltungsräume der Fabrik und im ersten Stock die Privaträume der Familie. Hier im Zentrum der Landeshauptstadt residierten die Schokoladenfabrikanten nicht weniger komfortabel als draußen in der Grünwalder Villa.
Im Salon der Privatwohnung saßen die Wartenden zusammen. Marie-Louise stopfte das letzte Stück eines Schokoriegels, natürlich aus der väterlichen Herstellung, in den Mund. Ihr pausbackiges Gesicht war verschmiert von Schokolade und Nugat. Margaret wischte sie mit ihrem Stofftaschentuch sauber. „Wie siehst du denn wieder aus? Willst du so dein kleines Geschwisterchen begrüßen?“
„Wieso nicht? Ist doch standesgemäß für eine von Konsigny!“, warf der Vater ein.
Margaret sah ihren Schwager tadelnd an. „Du weißt, was ich von übermäßigem Schokoladengenuss halte. Gerade bei einem Mädchen. Wie soll sie jemals einen Mann finden, wenn sie schon als Kleinkind nur Schokolade isst?“
„Stimmt ja nicht“, verteidigte sie ihr Bruder. „Sie isst auch andere Sachen. Bonbons zum Beispiel. Und Kuchen. Den vor allem!“ Er dachte an ein Picknick im Englischen Garten, das die Familie vor Kurzem gemacht und bei dem die kleine Schwester ihm das letzte, heiß umkämpfte Stück Kuchen streitig gemacht hatte. Er sah der Ankunft eines weiteren Geschwisterchens mit gemischten Gefühlen entgegen, be-stand doch die Gefahr, dass er künftig noch mehr von den Leckereien würde teilen müssen.
Der Vater sagte gönnerhaft: „Lass sie doch, Margaret. Sie sind doch noch Kinder.“
Die Tante konnte nicht anders, als in das Lachen des Vaters mit einzustimmen. Die Tür ging auf und das Hausmädchen trat ein. Es knickste höflich, erst vor dem Herrn Kommerzienrat, dann vor seiner Schwägerin.
„Gibt es etwas Neues? Wann kommt das Baby?“
Doch das Mädchen kam nicht von der Gebärenden, sondern aus dem Fabrikkontor. „Sie möchten bitte schnell hinüberkommen, Herr Kommerzienrat. Es sei dringend.“
„Was kann heute dringender sein als meine Frau und unser drittes Kind?“ Dennoch erhob er sich und ging hinüber in die Fabrik. Alexander folgte ihm.
Margaret blieb mit der Kleinen allein zurück. „Komm mit, wir schauen nach der Mama.“
„Mama“, echote Marie-Louise und ließ sich von ihrer Tante hinausführen.
Die Geschäfte machten es notwendig, dass die Familie die meiste Zeit des Jahres in ihrer Stadtwohnung auf dem Fabrikgelände lebte. Das Anwesen in Grünwald sahen die von Konsignys nur noch selten, dabei fühlte Eleanor sich draußen in der Villa viel wohler als in der Stadt. Jetzt, wo sie bald drei Kinder zu versorgen hatte, würde Theodor vielleicht endlich nachgeben und sie mit den Kindern ganz hinaus ziehen lassen.
Als Theodor wieder ins Wohnhaus herüber kam, war sein zweiter Sohn bereits auf der Welt. Der stolze Vater nahm das Baby auf den Arm, das aus Leibeskräften brüllte.
„Da hast du deinen Sohn“, sagte die Mutter und ihr erschöpftes Gesicht strahlte. „Ich wusste, dass es wieder ein Bub sein würde.“
„Du wusstest es. Natürlich.“
„Und wie soll mein jüngster Neffe heißen?“, fragte Margaret dazwischen. Sie musste die Stimme erheben, um das energische Geplärr des Neugeborenen zu übertönen.
„Rudolph. Wie unser Vater. Nicht, Theodor? Er wird nach unserem Vater benannt werden.“
Theodor gab das schreiende Baby seiner Frau zurück, die es sofort an die Brust legte, und erwiderte zustimmend: „Ja, er soll wie euer Vater heißen, den ich leider nicht mehr kennenlernen durfte. Herzlich willkommen, kleiner Rudolph.“
Mit lautem Indianergeheul stürmte Alexander ins Zimmer. „Wo ist er? Wo ist mein Bruder?“
„Hier, mein Schatz, hier ist er doch.“
Enttäuscht sah Alexander das Bündel in den Armen seiner Mutter an. „Was, das ist er? So klein? Wie soll denn der jemals mit mir spielen?“
Die Umstehenden lachten. „Der wird schon noch größer, Alex. Du warst auch nicht so groß, als du auf die Welt kamst.“
„Doch, doch, ich war viel größer. So ein Winzling! Da ist Marie ja noch größer. Und mit der kann man auch nicht richtig spielen.“ Marie verzog ihr Kleinmädchengesicht und fing an zu heulen.
„Und immer heult sie gleich rum“, bestätigte ihr enttäuschter Bruder.
„Dafür wirst ja auch du einmal die Fabrik übernehmen, weil du jetzt schon der Allergrößte bist“, beschwichtigte seine Tante.
Das schien den Knaben tatsächlich zu beruhigen, zumindest für den Moment.
„Es tut mir leid, Eleanor. Ich muss noch einmal hinüber in die Fabrik. Es wurde zu wenig Kakao geliefert. Ich muss sehen, weshalb. Wir kommen sonst in einen Produktionsengpass.“
Eleanor nickte nur, bevor ihr die Augen zufielen.
Theodor bestimmte: „Mama braucht sowieso Ruhe. Also schert ihr euch jetzt besser auch hinaus, Rasselbande.“
Margaret und die Kinder folgten Theodor hinaus, nur der Neugeborene blieb bei seiner Mutter. Theodor ging wieder über den Hof, hinüber in sein Kontor, Alexander folgte ihm wie ein Schatten und Marie-Louise wackelte auf ihren krummen Beinchen hinter ihnen her. Margarete lehnte in der Tür und sah den dreien nach.
Zwei Wochen später zogen Eleanor und die Kinder mit Margaret und einem Teil der Hausangestellten tatsächlich ganz hinaus aufs Land. Eleanor hatte sich durchgesetzt. Ihre Kinder sollten nicht in der Großstadt aufwachsen. Vater Theodor kam nur an den Wochenenden zu seiner Familie hinaus. Er bedauerte es, sie nicht mehr täglich um sich zu haben. Doch wenn er Alexander und Marie-Louise über die Wiese toben sah, dann musste er seiner Frau rechtgeben. Leider ließen es seine Geschäfte nicht zu, dass Theodor viel Zeit mit seiner Familie in der Villa verbrachte. Ein exklusiver Liefervertrag mit dem kaiserlichen Hof in Berlin stand derzeit nämlich auch im Gespräch, der nicht gerade unbedeutend war.
Bei einem seiner Besuche in Grünwald erklärte er daher seiner Frau: „Ich werde nach Berlin reisen. Möglichst bald schon. Solche Geschäfte erledigt man am besten persönlich.“
Eleanor sah ihren Gatten überrascht an. Die beiden Eheleute saßen in einem seltenen, ungestörten Augenblick auf der Terrasse der Villa beim Nachmittagstee zusammen. Die Kinder spielten im Garten, der neugeborene Rudolph lag in einem Stubenwagen, den man ebenfalls an die Sonne gestellt hatte. Margaret hatte sich entschuldigen lassen, sie fühle sich nicht wohl.
„Nach Berlin? Jetzt?“, fragte Eleanor und setzte ihre Tasse ab.
„Ja. Es geht nicht anders. Die Verhandlungen mit der Confiserie dort sind ins Stocken geraten. Ich möchte nicht, dass dieses Geschäft verloren geht.“
„Du weißt, in geschäftliche Belange mische ich mich nicht ein.“
„Ich weiß, meine Liebe. Aber ich möchte, dass du mich nach Berlin begleitest.“
„Ich?“ Eleanor war hin- und hergerissen zwischen Vorfreude und Skepsis. Seit ihrer Bayreuth-Reise hatte Eleanor München nicht mehr verlassen. Die Aussicht auf eine Reise in die preußische Hauptstadt löste in der jungen Frau gemischte Gefühle aus. „Aber ich kann doch gar nicht weg. Was ist mit den Kindern?“
„Rudolph nehmen wir mit und dazu ein Kindermädchen. Die zwei Großen bleiben hier. Margaret kann auf sie aufpassen, das wird sie gerne machen.“ Die unverheiratete und kinderlose Schwägerin war dem Ehepaar von Konsigny eine große Hilfe. Und sie half wirklich gerne. So gab Eleanor ihre Zweifel auf und begann sich auf die Reise zu freuen.
Eine Woche später reisten die Eheleute mit ihrem Jüngsten nach Berlin. Eleanor zeigte sich vom Flair der Hauptstadt fasziniert: den herrschaftlichen Fassaden, den Lindenalleen und dem komfortablen Hotel, in dem Theodor sie einquartierte. Während er seinen Geschäften nachging, spazierte Eleanor mit Rudolph durch die Einkaufsstraßen. Kommerzienrat von Konsigny wurde schließlich als angehender Hoflieferant sogar die Ehre einer Einladung an den Hof zuteil.
„Wir sind zur Cour geladen? Ist das dein Ernst?“
Theodor nickte. „Ich hatte gehofft, dass wir dem Kaiser persönlich vorgestellt werden. Deshalb wollte ich, dass du mitkommst.“
Eleanor blickte an sich hinunter. „Dem Kaiser? Theo, ich weiß gar nicht, was ich da machen muss. Und was ziehe ich zu solch einem Anlass an?“
Theodor lachte.
„Ihr Frauenzimmer! Selbstverständlich bekommst du für die Cour eine neue Ausstattung, und wir werden Courunterricht nehmen müssen.“
Tatsächlich verbrachten Theodor und Eleanor die nächsten Abende mit einem Tanz- und Courlehrer. Außerdem kam eine Schneiderin ins Hotel, die Eleanors Maße nahm und ihr die neusten Schnitte vorführte. Eleanor fühlte sich wie eine Königin.
„Sie brauchen eine Courschleppe, gnädige Frau. Eine Courschleppe für die Frau eines Kommerzienrates und angehenden Hoflieferanten muss mindestens drei Meter lang und drei Bahnen breit sein. Darunter ist es nicht standesgemäß, gnädige Frau.“
Als Eleanor dann die Preise hörte, die die Schneiderin für die Garderobe haben wollte, schreckte sie entsetzt zurück. Doch Theodor winkte nur ab, als sie ihre Bedenken äußerte. Es machte ihm Spaß, seine schöne Frau auszustaffieren.
Frühmorgens verließ Theodor das Hotel und kümmerte sich noch einmal um die Verträge, dann traf er sich mit Eleanor zu einem späten Gabelfrühstück in einem schicken Kaffeehaus am Potsdamer Platz. „Mir scheint, Berlin ist ein Wespennest! Es ist so viel lauter und geschäftiger als München“, philosophierte Eleanor über die vorbeieilenden Menschen auf der Straße, die Droschken und Fuhrwerke.
„Kein Wunder. Berlin ist eine Millionenstadt! Außerdem empfängt Ihre Majestät Kaiserin Auguste Viktoria an-scheinend gerade den internationalen Frauenkongress.“
Skeptisch sah Eleanor ihren Mann an. „Einen Frauenkongress? Wozu sollte der denn gut sein? Haben diese Damen denn nichts Besseres zu tun, als in der Politik herumzustümpern? Einen Haushalt zu führen zum Beispiel?“
Theodor lächelte. „Ich weiß, für derlei hast du keinen Sinn, Eleanor. Zugegeben, mir ist es auch lieber, meine Frau benutzt ihren hübschen Kopf, um unsere Fabrik beim Kaiser in gute Erinnerung zu bringen, als dass sie ihn sich in irgendwelchen Kongressen zerbricht. Auch wenn es internationale sind.“
„Ganz recht. Im Hause von Konsigny wäre es auch höchst unangebracht, sich so neumodischen Dingen wie dem Sufragettentum zu verschreiben.“
„Wenn du dich da mal nicht täuschst, meine Liebe. Nichts ist so emanzipiert wie die Schokolade. Sie schmeckt Männern wie Frauen, und das schon seit Jahrhunderten. Du siehst also, Liebes, wir sind bereits äußerst fortschrittlich im Hause von Konsigny.“
Am Abend hatten die von Konsignys noch einmal Courunterricht. Der Lehrer bestand darauf, dass das Paar bereits in voller Montur erschien. Eleanor erfuhr auch sofort am eigenen Leib, weshalb dieses Vorgehen angebracht war.
Es war alles andere als einfach mit der drei Meter langen Schleppe, die an der Taille befestigt wurde, zu gehen, geschweige denn, sich damit nachher zwischen all den anderen Gästen, Mobiliar und vor allem den anderen Frauen, die ebenfalls Schleppen trugen, hindurch zu lavieren. Das Ganze sollte zudem leicht und graziös wirken. Eleanor und Theodor kamen mächtig ins Schwitzen.
Doch der Aufwand lohnte sich. Die beiden verbrachten einen unvergesslichen Abend im Berliner Stadtschloss. Der beeindruckende Bau auf der Spreeinsel faszinierte Eleanor sehr. Die ältesten Teile des Baus gingen auf das Jahr 1443 und den Kurfürsten Friedrich II. zurück. Im Laufe der Jahrhunderte jedoch hatte sich das Schloss im Zentrum Berlins doch erheblich verändert. Erst vor etwa fünfzig Jahren war die dominante Kuppel über dem Eingang hinzugekommen, basierend auf den ehrgeizigen Plänen Karl Friedrich Schinkels.
Dem prachtvollen Westeingang gegenüber thronte Kaiser Wilhelm I. auf seinem Pferd vor der Kulisse einer Sandsteinhalle, bestehend aus miteinander gekoppelten ionischen Säulen, die zwei Eckpavillons flankierten. Zwischen diesen beiden beeindruckenden Bauwerken hindurch schritt Theodor von Konsignys mit Eleanor an seinem Arm. Ehrfürchtig folgte sie ihrem Mann ins Innere. Über die Haupttreppe wies man sie hinauf zu den Gesellschaftssalons, in denen der feierliche Empfang stattfand. Der Höhepunkt des Balls war natürlich die Audienz bei Seiner Majestät.
„Kommerzienrat Theodor von Konsigny und Gemahlin!“, kündigte der Marschall die Münchner mit dröhnender Stimme an. Eleanor glaubte, jeden Moment über ihre eigenen Füße zu stolpern oder auf ihre Schleppe zu treten. Kaiser Wilhelm II., der deutsche Kaiser, war ein stattlicher Mann von fünfundvierzig Jahren. Er trug zur Audienz, wie meistens in der Öffentlichkeit, eine preußische Galauniform. An den Moment, als sie dem Kaiser gegenüberstand, erinnerte Eleanor sich nachher gar nicht mehr genau, so aufgeregt war sie.
Aber an die Kaiserin Auguste Viktoria, selbst Mutter von sieben Kindern und für ihr soziales Engagement bekannt, sollte Eleanor sich ihr Leben lang erinnern. Optisch war aus der zarten Prinzessin von Schleswig-Holstein im Amt der höchsten Dame des Reiches eine beeindruckende Matrone geworden.
„Sie ist größer als der Kaiser! Und die eleganteste Dame, die ich je gesehen habe! Hach, wenn man halt auch eine Kaiserin sein könnte …“, erzählte Eleanor ihren Kindern zu Hause mit leuchtenden Augen.
Theodor entrüstete sich: „Der hätte dir wohl besser gefallen, der Kaiser? Besser als ein Kommerzienrat?“
Eleanor stieß ihn in die Rippen. „Na ja, ein Kaiser wär mir schon recht, aber ein Chocolatier tut’s dann auch.“
Von diesem für sie ganz besonderen Abend im Stadtschloss von Berlin sollte Eleanor noch lange schwärmen.
III.
München, Februar 1906
„Glücklich ist, wer vergisst,
was doch nicht zu ändern ist.
Glücklich macht uns Illusion,
ist auch kurz die ganze Freud;
sei getrost, ich glaub dir schon
und bin glücklich heut.“
Das neue Jahr begann mit dem festlichen Akt zum hundertjährigen Bestehen des bayerischen Königreichs, das 1806 als Nachfolger des, um weite Teile von Schwaben und Franken erweiterten, Kurfürstentums Bayern entstanden war, während das Heilige römische Reich deutscher Nation sich auflöste.
Im Frieden von Preßburg 1805, den der abdankende Kaiser Franz II. mit dem siegreichen Napoleon von Frankreich schloss, wurden mehrere Fürstentümer zu Königreichen proklamiert, darunter Bayern. Am 1. Januar 1806 nahm der regierende Kurfürst Maximilian Joseph den Titel eines Königs von Bayern an.
Unter seinem Sohn Ludwig I. stieg die Hauptstadt München zu einem Zentrum von Kunst und Kultur auf, bis ihn 1848 die deutsche Märzrevolution und seine Affäre mit der irischen Tänzerin Lola Montez dazu zwangen abzudanken. 1866 führte sein Nachfolger Maximilian II. Bayern als Teil des deutschen Bundes an der Seite Österreichs in den Krieg gegen Preußen, den sie mit Pauken und Trompeten verloren. So wurde Bayern 1871 ein Teil des Deutschen Reichs.
König Ludwig II. schwärmte für Wagner, Architektur und die bayerischen Alpen und zeigte wenig politisches Engagement. Daher wurde er, der prunksüchtige und schwermütige Märchenkönig, 1886 von der bayerischen Regierung entmündigt und Prinzregent Luitpold an seine Stelle gesetzt. Am 13. Juni fand man König Ludwig II. tot im Starnberger See. Auch sein jüngerer Bruder und offizieller Thronfolger Otto I. erwies sich als nicht regierungsfähig aufgrund einer Geisteskrankheit, und Prinzregent Luitpold blieb in der Regierungsverantwortung. Grund genug, ihn nun gebührend zu ehren.
„Wie ist er denn, dieser Stuck?“, fragte Eleanor vom Frisiertisch aus.
„Von Stuck“, korrigierte ihr Mann. „Er wurde geadelt.“
Eleanor rümpfte die Nase. „Klingt nach einem Emporkömmling.“
Theodor lachte. „Darauf ist er sehr stolz. Er war der Sohn eines Dorfmüllers, bevor er hier in München sein Glück gemacht hat.“
Eleanor wandte sich ihrem Mann zu und ließ die Bürste sinken, mit der sie bis eben ihr Haar gekämmt hatte. Schokoladenbraun nannte Theodor ihr Haar – „Wie es sich für eine von Konsigny gehört!“
„Wie kommen wir denn überhaupt zu dieser Einladung? Ist dieser von Stuck nicht der erklärte Widersacher von Lenbachs gewesen?“ Eleanor betonte das angeeignete „von“ besonders nachdrücklich.
„Naja, so kann man das nicht sagen. Sie hatten nie persönlich etwas gegeneinander. Aber unser alter Freund, Gott hab ihn selig, hatte eben ganz andere Ansichten zur Kunst als von Stuck und seine Anhänger. Freu dich doch über die Einladung. So wie ich dich kenne, schleichst du jedes Mal, wenn du in der Stadt bist, neugierig um die Villa Stuck herum und fragst dich, wie sie von innen aussieht“, neckte Theodor sie.
Eleanor drohte damit, die Bürste nach ihm zu werfen.
„Ein schönes Haus, das ist schon wahr. Aber unsere Villa hier gefällt mir besser.“
„Das freut mich. Dann muss ich heute Abend nicht befürchten, dass du lieber dort bleibst, als mit mir zurückzukommen.“
Der gute Franz von Lenbach war vor zwei Jahren gestorben. Bereits kurz nach dem gemeinsamen Bayreuth-Aufenthalt hatte der Fünfundsechzigjährige einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich nicht mehr richtig erholt hatte. Zu seinem Begräbnis auf dem Westfriedhof war die gesamte Münchner Gesellschaft erschienen und die ganze Stadt hatte man mit schwarzen Trauerfahnen beflaggt.
„Was er wohl dazu gesagt hätte, dass wir heute in die Villa Stuck geladen sind?“, fragte Eleanor ihren Mann noch einmal.
„Er war kein eifersüchtiger Typ“, antwortete der lapidar.
Eine Stunde später fuhr das Ehepaar von Konsigny mit dem Landauer vor der Villa Stuck vor. Ein Stallbursche eilte herbei und übernahm die Zügel der zwei Braunen. Ein livrierter Diener öffnete ihnen den Schlag und half Eleanor beim Aussteigen, dann führte er sie hinauf zum Hauptportal, das von vier stattlichen Säulen begrenzt wurde. Eleanor war zutiefst beeindruckt.
Die beiden wurden vom Ehepaar Stuck begrüßt. Der Künstler Franz von Stuck war ein attraktiver Mann in den Vierzigern, seine Frau Mary galt als eine der schönsten und meistbewunderten Frauen der Münchner Gesellschaft. Eleanor kannte sie bisher nur aus den Klatschspalten der Gazetten. Als sie ihr nun gegenüberstand, kam sie sich in ihrem braunen Ensemble aus Wildseide geradezu bieder vor. Aber Mary von Stuck war eine warmherzige, gesellige Frau.
Sie nahm Eleanor an beiden Händen und begrüßte sie mit den Worten: „Oh, Frau von Konsigny, wie schön! Ich wollte Sie schon so lange einmal einladen. Willkommen in der Villa Stuck!“ Dann hakte sie sich bei der überraschten Eleanor unter und führte sie hinein. Theodor zu unterhalten, überließ sie ihrem Gatten.
Ein Dienstmädchen nahm den beiden Neuankömmlingen Hüte und Mäntel ab, kurz darauf führten ihre Gastgeber sie zu den übrigen Gästen. Alles, was in München Rang und Namen hatte, war der Einladung gefolgt. Natürlich waren die Gäste vor allem aus dem Künstlermilieu – Kollegen, Schüler und Bewunderer Franz von Stucks.
„Wen darf ich Ihnen vorstellen, Frau von Konsigny? Kennen Sie schon Max Liebermann?“ Mary führte Eleanor zu einem älteren, kahlköpfigen Mann.
„Sehr erfreut, gnädige Frau. Sehr erfreut.“
„Sind Sie denn Münchner, Herr Liebermann?“, fragte Eleanor, um auch etwas zu sagen.
„Nein, nicht mehr. Die Münchner mögen mich nicht. Wenn man einmal von meinem Freund Stuck hier und dem Prinzregenten absieht.“ Er ließ ein dunkles Lachen hören.
Mary korrigierte: „Aber nein, meine Liebe, Max lebt inzwischen wieder in Berlin. Er kommt viel zu selten zu Besuch. Sie haben Glück, dass Sie ihn heute hier antreffen.“
Auch Theodor wurde von Franz von Stuck herumgereicht. Eleanor hatte ihn inzwischen aus den Augen verloren. Der Saal der Villa Stuck war voll von lachenden und schwatzenden Menschen. Eleanors Wangen glühten, teils wegen der Hitze, teils vor Aufregung. Es waren so viele interessante Menschen hier versammelt.
„Da drüben stehen einige Schüler meines Gatten, sehr talentierte junge Männer. Da siehst du die zukünftige Kunstelite Münchens!“ Inzwischen war Mary zum Du übergegangen und unterhielt sich mit Eleanor vertraulich wie mit einer alten Freundin. „Der linke heißt Klee. Peter, glaub ich. Nein, warte … Paul! Paul Klee. Ist er nicht ein hübscher Kerl?“
Eleanor sah Mary erschrocken an. „Aber Mary! Du bist eine verheiratete Frau!“
Mary von Stuck hatte sehr moderne Ansichten. Sie hatte selbst in München einige Jahre an der Universität studiert, bevor sie Franz von Stuck kennengelernt hatte.
Die gebürtige Amerikanerin war für den umtriebigen Maler mehr als nur Muse, denn sie war es auch gewesen, die ihrem Mann den Weg in die Münchner Gesellschaft geebnet hatte. Sie war reich, gebildet und mit den besten Kontakten ausgestattet.
„Sicher. Aber deshalb bin ich doch nicht blind! Du etwa?“ Ohne eine Antwort von Eleanor abzuwarten, wandte sie sich wieder der Gruppe von Schülern ihres Mannes zu. „Der andere ist Franz Marc. Der ist weniger mein Typ, wenngleich er dem hübschen Paul an Begabung in nichts nachsteht. Sagt jedenfalls mein Franz. Du musst unbedingt bald einmal in meinen Salon kommen. Donnerstag ist unser Jour fixe, da treffen sich immer die interessantesten Leute. Nicht nur Maler, auch Dichter und Musiker. Sehr inspirierend.“
Eleanor versprach es.
Der Abend war ein voller Erfolg. Eleanor konnte nicht anders, als mit der herzlichen Mary eine rasche Freundschaft zu schließen, und sie versprach beim Abschied, baldmöglichst bei ihrem donnerstäglichen Salon vorbeizukommen, in dem sämtliche Vertreter der schönen Künste in München ein- und ausgingen.
Auf der Heimfahrt unterhielten Theodor und Eleanor sich noch über den traumhaften Abend und ihre beiden Gastgeber. „Stell dir vor, Theo, sie war an der Universität!“
Theodor nickte. „Das ist heute nicht mehr so außergewöhnlich. Franz hat mir erzählt, dass er viele Frauen in seinen Kursen hat. Und sie sind nicht schlechter als ihre männlichen Kollegen. Seit letztem Jahr sind Frauen sogar zum Medizinstudium zugelassen, wusstest du das nicht?“
Eleanor schüttelte sich. „Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Eine Frau als Medizinalrat! Oder muss es dann Medizinalrätin heißen? Das ist doch albern. Findest du nicht, Theodor?“
Theodor lachte. „Wer weiß? Vielleicht wird unsere Marie eines Tages sogar eine Frau Doktor.“
„Gegen einen Arzt als Schwiegersohn hätte ich nichts einzuwenden. Aber meine Tochter, eine Ärztin?“
„Na und?“, widersprach Theodor immer noch lachend. „Die Zeiten ändern sich.“
Eleanor sah Theodor verblüfft an: „Wie? Sogar im Hause von Konsigny?“
IV.
Berlin, Oktober 1907
„Leise, ganz leise klingt’s durch den Raum,
liebliche Weise, Walzertraum.
Einmal noch beben, eh es vorbei,
einmal noch leben, lieben im Mai!“