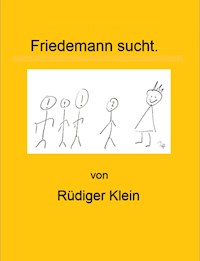
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
P.G. Wodehouse trifft Tom Sharpe in Auerbachs Keller. Dieser Mischung entspricht der Stil des Romans, dessen skurrile, etwas aus der Zeit gefallene Protagonisten Friedemann und Traugott mit ihren Freunden Hernandez und Olivier um die Welt ziehe, um den Sinn des Lebens und die Frau fürs Leben zu finden. Stationen dieser emotionalen wie philosophischen Odyssee sind unter anderem Las Vegas, Pjöngjang, Hamburg, Porto Cervo und Cornwall. Der Roman ist gespickt mit gesellschaftspolitischen, philosophischen und ästhetischen Spitzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedemann sucht.
von
Rüdiger Klein
ISBN 978-3-7375-0782-0
Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Copyright: ©2014 Rüdiger Klein, [email protected]
Ich, Maman, Papa
„Wenn Katzen kotzen, kotzen Katzen Katzenkotze. Töricht, Friedemann, wer anderes erwartet.“
Glauben Sie mir, Maman wusste Bescheid.
Ich bin nicht schön.
Ich bin nicht klug.
Aber, ich will mich nicht beschweren.
Ich bin reich.
So richtig scheißenreich, mit allem, was dazugehört.
Irgendeiner meiner Vorfahren hat so viel Wasauchimmer besessen, dass die ehrenwerte Familie Nedellamm-Moenten, deren bislang letzter Spross ich bin, noch Generationen ausschließlich damit wird verbringen können, herauszufinden, wie ein von materiellen Sorgen freier Mensch die Krone der Schöpfung würdig repräsentiert.
~
Meine liebe Maman scheint spätestens auf dem Sterbebett von der Gewissheit beseelt gewesen zu sein, dass ihr einziges Kind auf diese Frage keine angemessene Antwort findet.
Dass mit dem Aussterben der Familie Nedellamm-Moenten ein Zacken aus der Schöpfung Krone fiele, war jedoch für Maman ausgemachte Sache. Ihr letzter Wille war daher, ich möge fruchtbar sein und mich vermehren. Wenigstens in dieser Hinsicht, so wünschte sie mit fast schon gebrochenem, aber immer noch strengem Blick, solle ich sie nicht enttäuschen: „Friedemann, mein Junge, Du musst nur die richtige Frau finden. Den Rest überlass ihr. Dann wird alles gut.“
„Gewiss, Maman, sobald ich so weit bin.“
„Du bist fünfunddreißig, mein Junge.“
„Eben.“
Maman seufzte und starb.
~
Sie müssen wissen, ich habe Maman sehr geliebt und ihre Urteilskraft als nahezu unfehlbar geschätzt. Doch ihr letzter Wunsch gründete vielleicht mehr auf Verzweiflung denn auf Hellsichtigkeit. War doch mein Vater, obschon er fraglos die Richtige gefunden und dieser dann alles andere überlassen hatte, in die Gruft gefahren, ohne dass alles gut geworden war.
Maman sagte, ich sei ihm sehr ähnlich.
~
Alt wurde Papa leider nicht. Meine Erinnerungen an ihn sind vage. Ich entsinne mich vor allem seiner schattenspendenden Ohren.
Sein Glück wie auch sein Ende verdankte er dem Umstand, nicht schwimmen zu können. Papa soll ein leidenschaftlicher Fliegenfischer gewesen sein. Überhaupt war alles an Leidenschaft, das in ihm steckte, dem Fliegenfischen geschuldet. Jeder, der auch nur eine vage Vorstellung von dieser Extremsportart hat, mag ermessen, welchen Grad ekstatischer Verzückung das kontemplative Ruteinswasserhalten zulässt.
Jedenfalls stand Papa eines frühen Morgens mit seinem Gummistrampler hüfthoch in dem an seinem französischen Wasserschlösschen vorbeilaufenden Flüsschen und schaute in stiller Erregung auf die Spitze seiner Angelrute, als Maman, damals Küchenhilfe im Schloss, ihn davon in Kenntnis setzen wollte, dass das Frühstück angerichtet sei. Von Papa unbemerkt war sie hinter ihm ans Ufer getreten und rief: „Monsieur, le petit dejeuner c‘est prèparè!“
Erschrocken drehte er sich um, verlor das Gleichgewicht und schickte sich an, zu ertrinken. Maman, schon damals überaus besonnen, widerstand dem Impuls, sofort ins Wasser zu springen und ihn zu retten. In aller Ruhe entledigte sie sich ihrer Kleider, wartete bis Papa hinreichend frisches Flusswasser in den Lungen hatte und Anstalten machte, ohnmächtig flussabwärts zu treiben. Dann sprang sie beherzt hinzu, zog ihn an Land, sprang noch einmal zurück, um auch seine Angel zu retten und entledigte Papa aller meine Zeugung hemmenden Kleidungsstücke. Lehrbuchmäßig holte sie ihn sodann mit vollem Körpereinsatz zurück ins Leben. Dafür war er ihr durchaus dankbar. Als aber Papa sah, dass Maman auch seine Lieblingsrute gerettet hatte, kannte seine Dankbarkeit keine Grenzen. Dieses eine Mal begeisterte er sich für etwas anders als Fliegenfischen. Maman verstand es, ihn davon zu überzeugen, die Frau zu heiraten, welche der Frucht dieser Begeisterung das Leben schenken würde.
Für Papa fiel mit dieser Heirat eine große Last von seinen Schultern. Mein Zeugungsakt war das Produktivste, was ihm je gelungen war. Er war zufrieden damit, Maman alles weitere zu überlassen.
~
Später, als ich in dem nun mir gehörenden Wasserschlösschen – ich komme später darauf zurück – einen einsamen Sommer verbrachte, fand ich im Osttürmchen eine seltsame Hinterlassenschaft von Papa. Ich war, wie so oft in diesen mußevollen Wochen, den ganzen Tag durchs Schloss gebummelt und irgendwann in Papas Allerheiligstes gelangt. Das Dachzimmerchen des Osttürmchens dieses Schlösschens, des Château Boi de Forêt, war Papas Angelzimmer gewesen. Hierhin hatte er sich gerne zurückgezogen. Hier hatte er die von Maman gehassten Zigarren geraucht. Hier hatte ihm frühmorgens das erste Anglerlicht ins Fenster geleuchtet. Hier bewahrte er seine Angelruten, seine Fliegen, kurz – seine Schätze auf.
Als ich nun so gedankenlos in den Fliegenboxen stöberte, zwischen den Trockenfliegen, Nymphen und Tubenfliegen, stieß ich auf ein ledernes Etui, dessen angelspezifischer Zweck sich mir nicht erschloss. Neugierig öffnete ich den schon brüchigen Umschlag und fand darin einen vergilbten Zettel mit den kaum noch sichtbaren Resten eines Kussmundes, eine schwarze Locke und ein farbverschossenes kleines Lichtbild, das eine junge Frau zeigte, die nicht meine Mutter war.
~
Ach ja, aus unerklärlichen Gründen scheint Papa einige Jahre nach meiner Geburt an genau der Stelle, an der Maman ihn gerettet hatte, wiederum aus dem Gleichgewicht gekommen zu sein. Jedenfalls wurde er dieses Mal nicht reanimiert. Wie das Leben so spielt.
~
Aber ich hatte ja Maman. Sie liebte mich so wohlwollend, wie eine Mutter ihren großohrigen Sohn lieben kann.
Ihre Liebe zu mir hatte einen, wie soll ich sagen, dynastisch-protektiven Charakter. Ich erinnere mich insbesondere an Situationen, in denen es um sportlichen Wettstreit ging. Maman dachte damals noch, dass die anderen Jungen einfach besser waren als ich. Mir war schon damals klar, dass in Wahrheit ich schlechter war als die anderen Jungen. Jedenfalls hat sich Maman damals noch rührend darum bemüht, sportliche Leistungsvergleiche zu meinen Gunsten etwas komplexer zu gestalten. Ein in Mamans Augen zu Unrecht guter Skiläufer wurde somit bisweilen nicht nur von einem anspruchsvollen Parcours, sondern außerdem von seiner defekten Skibindung gefordert. Maman war sich nie zu schade, für den Erfolg ihres einzigen Kindes persönlich in aller Herrgottsfrühe aufzustehen, um Sauerstoff aus Tauchflaschen abzulassen oder Fallschirmseile zu verknoten. Traditionelle Werte wie die Familie waren Maman immer heilig.
~
Ihnen wird bekannt sein, dass einer der unschätzbaren Vorteile unermesslichen Reichtums ist, dass man so viele Freunde haben kann. Mehr als man braucht.
Maman lehrte mich früh, dass die richtigen Freunde nicht unter den Bedürftigen zu finden sind: Entweder sie haben es nur auf mein Geld abgesehen oder sie sind von der Knatter so verunsichert, dass man mit ihnen nichts anfangen kann. Also umgebe ich mich mit Menschen, deren Sozialisierung der meinen nicht unähnlich ist. Die Gruppe dieser Zeitgenossen ist recht überschaubar. Dennoch ist die Bandbreite enorm.
Ich, Hernandez, Olivier, Traugott
Hernandez beispielsweise ist legitimer Erbe eines höchst illegitimen Drogenbarons aus Cuernavaca. Er wuchs in schweizerischen und englischen Bildungsanstalten auf und hat seinen Vater nicht öfter gesehen als ich:
Ich lernte den alten Herrn letztes Jahr kennen, als er hübsch geschminkt in einer glänzenden Mahagonikiste lag.
„Peaceman, Alter, bitte komm mit. Ich weiß nicht, wie ich es unter diesen Barbaren allein aushalten soll."
„Was trägt man denn zu einer mexikanischen Beerdigung?"
„Dezente Faustfeuerwaffen."
~
Hernandez und ich waren vom Flughafen Benito Juárez in Mexico City mit drei schwarzen Lincoln Navigator abgeholt worden. In jedem der drei Gefährte saßen drei wenig vertrauenserweckende, nach Hernandez‘ Versicherung aber durchaus vertrauenswürdige Gestalten, die wie klassische B-Movie-Komparsen wirkten. Hernandez und ich wurden in den mittleren der Wagen gesetzt. Aus dem Umstand, dass unsere Koffer, bevor diese im letzten SUV landeten, zunächst einmal durchsucht wurden, schloss ich, dass wir auf die Herrschaften wohl auch wenig vertrauenserweckend wirkten – nur dass sich niemand hinreichend für unsere Vertrauenswürdigkeit verbürgt hatte. Was man in unseren Koffern zu finden hoffte oder fürchtete, erschloss sich mir nicht ohne weiteres.
„Hernandez, sag, wurde unser Gepäck nicht vom Sicherheitspersonal des Flughafens gecheckt?“
„Klar, Peaceman, aber was soll das unseren Gastgebern bringen, wenn die Airport-Security auf der Payroll eines anderen Kartells steht?“
Die Fahrt, etwa fünfundachtzig Kilometer bis Cuernavaca, und danach weitere annähernd zwanzig Kilometer nach Norden ins Gebirge zur Bergfestung der Familie, war ebenso langweilig wie angespannt. Das düstere Schweigen unserer Begleiter erstickte unsere Redelust im Keim. Das Interessanteste, was es auf der Fahrt zu sehen gab, war der Staub, den das vor uns fahrende Fahrzeug aufwirbelte. Wir waren froh, als die Wagen im Atrium eines schwer befestigten Gebäudekomplexes hielten und wir von einem Subalternen in Empfang genommen wurden, der nicht wie ein Bösewicht aussah – und Englisch sprach:
„Willkommen auf der Wolfsschanze, mein Name ist Stanley. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise. Darf ich Sie auf Ihre Zimmer bringen?“
„Guten Tag, Stanley! Danke der Nachfrage. Ich denke, wir würden uns in der Tat gerne etwas frisch machen, nicht wahr, Hernandez.“
„Klar Mann. Hi Stanley!“
~
Über der Eingangstür prangte eine quadratische Platte aus schwarzem Granit. In jede der Ecken war ein großes Fragezeichen aus massivem Gold eingelassen. Jede Seite wies einen ebenfalls in Gold (und spanisch) gehaltenen Text auf – wahrscheinlich die zu den Fragezeichen gehörenden Fragen. In der Mitte der Platte zeigte sich eine große goldene Vier, daneben, auch in Gold, die Buchstaben CCP. Hernandez nahm mein Interesse wahr und ließ mich wissen: „Das ist das Wappen des CCP, cartel cuatro preguntas, das Kartell der vier Fragen. Hat sich Jesus Diablo ausgedacht, ein echter Philosoph. Den lernst Du noch kennen.“
In der Tat fand sich das Wappen überall im Haus, sogar auf der Bettwäsche. Eine omnipräsente Geschmacklosigkeit.
~
Wie sich herausstellte, hatte Stanley einen MBA gemacht. Da er es jedoch versäumt hatte, seine Alma Mater aus der Reihe der Ivy-League-Hochschulen zu wählen, stand er bald vor der Wahl, entweder bei Walmart Einkaufstüten zu packen oder sein Glück als Gastarbeiter zu suchen. Ihm kam zugute, dass es in der mexikanischen Upper Class als dernier cri gilt, sich diplomierte US-Amerikaner als Haushaltshilfen zu halten. Dabei erhöht es den Chic noch ungemein, wenn der Domestik nicht über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung für Mexiko verfügt.
~
„Nun“, vertraute uns Stanley an, „ich schätze, ich werde das hier noch ein paar Jahre durchziehen, bis ich genug beiseite gelegt habe. Dann werde ich zuhause in Dubuque ein Café aufmachen und eine Familie gründen.“
Stanley hatte Hernandez und mich in zwei nebeneinanderliegende Räume in der Bel Etage einquartiert und war, da er spürte, dass wir uns von den sonst einkehrenden Gästen sehr unterschieden, schnell zutraulich geworden. Den eigentlichen Gastgeber, den Schwager von Hernandez‘ Vater, Jesus Diablo, hatten wir noch nicht zu Gesicht bekommen. Er sollte gegen Abend eintreffen. Bis dahin waren wir auf uns gestellt und ließen uns von Stanley unterhalten. Nachdem wir eine Weile gescherzt und gelacht hatten, trübte sich Stanley’s All American Frohsinn plötzlich ein.
„Warum schauen Sie so bekümmert, Stanley?“
„Na, ich hoffe, dass Ihr beide wieder heil nach Hause kommt. Ihr wisst schon, Hotel California, und so.“
„Hotel California?“ fragte ich blöde.
„Eagles“, meinte Hernandez lässig.
„Genau“, bestätigte Stanley.
„Würde mich mal bitte jemand aufklären! Ich kann mit Adlern in einem Westküstenhotel nichts anfangen.“
„Na ja“, begann Stanley zögerlich, „nicht alle, die hierhinkommen, gehen auch wieder.“
„Sie verlassen das Haus nicht mehr?“
„Das schon. Aber sie werden dann eher getragen oder geschleift. Ich meine, Ihr wisst schon, bei wem Ihr hier zu Gast seid, nicht wahr?“
„Aber, Mann, ich bin doch nur hier, um meinem alten Herrn das letzte Geleit zu geben. Dann bin ich wieder weg.“
„Es wäre vielleicht klug, das klarzustellen. Denn morgen Abend nach der Beerdigung wird die ganze – Familie – hier sein, um die Nachfolge Deines Vaters zu regeln. Das wird gewiss kein Plauderabend. Ich bekomme über die anderen Angestellten so einiges mit. Man betrachtet Euer Kommen mit durchaus gemischten Gefühlen. Also, nicht dass Ihr mich falsch versteht. Ich kann mich über nichts beklagen. Aber dies hier ist nicht der Verwaltungssitz einer Kinderhilfsorganisation.“
Ich war verblüfft über diese Einlassung und hakte nach: „Aber was, Stanley, hat Sie dazu bewogen, hier anzuheuern?“
Stanley antwortete etwas indigniert: „Es ist ja nicht so, als hätte ich mir wie ein Au-pair Mädchen meine Gastfamilie im Internet aussuchen können. Die Schleuser haben mich für fünfhundert Dollars über die Grenze nach Mexiko gebracht, mich in einem Container bis nach Morelos gekarrt und dann in einem Schuppen abgeladen. Nebenan standen ein paar Wellblechhütten, in denen das Assessment-Center war. Ich habe die Tests gemacht, wurde klassifiziert und musste einen Vertrag unterschreiben. Schließlich wurde ich von einem schweigsamen Fahrer hierhin gebracht zu Deinem Vater, der mir sagte, er sei nun mein Arbeitgeber. Meine Stellung war irgendwie die eines Kammerdieners. Da die Isotopieebene der von Deinem Vater geführten beruflichen Gespräche eher atavistisch geprägt war, nutzte er mich, wenn ihm intellektuell zumute war, zum Ausgleich gerne als Konversationskatalysator. Ich habe mich mit Deinem Vater trotz seiner Profession ganz gut verstanden. Naja, wie das jetzt weiter geht, weiß ich auch nicht. Einstweilen ist meine Stellenbeschreibung eher amorph. Aber ich stehe jedenfalls nicht auf der niedrigsten Stufe der mexikanischen Gesellschaft. Das soziale Umfeld ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber als blauäugiger blonder Ami mit MBA bin ich hier als Slankee finanziell in der Premier League.“
„Slankee?“
„So nennen die Mexikaner ihre US-amerikanischen Haussklaven.“
Ich war tief beeindruckt.
Hernandez hatte mittlerweile begonnen, sich Sorgen zu machen.
„Hör mal, Stanley“, sagte er, „ich habe keine Ambitionen, in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Er hat einen fetten Trust für mich eingerichtet, der mehr abwirft als ich je brauchen werde. Das ist absolut kein Thema für mich. Hast Du denn irgendwelche Tipps für uns, wie wir hier heile wieder rauskommen?“
„Na ja, dann solltest Du den Seniores schnellstens klar machen, dass Du vom Kuchen nichts willst. Und im Übrigen solltet Ihr die Leute nicht irritieren. Ihr beide, zumal Dein Freund, Ihr wirkt schon exotisch genug. Da die Herrschaften ohnehin recht nervös sein dürften, wäre eine gute Assimilation hilfreich.“
„Gibt es da besondere Gebräuche, die wir kennen sollten?“
„Jedenfalls ist die Sache mit dem Nachtisch nicht zu unterschätzen.“
„Was meinst Du?“
„Ich denke mal, dass heute Abend zum Dessert bolivianisches Marschierpulver serviert wird“, eröffnete uns Stanley.
Hernandez und ich waren nun gleichermaßen alarmiert.
„Man erwartet von uns, dass wir Drogen konsumieren?“, fragte ich.
„Na ja, Leute, es kommt nicht nur darauf, an, dass Ihr das Zeug nehmt, sondern wie Ihr es nehmt.“
„Was, meinst Du, Mann?“
„Das ist ein ganz spezieller Drogentest. Wer sich das Kokain wie ein Staubsauger reinzieht, gilt als unzuverlässiger Addict; wer sich weigert, gilt als noch unzuverlässiger.“
„Ach, ja“, verstand ich, „das ist die mexikanische Variante von ‚Wer niemals einen Rausch gehabt, ist auch kein braver Mann‘.“
Stanley sah mich zweifelnd an und Hernandez fragte: „Wie sollen wir das Zeug denn nehmen? Also, wenn ich so an die einschlägigen Filmszenen denke, geht das mit Kreditkarte und gerollten Geldscheinen auf dem Klo, oder?“
Stanley war sichtlich erstaunt: „Leute, ich schätze, solche Typen wie Ihr waren noch nie in diesen Mauern zu Gast. Ihr seid hier definitiv nicht am richtigen Ort.“
„Das hilft uns jetzt auch nicht weiter, Mann. Was sollen wir tun?“
„Am besten wäre es natürlich, sich ganz nonchalant eine Linie reinzuziehen, kurz anerkennend zu nicken und sich zurück zu lehnen.“
„Mmh, sollen wir das mal üben?“ wollte Hernandez wissen.
Stanley schüttelte den Kopf: „Keine gute Idee. Wer weiß, ob Ihr rechtzeitig wieder runterkommt. Kokain bringt die meisten Leute auf die schlechte Idee, zu meinen, sie hätten eine gute Idee. Ihr würdet Euch wahrscheinlich um Kopf und Kragen labern.“
„Und nun?“
„Keine Ahnung. Seid einfach vorsichtig.“
~
Gegen einundzwanzig Uhr fanden wir uns im Speisesaal mit vierzehn mehr oder minder düster blickenden Gestalten wieder.
Hernandez und ich trugen Abendkleidung. In meinem Fall hieß das: Dinner Jackett. Hernandez trug eine weinrote Paillettenjacke über einem gleißend gelben Rüschenhemd. Unvergleichlich. Die anderen sahen aus wie die beim Casting gescheiterten Bewerber für die Rolle der Blues Brothers. Als Hintergrundmusik lief eine Endlosschleife die uns abwechselnd mit der kleinen Nachtmusik und ‚Cherry cherry Lady‘ beglückte. Am Kopf der Tafel saßen Jesus Diablo und Hernandez. Rechts neben Hernandez saß ich, links neben Jesus Diablo eine flachstirnige Fettbacke, die unablässig reihum alle anderen Teilnehmer des Abendmahls mit bösen Blicken bedachte.
Kaum dass die Honneurs verklungen waren, erhob Hernandez das Glas, um seine Lebensversicherung abzuschließen: „Liebe Familie, Leute, mein lieber Jesus.“
Ich verstand kaum ein Wort, da mir das, was Hernandez in diesem Kreis sagte, spanisch vorkam. Im Nachhinein ließ er mich den (angeblichen) Wortlaut der Rede wissen:
„Der Mann“, fuhr er fort, „den wir morgen beerdigen, war ja nicht nur mein alter Herr. Er war ja auch der Vater dieses großartigen Unternehmens. Er war ein starker, cooler Typ. Um die Sache hier zu schaukeln, muss man stark und cool sein. Ich bin auch cool. Aber ich weiß nicht so wirklich, was hier abgeht. Ich kenne das Geschäft nicht. Ich kenne Euch nicht. Ich bin einfach nur der Typ, der seinem lieben Vater die letzte Ehre erweist – und weg bin ich.“
Beifälliges Murmeln.
„Natürlich habe ich mich gefragt: Mensch, Hernandez, willst Du nicht den Laden übernehmen?“ Augenblicklich nahmen die Gesichter der Trauergemeinde raubtierhafte Züge an. „Aber“, fuhr Hernandez fort „ich wusste gleich: Das ist Quatsch. Ihr habt ja den lieben Schwager meines Vaters. Ihr habt Jesus Diablo. Der hat doch bis jetzt auch alles super geregelt. Jesus ist cool. Ich finde, er macht das ganz prima und ich wünsche ihm alles Gute!“ Etwa die Hälfte der Raubtiergesichter verwandelte sich Chihuahuas, der Rest in Hyänen.
Jesus Diablo versuchte erfolgreich, Contenance zu bewahren. Hernandez erhob sein Glas und schritt zum Äußersten: „Also Leute! Auf den neuen Chef der Familie. Viva Jesus Diablo! Viva! Viva!“
Keiner der Tischgenossen wagte, das Glas stehen zu lassen, aber Jesus Diablo registrierte sehr genau, wer sich als Chihuahua zu erkennen gab, und wer zu den Hyänen zählte.
Das Essen nahm seinen Gang, und ich versuchte, mich zu entspannen. Der Rotwein half mir dabei. Da ich kein Spanisch sprach, Hernandez ins Gespräch vertieft war und der Mann rechts neben mir mich nur angewidert angesehen hatte, als ich das Wort auf Englisch an ihn richtete, konzentrierte ich mich auf das Trinken. Ich hatte schon geglaubt, die Sache sei überstanden, als Stanley, herausgeputzt wie ein Gardeäffchen, mit einem Silbertablett zum Tisch schritt, neben Hernandez innehielt und das Tablett halbrechts vor ihm abstellte. In dieses Tablett war das allgegenwärtige CCP-Wappen geprägt. Doch dort, wo die anderen Ausführungen des Wappens die Fragen zwischen den Fragenzeichen in den vier Ecken zeigten, fanden sich schmale kanalartige Vertiefungen, die liebevoll akkurat mit einem feinen weißen Pulver gefüllt waren. Gleich einem Füllfederhalter stak rechts oben in dem Tablett ein goldenes Röhrchen, dessen Zweck für den Connaisseur keiner weiteren Erläuterung bedurfte. Es war angerichtet.
Hernandez, der gerade noch launig mit Jesus Diablo geplaudert hatte, hielt inne. Er blickte auf das Tablett wie das Gnu auf den Ochsenfrosch. Seine Stirn wurde feucht und seine Mimik starr. Ich verspürte das starke Bedürfnis, ihm zu helfen. Die flachstirnige Fettbacke zog ihre Brauen bis zur Nasenwurzel hinunter. Die Chihuahuas und die Hyänen begannen, Witterung aufzunehmen. Das war nicht gut. Die Krise war da. Ich fühlte mich gefordert, griff mir das Goldröhrchen und improvisierte:
Unbemerkt füllte ich meine Lungen, tief in den Bauch atmend, mit Luft, schloss meine Lippen um das Röhrchen und – mich wie ein beherzt Einatmender aufrichtend – tat ich so, als sauge ich mit aller Kraft das Kokain in meine Lunge. Das bisschen, was ich tatsächlich aufnahm, platzierte ich unter meiner Zunge, während ich bei meinem markierten todeskampfartigen Hustenanfall darauf achtete, das Tablett mit dem Rauschgift zu Boden zu reißen. Hernandez und Stanley waren entsetzt und stürzten hinzu, mich zu retten. Der Rest der Gesellschaft war von der Blödheit des Gringos unangenehm berührt, wusste aber nicht recht, was von der Sache zu halten sei. Hernandez und Stanley schafften mich zwecks erster und zweiter Hilfe aus dem Raum und waren damit stillschweigend von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung entbunden.
Ich hatte mittlerweile das Rauschgift ausgespuckt und sorgte mich wegen des tauben Gefühls im Mund. Stanley sagte mir, Gin Tonic sei in meinem Fall genau die richtige Medizin. Ich vertraute ihm zu Recht. Ich schlief tief und ruhig.
~
Am nächsten Mittag fand die Beerdigung statt. Ein Konvoi von elf schwarzen Verbrecherautos bewegte sich von der Bergfestung hinunter zur Nekropole des am Fuße des Berges gelegenen Ortes. Diesmal, man hatte uns mittlerweile für ebenso harmlos wie wertlos befunden, saßen Hernandez und ich ohne Aufpasser im letzten Wagen. Stanley war unser Fahrer. Dass wir im letzten Wagen saßen, bedeutete auch, dass wir in der glühenden Mittagshitze an der langen vor der Kapelle parkenden Wagenkolonne vorbei gehen mussten, bevor wir endlich in den rettenden Schatten des Gotteshauses gelangten.
~
Sollten Sie jemals zu einer mexikanischen Beerdigung im Sommer eingeladen werden, bestehen Sie darauf, im ersten Wagen zu sitzen. Dieser Hinweis gilt allerdings nicht uneingeschränkt.
~
Eine Ausnahme gilt zum Beispiel für den Fall, dass die Trauergemeinde ähnlich sozialisiert ist, wie die sich zu Hernandez‘ Vaters Beerdigung zusammenfindende. Denn als Hernandez, Stanley und ich im Anschluss an die Trauerfeier nach endlosen Metern völlig dehydriert schließlich wieder an unserem Wagen angelangt waren, hatte sich der Anfang der Kolonne schon längst in Bewegung gesetzt, und nach wenigen Sekunden waren die ersten sechs Fahrzeuge durch einige lustige Raketen in die Luft gejagt worden – sei es von missgünstigen, sich um die Regeln des fairen Wettbewerbs nicht scherenden, Konkurrenten – sei es von verantwortungsbewussten Joystick-Piloten im Pentagon.
„Peaceman“, meinte Hernandez, „ich glaube, der offizielle Teil der Feier ist damit durch.“
„Stanley“, fragte ich, „kennen Sie den kürzesten Weg zum Flughafen?“
„Surest thing you know.“
Und weg waren wir.
~
Stanley hat übrigens kurz darauf einen Fünf-Jahres-Vertrag als Privatsekretär von Hernandez unterschrieben. Die Finanzierung seines Cafés in Dubuque war bereits mit der Unterschrift gesichert.
~
Oliviers Vater hatte es zweimal auf die Titelseite einer bekannten Zeitschrift geschafft. Das erste Mal zierte sein dominantes Kinn das Forbes-Magazin über dem Titel „Jüngster Junk-Fonds-Milliardär“. Das zweite Mal prangte sein deutlich unvorteilhafteres Portrait auf der New York Times: als reichster Wirtschaftskrimineller, dessen im Polizeigewahrsam begangenen Selbstmord das NYPD zu beklagen hatte. Wenn auch die SEC das Familienvermögen eingefroren hatte, war Oliviers luxuriöse Zukunft Dank der rekordverdächtigen Schadensersatzzahlung des Staates New York gesichert.
Olivier hatte die kriminellen Machenschaften seines alten Herrn stets aufs Entschiedenste verurteilt und jegliche monetären Zuwendungen von ihm brüsk zurückgewiesen. Er war also ganz auf die Naturaleffekte Daddys stinkenden Reichtums beschränkt gewesen. Dem Erfolg der Staatshaftungsklage verdankte er die Gewissheit, über sauberes Geld zu verfügen.
„Weißt du, Peaceman, es ist ein gutes Gefühl, als anständiger Mensch anständiges Geld auszugeben."
„Olivier, ich glaube manchmal, Du bist der einzige von uns, der sich in diese Art von Leuten hineinversetzen kann, die abends ihr hart erarbeitetes Brot brechen und dabei so richtig rechtschaffen zufrieden sind."
~
Olivier lernte ich in Genf kennen. Hernandez hatte mich überredet, zu einer Vernissage in eine dieser zauberhaften an der Nordseite des Lac Leman gelegenen Villen mitzukommen. Er selbst war dann aber auf seinem Chalet bei Chamonix in einer Schneewehe oder einem Skihasen stecken geblieben. Ich stand etwas verloren mit meinem Champagner im Salon und versuchte, mein zartes ästhetisches Empfinden vor den abstoßenden „Installationen“ des uns von der Gastgeberin als ausstellenden Künstler vorgestellten Geschmacksverbrechers zu schützen. Zu diesem Zweck vertiefte ich mich in die zur Einrichtung der Villa gehörende mutmaßliche Replik eines Bildes von Lorenzo Lotto. Das Gemälde stellte einen jungen Mann in seinem Studierzimmer dar. Unter seinem Wams trug der Portraitierte ein leichtes weißes Hemd mit über den Handgelenken gerafften Ärmeln und einem bis zum Hals geknöpften schmucklosen Rundkragen.
„Schickes Hemd, nicht wahr?“, sagte jemand, der sich, von mir unbemerkt, hinzugesellt hatte. Ich blickte nach rechts und sah einen sehr lässigen Mann, der über einer schwarzen Leinenhose ein ähnliches Hemd trug, wie das, welches den Portraitierten kleidete. Ich entgegnete: „Oh, wie ich sehe, haben Sie denselben Schneider.“
Wir hatten uns gerade miteinander bekannt gemacht, als sich der Günstling der Hausherrin bemerkbar machte: „Hallo!“
„Selber Hallo.“, murmelte ich, was ihn leider nicht abschreckte. Er ließ nicht locker: „Aber, aber! Sie sind doch nicht hier, um sich mit billigen Kopien alter Schinken zu langweilen. Was hier an den Wänden hängt, ist tote Leinwand – und nicht mal echt. Sehen Sie sich meine Werke an: Das ist relevante Kunst.“
Olivier und ich wandten uns unangenehm berührt dem Störenfried zu. Er sah aus wie manche Künstler meinen, aussehen zu müssen. Olivier ließ seinen Blick über die im Salon aufgestellten Konstruktionen schweifen und fragte: „Das also sind Ihre Werke?“
„Genau.“
Dann bewegte Olivier sich nachdenklich zu einem an der jenseitigen Wand stehenden Deckenfluter, legte den Kopf leicht schräg und sprach mit Blick auf den Maestro: „Ein wirklich gelungenes Design.“
„Ja, ja. Sehr hübsch“, wurde er verärgert beschieden, „aber jeder Trottel erkennt, dass das keine Kunst ist.“
„Wie das?“, mischte ich mich ein.
„Weil“ – der gute Mann bewegte sich auf unsicheres Terrain – „weil der künstlerische Mehrwert fehlt.“
„Das sehe ich ein“, log ich ihm offen ins Gesicht, „Vielleicht sind Sie so freundlich, das dem jungen Herrn an der Stehlampe einmal an einem Ihrer Werke zu demonstrieren.“
Olivier sandte mir einen vergnügten Blick zu und meinte: „Mag sein, dass das helfen würde.“
„Ja, gerne“, akzeptierte das ahnungslose Opfer unseres Schabernacks seine Rolle: „Ich schlage vor, wir sehen uns einmal dieses Objekt an.“ Damit wies er auf einen in der Mitte des Raumes platzierten großen durchsichtigen Plastikeimer, der zu zwei Dritteln mit einer honiggelben, zähen Flüssigkeit gefüllt war, in der kopfüber bis zum Bauchnabel eine nackte Barbiepuppe stak. Das rechte Bein der Puppe war mit einem kleinen hölzernen Fahnenmast verlängert, der ein Schild trug mit der Aufschrift „Dead Puppet Drowning“.
Olivier und ich traten gesenkten Hauptes vor die Scheußlichkeit und gönnten dessen Urheber gemessene Sekunden vermeintlich respektvollen Schweigens.
„Oh, ha!“, brach es dann aus mir heraus.
„In der Tat“, pflichtete Olivier mir bei.
„Sehen Sie?“, hob ich an, „die Doppelgründigkeit erweist sich schon im Titel.“
„Lassen Sie hören!“ ermunterte mich Olivier.
„Nun“, fuhr ich fort, „Ertrinken bezeichnet eine Art des Übergangs vom Leben zum Tod, setzt also Leben voraus.“
„Hört, hört!“
„Puppen aber leben nicht.“
„Ach so. Ich verstehe“, fiel Olivier ein, „deshalb heißt es ja auch ‚tote Puppe‘. Nicht wahr?“
„Genau: Minus und Minus ergibt Plus.“
„Ja. Und dadurch wird die Puppe quasi lebendig.“
„Ja. Und kann sterben.“
„Ja. Und ertrinken.“
„Ja. Toll.“
„Entschuldigung!“, der Blödmann versuchte, in die Exegese seiner Schöpfung einzugreifen, „also eigentlich ist dieses Werk Ausdruck der …“
Er wurde sogleich von Olivier ausgebremst: „Sagen Sie, ist es nicht so, dass sich der Künstler in seinem Werk entäußert?“
„Oh, ehmm, sicher, emhmmja? Ja.“ Der Gedanke schien ihm zu gefallen. Er hob an, fortzufahren: „Ich will sagen…“
„Nein bitte!“, fiel ich ihm ins Wort, „tun Sie das nicht!“
„Höh?“
„Sie bestätigten soeben, dass sich der Künstler in seinem Werk entäußert. Er kann sich mithin nicht mehr qualifiziert ü b e r selbiges äußern.“
„Also…“
„Gilt das eigentlich für alle Künstler?“, wollte Olivier wissen.
„Ja. Ja“, bestätigte ich freudig erregt, „sogar für Ballkünstler.“ –
„Bitte?“ Der Puppentöter war angezählt.
„Aber ja doch“, erklärte ich ihm geduldig: „wenn so ein Ballkünstler das goldene, das perfekte Tor schießt, das alle Herzen höher schlagen lässt und ihn zum Gott verklärt, dann stürzt er sich kopfüber vom Olymp, wenn er anschließend dem Sportreporter seine Großtat erläutern will. Er wird etwas sagen wie ‚Und dann denkich, Mensch, denkich, den machich rein. Boaheh. Und dann einfach rein die Murmel.‘ Verstehen Sie?“
„Das soll doch Ihnen nicht passieren“, ergänzte Olivier.
„Gott behüte!“ schüttelte ich den Kopf. In stillem Einverständnis wandten Olivier und ich uns vom Puppenmassaker ab und wieder der Lorenzo Lotto Replik zu. Das hatte Spaß gemacht. Still vergnügt betrachteten Olivier und ich wieder das Ölgemälde.
„Stimmt“, konstatierte ich.
„Was?“ fragte Olivier.
„Schickes Hemd.“
~





























