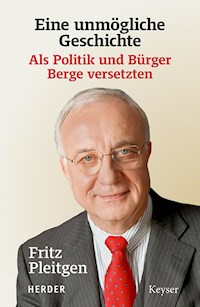5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein einzigartiger Austausch über ein fremdes nahes Land
Gibt es Anlass, Moskau zu fürchten? Hat womöglich Russland Grund, dem Westen zu misstrauen? Wodurch werden die Spannungen zwischen Ost und West befeuert? Und lassen sie sich lösen?
Der langjährige ARD-Korrespondent Fritz Pleitgen und der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Michail Schischkin erzählen von ihren Erfahrungen mit Russland und dem Westen und den Gegensätzen und Spannungen, die sich seit einigen Jahren wieder verschärfen: Zwei profunde Kenner, die erkunden, wie es nach der Ära der Entspannungspolitik und dem vermeintlichen Ende der Ost-West-Konfrontation zu der angespannten aktuellen Lage kommen konnte. Beide eint ihre Liebe zu Russland – doch in ihrer Einschätzung der Wurzeln des Konflikts sind sie Kontrahenten: Michail Schischkin kritisiert scharf Putins autoritäre Herrschaft und die Politik des Kreml. Für Fritz Pleitgen ist das Verhalten des Westens selbstgerecht und geschichtslos. Persönliche Einblicke, hellsichtige politische Analysen, historische Einsichten – ein notwendiges Buch in schwieriger Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Fritz Pleitgen • Michail Schischkin
Frieden
oder
Krieg
Russland und der Westen – Eine Annäherung
ZUM BUCH
Ein einzigartiger Austausch über ein fremdes nahes Land
Gibt es Anlass, Moskau zu fürchten? Hat womöglich Russland Grund, dem Westen zu misstrauen? Wodurch werden die Spannungen zwischen Ost und West befeuert? Und lassen sie sich lösen?
Die Frage »Frieden oder Krieg?«, die das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen im 20. Jahrhundert bestimmt hat, ist heute erneut von erschreckender Aktualität. Wer die Ursachen verstehen will, muss die Ängste und Erwartungen kennen, die sich aus historischen Erfahrungen speisen und das Bild der Staaten und Völker voneinander prägen.
Der langjährige ARD-Korrespondent Fritz Pleitgen und der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Michail Schischkin erzählen von ihren Erfahrungen mit Russland und dem Westen und den Gegensätzen und Spannungen, die sich seit einigen Jahren wieder verschärfen – zwei profunde Kenner, die erkunden, wie es nach der Ära der Entspannungspolitik und dem vermeintlichen Ende der Ost-West-Konfrontation zu der angespannten aktuellen Lage kommen konnte. Beide eint ihre Liebe zu Russland – doch in ihrer Einschätzung der Wurzeln des Konflikts sind sie Kontrahenten: Michail Schischkin kritisiert scharf Putins autoritäre Herrschaft und die Politik des Kreml. Für Fritz Pleitgen ist das Verhalten des Westens selbstgerecht und geschichtslos.
Eine ungemein erhellende Doppelperspektive: persönliche Einblicke, hellsichtige politische Analysen, historische Einsichten – ein ebenso kluger wie pointierter Austausch. Und eine Hoffnung machende Vision, denn so konträr die Positionen dieser beiden intimen Russlandkenner auch sind, in einem sind sie sich einig: Verständigung ist möglich. Ein notwendiges Buch in schwieriger Zeit.
ZU DEN AUTOREN
Fritz Pleitgen berichtete ab 1970 als Korrespondent des ARD-Studios Moskau aus der Sowjetunion. Nach Stationen in Ostberlin, Washington und New York kehrte er zum WDR nach Köln zurück, dessen Intendant er von 1995 bis 2007 war.
Michail Schischkin, 1961 in Moskau geboren, lebt seit 1995 in der Schweiz. Seine Romane Venushaar, Briefsteller und Die Eroberung von Ismail erhielten zahlreiche Preise und wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt.
Foto F. Pleitgen: © Dirk Borm
Foto M. Schischkin: © Evgeniya Frolkova
Inhalt
Vorwort
Der erste Russe
»Das sind ja die Deutschen! Die Faschisten!«
Der lange Weg nach Moskau
»Das Paradox der Lüge«
Das Regime: Chruschtschow und Breschnew
»Zar des Berges«
Der Widerstand: Sacharow und Kopelew
»Ckopo!« Bald!
Larissa Bogoras
Die neue »Zeit der Wirren«
Die Nonkonformisten
»Die Erhebung von den Knien«
Mörderische und andere Erfahrungen
»Das Fenster nach Europa« oder ein Spiegel?
Die Friedensbewegung
Der hybride Frieden
Arthur Miller
Zwei »Russenvölker«
Die Nato-Osterweiterung und ihre Folgen
»Auf die Geduld des großen russischen Volkes!«
Klitschko und die Ukraine
Futur I
Dem Verstand folgen
Futur II
Dank
Vorwort
Der Ursprung dieses Buchs liegt viele Jahre zurück, als beide Autoren in Moskau lebten, aber keine Ahnung voneinander hatten. Sie stiefelten durch dieselben Straßen, jedoch auf anderen Planeten. Die Zeiten waren ungemütlich. Es herrschten die Bedingungen des Kalten Krieges. Westliche Korrespondenten wurden wie Spione behandelt. Einer der Autoren, ein deutscher Journalist, war von seinem Sender geschickt worden, um eine Fernsehberichterstattung aufzubauen. Der andere, ein zukünftiger Schriftsteller, war damals noch ein Jugendlicher, las insgeheim verbotene Bücher, hasste trostlose Schlangen für karge Lebensmittel, musste in der Schule die Beschlüsse des Parteitages auswendig lernen und verkehrte mit Altersgenossen im Hof, jungen Kriminellen, die später fast alle im Gefängnis landeten. Zu westlichen Ausländern hatte er keinen Zugang.
Die beiden waren grundverschieden, alles trennte sie: das Alter, die Sprache, der Ursprung, die Vergangenheit. Doch sie haben etwas gemeinsam. Die beiden lieben Russland, seine Kultur und seine Menschen. Und es tut ihnen weh, dass Russland als Nachfolger der untergegangenen Sowjetunion nicht so Tritt gefasst hat, wie sie es beide erhofft hatten. Als der Kalte Krieg zwischen Ost und West zu Ende ging, war alles angerichtet, um Immanuel Kants Idee vom »ewigen Frieden« Wirklichkeit werden zu lassen. Friedensselig lagen sich die Völker Europas in den Armen. Ihre politischen Führungen schmiedeten eine Charta für ein neues friedliches Europa. Die Idee für ein »gemeinsames europäisches Haus« hatte ihnen mit Michail Gorbatschow ein Russe geliefert. Das war am 21. November 1990 in Paris.
Und heute? Alles Schall und Rauch. Der Westen rückte mit Nato und Europäischer Union allen Warnungen zum Trotz bis an die Grenze Russlands vor. Russland antwortete mit zweifachem Bruch des Völkerrechts: Es nahm unter militärischem Druck dem Nachbarn und Brudervolk Ukraine die Krim weg und führt ebenso unvertretbar in der Ostukraine einen Hybridkrieg, der über 10 000 Menschen das Leben gekostet hat. Unvermittelt stand die Frage wieder im Raum, die über viele Jahrzehnte das Verhältnis zwischen Ost und West, zwischen Russland und dem Westen beherrscht hatte: Frieden oder Krieg? Was war hier schiefgelaufen?
* * *
Kennengelernt haben wir uns – der russische Schriftsteller und der deutsche Journalist – auf der litCOLOGNE. Der Deutsche befragte den Russen zu seinem Roman Die Eroberung von Ismail. Und natürlich diskutierten wir über Russland. Uns beide beschäftigten die gleichen Themen und die gleichen Fragen, denn Jahrzehnte und Jahrhunderte vergehen, aber Russland übersteht mit Bravour all die unzähligen Versuche, es zu erklären. Warum ist Russland so, wie wir es heute erleben, warum verhält sich der Westen, wie er es tut? Inwieweit sind innere Faktoren ausschlaggebend, inwieweit spielen äußere Einflüsse, spielt die Dynamik der Beziehungen eine Rolle? Können wir ausbrechen aus Konfrontation und Machtpolitik, gibt es Wege zu Kooperation und Begegnung?
Das öffentliche Gespräch reichte nicht aus. Deshalb setzten wir den Gedankenaustausch privat fort. Dass unsere Ansichten gegensätzlich waren, schadete der gegenseitigen Wertschätzung nicht. Da wir uns nicht wie Nachbarn schnell und häufig zusammensetzen konnten, beschrieb jeder sein Bild von Russland. Wie zwei Tunnelbauer gingen wir daran, den massiven, granitharten Berg »Russland« den jeweiligen Positionen entsprechend von entgegengesetzten Seiten zu durchbohren, selbst auf die Gefahr hin, uns nicht in der Mitte zu treffen.
So entstand dieses Buch über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Verstehens. Kann man an Russland nichts als glauben, wie ein viel zitierter russischer Dichter behauptet hat, oder ist das Land nur mit dem Verstand zu begreifen? Warum können der Westen und Russland seit Jahrhunderten einander nicht finden? Was heißt Russland lieben? Was bringt die Zukunft?
Weil dies auch ein Buch über Russlands Zukunft ist, handelt es von der großen Geschichte und kleinen persönlichen Geschichten. Die Zukunft besteht ja aus der Vergangenheit und aus uns allen, die diese Vergangenheit jeden Tag mit ihrem Leben erschaffen.
Fritz Pleitgen & Michail Schischkin
Der erste Russe
Fritz Pleitgen
Den ersten Russen, der in meinem Leben eine Rolle spielte, habe ich durch die Erzählung meiner Mutter kennengelernt. Sie sprach mit ihm, aber sie erhielt keine Antwort. Sie konnte ihn auch nicht sehen. Die Umstände erlaubten es nicht. Er saß in einem Panzer. Und sie lief vor ihm her.
Die Geschichte spielte in Niederschlesien, wohin meine Mutter mit den beiden jüngsten von fünf Kindern evakuiert worden war. Kurz darauf wurde unsere Wohnung in Essen durch englische Luftminen völlig zerstört. Der Krieg zerriss unsere Familie. Mein Vater musste in Essen bleiben. Er arbeitete bei Krupp. Ein Rüstungsbetrieb. Unabkömmlich. Auch meine Schwester Marlies (21) galt ab unabkömmlich. Sie arbeitete bei Rheinstahl in Essen. Erst als sie von Telefunken übernommen und ihr Werksteil ins niederschlesische Kloster Leubus verlegt wurde, kam sie im Oktober 1944 zu uns. Mein ältester Bruder Günter war an der Ostfront schwer verwundet worden und lag seitdem in einem Lazarett in Brandenburg. Mein Bruder Hans-Georg (16) durfte Essen auch nicht verlassen. Er hatte als Flakhelfer die Stadt gegen Luftangriffe zu verteidigen.
In einer Siedlung bei Parchwitz hatte meine Mutter eine Notunterkunft gefunden. Zwölf Häuser, links und rechts einer Landstraße. Ärmlich, aber eine liebliche Moränenlandschaft. Und keine Bombenangriffe!
Im Januar 1945 war es vorbei mit dem Frieden. Endlose Trecks von Flüchtlingen zogen durch unsere Siedlung. Das Brüllen der Front rückte näher. Die Nazioberen brachten sich auf Lkw mit reichlich Hab und Gut in Sicherheit. Die Bevölkerung ließen sie sitzen. Auch die Natur zeigte sich wenig menschenfreundlich. Das Quecksilber fiel unter minus 20 Grad.
An einem frühen Morgen wurden wir mit dem Ruf »Die Russen kommen« aus den Betten gejagt. Wir waren vorbereitet. Voll angekleidet hatten wir die Nacht verbracht. Meine Schwester Marlies und mein Bruder Horst (11) stürzten aus dem Haus, spannten sich vor einen Schlitten und einen Handwagen, die sie mit zwei Koffern beladen hatten, und marschierten los; zunächst 25 Kilometer nach Liegnitz, wo wir uns bei Bekannten treffen wollten, falls wir auf der Flucht auseinandergerissen wurden. Ich war damals sechs Jahre alt und hatte Frost in den Füßen. Da ich die Strecke zu Fuß nicht schaffte, transportierte mich unser Hausbesitzer Zipter in einem Fahrradanhänger zum drei Kilometer entfernten Bahnhof Leschwitz, wo angeblich ein Zug wartete, um uns vor den Russen zu retten.
Meine Mutter war ein herzensguter Mensch. Wir liebten und verehrten sie sehr, was sie allerdings vor Spott nicht schützte, wenn die Rede auf ihre notorische Unpünktlichkeit kam, der sie selbst im Krieg treu blieb. Als in Essen die Bomben fielen, hatte sie immer noch etwas in der Wohnung zu erledigen, bevor sie Schutz suchte. Meist war sie die Letzte, die es in den Bunker schaffte. Und als die Russen kamen, verhielt sie sich nicht anders. Sie versuchte vergeblich, noch etwas im längst gepackten Koffer zu verstauen. Unnützes Zeug vermutlich. Später wurde in unserer Familie kolportiert, es seien Kleiderbügel gewesen. Beweise gab es dafür nicht. Der Koffer wurde auf der Flucht geklaut.
Als meine Mutter endlich das Haus verließ, kroch der erste russische Panzer in die Siedlung. Trotzdem trat sie auf die Straße. Und ging los. Einfach vor dem Schützenpanzer her. Sie hatte einen guten Vorsprung, bot aber auf der schnurgeraden Straße ein leichtes Ziel. »Die werden doch keine wehrlose Frau abknallen«, redete sie sich ein. Sicher war sie sich ihrer Sache nicht, wie sie mir später anvertraute.
Weil sie sich fürchtete, begann sie ein Gespräch mit dem Panzerschützen. »Deine Mutter hat dich sicher zu einem anständigen Menschen erzogen. Sie wäre traurig, wenn du einer Mutter von fünf Kindern das Leben nimmst.« Sie rechnete nicht mit einer Antwort, registrierte aber nach langen Minuten, dass das Rasseln und Quietschen hinter ihr aufhörte. Der Panzer hatte offenbar haltgemacht.
Meine Mutter wagte nicht, sich umzudrehen. Ihr ohnehin schwaches Herz pochte wie wild. »Nehmen sie dich jetzt ins Visier?«, fragte sie sich. Die deutschen Volkssturmleute, die am Ende der Siedlung mit Panzerfäusten bewaffnet in den mit Schnee gefüllten Gräben lagen, riefen ihr zu, endlich in Deckung zu gehen. Aber sie ging weiter. Sie wollte zu ihren Kindern. Angetrieben von der Sorge, zu spät zu kommen, hetzte sie mit ihren beiden Koffern die drei Kilometer zum Bahnhof Leschwitz. Sie hatte Glück. Der Zug stand noch da. Er hatte nicht abfahren können, weil auf der eingleisigen Strecke nach Liegnitz ein Truppentransporter abgewartet werden musste.
35 Jahre später – ich war inzwischen ARD-Korrespondent in der DDR – fuhr ich mit meiner Frau und unseren Kindern von Ostberlin nach Parchwitz im heutigen Polen. Die Kleinstadt heißt nun Prochowice und ist wie zu deutschen Zeiten Zentrale im Kreis Liegnitz, der sich jetzt Powiat Legnicki nennt. Auch sonst hatte sich wenig geändert.
Nur unsere Siedlung war verschwunden. Im Nachbarort Jurcz, den ich als Jürtsch in Erinnerung hatte, traf ich einen Polen, der mir in einem wilden Mix aus Deutsch, Englisch und Russisch erzählte, dass die deutschen Soldaten – vermutlich verstärkt durch den Truppentransporter, den unser Zug abwarten musste – der vorrückenden Roten Armee in unserer Siedlung erbitterten Widerstand geleistet hatten, wobei alle Häuser zerstört worden waren.
In einem ähnlichen Gemisch aus Deutsch, Englisch und Russisch erklärte ich meinem polnischen Gegenüber, dass Deutsche und Russen nicht immer Feinde gewesen seien, sondern häufig gemeinsame Sache machten, nicht zuletzt zulasten der Polen, aber auch gegen andere. Nicht weit von hier zum Beispiel.
Zwischen Katzbach und Wütender Neiße hatten Deutsche und Russen mit vereinten Streitkräften die französische Armee geschlagen. 1813 war das, im Befreiungskrieg gegen Napoleon – von dem die Polen hofften, er würde sie von den beiden Besatzern befreien. Unser Schriftsteller Theodor Fontane hatte mir auf die Sprünge geholfen. Vor unserer Parchwitzreise hatte ich seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg gelesen, in denen er Terrain und Verlauf der mörderischen Schlacht akribisch beschreibt.
Keine Literatur, aber erstaunlich detailliert war der Bericht des Stabes der 13. sowjetischen Armee an den Stab der 1. Ukrainischen Front vom 9. März 1945. Wie bin ich darangekommen? Ganz einfach! Ich wollte wissen, vor wem wir im Januar 1945 in Panik geflüchtet waren, und rief Igor Butz in Moskau an. Der findige Rechercheur und umsichtige Organisator war über viele Jahre eine unverzichtbare Stütze unserer Korrespondenten in Moskau.
Igor Butz reagierte schnell. In der russischen Militär-Enzyklopädie fand er heraus, dass Vorauseinheiten der 6. Garde- und der 112. Schützendivision die Oder in der Nacht zum 26. Januar an zwei Stellen östlich von Jürtsch überquert hatten. Von dort war es nur noch ein Kilometer durch den Wald bis zu unserer Siedlung.
Östlich der Oder war die deutsche Front offensichtlich völlig zusammengebrochen. Die Ukrainische Front unter Marschall Iwan Konew brauchte für die Strecke von der Weichsel bis zur Oder nur gut zwei Wochen. Auf einer Karte, die mir Igor Butz geschickt hatte, war zu sehen, dass die Rote Armee wie eine gigantische Feuerwalze auf die Oder vorrückte. Dem Bericht der 13. Armee war zu entnehmen, dass sowjetische Vorauseinheiten nach einem Vorstoß über 31 Kilometer die Oderüberquerung sofort in Angriff nahmen, ohne Vorbereitung. Der Brückenkopf am Westufer sei schnell ausgeweitet worden.
Nur an einer Stelle – zwischen den Dörfern Jürtsch und Lampersdorf – sei es den deutschen Gegnern gelungen, die sowjetischen Einheiten vorübergehend zurückzudrängen.
Für meinen Bruder Horst war das eine interessante Nachricht! Am Vorabend unserer Flucht stoppten zwei Busse in unserer Siedlung. Sie transportierten deutsche Soldaten an die Front, wo sie eine Kompanie zwischen den Dörfern Jürtsch und Lampersdorf ablösen sollten.
Der Kommandeur fragte nach dem Weg. Mein elfjähriger Bruder wusste Bescheid. Der Offizier wollte ihn gleich mitnehmen. Unsere Mutter war dagegen. Mein Bruder, soeben Mitglied im Jungvolk geworden und entsprechend auf Heldentaten gedrillt, wollte unbedingt mitfahren. Der Offizier gab sein Ehrenwort, ihn wieder zurückzubringen. Es sei eilig, sie dürften sich nicht verfahren. Die Russen seien im Anmarsch. Erstaunt fragt er, warum die Zivilisten nicht schon längst geflüchtet seien. Dies sei Frontgebiet. Unsere Mutter erklärte ihm, dass es noch keine Räumungserlaubnis gegeben habe.
Mein Bruder saß schon im Bus, unsere Mutter blieb voller Angst um ihr Kind zurück. Da nicht bekannt war, ob die sowjetische Armee die Oder bereits überquert hatte, fuhren beide Busse ohne Licht. Wie sich mein Bruder erinnert, wurde während der Fahrt kein einziges Wort gesprochen. In sich gekehrt starrten die blutjungen Soldaten in die Dunkelheit des eisigen Winterabends. Wahrscheinlich waren sie mit den Gedanken bereits bei den Kämpfen, die ihnen gegen die feindliche Übermacht bevorstanden. In Jürtsch und Lampersdorf erfolgte die Ablösung ohne viele Worte. Mit den völlig erschöpften Soldaten der abgelösten Kompanie an Bord kehrten die beiden Busse zurück. Mein Bruder wurde in der Siedlung abgesetzt, wo er von unserer Mutter sehnlichst erwartet wurde.
Der Bericht der 13. sowjetischen Armee vermerkt, dass um Jürtsch und Lampersdorf acht Tage gekämpft wurde. Am 3. Februar war der deutsche Widerstand gebrochen. Von Gefangenen ist in dem Bericht keine Rede.
Auch unsere Siedlung findet keine Erwähnung. Deshalb weiß ich nicht, warum meine Mutter aus der Begegnung mit dem Panzer heil herauskam. Ich werde im russischen Militärarchiv nachforschen müssen, um darüber Näheres zu erfahren.
War es Mitleid der Besatzung? Oder war dem Schützen eine ganze Panzergranate zu schade, um sie auf einen einzelnen, offensichtlich unbewaffneten Menschen abzufeuern? Nach Meinung von Igor Butz hatte meine Mutter einfach nur Glück.
Sie blieb davon überzeugt, dass die russische Panzerbesatzung sie aus Mitleid entkommen ließ. Wir widersprachen ihr nicht, auch aus Achtung vor ihr. Bei Fremden und selbst bei guten Bekannten stieß ihre Meinung vom »gütigen Russen« auf heftigen Unglauben. Nach dem Krieg stand das Ansehen der Russen bei uns in Westdeutschland nicht hoch im Kurs.
Berichte über Gräueltaten der Roten Armee beim Einmarsch in Ostpreußen wurden als Bestätigung für die Bösartigkeit der Russen genommen. »Nicht alle!«, hielt meine Mutter dagegen, ohne ihre Erfahrung Spott und Herablassung auszusetzen.
Was hat mir meine Mutter mitgegeben? Nicht nur ihre Unpünktlichkeit!
»Das sind ja die Deutschen! Die Faschisten!«
Michail Schischkin
Meine erste Erinnerung an die Deutschen ist mit einer Ohrfeige verbunden. Vielleicht hat das Kindergedächtnis diese Episode deswegen behalten. Ich war vier. Meine Eltern haben sich unseren ersten Fernseher angeschafft. Die üblichen Dokumentarbilder wurden gezeigt: Der Krieg. Eine Naziparade. Deutsche SS-Truppen marschieren in Reih und Glied. »Wie schön!«, sagt mein älterer Bruder begeistert und bekommt sofort eine Backpfeife vom Vater. »Wie kannst du so was sagen!«, schreit er empört, »das sind ja die Deutschen! Die Faschisten!«
Mein Vater war im Krieg als U-Boot-Matrose in der Ostsee. Er meldete sich mit 18 Jahren freiwillig, um seinen älteren Bruder zu rächen. Als ich klein war, wohnten wir in einem Keller auf der bekannten Moskauer Arbat-Straße, über meinem Bettchen hing ein Foto seiner »Schtschuka« (dt.: »Hecht«. Die Щ-310 war ein im Zweiten Weltkrieg eingesetztes russisches U-Boot). Als Kind war ich furchtbar stolz, dass mein Papa ein Unterseeboot hatte. Immerzu zeichnete ich es von dem Foto in mein Schulheft ab, malte ihm die Nummer an den Bug: Щ-310. Alljährlich zum 9. Mai, dem Tag des Sieges, nahm mein Vater seine Marineuniform aus dem Schrank, die er wegen zunehmender Leibesfülle immer wieder umändern musste, und hängte alle seine Orden an. Es war so wichtig für mich, stolz auf meinen Vater zu sein. Es hat einen Krieg gegeben, und Papa hat ihn gewonnen!
Erst viel später bekam ich mit, dass Vater in den Jahren 1944/45 an der Versenkung deutscher Schiffe beteiligt gewesen war, die Flüchtlinge aus Riga und Tallinn evakuierten. Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen fanden so den Tod in den baltischen Gewässern – dafür hatte Vater seine Orden bekommen. Der Stolz ist mir seit Langem vergangen, doch verurteilen mag ich ihn genauso wenig. Es war Krieg.
Nach dem Krieg trank er. Genau wie alle seine Freunde von der U-Boot-Flotte. Vermutlich konnten sie nicht anders. Er war doch noch ein Junge, als er monatelang im Einsatz auf hoher See war, in ständiger Angst, in einem eisernen Sarg unterzugehen. So etwas lässt einen nicht mehr los.
Zu Gorbatschows Zeiten, als die harten Hungerjahre anbrachen, bekam Vater als Kriegsveteran Hilfspakete zugeteilt, darunter auch Lebensmittel aus Deutschland. Er empfand das als persönliche Demütigung. Das ganze Leben hatten er und seine Kameraden sich als Sieger gefühlt, und nun sollten sie die Brosamen vom Tisch des besiegten Feindes essen. Als Vater uns das erste Mal die Lebensmittelration brachte, betrank er sich und schrie: »Wir haben doch gesiegt!« Dann wurde er still und weinte und fragte Gott weiß wen, wendete sich aber an mich: »Sag, haben wir den Krieg gewonnen oder verloren?«
In seinen letzten Jahren zerstörte er sich mit Wodka. Alle seine U-Boot-Kameraden hatten sich da längst ins Grab gesoffen, er war der letzte Überlebende. Vermutlich beeilte sich Vater, seine Kampfgefährten wiederzusehen. In seiner Seemannsuniform verbrannte er im Moskauer Krematorium.
Als Kinder haben wir immer Krieg gespielt. Die Feinde waren die Deutschen, wie in allen Filmen, die uns gezeigt wurden.
In der Schule wurden die Schüler in zwei Fremdsprachengruppen eingeteilt. Alle wollten Englisch lernen und niemand Deutsch. Die Lehrer drohten: »Wenn du schlechte Noten hast, kommst du in die deutsche Gruppe!« Ich hatte gute Noten, aber das Pech, dass meine Mutter unsere Schuldirektorin war. Sie sagte: »Mischa, ich weiß, du hast es verdient, in die englische Gruppe zu gehen, aber du wirst trotzdem Deutsch lernen. Dann können mir die anderen Eltern nicht vorwerfen, ich hätte dich bevorzugt.« So wurde ich dem Ruf der Schuldirektorin geopfert und musste die deutsche Sprache lernen.
Meine Einstellung änderte sich, als ich in der Abschlussklasse Max Frischs Mein Name sei Gantenbein in russischer Übersetzung las. Ich war total überwältigt, denn bei uns war fast alles verboten, was für die Entwicklung der Literatur im 20. Jahrhundert wichtig war. Nicht einmal Nabokov oder Joyce wurden publiziert. Mit Max Frisch kamen die technischen Errungenschaften der westlichen Prosa wie durch einen Trichter in mich hinein. Ich habe dann Stiller im Original aufgetrieben und mit dem Wörterbuch gelesen. So begann meine Liebe zur deutschen Sprache, die bis heute anhält. Viel später übrigens wurde ich von Max Frisch enttäuscht, aber das hatte nichts mit der Sprache zu tun.
Der lange Weg nach Moskau
Fritz Pleitgen
In meinen frühen Jahren als Fernsehreporter hatte ich mit Russland wenig zu tun. Ich war in der Gegenrichtung unterwegs. Mein Sender schickte mich zur Berichterstattung nach Brüssel und Paris. In Brüssel saß die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und in Paris die Nato. Beide Einrichtungen betrachteten sich als Gegenpole zur kommunistischen Supermacht Sowjetunion, die im Nato-Sprachgebrauch meist Russia oder Russie genannt wurde. Lord Ismay, der erste Chef der Nato, brachte das nordatlantische Bündnis auf die Formel: Keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. Diese Einstellung gegenüber Russland ist heute noch weitverbreitet: Russland gilt als feindselig und auf bedrohliche Weise rätselhaft.
Die Weltsicht von Nato und EWG färbte auf uns Journalisten ab. Russland war für uns der Inbegriff der Unfreiheit und Zwangsherrschaft, eine Gefahr für unsere Zivilisation. Militärische Macht gegen militärische Macht, lautete die Parole. Gelegentlich gab es heiße Krisen, die den Ausbruch eines Atomkriegs fürchten ließen (1961 beim Bau der Mauer in Berlin, 1962 wegen der Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in der Türkei und sowjetischer Atomwaffen in Kuba).
Ins Nachdenken über Russland geriet ich zum ersten Mal nicht durch ein literarisches Erweckungserlebnis, sondern durch eine politische Begegnung mit Willy Brandt.
1966 war es in der Bundesrepublik Deutschland zu einem Regierungswechsel gekommen. CDU/CSU bildeten mit der SPD eine Große Koalition. Brandt, Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei, wurde neuer Außenminister.
Als Regierender Bürgermeister von Berlin hatte er erlebt, dass die Großmächte kein Verlangen hatten, wegen deutscher Probleme einen weltvernichtenden Krieg gegeneinander zu führen. Diese Erkenntnis veranlasste Brandt zu einer Kehrtwende. Die Bundesrepublik stand damals nach wie vor unter der Kontrolle der Alliierten; Kontakte mit den Staaten des Ostblocks mussten sorgfältig mit den Siegermächten im Westen abgesprochen werden.
Brandt kam zu der Überzeugung, die Bundesregierung müsse sich, da es um das Schicksal der Deutschen ging, stärker einbringen und ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen, auch gegenüber dem Osten.
Nach einer Rede 1967 irgendwo in Ostwestfalen saß Brandt, was er gerne machte, mit ein paar Journalisten bei einem Glas Rotwein zusammen. Ich war der Jüngste in der Runde. »Wir sollten versuchen, mit Polen ein Freundschaftsverhältnis zu entwickeln, wie das Adenauer mit Frankreich gelungen ist. Aber der Schlüssel liegt in Moskau«, fasste Brandt seine Überlegungen zusammen.
Ich war gleich Feuer und Flamme. Endlich etwas Neues, etwas Kühnes im verrotteten Ost-West-Verhältnis. Fortan war ich Anhänger der Ostpolitik von Willy Brandt. Später trat ich seiner Partei bei. Das änderte zunächst nichts daran, dass Moskau für mich in weiter Ferne blieb. Die sowjetischen Lebens- und Arbeitsverhältnisse erschienen mir wenig verlockend. Ich war weiter auf Westtrip. Paris und Washington blieben meine Sehnsuchtsorte.
Hier muss ich eine Episode einschieben, die für meine spätere Entsendung nach Moskau eine wichtige Rolle spielte. Im Juni 1967 bescherte mir der Sechstagekrieg zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten einen Einsatz in Ägypten, also auf der Verliererseite. In Kairo hatte sich eine Heerschar erfahrener Kriegsreporter versammelt, die allerdings nicht zum Zuge kam. Die ägyptische Regierung schaffte es, die gesamte internationale Presse total abzublocken. Trotzdem brachte ich eine brauchbare Berichterstattung zustande. Als ich nach Köln zurückkehrte, galt ich als tauglich für schwierige Aufgaben, nicht zuletzt unter Zensurbedingungen.
Ohne dass ich es wusste, rückte mir Russland näher. Unser Korrespondent Lothar Loewe war die Arbeit in Moskau leid. Die Verhältnisse waren in der Tat unerträglich. Journalisten, die an Presse- und Meinungsfreiheit gewöhnt waren, hatten Mühe, sich mit der Zensur und der Überwachung im »Land der Lügen« – wie Michail Schischkin es nennt – zu arrangieren. »Es macht keinen Sinn mehr«, teilte der genervte Korrespondent unserem Sender mit.
Loewe, ein charakterfester, erfahrener Journalist, hatte in Berlin Blockade und Mauerbau miterlebt. Ein Sympathisant der Sowjetmacht war er darüber nicht geworden. In unserem Sender genoss er großes Ansehen. Als Loewe ging, wollte der WDR den Korrespondentenplatz Moskau nicht aufgeben. Für unseren Intendanten Klaus von Bismarck hatte Russland eine besondere Bedeutung. Vermutlich lag es an seinem Erbgut. Die enge Partnerschaft mit Russland war für seinen Urahn, den legendären Reichskanzler Otto von Bismarck, ein Eckpfeiler seiner Außenpolitik gewesen.
Der Chefredakteur ließ mich im Auftrag unseres Intendanten wissen, der Sender wolle mich nach Moskau schicken. »Ich bin kein Slawist und spreche kein Russisch«, wandte ich ein. – »Russisch können Sie lernen. Sie haben noch ein Jahr Zeit. Ihr Behauptungswillen wird Ihnen in Moskau helfen. Außerdem sind Sie für die Ostpolitik.« Das war ich. Aber musste meine Überzeugung in einen Opfergang ausarten?
Meine Frau gab den Ausschlag. »Wir kriegen das hin«, meinte sie. Trotz der Rückendeckung durch meine Frau war ich mir meiner Sache noch nicht sicher. Bei nüchterner Betrachtung der Verhältnisse kam ich zu dem Ergebnis, dass es nichts gab, was einen Fernsehreporter verlocken konnte, nach Moskau zu gehen. Die Sowjetunion versprach Arbeitsbedingungen, die im Vergleich zu Ländern unserer Hemisphäre dem Regime eines Straflagers glichen. Mit den heutigen Verhältnissen in Russland ist das nicht zu vergleichen.
Der Eiserne Vorhang, der in Deutschland und Mitteleuropa Ost und West voneinander trennte, schien damals undurchdringlich. Die Kommunikation war äußerst beschwerlich. Ein Telefonat nach Deutschland (West) musste im Fernmeldeamt angemeldet werden. Es dauerte wenigstens sechs Stunden, meist viel länger, bis die Verbindung hergestellt wurde.
Ähnlich schwierig war es mit der Flugverbindung.
Es gab zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion kein Luftverkehrsabkommen und deshalb keine direkte Flugverbindung. Wer von Moskau nach Westdeutschland reisen wollte, musste entweder über Stockholm oder Wien fliegen. Ein kürzerer Weg führte mit der DDR-Fluggesellschaft Interflug über Ostberlin, von dort passierte man die Grenze nach Westberlin und fuhr nach Tegel. Allerdings ging die Grenzpassage immer mit vielen unangenehmen Problemen einher.
Die Flugverbindungen spielten für Fernsehjournalisten eine wichtige Rolle, denn nur auf diesem Wege konnten wir damals unsere auf Film gedrehten Berichte in die Heimatsender verschicken. Dabei waren Ost und West auch in technischer Hinsicht durch den Eisernen Vorhang getrennt: Bei uns wurde auf Agfa gefilmt, in der Sowjetunion auf Kodak. Deshalb konnten wir unsere Filme nicht in einem Moskauer Labor entwickeln – wir drehten quasi blind. Was wir aufgenommen hatten, konnten wir uns in Moskau nicht ansehen.
Wenn ich heute über meine damaligen Arbeitsverhältnisse in Moskau erzähle, pflege ich mein Smartphone aus der Tasche zu ziehen. Mit einem solchen Gerät wäre ich damals unschlagbar gewesen. Ich hätte mit dem kleinen Alleskönner Gespräche und Ereignisse selbst in dunklen Winkeln aufnehmen können. Technisch vollkommen autark hätte ich das Aufgenommene leicht an die Heimatsender verschicken können. Die Realität von 1970 war der krasse Gegensatz. Wir westlichen Fernsehkorrespondenten arbeiteten unter Zensurbedingungen. Jeder Bericht musste im Vorfeld vom sowjetischen Außenministerium genehmigt werden. Erst danach konnte ich bei der staatlichen Presseagentur Nowosti ein Kamerateam bestellen.
Es bestand aus einem Kameramann, einem Tontechniker und einem sogenannten Realisator. Seine offizielle Aufgabe war es, bei Übersetzungen und Drehgenehmigungen vor Ort zu helfen. Er hatte auch für den Versand des gefilmten Materials zu sorgen. Nebenbei achtete er darauf, dass die Kommentare der ausländischen Fernsehkorrespondenten frei von offener oder versteckter Kritik an den sowjetischen Verhältnissen waren. Dem Kameramann oblag es, nur gepflegte Verhältnisse zu zeigen. Schlecht gekleidete oder hinfällige Menschen, Hinterhöfe oder Häuser in schlechtem Zustand wurden übersehen.
Die sowjetischen Kolleginnen und Kollegen, die mir geschickt wurden, waren durchweg freundliche und verständnisvolle Menschen. Sie wussten, dass wir im Westen andere Vorstellungen vom Journalismus hatten, und sie bemühten sich, meinen Wünschen zu entsprechen. Aber die Grenzen waren für sie eng gesteckt.
Die Ergebnisse unserer Arbeit, die wir unter diesen erschwerten Bedingungen zustande brachten, standen wiederum unter scharfer Beobachtung durch die jeweiligen Sowjetbotschaften in unserer Heimat. Im geteilten Deutschland gab es gleich zwei davon, eine in Bonn und eine in Ostberlin. Was über die Sowjetunion berichtet wurde, entging den Beobachtern in den Botschaften nicht. Wenn ihnen das Gesehene nicht gefiel, konnte dies Ärger auslösen. Dem Korrespondenten konnte es egal sein, aber warum sollte ein sowjetischer Kameramann oder Realisator für einen Bericht eines ausländischen Journalisten unangenehme Konsequenzen in Kauf nehmen? So war in groben Zügen die Lage.
Mein Auftrag wurde von meinen Vorgesetzten knapp formuliert. Ich sollte innerhalb von fünf Jahren eine angemessene Korrespondenz aufbauen. Was hieß das? Ich sollte dafür sorgen, dass uns die Sowjetunion mit einem eigenen Kamerateam arbeiten ließ und das Recht einräumte, unsere Berichte frei und ungehindert zu exportieren. Diese scheinbar schlichte Aufgabe sah eher nach Scheitern als nach Erfolg aus.
Als es an den Vertrag für meine Entsendung ging, fielen mir Bismarck und seine Politik der Rückversicherung ein. Ich erinnerte daran und ermutigte meinen Sender, mir eine angemessene Weiterbeschäftigung zuzusichern, falls meine Mission in Moskau schiefgehen sollte. Das sei selbstverständlich, erklärten meine Vorgesetzten. Schriftlich wollten sie mir die Garantie nicht geben. Dies sei unüblich. Aber sie unterstützten mich immer, ob sie nun Wördemann, Dingwort-Nusseck, Höfer, Scholl-Latour, Hübner oder von Sell hießen.
Meine Frau war inzwischen genervt von den ständigen Beileidsbekundungen, die sie zu hören bekam, vornehmlich von Freunden und Bekannten. Sie hielten unsere Moskaupläne für eine katastrophale Fehlentscheidung. »Wann geht es denn los zu Iwan, dem Schrecklichen?«, wurden wir scheinbar besorgt gefragt.
Die Zusicherung des WDR nahm meine Frau mit Erleichterung auf. »Mehr können wir nicht verlangen. Wir schaffen das. Lass die Leute reden, was sie wollen. Wir sind abgesichert und frei, unsere eigenen Erfahrungen zu machen.« Voller Zuversicht machten wir uns auf die Suche nach einer Russischlehrerin und hatten Glück.
Wir fanden Alla Petrowna, eine Mitarbeiterin der Deutschen Welle. Sie hatte im Krieg den deutschen Rundfunkingenieur Walter Spettnagel kennengelernt und ihn später geheiratet. Alla Petrowna war eine entschiedene Gegnerin des kommunistischen Regimes in Moskau, aber sie liebte Russland.
»Sind Sie ein Kenner der russischen Literatur?«, fragte sie mich. »Nur mäßig!«, gestand ich. Michail Lermontow war in meiner Jugend einer meiner Favoriten gewesen, mein literarischer James Dean gewissermaßen. Über Lermontow war ich auf Puschkin gekommen, später auf Tolstoi. Wie jeder Bildungsbürger hatte ich Krieg und Frieden sowie Schuld und Sühne gelesen und im Theater Tschechows Kirschgarten und Drei Schwestern gesehen.
»Nicht viel!«, stellte Alla Petrowna fest und forderte mich auf, die Lektüre von Dostojewskis Brüder Karamasow und von Tolstois Sewastopoler Erzählungen und Hadschi Murat nachzuholen. was ich befolgte. Als Zugabe konsumierte ich die Russische Geschichte: Von den Anfängen bis in die Gegenwart, ein Werk des renommierten Osteuropahistorikers Günther Stökl. Was ich jetzt von Michail Schischkin erfahre, habe ich bei Stökl allerdings nicht gelesen. Womöglich wäre ich erst gar nicht losgefahren.
»Kultur und Geschichte sind wichtig, wenn Sie Russland erklären wollen«, trug mir Alla Petrowna auf. Der Auftrag meines Senders war prosaischer. »Sie müssen nicht mit jedem Bericht die Sowjetunion als Diktatur enttarnen. Das wissen wir schon lange. Bauen Sie in Ruhe eine Korrespondenz wie in Frankreich auf!«, gab mir mein Chefredakteur noch einmal mit auf den Weg und klang fast schon wie Willy Brandt.
Bevor ich nach Moskau aufbrach, sprach mir Alla Petrowna gütig zu. »Sie sollten sich Friedrich nennen. Mit Ihrem Namen Fritz lösen Sie in Russland nur Abscheu aus. Fritz ist der Inbegriff des Killerdeutschen.« Ich mochte den Namen eigentlich auch nicht, aber nun hatte ich mich daran gewöhnt und wollte dabei bleiben. So begab ich mich als deutscher Fritz zu den Russen.
Um ein Gefühl für mein neues Berichtsgebiet zu bekommen, wollte ich über Land anreisen. Meine Frau sollte mit unserem ersten Kind später im Flugzeug nachkommen. Ende November 1970 fuhr ich los. Im Auto! Ein ungemütlicher, aber lehrreicher Trip. Nach meiner Reise vom Kölner Dom bis zum Kreml stand der Tacho bei 2125 Kilometern. Deutschland und Europa waren noch tief gespalten. Erst ging es durch die DDR, mit den üblichen Schikanen: lange Wartezeit an der Grenze in Helmstedt. Dahinter hatte ich die DDR-Staatssicherheit bis nach Frankfurt/Oder dicht auf den Fersen. Ich kam mir vor wie die englische Königin, immer in Begleitung.
In der Volksrepublik Polen verschwanden meine Beschatter. Ich schaute nicht mehr in den Rückspiegel, sondern konzentriert nach vorne. Auf dem Weg nach Warschau erforderten die vielen unbeleuchteten Pferdewagen in der früh anbrechenden Dunkelheit meine volle Aufmerksamkeit. Je näher ich nach meinem Stopp in Warschau der polnischen Ostgrenze kam, desto mehr beschworen Plakate am Wegesrand die unverbrüchliche Freundschaft zwischen der Volksrepublik Polen und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
Angesichts dieser Slogans und eingedenk der Verbrechen, die von Deutschen in Polen begangen worden waren, versuchte ich an einer Tankstelle auf Russisch, an Benzin zu kommen. Der Tankwart ging schweigend davon. Als ich meinem Unmut auf Deutsch Luft machte, kehrte er zurück. »Warum sprechen Sie nicht gleich Deutsch?«, fragte er mich. Während er mein Auto mit Treibstoff vollpumpte, brachte er mir mit derben Invektiven bei, dass es mit der Freundschaft zwischen Polen und Russen nicht weit her sei.
Es fing an zu schneien, als ich an der Grenze auf die Brücke über den Bug fuhr. Der Fluss war viel schmaler als in meiner Vorstellung. Ich musste an meinen Fernsehdirektor Heinz Werner Hübner denken, der am 22. Juni 1941 als Artilleriebeobachter vom westlichen Flussufer verfolgte, wie sich von sowjetischer Seite ein mit Getreide beladener Zug der Eisenbahnbrücke näherte. Stalin hatte bis zuletzt Wort gegenüber den Deutschen gehalten und sie mit Getreide beliefert.
Diese Lieferung wollten die Deutschen sich nicht entgehen lassen. Erst als der letzte Waggon die westliche Seite sicher erreicht hatte, ging das Trommelfeuer der deutschen Geschütze los. Der Krieg gegen die Sowjetunion hatte begonnen. Die Hinterlist und Brutalität des Überfalls empfand Heinz Werner Hübner zeit seines Lebens als deutsche Schande, auch wenn sich sein Mitgefühl mit dem betrogenen Massenmörder Stalin in Grenzen hielt.
Auf der Brücke über den Bug versperrte mir ein Schlagbaum die Einfahrt in die Sowjetunion. Ich machte es mir bequem und schlief ein. Nach einer Stunde weckte mich energisches Klopfen. Ein sowjetischer Grenzsoldat wies mich an, in die Grenzstation einzufahren.
Die sowjetische Botschaft in Godesberg-Rolandseck hatte mir eine zügige Abfertigung an der Grenze zugesichert. Die Kontrollen von Gepäck und Pass dauerten fünf Stunden. Viel Zeitaufwand für eine kleine Fuhre! Dennoch keine uninteressante Erfahrung für einen angehenden Korrespondenten.
Ich hatte sogar Verständnis für die Beamten. Für sie muss meine Ankunft eine willkommene Abwechslung gewesen sein. Denn in der ganzen Zeit kam kein weiteres Auto über die Brücke. Ich war allein auf weiter Flur und blieb es. Auf der gesamten weiteren Strecke von 1100 Kilometern bis Moskau sah ich kein Auto mit ausländischem Kennzeichen.
Beim Zoll lernte ich eine weitere Lektion. Die Beamten verstanden mein Russisch nicht. Als ich sie anredete, schauten sie mich verständnislos an. Als sie selbst loslegten, verstand ich kein Wort. Was ich theoretisch wusste, bestätigte sich gleich an der Grenze. Die Sowjetunion war nicht Russland, sondern bestand aus einer Vielzahl von Völkern. Die Mehrzahl der Menschen in dem Land, das wir Russland nannten, sprach kein sauberes und viele überhaupt kein Russisch. Sie waren Kasachen, Kaukasier, Balten oder Tataren.
Als ich nach der Zollabfertigung endlich losfuhr, war es stockdunkel. Ich hatte es nicht weit. Gleich hinter der Grenze hatte ich über die deutsche Botschaft Moskau in Brest eine Übernachtung buchen lassen. Es funktionierte. Im Hotel wurde mir der Pass abgenommen und der Polizei zur gründlichen Prüfung zugeleitet. Mich überraschte das nicht, ebenso wenig wie die vorangegangene Zollschnüffelei. Wie ich vor der Abreise zu Hause meinem Baedeker aus dem Jahre 1883 entnehmen konnte, erlebten schon die Besucher des zaristischen Russlands eine aufwendige Durchsuchung. Stabile Verhältnisse, dachte ich. Nicht nur in dieser Hinsicht! Französische Reisende konnten im Guide du voyageur von 1897 lesen: »Russland ist einem absolut autokratischen Regime unterworfen.«
Zwischen Brest und Moskau hatte ich genügend Muße, meinen Gedanken nachzuhängen. Hier waren sie also marschiert, die französischen und deutschen Heerscharen von Napoleon und Hitler. Sie zogen eine breite Spur von Tod und Verwüstung durch das Land. Fühlten sie sich als Soldaten einer gerechten Sache? Zehntausende ließen auf den Schlachtfeldern links und rechts der Rollbahn für den Größenwahn des französischen Kaisers und des deutschen Führers ihr Leben. Der Blick auf die Tankanzeige brachte mich in die Gegenwart zurück. Ich musste dringend tanken. Tankstellen hatte ich nur alle 50 Kilometer gesehen. Aber hier kurz hinter Minsk tauchte plötzlich eine auf.
Meine frischen, in Brest offiziell und teuer eingetauschten Rubel (auf dem Schwarzmarkt hätte ich das Dutzendfache bekommen) kamen nicht an, als ich für die Tankfüllung bezahlen wollte. Die Tankwartin wollte Talone sehen. Coupons, die auf einer Bank gegen Valuta zu erwerben seien. Hätte ich gerne gemacht! Aber hier gab es weit und breit keine Bank. Spät war es auch noch.
Der Fall schien aussichtslos. Ich griff zu meinem Notkoffer mit Lippenstiften und Strumpfhosen, der beim Zoll größeres Interesse hervorgerufen hatte. »Für wen?«, hatte mich der Zöllner gefragt. »Für meine Frau!« – »So viele?« – »Wir bleiben fünf Jahre.« Ich legte der Tankwartin einen Lippenstift Marke L’Oréal, Farbe Zartrosa auf den Tisch, dazu eine Strumpfhose.
Mein Vorgehen kam mir plump und peinlich vor, aber es löste das Problem. Die Tankwartin griff beherzt zu, öffnete den Lippenstift, lachte fröhlich und sah in ihrer Freude gleich zehn Jahre jünger aus. »Hast du einen Kanister?«, fragte sie mich. Auch den würde sie füllen. Ich hatte keinen Kanister. »Brauchst du hier aber!« Auch diesen Rat habe ich bis zum Schluss beherzigt.
Der Rubel war gesetzlich die einzig zulässige Währung in der Sowjetunion, aber ein Nichts gegen Valuta. Für mich erwies sich jedoch die Kombination aus Lippenstift und Strumpfhose als wirkungsvollste Währung. So gelangte ich problemlos nach Moskau, wo mir Lothar Loewe sein Beileid zu meinem neuen Job aussprach. Leider hatte er vergessen, die Dienstwohnung herrichten zu lassen.
Der »Remont« sollte jeden Tag kommen. Er kam aber nicht. So verbrachten wir dreieinhalb unvergessliche Monate ohne Gardinen, inmitten unausgepackter Kartons und zunehmend verunreinigter Klamotten. Danach waren wir überzeugt, dass unsere Ehe noch andere Belastungen aushalten konnte.
Inzwischen hatte ich begonnen, die Sowjetunion auf meine Seite zu bringen. Ich flutete das Außenministerium (MID) mit Drehanträgen arglosester Art. Im Namen des Friedens und der Völkerfreundschaft bat ich den »uwaschajeme Gospodin Chudin« (den verehrten Herrn Chudin) von der Presseabteilung, Filmaufnahmen im Brotladen »Chleb« oder im russischen Staatszirkus zu ermöglichen. Die Antwort war Schweigen.
Da Brandt begonnen hatte, seine Ostpolitik zu verwirklichen, vermehrten sich deutsch-sowjetische Regierungsgespräche und Wirtschaftstreffen. Wenn ich über offizielle Treffen mit Vertretern aus Deutschland berichten wollte, brauchte ich dafür keine Genehmigung des Außenministeriums. Ich benötigte nur ein Kamerateam, was mich mit der Presseagentur Nowosti ins Geschäft brachte.
Nowosti stellte gegen Valuta Kamerateams zur Verfügung und besorgte auch den Filmversand nach Deutschland. Daneben begann ich, den Raum der Illegalität auszutesten, der sich in Diktaturen wie ein zweiter, unsichtbarer gesellschaftlicher Raum ausdehnt. Zu diesem Zweck machte ich mich mit dem für Laien nicht einfachen Mechanismus unserer Studiokamera Arriflex vertraut, um im Notfall selbst drehen zu können, wie ich das bereits im arabisch-israelischen Sechstagekrieg gemacht hatte.
Problematisch war die Ausfuhr des selbst gedrehten Materials. Es ging nur mit Schmuggel, ich gab meine Filme Diplomaten und privilegierten Besuchern mit oder nahm sie selbst gut versteckt mit über die Grenze. So gelangten einige Filmchen nach draußen; eigentlich harmlos, aber sie erregten Aufmerksamkeit. Bilder von Gräbern deutscher Kriegsgefangener in Moskau, deren Existenz von den Behörden lange geleugnet wurde. Oder Aufnahmen von der Arbeit des Bildhauers Ernst Neiswestny.
Unglücklicherweise wurde mein Tun von den Sowjetbotschaften in Bonn und Ostberlin sowie vom DDR-Außenministerium dienstlich beobachtet. Sie berichteten dem sowjetischen Außenministerium MID, dem auffiel, dass einige der erwähnten Beiträge vom MID nicht genehmigt worden waren, was Fragen nach sich zog. Mithilfe kleiner Aufmerksamkeiten waren sie schnell beantwortet. Ansonsten blieben die Arbeitsverhältnisse ätzend. Ich verstand Lothar Loewe immer besser.
Meine Frau kam hingegen erstaunlich gut klar. Unseren kleinen Sohn Christoph an der Hand, war sie ständig unterwegs. Einzukaufen gab es nichts, was wir haben wollten. Park- und Spielplatz waren im Frühjahr verschlammt, aber meine Frau machte erfreuliche Bekanntschaften. Mit ihrem freundlichen Wesen und ihrer flotten Erscheinung hatte sie die Zuneigung der russischen Großmütter gewonnen, die links und rechts vom Kutusowski Prospekt im Moskauer Westen ihre Enkel hüteten. »Golubuschka« (Täubchen) nannten sie meine Frau liebevoll, ansonsten wurde sie mit ihrem Vatersnamen Gerda Gustavovna angesprochen. Die Babuschki waren Topquellen für interessante Geschichten. »Der Antichrist ist in Moskau angekommen«, vertrauten sie meiner Frau an.
»Und wer soll das sein?«, fragte ich. – »Der Breschnew natürlich!«, erwiderte sie.
»Und was hast du dazu gesagt?« – »Ich habe sie bestärkt. Wer sein Volk so schlecht versorgt, kann nur das Gegenteil von einem Christen sein.«
Dabei wurde der Partei- und Staatschef Breschnew meine Rettung. Der französische Staatspräsident Georges Pompidou kam zu einem Arbeitsbesuch in die Sowjetunion. Das Treffen fand im weißrussischen Saslauje bei Minsk statt, und obwohl unsere Nachrichtensendung Tagesschau kein Interesse an der Begegnung zeigte, fuhr ich hin.
Die Sondermaschine des französischen Präsidenten landete auf dem Militärflughafen. Durch ein Missverständnis kam das Politbüro zu früh auf das Vorfeld, um den Staatsgast zu begrüßen. Wir Journalisten waren in einem Viereck weggesperrt worden, das einem Boxring glich. Etwas unschlüssig winkte Breschnew uns zu. Ich winkte zurück, stieg über die Absperrung und ging auf das versammelte Politbüro zu.
Keine Heldentat! Die überraschten Sicherheitsleute ließen mich gewähren, zumal mir Breschnew zutraulich entgegenkam. Ich fing ein Gespräch mit ihm an. Die übrigen Journalisten waren mir nachgesprintet, nur mein russischer Kameramann hatte sich nicht getraut.
Zum Schluss unseres Gesprächs fragte ich Breschnew, ob und wann er sich mit dem amerikanischen Präsidenten Nixon treffen werde. »Bald!«, war die Antwort. »Und Vietnam? Stört Sie nicht, dass die USA gegen Ihren Verbündeten Ho Chi Minh Krieg führen?« Darauf Breschnew trocken: »Vietnam daliko!« Die kaltschnäuzige Antwort »Vietnam ist weit« ließ keinen Zweifel aufkommen. Ebenso entschieden, wie die Sowjetunion den Kalten Krieg betrieben hatte, suchte sie jetzt die Entspannung mit dem Westen.
Breschnew strebte ähnlich wie Brandt an, die verhärteten Fronten aufzuweichen. Allerdings mit gegenteiliger Absicht. Er wollte die unter Stalin gegenüber den Westalliierten durchgesetzten Grenzen in Europa auf Dauer festschreiben, auch die Innerdeutsche, während es Brandt darum ging, die Grenzfrage offenzuhalten, um irgendwann die deutsche Einheit zu ermöglichen. Der Unterschied in den Auffassungen von Ost und West bestand im Grunde nur in einem einzigen Wort. Moskau wollte den Status der Grenzen als »unverrückbar« festschreiben. Der Westen beharrte auf der Bezeichnung »unverletzlich«. Am Ende setzte sich die Formulierung »unverletzlich« durch. Das bedeutete, Grenzen durften friedlich verändert werden, was die einvernehmliche Wiedervereinigung Deutschlands erlaubte. Wären die Grenzen für »unverrückbar« erklärt worden, hätte es die deutsche Einheit völkerrechtlich nicht geben können. Bis dahin sollte es ein zähes Ringen werden, aber die Mühen sollten sich lohnen, aus deutscher und aus westlicher Sicht.
In der Sowjetpresse fand ich mich am nächsten Tag auf vielen Fotos wieder, vom Parteiorgan Prawda bis zur Zeitschrift Ogonjok (kleines Feuer). Bildunterschrift: »Der Generalsekretär des ZK der KPdSU im Gespräch mit ausländischen Korrespondenten.« Von da an wurden meine Anträge mit Respekt behandelt. Einen Schritt war ich weiter, aber das reichte nicht. Ich brauchte unbedingt meinen eigenen deutschen Kameramann und die Berechtigung, Filmmaterial selbst zu exportieren – wie es in anderen Ländern üblich war.
Unter den vorwiegend sowjetischen Journalisten fiel ich auf, nicht nur als westlicher Ausländer, auch mit meiner Körpergröße von 1,90 Metern. Von meinem Namen hatte Breschnew nur den in Russland berüchtigten Vornamen behalten. Wenn ich ihm bei Ankünften oder Abflügen auf Flughäfen nahe kam, begrüßte er mich jedes Mal leutselig mit den Worten: »Dawno was ni vidil, Gospodin Fritz!« (»Lange nicht gesehen, Herr Fritz.«) Nicht formvollendet, aber hilfreich. Die Bemerkung ließ auf Nähe schließen; fälschlich, aber nicht zu meinem Nachteil. Es konnte meinem Plan nur nützlich sein.
Ich schloss mich nun regelmäßig dem sowjetischen Pressetross an, wenn Breschnew auf Auslandsreisen ging: in die Mongolei, nach Kuba, nach Frankreich und in die USA. Die Entspannung zwischen Ost und West war in Gang gekommen.
Ich filmte selbst und brachte das Material zum Versand persönlich auf den Flughafen, ob die Tagesschau den Beitrag haben wollte oder nicht. Da es sich um Berichte über den Parteichef handelte, wurde ich vom Zoll als Exporteur grundsätzlich akzeptiert. Später wurde nach Inhalten nicht mehr gefragt. Routine! Wie der Korrespondent, der den allmächtigen Parteichef interviewt hatte, wurde nun auch der Tagesschau-Beutel mit Respekt behandelt. So geht das in Diktaturen.
Das riskante Schmuggeln entfiel. Eine große Hürde war aus dem Weg geräumt. Breschnew hatte mir dabei geholfen. Das konnten die russischen Babuschki natürlich nicht wissen. Die Welt der Politik, in der ich mich bewegte, und der russische Alltag, den ich mit meiner Frau teilte, waren weit voneinander entfernte Sphären.
Während dieser ersten Jahre, die ich in Moskau verbrachte, beherrschte vor allem eine Frage die Nachrichtenmeldungen: Kommt es zu einer Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, unter Beteiligung aller europäischen Staaten sowie den USA und Kanada? Eine solche Zusammenkunft hatte es in diesem Ausmaß noch nie gegeben, im Zuge der Entspannung waren es vor allem die Sowjets, die die KSZE anstrebten.
Allmählich zeichnete sich ab, dass die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa tatsächlich näher rückte. In Helsinki wollten sich 34 Staats- und Regierungschefs aus Ost und West treffen, um sich auf ein besseres Miteinander zu verständigen. In drei Körben hatten sie ihre Anliegen aufgeteilt. Politische und militärische Sicherheit (Korb I), wirtschaftliche Zusammenarbeit (Korb II) sowie Menschenrechte und Informationsfreiheit (Korb III). Mein Recht als Fernsehkorrespondent auf einen eigenen Kameramann gehörte nach meiner Auslegung in Korb III.
Mit dieser Botschaft klapperte ich die diplomatischen Vertretungen der großen Staaten ab und bat um Unterstützung für mein sehr spezielles Menschenrecht. Ich wollte bei meiner Arbeit nicht auf ewig von der Gunst und den Dienstleistungen des Gastgeberlandes abhängig sein. Mir war klar, dass ich mit meinen Aktivitäten meine Rolle als Korrespondent überschritt, denn ich agierte nicht nur als Berichterstatter, sondern war mindestens so intensiv in politischer Mission unterwegs.
Zu meiner Enttäuschung erfuhr ich auf westlicher Seite wenig Anteilnahme. Nur der sowjetische Botschafter in Bonn, Michail Falin, zeigte Verständnis und setzte sich entsprechend ein, wie sich später herausstellte.
Nach der Konferenz in Helsinki wurde ich in die Presseabteilung des sowjetischen Außenministeriums am Smolensker Platz gebeten und ohne lange Vorrede ermutigt, einen Kameramann meines Senders nach Moskau einzuladen. Erst einmal für zwei Wochen! Dann würde man weitersehen. Es war ein ermutigender Vertrauensbeweis von offizieller Seite. Ich tat, was mir geraten wurde. Der Kameramann kam und blieb fünf Jahre, länger als ich (ich hatte damals schon fünf Jahre in Moskau hinter mir). Als ich zwei Jahre später nach Ostberlin ging, konnte mein Nachfolger Klaus Bednarz von Beginn an mit einem eigenen deutschen Kameramann arbeiten. Er hat aus dieser Mitgift viel gemacht.
Zur Begrüßung von »Kino-Operator 001« in der Presseabteilung des MID gab es eine kleine Zeremonie. Tee wurde serviert und die Akkreditierung überreicht. Ein historischer Moment! Jürgen Bever aus Köln war der erste westliche Kameramann, der in Moskau akkreditiert wurde. Wir tauften ihn »Duch Chelsinki« – der Geist von Helsinki.
Ich zog Bilanz. Fünf Jahre waren vergangen. Technisch waren die Voraussetzungen für eine brauchbare Fernsehkorrespondenz aus Moskau geschaffen. Allein mit gutem Willen auf beiden Seiten! Als Anhänger der Entspannungspolitik von Willy Brandt fühlte ich mich durch meine eigenen Erfahrungen in meiner Haltung bestätigt: Dass es selbst im »Reich des Bösen« möglich ist, etwas zu verändern – mit Geduld, gutem Willen und vielen Hundert Gesprächen.
»Das Paradox der Lüge«
Michail Schischkin
Manchmal habe ich das Gefühl, es liegt an den Wörtern.
Manche Begriffe erweisen sich bei der Überquerung der russischen Grenze als Kisten mit falscher Markierung. Auf unheimliche Weise wird der Inhalt des Wortes entweder im Stillen ausgetauscht oder einfach geklaut. Die besten, die schönsten Begriffe verlieren vor russischer Kulisse ihren Sinn.
Als ich jung war, erschien alles so einfach und klar: Unser Land ist von einer Bande von Kommunisten eingenommen worden, und wenn man die Partei vertreibt, öffnen sich die Grenzen, und wir kehren in die weltweite Familie der Völker zurück, die nach den Gesetzen der Demokratie und der Freiheit leben und die Rechte des Einzelnen würdigen. Parlament, Republik, Verfassung, Wahlen – diese Wörter hatten einen märchenhaften Klang. Wir alle waren damals naiv. Irgendwie haben wir nicht daran gedacht, dass all diese Wörter schon da waren – die Stalinsche Verfassung aus dem Jahr 1936 war »die demokratischste Verfassung der Welt«. Wir lebten bereits unter diesen großen Wörtern, die jede Zeitung vollstopften. Und auch zu den Wahlen sollten wir regelmäßig gehen.
Wir hatten vergessen, dass all diese guten Wörter, die aus dem Westen durch die Grenze in unsere Gesellschaft eingedrungen sind, ihre ursprüngliche Bedeutung verloren hatten; dass sie begonnen hatten, alles Mögliche zu bezeichnen, nur nicht das, was sie eigentlich bedeuten.
Das Grundgesetz garantierte uns alle möglichen Rechte; hier stand es schwarz auf weiß geschrieben: »Das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht in geheimer Abstimmung.« – »Die Redefreiheit, die Pressefreiheit, die Kundgebungs- und Versammlungsfreiheit, die Freiheit der Durchführung von Straßenumzügen und -demonstrationen.« – »Den Bürgern der UdSSR wird die Unverletzlichkeit der Person gewährleistet. Niemand kann anders als auf Gerichtsbeschluss oder mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft verhaftet werden.« – »Die Unverletzlichkeit der Wohnung der Bürger und das Briefgeheimnis werden durch das Gesetz geschützt.«
Der Text dieser wunderschönen Verfassung stammt von Nikolai Bucharin. Drei Monate nach der Verabschiedung des Grundgesetzes, im März 1937, wurde sein Autor unter dem Vorwurf der Spionage und der Beteiligung an einem Komplott gegen Stalin verhaftet. In seinem letzten Brief flehte Bucharin Stalin an, ihn nicht zu erschießen, sondern ihm eine tödliche Dosis Morphium zu verabreichen. Anstatt ihm diese Gnade zu gewähren, ließ NKWD-Chef Nikolai Jeschow, der Bucharins Exekution persönlich beaufsichtigte, den Verurteilten zusehen, wie andere Mithäftlinge vor ihm erschossen wurden.
Bucharin war dreimal verheiratet. Seine erste Frau Nadeschda Lukina wurde am 1. Mai 1938 verhaftet und am 9. März 1940 erschossen. Seine zweite Frau Esfir Gurwitsch und seine Tochter Swetlana verbrachten viele Jahre im Gulag. Auch seine dritte Frau Anna Larina wurde verhaftet. Der Sohn Juri wuchs im Waisenhaus auf, ohne zu wissen, wer seine Eltern waren.
Die Wörter ließen ihren Autor im Stich. Es scheint, als hätten sich die Wörter gegen uns verschworen.
Unter den einfachsten, gebräuchlichsten Begriffen werden ganz verschiedene Dinge verstanden. Wenn man über die Marktwirtschaft oder das Privateigentum in Russland spricht, klingt das für das westliche Ohr attraktiv und vertraut, aber es ist irreführend. Es gibt in Russland weder gesichertes Privateigentum noch eine Marktwirtschaft im westlichen Sinne. Oder nehmen wir, zum Beispiel, den Staat. In der zivilisierten Welt ist es längst selbstverständlich, dass der Staat als Instrument zur Verfechtung der Interessen seiner Bürger dient und keine eigenen Interessen verfolgt. Die Macht wird von unten aufgebaut, und nur die Machtbefugnisse, die auf unterster Ebene nicht realisiert werden können, werden nach oben delegiert. Das Wissen über die Teilung der Staatsmacht in Legislative, Exekutive und Judikative wird jedem Bürger mit der Muttermilch eingeflößt.
In Russland versteht man unter dem Staat etwas ganz anderes: Die Macht und das Territorium. Und beide sind sakral. Im Westen ist der Bürger Mitinhaber des Staates, in Russland ist er sein Leibeigener, unabhängig davon, welches Schild der Staat an seiner Pforte aufhängt.
Wer hätte in der Sowjetunion gedacht, dass die Kommunistische Partei zwar verschwindet, im neuen Russland aber all die guten Wörter wie Demokratie, Parlament und Verfassung einzig zu Schlagstöcken im unendlichen Kampf um Macht und Geld werden?
Nehmen wir den Begriff »Demokratie«. In Europa gilt sie als Garant persönlicher Freiheiten, der Menschenrechte. Für die Mehrheit der Russen bedeutet der Begriff das Chaos der Neunzigerjahre. Niemand in Russland will zurück in die »wilden Neunziger«.
Dieselben Worte lösen in Russland und im Westen ganz verschiedene Reaktionen aus. Zum Beispiel schmunzelte man im Westen über den berühmt gewordenen Satz, der Untergang der Sowjetunion sei die »größte geopolitische Katastrophe« des 20. Jahrhunderts (Wladimir Putin im April 2005). Während das Ende der Sowjetunion in den USA und in Westeuropa als Triumph der Freiheit und Demokratie interpretiert wurde, war es für die Mehrheit der Russen eine ungeheure menschliche und soziale Katastrophe. Putin sprach den meisten Russen aus dem Herzen.
Das wohl größte Missverständnis zwischen dem Westen und Russland entsteht daraus, dass die demokratischen Begriffe in Russland leere Worthülsen sind, die keinerlei Wirkung entfalten. Im Westen müssen sich Regierungen an den Begriffen messen lassen; in Russland handelt es sich um Fassaden, und jeder in Russland weiß, dass hinter diesen Fassaden nichts als Leere klafft. Der russische Staat kann »Gesetze«, »Verfassung«, »Menschenrechte« und egal welche »Freiheiten« proklamieren, Russland lebte und lebt nur nach einem Gesetz, und zwar nach dem Gutdünken der uneingeschränkten Macht des Kremls. Deshalb können die, die mein Land regieren, es einfach nicht verstehen, warum zum Beispiel England tschetschenische Separatisten nicht an Russland ausliefert. In ihrem Weltbild wäre die Sache durch einen Anruf des britischen Premierministers an den zuständigen Richter erledigt.
Im russischen Weltall haben große Wörter eine andere Funktion. Sie dienen zur Tarnung. Was für einen Außenseiter als Lüge erscheinen mag, trägt innerhalb des russischen Sprachgebrauchs zur allgemeinen Verständigung bei. Das ist kein Paradoxon, sondern die russische Wirklichkeit der Worte.
»Auf der Krim gibt es keine russischen Soldaten«, vermeldete man im Frühling 2014 der ganzen Welt mit scheelem Grinsen. Im Westen konnte man das nicht verstehen: Wie vermochte Putin sein Volk so unverfroren zu belügen? Doch die Bevölkerung nahm das nicht als Lüge wahr: Wir verstehen unter uns doch alles, man betrügt schließlich den Feind, das ist keine Sünde, sondern reine Soldatentugend. Mit welchem Stolz wurde dann zugegeben: »Ja, es waren russische Soldaten auf der Krim!«
Man lügt dem Westen dreist ins Gesicht: »Wir haben die Boeing 777 über Donezk nicht abgeschossen!« Alle wissen, dass es eine Lüge ist. Und dann geht es weiter, business as usual.
Wenn Putin den westlichen Politikern unverfroren dreiste Lügen präsentiert, beobachtet er ihre Reaktionen mit offensichtlichem Interesse und nicht ohne Vergnügen; er sonnt sich in ihrer Fassungslosigkeit und Hilflosigkeit. Dreistigkeit ist eine Demonstration der Stärke, sie bringt den Gegner unter Zugzwang und damit in Verlegenheit. Zu solchen Lügen sind sie nicht bereit. Statt offen zu lügen, schwindeln die westlichen Politiker möglichst unauffällig, im demokratischen Europa herrscht ein anderer Algorithmus der Lüge vor.
Chris Patten, der letzte Gouverneur von Hongkong und ehemaliger EU-Kommissar, beschreibt in seinen Memoiren eine Episode, wie er während eines Gipfeltreffens an einem Tisch mit Putin saß. Man sprach über Tschetschenien und die Menschenrechtsverletzungen dort. »Die Situation war äußerst peinlich. Wir verstanden, dass Putin uns anlügt, Putin sah, dass wir es verstehen, und wir sahen, dass Putin versteht, dass wir verstehen, dass er uns anlügt. Und wir schwiegen. Es war sehr beschämend.«
Man behauptet, keinen Anteil am Krieg in der Ostukraine zu haben, obwohl alle wissen, dass auch das eine Lüge ist. Und dieser Standpunkt wird von der westlichen Diplomatie hingenommen. Die Herrscher im Kreml entsenden Soldaten in die Ostukraine, lassen sie dort bei dieser schändlichen Kryptointervention sterben und belügen danach ihre Familien über die Todesursache und den Todesort. Die Familien tun so, als ob sie der Regierung glauben. Und schweigen. Wenn Putin in seinem eigenen Land die Unwahrheit erzählt, wissen alle, dass er lügt, und er selbst weiß, dass es alle wissen, doch seine Wählerschaft ist mit seinen Lügengeschichten einverstanden. Die russische »Wahrheit« ist eine never ending Lüge.
Das alles gab es schon. Das sowjetische Radio übertrug einst folgende in Umlauf gebrachte Lüge: »[Die sowjetische Nachrichtenagentur] TASS erklärt, dass sich kein sowjetischer Soldat auf dem Territorium Koreas befindet!« Es gab keine sowjetischen Soldaten in Ägypten, in Algerien, im Jemen, in Syrien, in Angola, in Mosambik, in Äthiopien, in Kambodscha, in Bangladesch oder in Laos. Wenn die Soldaten, die dort stationiert waren, das Glück hatten, am Leben geblieben zu sein und sie in ihre Heimat zurückkehrten, wurde ihnen befohlen: kein Wort! Die Heimat verleugnete sie. Erst in den Neunzigerjahren wurden sie nachträglich anerkannt und als Teilnehmer kriegerischer Handlungen in den Gesetzesparagrafen »Über die Veteranen« eingefügt. In diesem Gesetz ist eine Aufzählung der Kriege aufgeführt, in denen unsere Soldaten und Offiziere gekämpft haben – Kriege, an denen teilgenommen zu haben unsere Regierungen jedoch kategorisch und grimmig verneinten. Die zukünftigen Gesetzgeber werden in diese Auflistung auch die Ukraine aufnehmen müssen.
Russland ist in die sowjetischen Zeiten der totalen Lüge zurückgekehrt. Die Macht schloss damals mit ihren Untertanen einen Gesellschaftsvertrag ab, nach dem wir über Jahrzehnte gelebt haben: Wir wissen, dass wir lügen und dass ihr lügt, und wir lügen weiter, um zu überleben. Unter diesem »Contract Social« sind Generationen groß geworden.
In der Schulbibliothek habe ich einmal das Buch Gelsomino im Lande der Lügner des Italieners Gianni Rodari ausgeliehen. Darin kommt ein Junge in ein Land, das von einer Piratenbande gekapert worden ist, die nun alle zum Lügen zwingt. Den Katzen wird befohlen zu bellen, den Hunden zu miauen. »Brot« muss »Tinte« genannt werden. Es ist nur Falschgeld im Umlauf, und die Einwohner werden über die Zeitung Der musterhafte Lügner über die wichtigsten Nachrichten informiert. Mir gefiel die Absurdität dieser Situation natürlich. Für die Erwachsenen lag das Geheimnis des unglaublichen Erfolgs dieses Buches allerdings darin, dass sie, im Unterschied zu den Kindern, verstanden, über welches Land hier in Wirklichkeit geschrieben wurde. Orwell für Anfänger. Ich weiß noch, wie meine Eltern sich wunderten, wieso das Buch nicht verboten war. Sie wussten, dass sie genau in diesem gekaperten Lügenland lebten.
Die Lüge war allgegenwärtig. Die Zeitungen logen, das Fernsehen, die Lehrer. Der Staat betrog seine Bürger, die Bürger betrogen den Staat. So waren die allen verständlichen Spielregeln. Vom Kindergarten an gewöhnten wir uns daran. In dieser Lügenlandschaft sind alle Akteure aufgewachsen, die das heutige Russland darstellen.
Über Jahrzehnte wurden die eigenen Leute und Fremde angelogen, und man störte sich nicht daran, dass niemand einander glaubte. Mit Plakaten erklärte man der Bevölkerung, dass die »UdSSR das Bollwerk des Friedens« sei, und schickte gleichzeitig seine Panzer in die ganze Welt. Unter dem Vorwand, den der »Aufruf einer Gruppe von Genossen« lieferte (einer lächerlich kleinen Gruppe, die aus fünf Funktionären des stalinistischen Parteiflügels in der tschechoslowakischen KSČ bestand), fiel man in die Tschechoslowakei ein. Man log, dass man uns nach Afghanistan gerufen habe. Es wurde über Flugzeugabstürze gelogen, wenn nur keine Fußball- oder Hockeymannschaften starben – denn solche Katastrophen kamen ja nur dort vor, im Westen. Die ganze Welt wurde belogen, als der neue Parteisekretär Breschnew kam: Chruschtschow wurde aus den offiziellen Bildern des Empfangs, den man Gagarin nach seinem Flug in den Kosmos auf dem Roten Platz bereitet hatte, herausgeschnitten. Man log über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, zu jedem Anlass, egal ob wichtig oder unwichtig.
Im Fernsehen berichtete man freudig über die Erfüllung der Fünfjahrespläne, doch die Regale in den Geschäften wurden fortwährend leerer und die Schlangen davor größer. Wir lebten in dem Land, »in dem der Sozialismus gesiegt« hatte, in dem nach dem Gesetz alles dem Volk gehörte, doch in Wirklichkeit besaß das Volk nichts. Und überhaupt gehörte niemandem etwas. Wir lebten in diesem außergewöhnlichen Land voller Sklaven, in dem alle dem System gehörten. Auch diejenigen, die uns anführten.
Die Macht verlangte von der Bevölkerung begeisterte Erfolgsberichte in allen Bereichen der Volkswirtschaft und bekam jubelnde, verfälschte Rapporte zurück. Die Macht bestellte Lügen, bekam sie und tat so, als ob man an diese Lügen glaubte. Fand sich jemand, der dieses Spiel mit den Worten nicht mitspielen wollte, wurde er von den anderen kaltgestellt, gerügt, entlassen, verhaftet, getötet. Das Maß der Strafe hing von der Temperatur der Epoche ab. In der Stalin-Zeit wurde man erschossen. Also lieber mitlügen, besonders wenn man eine Familie hatte und für die Kinder sorgen musste.
Meine Mutter unterrichtete in der Schule, doch ich habe zu der Zeit natürlich noch nicht realisiert, wie schwierig die Gestaltung des Unterrichts für sie und alle Lehrer war. Sie standen vor einer unlösbaren Aufgabe: Die Kinder zu lehren, die Wahrheit zu sagen, und sie gleichzeitig auf ein Leben im Land der Lügen vorzubereiten. Nach dem geschriebenen Gesetz sollte man immer die Wahrheit sagen, doch das ungeschriebene hieß: Wenn du die Wahrheit sagst, bist du selber an den Folgen schuld.