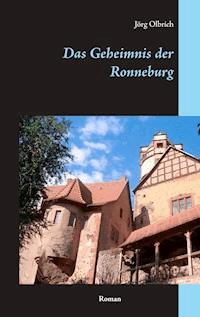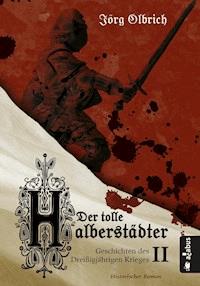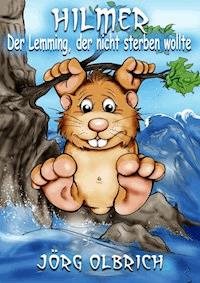Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geschichten des Dreißigjährigen Krieges
- Sprache: Deutsch
Das packende Finale 1643: Die Länder leiden unter den Söldnern, die im Kampf um das eigene Überleben nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden. Frieden, die Menschen wollen nur noch Frieden. Der kaiserliche Chronist Anton versucht, die Bedingungen für einen Friedensschluss im Heiligen Römischen Reich zu verhandeln. Trotzdem geht der Krieg mit unverminderter Härte weiter. Die Gräben zwischen den Parteien sind tief. Die Gaunerin Helena und der junge Hugo suchen im für neutral erklärten Osnabrück Schutz. Nachdem ihnen der Krieg alles genommen hat, wollen sie dort ein neues Leben beginnen. Sie ahnen nicht, dass ihnen die heftigsten Kämpfe noch bevorstehen. Söldner Peter Hagendorf und seine Frau stehen vor neuen Herausforderungen. Kann ihre Liebe die bitteren Zeiten überstehen? Verwüstung, Hungersnöte, Armut und Pest kosteten zwischen 1618 und 1648 rund sechs Millionen Menschen das Leben. Die Romanreihe "Geschichten des Dreißigjährigen Krieges" überzeugt mit historischen Fakten und einer spannungsgeladenen Entwicklung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Olbrich
Friedenskaiser wider Willen
Geschichten des Dreißigjährigen Krieges
Band 8
Roman
Inhalt
Impressum
Bodensee, 30. Januar 1643
Osnabrück, 14. Mai 1643
Wien, 23. Juni 1643
Osnabrück, 18. Juli 1643
Baden, 6. August 1643
Wien, 17. September 1643
Osnabrück, 3. Oktober 1643
Württemberg, 24. November 1643
Bodensee, 30. November 1643
Osnabrück, 17. Dezember 1643
Wien, 13. Januar 1644
Osnabrück, 5. April 1644
Stockholm, 2. Mai 1644
Bodensee 6. Mai 1644
Kolberger Heide, 1. Juli 1644
Osnabrück, 16. Juli 1644
Kiel, 25. Juli 1644
Breisgau, 3. August 1644
Wien, 17. August 1644
Stockholm, 30. September 1644
Osnabrück, 26. November 1644
Wien, 28. November 1644
Bodensee, 6. Januar 1645
Wien, 8. April 1645
Bayern, 30. April 1645
Osnabrück, 3. Mai 1645
Wien, 11. Juli 1645
Bayern, 31. Juli 1645
Bodensee, 17. August 1645
Bayern, 3. November 1645
Westfalen, 28. November 1645
Osnabrück, 5. Dezember 1645
Münster, 7. März 1646
Stockholm, 22. April 1646
Osnabrück 2. Mai 1646
Hessen, 3. Juni 1646
Osnabrück, 7. August 1646
Münster, 28. August 1646
Bayern, 30. September 1646
Bodensee, 2. November 1646
Oberpfalz, 18. November 1646
Osnabrück, 4. Januar 1647
Bodensee, 29. Dezember 1646
Münster, 19. Februar 1647
Bodensee, 20. Februar 1647
Niederbayern, 17. März 1647
Bodensee, 5. April 1647
Osnabrück, 7. April 1647
Münster, 3. Juni 1647
Osnabrück, 10. Juli 1647
Wien, 17. August 1647
Niederbayern, 12. September 1647
Wien, 11. Oktober 1647
Bodensee, 17. Oktober 1647
Wien, 2. März 1648
Osnabrück, 22. März 1648
Memmingen, 20. Mai 1648
Wien, 11. Juni 1648
Osnabrück, 6. August 1648
Wien, 22. August 1648
Bodensee, 10. September 1648
Osnabrück, 20. Oktober 1648
Memmingen, 26. Oktober 1648
Wien, 2. November 1648
Historische Anmerkung
Historische Eckdaten
Nachwort
Der Autor
Impressum
Olbrich, Jörg: Friedenskaiser wider Willen. Geschichten des Dreißigjährigen Krieges 8. Hamburg, acabus Verlag 2025
1. Auflage
ISBN: 978-3-86282-880-7
Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich und kann über den
Handel oder den Verlag bezogen werden.
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-879-1
Lektorat/Korrektorat: Amandara M. Schulzke, acabus Verlag
Satz: Enrico Frehse, Phantasmal-Image
Cover: © Annelie Lamers
Covermotiv: Soldat: © tin soldier toy - ©agnormark/stock.adobe.com
© https://pixabay.com/de/weiß-stoff-vorhangtransparenz-2130332
Druck: CPI Books GmbH, Birkstraße 10, 25917 Leck, Mail: [email protected]
Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2025
Alle Rechte vorbehalten.
www.acabus-verlag.de
Gedruckt in Deutschland
Bodensee, 30. Januar 1643
»Wir hätten den Bastard längst vom Hohentwiel vertreiben müssen.«
»Was ist los?« Hilde Heimdall sah ihrem Gemahl den Zorn an, der die ansonsten so gütigen Gesichtszüge des Kaufmannes überzog.
»Konrad Widerholt ist nach Überlingen marschiert und hat die Stadt mithilfe von französischen Truppen eingenommen.«
»Der Kommandant der Festung Hohentwiel?«
»Genau der. Dieser gottverdammte Mistkerl.«
»Haben sich die Überlinger nicht gewehrt?« Hilde erinnerte sich, dass die Stadt bereits im Jahr 1634 eine vierwöchige Belagerung durch die Schweden aushalten musste. Damals versorgten die Kaiserlichen die Bürger vom See aus durch Schiffe. Der Feind zog schließlich ohne Erfolg wieder ab.
»Die Feiglinge sollte man allesamt aufhängen«, fluchte Gregor Heimdall.
»Was ist geschehen?«, wiederholte Hilde ihre Frage.
»Widerholt hat sich mit den Franzosen verbündet«, berichtete der Kaufmann mit zornesrotem Gesicht. »Sie sind gemeinsam nach Überlingen gezogen. Die Einwohner hatten nichts Eiligeres zu tun, als ihren Besitz in die Burg zu tragen und die Stadt dem Feind zu überlassen. Sie haben nicht einmal versucht, sich gegen die Bastarde zu wehren.«
Die Besatzung der Festung Hohentwiel versetzte die Menschen der Umgebung bereits seit Jahren in Angst und Schrecken. Immer wieder schickte der Kommandant Konrad Widerholt Raubzüge los, bei denen seine Männer mehrere Dörfer vernichtet und die Bewohner getötet hatten.
»Damit bekommt der Feind einen Hafen«, sagte Hilde erschrocken. »Jetzt können sie jederzeit überall auf dem Bodensee auftauchen.«
»Genau das gilt es zu verhindern. Wenn die Feiglinge wenigstens ein oder zwei Tage ausgehalten hätten, wären wir ihnen vom See aus zur Hilfe gekommen. Jetzt müssen die Kaiserlichen Überlingen belagern und zurückerobern.«
»Werden sie das?«
»Ich hoffe es«, antwortete Gregor. »Ich gehe noch heute zum Truchsess. Er muss eine Flotte zusammenstellen, die verhindert, dass der Feind von Überlingen ausläuft.«
In seiner Aufregung war der Kaufmann bisher nicht dazu gekommen, die Jacke auszuziehen. Jetzt schlug er sie enger um den Körper. »Am besten erledige ich das sofort.«
Hilde sah ihrem Gemahl kopfschüttelnd nach, als er durch die Tür ins Freie stürmte. Sie verstand Gregors Zorn. Der Fall Überlingens konnte sich auf die Bevölkerung der ganzen Umgebung rund um den Bodensee auswirken. Damit geriet auch Lindau in Gefahr. Feindliche Truppen hatten die Insel schon einmal belagert. Damals waren die Schweden gekommen, um die Stadt zu erobern.
Die Kaufmannsfrau hätte die furchtbaren Ereignisse, bei denen sie vor zehn Jahren beinahe gestorben wäre, gerne vergessen. Jetzt brachen die Erinnerungen mit solcher Gewalt über sie herein, dass ihr schwindelig wurde.
Damals hatten Eindringlinge Hilde aus dem Schlaf gerissen, indem sie in das Haus ihres Großvaters eingedrungen waren. Die schwedischen Offiziere nahmen den ehemaligen Stadtschreiber von Lindau gefangen, um von ihm Informationen über die Festungen auf der Insel zu erhalten. In jener Nacht hatte die Siebzehnjährige Glück, dass die Männer sie nicht entdeckten.
Gemeinsam mit ihrem Geliebten Kasper Diller schloss sich Hilde daraufhin einer Gruppe Freiheitskämpfer an, die den Schweden kleinere Scharmützel lieferten, wo immer sie konnten. Mehrfach musste sie um ihr Leben kämpfen und erfuhr die ganze Grausamkeit des Krieges am eigenen Leib. Ihr Großvater kehrte schließlich zurück, wurde aber von den Kaiserlichen, die ihn des Verrates bezichtigten, in der Lindauer Festung gefangen gehalten.
Nachdem die Schweden Kasper Diller gefangen nahmen, ging Hilde auf die Insel. Dort kämpfte sie als Bettlerin ums Überleben. Sie gab sich als Mann aus und heuerte auf einem Schiff von Gregor Heimdall an. Die Lindauer Flotte stand Konstanz im Kampf gegen den Feind bei. Kurz darauf zogen die Schweden ab. Sie ließen nichts als Trauer und Schmerz zurück.
Hilde sah Kasper Diller nie wieder. Sie vermutete, dass er schon lange tot war. Die Festung in Lindau bekam einen neuen Kommandanten, der ihren Großvater sofort frei ließ. Zwei Jahre später starb Hans Heinrich Peller. Hilde heiratete Gregor Heimdall und brachte ein weiteres Jahr später ihren Sohn August zur Welt. Als Kaufmannsfrau führte sie seitdem ein gutes Leben.
Eine Rückkehr der Schweden war der schlimmste Albtraum, den sie sich vorstellen konnte. Auch wenn die mit der Besetzung Überlingens zunächst nichts zu schaffen hatten, bestand die Gefahr, dass die Nordmänner jederzeit wieder in der Gegend auftauchten.
***
»Was hat der Kommandant gesagt?«, fragte Hilde am Abend, nachdem ihr Gemahl von der Besprechung mit Truchsess Maximilian Willibald zurückgekehrt war. Der Graf von Waldburg-Wolfegg hatte das Kommando über die Stadtwache übernommen, nachdem Oberst von Vitzthum vor sechs Jahren starb.
»Die Lage ist ernst«, antwortete Gregor. Die Zornesröte, die sein Gesicht am Mittag beherrscht hatte, war verschwunden. Jetzt zeichneten sich Sorgenfalten auf seiner Stirn ab. »Die Franzosen haben sich in Überlingen festgesetzt. Konrad Widerholt deckt sie zudem von der Festung Hohentwiel aus. Es sind keine kaiserlichen Truppen in der Nähe, die etwas gegen diese Bedrohung ausrichten könnten.«
»Also sind wir auf uns alleine gestellt.«
»Ja. Der Truchsess hat Briefe an den Kaiser und den Kurfürsten geschrieben. Wir haben derzeit nur vierhundertfünfzig Soldaten in der Garnison. Das sind zu wenige.«
»Also können wir Überlingen nicht zurückerobern«, stellte Hilde fest. Sie erinnerte sich daran, dass vor zehn Jahren mehr als doppelt so viele Männer auf Lindau stationiert waren. Und selbst das hätte kaum ausgereicht, um gegen die Schweden zu bestehen, wären die nicht von alleine abgezogen.
»Nein. Maximilian Willibald will eine Blockade errichten, um zu verhindern, dass die Stadt über den See versorgt wird.«
»So werden wir den Feind nicht vertreiben.«
»Nein«, gab Gregor zu. »Zumindest hindern wir die Franzosen daran, mit ihren Schiffen andere Häfen anzugreifen.«
»Damit ist der Krieg wieder zu uns zurückgekehrt«, sagte Hilde traurig.
»Du darfst die Hoffnung nicht verlieren.« Er ging zu seiner Gemahlin und nahm sie tröstend in den Arm. »In Kürze werden in Westfalen Verhandlungen über einen Friedensschluss beginnen. Dann endet dieser Krieg.«
»Das kann Jahre dauern.«
»Wir haben schon schwierigere Zeiten überstanden.« Gregor strich Hilde zärtlich über ihre langen blonden Haare. »Das wird uns auch jetzt gelingen.«
»Ich mache mir Sorgen um August. Was hat er für eine Zukunft, wenn das Land in Schutt und Asche liegt.«
»Das wird nicht geschehen.«
»Ich hoffe, du behältst recht.«
»Wir werden unseren Beitrag leisten, um Unheil von der Insel abzuwenden. So, wie wir es immer getan haben.«
Hilde küsste ihren Gemahl. Dann löste sie sich aus der Umarmung. Sie war Gregor dankbar, dass er ihr Mut zusprach. Vor Jahren hatte sie lange darüber nachgedacht, ob sie den Antrag des Kaufmanns annehmen solle. Schließlich war er ein Freund ihres verstorbenen Vaters und mittlerweile fast sechzig Jahre alt. Bereut hatte sie die Heirat nie. Sie liebte Gregor, der alles dafür tat, dass es seiner Familie gut ging.
***
»Es gibt Männer auf dieser Insel, die den Ernst der Lage noch immer nicht erkannt haben«, berichtete Gregor seiner Gemahlin von der Sitzung des Lindauer Stadtrates, dem er seit vier Jahren angehörte. »Der Truchsess will die Handelsschiffe zu Kriegsschiffen umbauen, damit sie bei der Blockade Überlingens helfen, aber auch gegen feindliche Angriffe zur Verfügung stehen. Unsere ach so gescheiten Kaufleute wollten das nicht. Sie behaupten, dass sie keine Schiffe entbehren können.«
»Dann muss der Truchsess sie dazu zwingen«, sagte Hilde. »Die Armee hat weder genug Schiffe noch genug Männer, um die Blockade alleine zu bewerkstelligen. Auch nicht mit der Unterstützung von Bregenz und Konstanz.«
»Genau das wird Maximilian Willibald tun«, sagte Gregor. Er küsste seine Gemahlin, die ihm aus dem dicken Mantel geholfen hatte. »Ich wünschte, die anderen Ratsmänner wären so gescheit wie du. Sie denken aber nur an ihren finanziellen Verlust und sehen nicht, was geschehen kann, wenn der Feind die Kontrolle über den Bodensee übernimmt.«
Anfang Februar hatte Kommandant Maximilian Willibald von Waldburg-Wolfegg mit einem Offizier von General Franz von Mercy über die weiteren Schritte gegen den Feind beraten. Die mittlerweile eingerichtete Seeblockade der Stadt musste aufrechterhalten werden. Die Lindauer Befestigungsanlagen sollten ausgebaut werden. Kaiser Ferdinand III. verfügte, dass aufgrund des möglichen Angriffs auf die Insel alle begonnenen Maßnahmen schnellstmöglich abzuschließen seien.
»Wenn die Franzosen oder die Schweden vor Lindau aufmarschieren, werden sie ihren Fehler erkennen«, bestätigte Hilde.
»Dann kann es zu spät sein.«
»Hast du Hunger?«, wechselte Hilde das Thema. Ihrem Gemahl fiel es nach den Ratssitzungen zunehmend schwerer, die Beratungen aus dem Kopf zu bekommen. Sie beschäftigten ihn oft bis zum Morgen.
»Nein. Ich bin müde.«
»Dann lass uns jetzt zu Bett gehen.«
***
»Zumindest hat der Rat zugestimmt, einen Beitrag zur Befestigung der Stadt zu leisten«, sagte Gregor. August lag in einem kleinen Raum neben dem Schlafgemach der Eltern.
»Es lässt dir keine Ruhe.«
»Wie könnte es das?«, fragte Gregor. »Ginge es lediglich um meine Zukunft, könnte ich ruhig schlafen. Was wird aber aus dir und August, wenn die Insel in feindliche Hände fällt?«
»So weit ist es noch lange nicht.«
»Dennoch ist es wichtig, dass Lindau wehrhaft bleibt. Es gibt viel zu tun.«
»Ich hoffe, dass die Steinbrücke jetzt nicht weiter abgetragen wird«, sagte Hilde.
»Oberst von Vitzthum wollte sie schon vor Jahren abreißen. Er hatte die Erlaubnis des Kaisers dazu. Früher oder später wird sie wegmüssen. Sie ist der einzige Landweg auf die Insel und damit eine Gefahr für die Stadt.«
»Reicht es denn nicht, dass man Löcher hineingerissen hat? Die Brücke gehört zu unserer Stadt. Warum verstärkt der Truchsess das Schänzlein nicht?« Oberst von Vitzthum hatte den Übergang bereits an drei Stellen unterbrochen und die Steine durch eine Zugbrücke aus Holz ersetzt. Der Kommandant war der Meinung gewesen, einen feindlichen Angriff auf die Insel so aufhalten zu können.
»Der Truchsess glaubt, dass eine Schanze auf der Landseite der Brücke bei einer Belagerung nicht zu halten ist. Wenn ich ehrlich bin, muss ich ihm recht geben.«
»Wer soll nach dem Krieg eine neue Steinbrücke bauen? Wir schneiden uns den Landweg ab. Dir als Händler kann das nicht gefallen.«
»Das tut es auch nicht. Im Augenblick ist mir unsere Sicherheit allerdings wichtiger.«
Hilde kannte die Argumente, die für den Abriss der Brücke sprachen. Dennoch tat es ihr in der Seele weh, zu sehen, wie sie Stück für Stück zerstört wurde. Für diesen Abend hatte sie jetzt endgültig genug von den Problemen des Stadtrates, die sie ohnehin nicht lösen konnte. Sie stand auf, ließ ihr Nachtgewand zu Boden gleiten, legte sich wieder ins Bett und rückte so dicht an ihren Gemahl, dass sie seine Nähe spürte.
»Was tust du, Weib?«
»Ich werde dafür sorgen, dass du den Krieg und den Stadtrat vergisst. Zumindest für heute Nacht.«
Osnabrück, 14. Mai 1643
»Verschwindet! Ich habe geschlossen.«
»Warum steht die Tür dann offen?«
»Was?« Der Mann hob den Kopf von der Tischplatte und schaute aus glasigen Augen zum Eingang des Schankraumes. Nachdem sich sein Blick so weit geklärt hatte, dass er die Besucher erkennen konnte, stand er schwerfällig auf. Dabei schob er den Tisch mit seinem mächtigen Bauch ein Stück nach vorne. »Haut sofort ab und lasst euch hier nie wieder blicken!«
»Das machen wir nicht.«
»Was sagst du da?« Der Wirt taumelte ein paar Schritte auf den Eingang zu, stolperte über seine eigenen Füße und fiel zu Boden. »Euch werde ich es zeigen.«
»Ich habe Schweine gesehen, die ein besseres Leben führen«, spottete Helena. »Es wundert mich nicht, dass es bei dem Gestank keine Gäste gibt.«
»Ich habe geschlossen, verdammt noch mal.« Der Wirt versuchte, sich mit den Fäusten vom Boden hochzudrücken. Dann übergab er sich und fiel mit dem Gesicht in das Erbrochene.
Mit zwei geschickten Griffen drehte Helena den Körper auf die Seite, damit der Mann nicht erstickte.
»Der Kerl ist völlig betrunken.« Hugo spuckte aus. »Wir sollten gehen. Hier verschwenden wir unnötig Zeit.«
»Nein«, entgegnete Helena entschlossen. »Er wird uns helfen. Ich habe einen Plan.«
»Bist du dir da sicher?«
»Er wird unsere Probleme lösen. Er weiß es nur noch nicht.«
»Schau ihn dir an! Würdest du wollen, dass der Trunkenbold dir ein Essen zubereitet?«
Tatsächlich gab der Wirt ein armseliges Bild ab. Die wenigen Haare klebten in langen Strähnen an der Kopfhaut über einem aufgedunsenen Gesicht. Er stank nach Schweiß und Urin. Seine Kleidung strotzte vor Schmutz.
»Mach ein Fenster auf! Die Luft ist unerträglich.«
»Das wird kaum etwas bringen. Das Dreckloch bekommt niemand mehr sauber.«
»Tu es einfach!« Helena wollte nicht mit ihrem Gefährten streiten. Sie musste nachdenken. Im ersten Moment hatte sie der Anblick des Schankraumes geschockt. Sie hatten das Wirtshaus, das direkt gegenüber des Osnabrücker Rathauses lag, besucht, um den Besitzer nach Arbeit zu fragen. Jetzt befürchtete sie, dass der Wirt sein einziger Gast war. Die besseren Zeiten der Schänke schienen vergangen. Vielleicht konnte sich aber genau das als Vorteil erweisen.
»Die anderen Räume sehen genauso aus«, berichtete Hugo, als er nach einem kurzen Rundgang zurückkehrte. »Der Dicke hat recht. Wir sollten verschwinden.«
»Wir müssen herausfinden, warum die Schänke so heruntergekommen ist. Der Mann wirkt verzweifelt. Irgendetwas muss geschehen sein.«
»Warum suchen wir uns kein anderes Wirtshaus?«, fragte Hugo. »Wir sind an mehreren vorbeigekommen, die einen deutlich besseren Eindruck machen.«
»Weil wir von hier aus das Rathaus beobachten können. Vertrau mir! Ich weiß, was ich tue.«
»Das hoffe ich.«
Helena warf ihrem Gefährten einen bösen Blick zu, antwortete aber nicht. Im Grunde verstand sie Hugos Zweifel. Seitdem sie am Abend zuvor in Osnabrück angekommen waren, hatten sie kaum ein Gebäude gesehen, das in einem schlechteren Zustand war als dieses Wirtshaus. Der Stadtrat würde den Schandfleck sicher abreisen lassen, wenn sich ihm die Gelegenheit dazu bot. Das wollte Helena verhindern. Sie war fest entschlossen, sich in Osnabrück eine Zukunft aufzubauen. Es wurde Zeit, dass sie endlich einen Platz zum Leben fanden.
Es war sechseinhalb Jahre her, dass Helena Greif gemeinsam mit ihrem Bruder aus Wittstock geflohen war. Um seine Schwester zu retten, hatte Josef damals einen reichen Kaufmann ermordet und war dabei gesehen worden, als er die Leiche wegschaffte. Zu dieser Zeit hatte vor der Stadt eine verheerende Schlacht zwischen den Schweden und den Kaiserlichen stattgefunden. Sie hatten das Durcheinander genutzt, um ihre Heimat zu verlassen.
Unterwegs waren die Geschwister auf den zwölfjährigen Hugo mit einem Braunbären getroffen. Der Junge hatte das Tier in Torgau vor schwedischen Söldnern gerettet, die es schlachten wollten. Gemeinsam hatten sie sich einer Gruppe Spielleute angeschlossen, mit denen sie einige Jahre durch die Lande zogen. Helena hatte eine größere Menge an Münzen beiseitegelegt, die sie bei Diebeszügen erbeutet hatte.
Sie war mit ihrem Leben bei den Spielleuten zufrieden gewesen, bis die Gruppe von der Pest heimgesucht worden war. Unter den Überlebenden kam es zum Streit. Einer der Männer verließ sie und kehrte später mit einer Schar Reiter zurück, um seine ehemaligen Gefährten zu überfallen. Beim Kampf wurden der Braunbär und fast alle Spielleute getötet. Lediglich Helena und Hugo gelang die Flucht. Der schwer verwundete Junge hatte sich in einem Kloster erholt.
Gemeinsam hatten sie sich auf den Weg nach Osnabrück gemacht. Helena hatte gehört, dass dort und in Münster Friedensverhandlungen beginnen sollten, weswegen beide Städte für neutral erklärt worden waren. Sie setzte große Hoffnung darauf, dass sie dem Krieg dort entkommen konnten. Wenn die Verhandlungen stattfanden, würden Gesandte aus ganz Europa anwesend sein und viel Geld in die Stadt bringen.
Zu Helenas Ärger hatten die beiden Osnabrück vor Einbruch des Winters nicht mehr erreicht. Immer wieder mussten sie schwedischen Söldnern ausweichen, die sich aus der Stadt zurückzogen. Genau wie Hugo hasste sie diese Männer bis aufs Blut.
In den vergangenen Monaten waren sie in einem leerstehenden Haus in Bielefeld untergekommen. Dort hielten sie sich mit kleineren Diebstählen am Leben. Helena besaß ein paar Silbermünzen, wollte diese aber nur im äußersten Notfall ausgeben.
»Was machen wir mit dem Kerl«, riss Hugo seine Gefährtin aus den Gedanken.
»Wir legen ihn ins Bett und lassen ihn seinen Rausch ausschlafen. In der Zwischenzeit räumen wir auf.«
»Das kann nicht dein Ernst sein.«
»Doch. Ich weiß, dass du das im Moment nicht einsehen willst, aber wir werden hierbleiben.«
»Du bist völlig verrückt geworden. Glaubst du, der Kerl wird uns danken, wenn er aufwacht? Er wird uns rauswerfen?«
»Das wird er nicht. Ich überzeuge ihn schon davon, dass er unsere Hilfe braucht.«
»Selbst wenn. Was willst du in diesem Loch?«
»Vertraue mir! Wir haben bisher immer einen Weg gefunden.« Helena würde sich von Hugo nicht von ihrem Plan abbringen lassen. Sie wusste, dass der Junge an ihrer Seite bleiben und alles tun würde, was sie von ihm verlangte. Sie traf die Entscheidungen.
***
»Jetzt.«
Hugo, der nur auf Helenas Aufforderung gewartet hatte, verzog das Gesicht zu einem bösen Grinsen. Dann kippte er dem Schlafenden einen Eimer Wasser über den Kopf.
Der Wirt fuhr hoch, stieß einen wütenden Schrei aus, schlug mit beiden Fäusten in die Luft und riss die Augen auf.
Helena sah, wie die Verwirrung langsam aus dem Gesichtsausdruck des Mannes verschwand. Dann kam der Zorn zum Vorschein.
»Ich erkenne dich«, ächzte er. »Ich habe dir schon einmal gesagt, dass du verschwinden sollst.«
»Wie du siehst, sind wir noch hier. Wir haben auch nicht die Absicht, wieder zu gehen.«
»Das werden wir ja sehen.« Der Wirt wollte sich aufsetzen, hielt aber mitten in der Bewegung inne, als er das Messer an seiner Kehle spürte.
Helena hatte mit dieser Reaktion des Mannes gerechnet. »Du solltest dich beruhigen. Dann wird dir nichts geschehen.«
»Was wollt ihr von mir? Geld? Da muss ich euch enttäuschen. Ich besitze selbst nichts.«
»Das haben wir gesehen«, antwortete Helena. Die Worte des Trunkenboldes waren kaum zu verstehen. Der Kerl widerte die Diebin an. Dennoch war sie nicht bereit, ihren Plan aufzugeben. Dafür lag das Wirtshaus zu günstig. Sie würde alles mitbekommen, was dort geschah. Daraus würde sich ganz sicher Kapital schlagen lassen.
»Wenn es uns darum ginge, dich zu berauben, wären wir längst wieder verschwunden. Natürlich erst, nachdem wir dich getötet hätten.«
»Warum seid ihr dann hier?«
»Wir haben etwas mit dir zu bereden.«
Jetzt verzichtete der Wirt auf eine böswillige Antwort und nickte stattdessen. Er schien zu begreifen, dass es tatsächlich besser war, wenn er der Fremden zuhörte. »Was wollt ihr?«
»Wir suchen Arbeit. Und eine Unterkunft.«
»Hier?« Der Mann sah Helena überrascht an. »Ihr seht doch selbst, dass dieses Gasthaus am Ende ist.«
»Das muss ja nicht so bleiben.«
»Wie meinst du das?«
»Wir werden dir helfen, Ordnung zu schaffen.«
Jetzt schien sich der Wirt endlich für die Besucher zu interessieren. Helena musste ihn nun davon überzeugen, dass er mit ihnen zusammenarbeitete und dabei überlegen, wie viel sie ihm von ihren Plänen verriet. Mögen würde sie den Kerl nie.
»Ich könnte euch für eure Arbeit nicht bezahlen.«
»Das verlangen wir auch nicht. Wir benötigen lediglich eine Unterkunft.«
»Was habt ihr verbrochen?«
»Wie meinst du das?«, fragte Helena überrascht.
»Seid ihr auf der Flucht und braucht ein Versteck?«
»Nein.«
»Dann verstehe ich nicht, warum ihr fast ohne Gegenleistung für mich arbeiten wollt.«
»Ich werde dir alles erklären. Zunächst habe ich aber eine Frage an dich. Wie ist dieses Gasthaus zu einem derartigen Schweinestall verkommen?«
Die Miene des Wirtes verfinsterte sich. »Wenn ihr nur gekommen seid, um mich zu beleidigen, verschwindet wieder.«
»Wir können dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, was hier geschehen ist.«
»Das seht ihr doch?«
»Wie ist es so weit gekommen?« In Helena wuchs der Drang, dem Kerl das Messer in die Kehle zu rammen. Sie zwang sich zur Ruhe, atmete tief durch und ließ die Waffe unter ihrem Rock verschwinden. »Es kann hier ja nicht immer so ausgesehen haben.«
»Die schwedischen Söldner sind schuld«, sagte der Mann nach einer Weile. »Sie haben den Schankraum bis zum letzten Platz besetzt und gesoffen, was man ihnen vorsetzte.«
»Du hast also gute Geschäfte gemacht.«
»Ja. Zunächst war ich über die hohe Zahl an Gästen froh. Dann bezahlten sie aber weniger für Bier und Wein. Sie drohten mich zu töten, wenn ich mich wehrte. Als sie die Stadt verlassen mussten, schlugen sie alles kurz und klein. Ich hatte zwei Mägde. Die Soldaten haben sie mitgenommen.«
»Warum hast du nicht die Stadtwache gerufen?«
»Du hast wirklich keine Ahnung«, höhnte der Wirt. Er spuckte Helena vor die Füße. »Die Stadtwache hatte selbst am meisten Angst vor den Söldnern. Niemand wagte es, etwas gegen die Kerle zu unternehmen.«
»Gab es keine anderen Gäste?«
»Früher schon. Während die Schweden hier waren, hat sich keiner aus der Stadt mehr hierher getraut. Die Bürger sind in andere Wirtshäuser gegangen und später nicht mehr zu mir zurückgekehrt.«
»Ich verstehe«, sagte Helena nachdenklich. Sie vermutete, dass der Wirt im Groben die Wahrheit sprach, auch wenn er sich für ihren Geschmack zu sehr als Opfer darstellte. Er hatte von den schwedischen Söldnern profitiert. Wäre es nicht so, hätte er die Stadt längst verlassen.
»Also? Warum wollt ihr mir helfen?«
»Wir sind in den vergangenen Jahren viel im Land herumgekommen«, antwortete Helena. »Nirgendwo war es sicher. Wir suchen einen Platz, an dem wir bleiben und in Frieden leben können. Wenn du uns eine Unterkunft und Essen gibst, werden wir dir helfen.«
»Einfach so?«
»Ja. Zumindest für den Augenblick. Wenn wir es schaffen, deinen Schankraum wieder voll zu bekommen, reden wir weiter.«
»Einverstanden.« Der Wirt stand auf und reichte Helena die Hand. »Ich bin Friedrich Karzer.«
Helena stelle sich und Hugo, der den Mann die ganze Zeit über schweigend angestarrt hatte, vor. Dabei behauptete sie, dass der Junge ihr Bruder sei. Sie wollte unnötigen Fragen aus dem Weg gehen, wenn die beiden in einer Kammer übernachteten.
»Eines musst du mir noch verraten«, sagte Friedrich. »Was macht dich so sicher, dass du das Wirtshaus voll bekommst?«
»Du weißt, dass es in Osnabrück bald Friedensverhandlungen für das gesamte Reich geben wird?«
»Ja.«
»Es werden hunderte Gesandte mit ihren Begleitern hierherkommen. Wir wollen etwas von dem Reichtum abbekommen, den sie in die Stadt bringen.«
***
»Karzer ist selbst an seiner Lage schuld«, sagte Hugo eine Stunde später. Sie saßen gemeinsam in der kleinen Kammer, die ihnen der Wirt zur Verfügung stellte. Abgesehen von zwei Betten und einer Truhe war der Raum leer. Er sah aus, als wäre er seit Monaten nicht mehr betreten worden. Die kalte Luft, die durch das offene Zimmer hereinströmte, schaffte es nicht, den Gestank zu vertreiben. »Er hätte sich nicht mit den Schweden einlassen dürfen.«
»Er konnte sich nicht gegen die Söldner wehren. Sie hätten ihn getötet.«
»Trotzdem. Ich traue ihm nicht.«
»Ich auch nicht.«
»Was machen wir dann hier?«
»Wir sind in Sicherheit. Es gibt keine schwedischen Söldner mehr in Osnabrück. Die Stadt wurde für neutral erklärt. Das heißt, sie wird nicht belagert werden. Wir haben in den vergangenen Jahren viel erlebt und fast alles verloren. Auch in Bielefeld hätten wir nicht mehr lange bleiben können.«
»Das habe ich verstanden«, sagte Hugo. »Warum aber bleiben wir ausgerechnet bei Karzer?«
»Wir brauchen eine sichere Unterkunft, aus der uns niemand vertreiben kann. Von hier aus haben wir einen guten Überblick. Wenn wir es geschickt anstellen, können wir uns das zunutze machen.«
»Was macht dich da so sicher? Was, wenn die Teilnehmer der Verhandlungen nicht in dieses Gasthaus kommen?«
»Das werden sie«, erklärte Helena bestimmt. »Die Menschen brauchen eine Unterkunft. Die bieten wir ihnen.«
»Und wenn uns Karzer nichts von dem Gewinn abgibt? Ich habe die Gier in seinen Augen gesehen. Er wird uns ausnutzen.«
»Wir holen uns einen Anteil. Außerdem finden wir auch andere Wege, wie wir an das Geld der Männer kommen.«
»Ich weiß, was du vorhast«, Hugo sah Helena ärgerlich an. »Du willst wieder als Hure arbeiten.«
»Rede nicht so mit mir«, forderte Helena scharf. »Du kannst gerne gehen und dein Glück alleine suchen.«
»So habe ich das nicht gemeint.«
»Dann halt den Mund!«
***
»Wo ist der Junge?«
»Auf dem Markt.«
»Ist er schon lange weg?«
»Er ist gerade erst los. Was willst du von ihm?« Helena drehte sich zu Friedrich Karzer um. Ein kurzer Blick in dessen Augen reichte, um zu erkennen, dass der Wirt betrunken war.
»Wir sind also ungestört.«
Die Art, wie Friedrich die Worte aussprach, ließ Helena erschaudern. Jetzt bekam sie das erste Mal Angst vor dem Mann. Bisher hatte sie sich dem Kerl immer überlegen gefühlt. Dies änderte sich nun schlagartig.
Sie wusste, dass sie sich ihre Unsicherheit nicht anmerken lassen durfte, und versuchte, mit energischer Stimme zu sprechen. »Was auch immer du vorhast«, sagte sie scharf. »Du solltest nicht einmal daran denken.«
»Warum bist du so abweisend. Ich möchte mich nur mit dir unterhalten.«
Während Friedrich näher auf Helena zukam, schloss die ihre Faust fest um das Messer, mit dem sie gerade gearbeitet hatte. Es hatte nur eine kurze Klinge, würde aber ausreichen, um Karzer zumindest ein paar kleinere Wunden zuzufügen, sollte er sich nicht zusammenreißen. »Bleib stehen und wage es nicht, mich anzufassen!«
»Was stellst du dich so an?«, entgegnete der Wirt. Er schwankte leicht, als er einen weiteren Schritt auf die Frau zukam. »Du könntest ruhig ein bisschen netter zu mir sein. Deinen Bruder lässt du doch auch in dein Bett.«
»Das ist nicht wahr.«
»Ich habe Augen und Ohren. Was denkst du, was die Leute in der Stadt dazu sagen, dass du Unzucht mit dem Jungen treibst? Ich bezweifle, dass du dann immer noch so viele Gäste in den Schankraum lockst.«
»Du bildest dir da etwas ein«, entgegnete Helena. Es gelang ihr nicht, die Verzweiflung in ihrer Stimme zu unterdrücken. Sie hatte keine Angst vor den Bürgern der Stadt. Karzer würde sich hüten, auch nur ein Wort zu sagen. Seine Geschäfte liefen deutlich besser, seitdem Helena und Hugo bei ihm waren.
Gemeinsam hatten sie den ganzen Unrat aus dem Wirtshaus geschafft und alles sauber gemacht. Die Leute sahen, wie in dem Gebäude gearbeitet wurde. Zunächst kamen nur ein paar neugierige Gäste, nach und nach mehr. Karzer wusste, dass er Helena und Hugo brauchte. Im Augenblick ging die größere Gefahr vom Wirt selbst aus.
»Du bist eine schöne Frau.« Friedrich griff nach Helenas Brust. »Du wirst mich jetzt dafür entlohnen, dass ich euch bei mir aufgenommen habe.«
»Nein!« Helena wollte dem Wirt das Messer in die Hand stechen, doch der zog sie schnell zurück.
Trotz seiner Trunkenheit schien Karzer über gute Reflexe zu verfügen. Er fing Helens Hand ab und drehte das Gelenk so weit nach rechts, dass sie das Messer fallen lassen musste.
»Ich habe dir die Möglichkeit gegeben, freiwillig zu mir zu kommen«, keuchte der Mann. »Jetzt werde ich mir nehmen, was mir zusteht.«
»Nichts steht dir zu«, schrie Helena und spuckte dem Mann ins Gesicht. »Ohne uns wärst du in deinem Drecksloch verreckt.«
»Teuflisches Weib«, fluchte Friedrich. Er schlug so hart zu, dass die Frau mit dem Kopf gegen die Wand stieß. Dann griff er nach ihrem Hals und zog sie zu sich.
Bevor Helena etwas dagegen tun konnte, riss Karzer ihr die Bluse vom Leib. Sie spürte den Schmerz im Kopf und im Gesicht, wo sie der Schlag des Wirtes getroffen hatte. In ihrer Verzweiflung zog sie das Knie hoch, traf aber nur den Oberschenkel des Mannes. Das stachelte dessen Wut weiter an.
Karzer hieb Helena den Unterarm gegen die Kehle. Er schob sie zurück, bis sie mit dem Rücken gegen die Wand stieß. Dann griff er ihr mit der freien Hand in den Schritt. »Ich werde dir beibringen, wie du dich zu benehmen hast.«
Wieder spie Helena ihren Widersacher an, der erneut zuschlug. Sie schmeckte das Blut, das ihr aus der Nase in den Mund lief. Karzer zerrte an ihrem Kleid. Dann stand sie nackt vor ihm. Sie schlug nach dem Kerl, doch der lachte nur. Er ließ die Hose herunter und warf die Frau brutal auf den Boden.
Helena konnte sich nicht gegen ihren Widersacher wehren. Der war so in Rage, dass sie Angst haben musste, von ihm getötet zu werden. Sie dachte an Josef, der sie in Wittstock immer vor zu aufdringlichen Männern beschützt hatte. Auch Hugo wäre sicher auf den Wirt losgegangen, hätte aber kaum eine Chance gegen ihn gehabt.
Karzer drückte seinem Opfer die Beine auseinander und legte sich auf sie. Helena roch den widerlichen Atem des Mannes. Karzer stieß ein lang gezogenes Grunzen aus und verkrampfte sich. Eine klebrige Flüssigkeit lief am Oberschenkel langsam auf ihrer Haut nach unten.
Endlich ließ der Wirt von Helena ab. Er stand auf und taumelte einen Schritt zur Seite. Dann griff er nach der Hose.
»Wenn du irgendjemandem sagst, was gerade geschehen ist, werde ich dich töten.«
Helena antwortete nicht. Heute hatte Friedrich Karzer sie gedemütigt. Noch brauchte sie den Mann. Irgendwann aber würde er die verdiente Strafe bekommen.
***
»Was ist mit dir?«, fragte Hugo erschrocken, nachdem er die Kammer betreten hatte, in der Helena mit blutüberströmtem Gesicht im Bett lag.
»Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht.«
»War das Karzer?«
»Du musst dich beruhigen. Es wird mir bald besser gehen.«
»Was hat er dir angetan?«
»Er hat mich geschlagen.« Helena verschwieg Hugo die Wahrheit bewusst. Der Junge brauchte nicht zu wissen, dass sie von dem Wirt geschändet worden war.
»Ich werde das Dreckschwein umbringen.«
»Nein«, entgegnete Helena. Sie hatte mit der Reaktion des Jungen gerechnet, wollte aber vermeiden, dass er sich in Gefahr begab. Karzer würde keinen Wimpernschlag zögern, Hugo zu verprügeln. Vielleicht brachte er ihn sogar um. »Du wirst nichts unternehmen.«
»Du willst den Mistkerl ungeschoren davonkommen lassen?« Hugo sah seine Gefährtin mit hochrotem Kopf an.
»Nein. Im Augenblick ist es besser, wenn wir uns ruhig verhalten. Ich muss mich erholen. Danach kümmere ich mich um alles.«
»Wir sollten die Stadtwache rufen. Sofort!«
»Nein. Karzer wird sich herausreden und wir verlieren alles.«
»Du willst also nichts unternehmen?«
»Später.«
»Wir können uns das nicht gefallen lassen.«
»Doch, Hugo. Genau das werden wir tun.«
Der Junge sah seine Gefährtin einen Moment fassungslos an. »Wie schlimm ist es?«, fragte er dann.
»Es wird gehen. Hole mir nur eine Schüssel mit Wasser, damit ich mir das Blut abwaschen kann.« Helena sah die Sorge in Hugos Gesicht und musste trotz der Schmerzen lächeln.
Als Hugo verschwand, lauschte Helena darauf, ob sie Geräusche von unten hörte. Sie befürchtete, dass der Junge Friedrich Karzer zur Rede stellen würde. Zu ihrer Erleichterung geschah das allerdings nicht. Vermutlich hatte sich der Wirt zurückgezogen und schlief seinen Rausch aus.
»Wir sollten das Gasthaus verlassen«, sagte Hugo, nachdem er die Wasserschüssel auf der Truhe abgestellt hatte.
»Darüber haben wir jetzt oft genug gesprochen.«
»Das mag sein. Karzer hat heute gezeigt, wie gefährlich er ist.«
»Du musst dir keine Sorgen machen«, sagte Helena. »Er wird keinen von uns beiden jemals wieder anrühren. Das garantiere ich dir. Wir haben hier sehr viel Arbeit geleistet. Jetzt füllt sich der Schankraum Tag für Tag mehr. Das ist der Verdienst von dir und mir. Ich werde das nicht aufgeben.«
»Wir sind hier nicht glücklich.«
»Irgendwann werden wir das sein.«
In den folgenden Tagen setzte Helena keinen Schritt in den Schankraum. Hugo berichtete ihr, dass Karzer mehrfach gefragt hatte, wann sie endlich an ihre Arbeit zurückkehren würde. Sie ließ ihm ausrichten, dass sie dies erst tun würde, wenn ihre Verletzungen nicht mehr zu sehen waren. Der Wirt schrie in der Küche herum, wagte es aber weder, sie in ihrer Kammer aufzusuchen, noch die Hand gegen Hugo zu richten. Auch der Junge hielt sich in den nächsten Tagen zurück. Helena konnte sich denken, wie schwer ihm das fiel.
***
»Auf ein Wort, junge Frau.«
Helena fuhr erschrocken zusammen und drehte sich blitzschnell um. Dabei wäre sie fast mit dem Ratsherrn zusammengestoßen, der wie aus dem Nichts hinter ihr aufgetaucht war.
»Ich wollte dich nicht erschrecken.«
»Es ist ja nichts passiert.« Helena sah sich im Hinterhof des Gasthauses um. Sie war mit dem Ratsherrn alleine. Weder Hugo noch Karzer schienen sich in der Nähe aufzuhalten. »Was wollt Ihr von mir?«
»Mit dir reden.«
»Das hättet Ihr im Schankraum tun können, anstatt mir aufzulauern.« Helena sah den Mann vorwurfsvoll an. Sie kannte den etwa fünfundzwanzigjährigen Ratsherrn durch dessen Besuche im Wirtshaus und wusste, dass er in der Nachbarschaft des Rathauses bei einer älteren Frau wohnte. Seinen Namen kannte sie nicht. Bisher hatte er sich eher unauffällig verhalten. Dennoch hatte sich Helena sein Gesicht gemerkt. Ihr war es wichtig, möglichst viel über die Menschen in der Umgebung herauszufinden.
»Dort bist du lange nicht gewesen. Als ich dich eben im Hof sah, habe ich mich dazu entschlossen, dich zu fragen, ob du vielleicht Hilfe benötigst.«
»Nein. Es geht mir gut.« Helena dachte nicht im Traum daran, ihre Probleme mit dem Ratsherrn zu besprechen, doch der bohrte weiter.
»Was ist mit deinem Auge passiert?«
»Ich bin vor ein paar Tagen gestürzt.«
»Ist das so?«
»Wollt Ihr behaupten, dass ich lüge«, entgegnete Helena ärgerlich. »Außerdem geht es Euch rein gar nichts an, was ich tue.«
»Im Grunde hast du recht. Ich sehe dir aber an, dass du lügst. Ich kenne Friedrich Karzer schon seit langer Zeit. Nachdem ihm zwei Mägde weggelaufen sind, habe ich daran gezweifelt, dass er eine neue findet. Hat er dich geschlagen?«
»Darüber möchte ich nicht sprechen.«
»Also ja.«
»Das habe ich nicht gesagt.« Helena wünschte sich, der Ratsherr würde sie einfach in Frieden lassen und verschwinden. Zu ihrem Ärger schien dessen Neugierde aber noch nicht befriedigt zu sein.
»Geschieht dies öfter?«
»Bisher ein Mal.« Helena erschrak, wie bereitwillig sie dem Mann Antwort gab. Sie hatte nichts mehr sagen wollen.
»Musstest du ihm auch zu Willen sein?«
»Er hat mich gezwungen.«
»Ich verstehe.«
Gar nichts versteht Ihr, dachte Helena, widersprach aber nicht. Der Ratsherr kam ihr fragwürdig vor. Er schien sich tatsächlich für ihr Schicksal zu interessieren. Grundlos vermutlich nicht. Interessant fand sie die Information, dass die beiden Mägde freiwillig gegangen waren. Auch hier hatte Karzer gelogen.
»Es würde mich freuen, dich bald wieder im Schankraum zu sehen«, sagte der Mann schließlich und drehte sie um.
»Nennt mir Euren Namen.«
»Gerhard Singes.«
»Ich bin Helena.«
»Ich weiß.«
Helena wollte noch etwas sagen, aber der Ratsherr ließ sie einfach stehen. Verwundert schaute sie ihm nach und merkte dadurch nicht, wie Friedrich Karzer hinter ihr auftauchte.
***
»Was hast du mit dem Ratsherrn zu schaffen?«
»Nichts.«
»Ich habe dich mit ihm sprechen sehen.«
»Du beobachtest mich?« Helena sah Karzer herausfordernd an. Dabei legte sie die rechte Hand auf ihre Hüfte, wo sie unter dem Kleid den Griff des Messers spürte. Noch einmal würde sie sich nicht angreifen lassen.
»Ich habe euch durch das Fenster gesehen. Worüber habt ihr gesprochen?«
»Das hat dich nicht zu interessieren.«
»Und ob es das hat. Ich habe es dir schon einmal gesagt. Wenn du es wagst, mit irgendjemandem über den Vorfall von vor ein paar Tagen zu sprechen, werde ich dafür sorgen, dass man dich auf dem Scheiterhaufen verbrennt.«
»Vorfall«, schrie Helena wütend. »Du verdammter Hurenbock hast mich geschändet.«
»Sei leise! Oder willst du, dass uns jemand hört?«
»Ich habe nichts zu verbergen«, entgegnete Helena schnippisch.
»Treib es nicht zu weit, du Miststück!«
»Was willst du von mir?«, fragte Helena zornig.
»Ich verlange, dass du mir die Wahrheit sagst.«
»Der Mann ist zu mir gekommen und wollte wissen, warum ich so lange nicht im Schankraum war. Das ist alles. Soll ich den Gästen etwa aus dem Weg gehen?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Dann kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten!« Helena musste sich zur Ruhe zwingen. Karzers Atem verriet ihr, dass er getrunken hatte. Sie bezweifelte, dass er am helllichten Tag im Freien über sie herfallen würde; seine Anwesenheit reichte aber aus, um ihr Übelkeit zu bereiten.
»Wann wirst du wieder im Wirtshaus arbeiten?«
»Wenn man nicht mehr sieht, dass ich verprügelt worden bin.«
»Ohne dich bleiben die Gäste weg.«
»Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du über mich hergefallen bist.«
»Du übertreibst. So schlimm ist es nicht gewesen.«
»Rühre mich noch einmal an, und ich zeige dir, was schlimm ist.«
»Willst du mir etwa drohen?« Karzer ging einen Schritt auf Helena zu.
»Rühre mich an und ich schwöre, dass du es bereuen wirst!«
»Was kannst du schon ausrichten?«, fragte der Wirt spöttisch. »Was denkst du, wem die Leute glauben werden; einer dahergelaufenen Hure oder einem unbescholtenen Bürger der Stadt?«
»Lass mich einfach in Ruhe! Und höre endlich damit auf, Hugo zu schikanieren! Du kannst froh sein, dass er dir hilft.«
Karzer lachte auf, drehte sich dann aber um und ging zurück. Helena hatte den Griff des Messers die ganze Zeit über nicht losgelassen. Sie hätte den Mann getötet, wenn er versucht hätte, sie ein weiteres Mal zu schlagen.
Drei Tage später nahm Helena ihre Arbeit wieder auf. Hugo war erleichtert, weil die Schikanen des Wirtes nun abnahmen. Karzer registrierte ihre Anwesenheit mit einem stummen Nicken. Sie versuchte, sich den Gästen gegenüber zuvorkommend zu verhalten, und musste innerlich lachen, wenn sie Karzers mürrisches Gesicht sah. Es würde sich noch herausstellen, wem die Menschen in Osnabrück Glauben schenkten, sollte der Streit zwischen Helena und dem Wirt an die Öffentlichkeit gelangen.
Wien, 23. Juni 1643
Eintrag in die Kaiserliche Chronik des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation:
Obwohl Osnabrück und Münster inzwischen als neutral erklärt wurden und die Soldaten aus beiden Städten abgezogen sind, haben die Friedensverhandlungen noch nicht begonnen. Dies scheitert derzeit vor allem daran, dass sich die beteiligten Parteien nicht über die Anzahl der Teilnehmer einigen können.
In Folge der verheerenden Niederlage bei Breitenfeld hat Erzherzog Leopold Wilhelm von Österreich sein Amt als Oberbefehlshaber niedergelegt. Octavio Piccolomini übernahm die Truppen zunächst, trat aber ebenfalls zurück, nachdem er die sächsische Stadt Freiberg von einer schwedischen Belagerung befreit hat. Er steht nun in den Diensten Spaniens.
König Ludwig XIII. von Frankreich ist im Alter von einundvierzig Jahren nach sechswöchiger Krankheit in Saint-Germain-en-Laye verstorben. Noch vor seinem Tod verfügte er, dass Kardinal Jules Mazarin zum Ersten Minister von Frankreich ernannt wird. In Vormundschaft für den noch unmündigen Ludwig XIV. übernahm dessen Mutter Anna Maria von Österreich die Regentschaft.
Nach seinem Abzug aus Freiberg ist der schwedische Feldmarschall Lennart Torstensson mit seinen Truppen in Mähren eingedrungen und bedroht nun auch Böhmen.
Franz von Mercy wurde zum Feldmarschall ernannt und hat das Oberkommando über die bayrische Armee übernommen. Am Bodensee soll er nun den weiteren Vormarsch des feindlichen Heeres verhindern.
Dem Kommandanten der Festung Hohentwiel ist es gemeinsam mit französischen Truppen gelungen, Überlingen und weitere Stützpunkte am Bodensee zu erobern.
Die Tinte verschwamm vor Antons Augen auf dem Pergament, als hätte man es in Wasser getaucht. Erschrocken schob der Bibliothekar die Chronik weg, konnte aber nicht verhindern, dass ein weiterer Tropfen auf das gerade Geschriebene fiel. Dann erkannte er, dass es die eigenen Tränen waren, die seine Arbeit vernichteten.
Es war auf den Tag genau ein halbes Jahr her, dass sein Leben auf die grausamste Art zerstört worden war, die er sich vorstellen konnte. Er hatte das verloren, was er am meisten liebte.
In den fünfundzwanzig Jahren, die er im Kaiserhof in Wien beschäftigt war, hatte es Höhen und Tiefen gegeben. Anton hatte harte Schicksalsschläge hinnehmen müssen und sich nur schwer davon erholt. Dann trat Isabella in sein Leben.
Zunächst war er entsetzt, als ihn Kaiser Ferdinand III. zwang, die spanische Hofdame seiner Gemahlin zu ehelichen. Die beiden besaßen nicht die geringste Gemeinsamkeit. Nach und nach kamen sich Anton und Isabella aber näher. Spätestens, nachdem sie ihn aus dem Kerker gerettet hatte, in den er aufgrund einer Intrige geworfen worden war, hätte der Bibliothekar alles für sie getan. Dann wurde Wilhelm geboren. Aus den ehemals verhassten Eheleuten wurde eine glückliche Familie.
Im vergangenen Jahr war Isabella ein zweites Mal schwanger geworden. Anton hatte die meiste Zeit auf der Suche nach einem Schatz verbracht, der während der türkischen Belagerung Wiens unter der Stadt versteckt worden war. Als sie das Gold tatsächlich gefunden hatten, war das Glück der Familie vollkommen. Dann starb Isabella bei der Niederkunft gemeinsam mit dem Kind.
Seit diesem Tag gelang es Anton kaum, sich für irgendetwas zu begeistern. Der einzige Grund, warum er noch leben wollte, war Wilhelm. Die Zukunft des Siebenjährigen war sein Antrieb. Alles Weitere unwichtig. Die Arbeit, die er früher so sehr liebte, erledigte er jetzt nur, weil sie getan werden musste.
Anton wischte sich mit dem Jackenärmel die Tränen aus den Augen. Er hörte ein Klopfen. Dann öffnete jemand die Tür zur Bibliothek. Als Hektor zu seinem Schreibtisch gerannt kam, wusste er, wer ihn besuchte. Er hatte den Hund vor acht Jahren von Isabella geschenkt bekommen. Seit dem Tod der Spanierin verbrachte das Tier die meiste Zeit bei Wilhelm. Es sollte den Jungen trösten und beschützen.
»Ich bin hier. Komm zu mir!«
Der Knabe trat zögerlich näher. Fast schien es Anton so, als habe er Angst vor ihm. Hatte er etwas ausgefressen, was er ihm beichten wollte? Wilhelm wohnte seit Isabellas Tod im Jesuitenkolleg, wo er die Schule besuchte. Wenn er alt genug war, sollte er dort zur Universität gehen. Der Bibliothekar hatte durch eine großzügige Spende dafür gesorgt, dass es dem Knaben dort gut ging.
Wie immer stand er beim Anblick seines Sohnes kurz davor, in Tränen auszubrechen. Er hatte Isabellas Augen.
»Du wirkst betrübt«, sagte Anton. »Ist dir etwas zugestoßen?«
»Weißt du nicht, welcher Tag heute ist?«
Der Bibliothekar sah den Jungen erstaunt an. Wieso hatte er gar nicht daran gedacht, dass auch Wilhelm wusste, dass der Tod seiner Mutter heute genau ein halbes Jahr her war? Jetzt verstand er, warum der Knabe so traurig war.
»Doch. Natürlich weiß ich das.«
»Gehst du mit mir zu ihrem Grab?«
Anton lief ein Schauer über den Rücken. Er hatte Isabellas letzte Ruhestätte nach der Beerdigung nur ein einziges Mal besucht. Ihm fehlte die Kraft dazu. Stattdessen bezahlte er eine der Mägde dafür, dass sie das Grab in Ordnung hielt. Er wusste, dass es ihm Wilhelm nicht verzeihen würde, wenn er ihm diesen Wunsch abschlug. Daher stimmte er zögerlich zu.
»Ich vermisse sie«, sagte Wilhelm eine halbe Stunde später mit trauriger Stimme.
»Ich auch. Deine Mutter war eine wunderbare Frau. Es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass sie nicht mehr bei uns ist.« Anton wusste, dass er seinem Sohn jetzt Mut zusprechen müsste. Er konnte es nicht. Der Bibliothekar bekam das Gefühl, sein Magen würde zerreißen.
Vater und Sohn störten sich nicht am strömenden Regen, der dafür sorgte, dass sie die letzten Besucher auf dem Friedhof waren. Sie hielten sich an den Händen und starrten schweigend auf das gut gepflegte Grab.
»Warum hat Gott zugelassen, dass sie stirbt?«
»Das weiß ich nicht, mein Sohn. Vielleicht ist es eine Prüfung.«
»Aus welchem Grund? Wir haben niemandem etwas getan.«
»Nein. Keiner von uns beiden hat das.« Anton fiel es schwer, die richtigen Worte zu finden. In den vergangenen Monaten hatte er sich dutzende Male die gleichen Fragen gestellt, die Wilhelm vorbrachte. Es gab keine Antworten.
Sie blieben eine Weile im Regen stehen. Dann wurde dem Bibliothekar bewusst, dass seine Kleidung klitschnass war und ihn der leichte Wind auskühlte. »Lass uns gehen, ich möchte nicht, dass du krank wirst.«
»Wann werden wir wieder hierherkommen?«
»Wann immer du willst.« Anton musste seine ganze Kraft aufwenden, um Wilhelm dieses Versprechen zu geben. Er wusste nicht, ob er es auch einhalten konnte.
***
»Ich werde Matthias von Gallas als Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres einsetzen.«
Die Wirkung der Worte, mit denen Ferdinand III. die Sitzung des Hofkriegsrats eröffnete, hätte nicht frappierender sein können, wenn er ein Nest mit wütenden Wespen auf den Tisch geworfen hätte. Anton sah das Entsetzen in den Gesichtern der Männer. Sie sprachen wild durcheinander.
»Das könnt Ihr nicht tun, Eure Majestät«, rief Schlick aufgebracht.
»Der Heeresverderber wird unsere Truppen zugrunde richten«, schrie von Questenberg und schlug mit der Faust auf den Tisch.
»Eine schlechtere Wahl könnte es wohl kaum geben«, meinte Maximilian von Trauttmansdorff.
Ferdinand III. schien mit einer derartigen Reaktion der Ratsmitglieder gerechnet zu haben. Er saß am Tisch und wartete, bis sich die Männer beruhigt hatten. »Er ist der erfahrenste Offizier, den wir für das Amt haben.«.
»Und der schlechteste«, entgegnete Schlick.
»Bei allem Respekt, Eure Majestät«, warf von Trauttmansdorff ein. »Wäre es nicht vorteilhafter, wenn wir Euren Bruder davon überzeugen, das Amt erneut anzunehmen.«
»Das habe ich bereits versucht«, erklärte der Kaiser. »Leopold Wilhelm steht nicht zur Verfügung.«
»Ich schlage Melchior von Hatzfeldt vor«, sagte Schlick.
»Der hat ebenfalls abgelehnt«, berichtete von Trauttmansdorff.
»Von Gallas kann unsere Truppen nicht zu einem Sieg führen«, sagte Schlick ärgerlich. »Wir brauchen eine andere Lösung.«
»Die haben wir nicht«, erwiderte der Kaiser. »Mein Entschluss steht fest. Matthias von Gallas wird die Hauptarmee anführen.«
»Ist er dazu denn überhaupt bereit?«, fragte von Questenberg.
Anton sah dem Diplomaten an, dass er darauf hoffte, dass von Gallas das Oberkommando ebenfalls ablehnte.
»Er stellte lediglich einige wenige Bedingungen«, antwortete der Kaiser.
»Wie lauten diese?«, fragte Schlick, dem die Unzufriedenheit ins Gesicht geschrieben stand.
»Er will Franz von Mercy, Johann Wilhelm von Hunolstein und Georg Adam von Traudisch in seinen Generalstab berufen. Außerdem fordert er, dass er dauerhaft über die bayrische Armee verfügen kann.«
»Ausgeschlossen«, widersprach Siegfried Preuss, der als Gesandter von Herzog Maximilian an der Ratsversammlung teilnahm. »Unsere Truppen müssen die Franzosen von einem Vormarsch abhalten. Von Mercy ist unabkömmlich.«
»Das ist richtig«, bekräftigte von Trauttmansdorff. »Wir können nicht ein Loch reißen, um ein bestehendes zu stopfen.«
»Dann ist es entschieden«, sagte der Kaiser. »Von Gallas wird Oberbefehlshaber, aber die Bayern bleiben, wo sie sind.«
***
»Was ist geschehen? Ihr wirkt heute noch niedergeschlagener als sonst.«
Warum muss ich ausgerechnet auf ihn treffen. Nach der Sitzung des Hofkriegsrates hatte sich Anton Zeit damit gelassen, in die Bibliothek zurückzukehren. Das bereute er jetzt. Kurz bevor er das Ziel erreichte, kam ihm auf dem Flur der Obersthofmeister entgegen.
Von Trauttmansdorff gehörte zu den Menschen, mit denen er im Augenblick am wenigsten sprechen wollte. In den letzten Jahren waren die beiden Männer respektvoll miteinander umgegangen. Anton hatte aber immer das Gefühl, dass der Obersthofmeister nur darauf wartete, ihm einen Schlag versetzen zu können. Er hatte den Mann vor längerer Zeit beim Stelldichein mit einer Magd erwischt. Seitdem suchte von Trauttmansdorff nach einer Möglichkeit, wie er etwas gegen den Schreiber in die Hand bekam. Hätte er auch nur geahnt, dass Anton einen gewaltigen Schatz in der Bibliothek versteckte, wäre er ihm nicht mehr von der Seite gewichen.
In der Hoffnung, den Mann schnell loszuwerden, entschloss er sich, ihm die Wahrheit zu sagen. »Ich war mit meinem Sohn auf dem Friedhof. Isabella ist genau vor einem halben Jahr gestorben.«
»Ich verstehe. Es muss eine furchtbare Zeit für Euch und den Jungen sein.«
»Das ist es.«
»Darf ich Euch dennoch einen Augenblick sprechen?«
Habe ich eine andere Wahl? »Wenn es nicht lange dauert. Heute ist tatsächlich kein guter Tag für mich.«
Anton war sich darüber im Klaren, dass er von Trauttmansdorff nicht zufällig getroffen hatte. Der Mann wollte etwas von ihm. Jetzt war äußerste Vorsicht geboten. Vom ungepflegten Äußeren des Obersthofmeisters ließ sich der Bibliothekar schon lange nicht mehr täuschen. Auch wenn seine Kleidung abgetragen war und einige Flecken hatte, durfte er ihn niemals unterschätzen. Er hatte einen messerscharfen Verstand.
»Ich habe Euch bereits vor einiger Zeit gefragt, ob Ihr an einem gegenseitigen Austausch interessiert seid. Das möchte ich nun wiederholen.«
»Warum sollte ich meine Meinung geändert haben?«
»Weil die Situation eine andere geworden ist. Ihr habt erst heute wieder erlebt, wie uneinig sich die Ratsmitglieder sind. So werden die Friedensverhandlungen scheitern.«
»Dessen bin ich mir bewusst. Ich wüsste aber nicht, was wir beide dagegen tun könnten.«
»Also wollt Ihr den Frieden?«
»Wer möchte ihn nicht?«
»Seine Majestät«, antwortete von Trauttmansdorff. »Der Kaiser will den Feind besiegen und aus dem Reich werfen.«
»Das kann kaum gelingen.«
»Genau da liegt das Problem. Ferdinand III. ist weit davon entfernt, einen Friedensvertrag mit Schweden oder Frankreich zu schließen. Er kann sich ja nicht einmal mit den Reichsfürsten einigen, ob die an den Verhandlungen teilnehmen dürfen.«
»Auf was wollt Ihr hinaus?« Anton war überrascht, wie offen der Obersthofmeister mit ihm sprach. Er hatte zugegeben, dass er die Meinung des Kaisers nicht teilte. Dabei war er dessen erster Berater und in der Vergangenheit immer einer derjenigen, der vom Endsieg gesprochen hatte, wenn die Boten Schlachterfolge vermeldeten.
»Die Verhandlungen in Münster und Osnabrück dürfen nicht scheitern. Ich werde alles daransetzen, dass sie erfolgreich verlaufen. Alleine gelingt mir das aber nicht.«
Anton sah den Obersthofmeister nachdenklich an. Er schien seine Worte ernst zu meinen und sprach dem Bibliothekar damit aus der Seele. Der Krieg musste ein Ende finden. Das Reich brauchte den Frieden.
»Ich stimme zu«, sagte Anton nach einer Weile. »Dennoch weiß ich nicht, wie ich Euch unterstützen kann.«
»Im Augenblick bitte ich nur um Euer Vertrauen«, sagte von Trauttmansdorff. »Wenn es Differenzen zwischen uns gibt, sollten wir die begraben. Zum Wohle des Reichs.«
Antons Kopf schmerzte leicht. Er fühlte sich an diesem Tag für derartige Gespräche nicht in der Lage. Der Obersthofmeister hatte recht. Konnte er ihm aber trauen?
»Ihr wollt also für den Moment lediglich, dass wir uns gegenseitig informieren, wenn wir Neuigkeiten erfahren?«
»So ist es.«
»Das werde ich tun.«
»Ihr werdet es nicht bereuen.« Der Obersthofmeister reichte Anton die rechte Hand, die der verwundert ergriff. »Ich möchte Euch jetzt nicht länger aufhalten. Ich sehe Euren Schmerz. Alles Weitere können wir zu einem späteren Zeitpunkt besprechen.«
»Ich danke Euch.«
Von Trauttmansdorff drehte sich um und ging auf dem gleichen Weg fort, den er gekommen war. Mit gemischten Gefühlen schaute Anton ihm nach. Hatte er soeben einen Pakt mit einem seiner größten Widersacher geschlossen?
Osnabrück, 18. Juli 1643
»Auf ein Wort.«
Helena ließ beinahe vor Schreck ihren Wassereimer fallen und drehte sich ärgerlich zu Gerhard Singes um. »Müsst Ihr Euch so an mich heranschleichen?«
»Ich habe etwas mit dir zu besprechen.«
»Das hättet Ihr auch im Schankraum tun können. Warum lauert Ihr mir im Regen auf? Und sagt jetzt nicht, dass Ihr mich hier zufällig gesehen habt. Diese Ausrede glaube ich kein zweites Mal.«
»Weil niemand hören soll, was wir reden.«
Helena sah den Ratsherrn skeptisch an. Sie wusste nicht so recht, was sie von dem Mann halten sollte. Nach ihrem ersten Gespräch hatte er so getan, als würde er die junge Frau nicht kennen. Er hatte kaum ein Wort mit ihr gesprochen, wenn sie ihm Bier oder Essen serviert hatte. Warum tat er jetzt so geheimnisvoll?
»Wie stehst du zu Karzer?«
»Ihr wollt mit mir über den Wirt sprechen?«
»Nicht nur. Beantworte meine Frage. Hat er dich ein weiteres Mal geschändet?«
»Nein. Mein Bruder und ich arbeiten für ihn. Er gewährt uns Essen und Unterkunft.«
»Also bist du nicht sein Weib?«
»Gott bewahre, nein.«
»Bist du ihm ansonsten in irgendeiner Form verbunden?«
»Um ehrlich zu sein, hasse ich ihn«, sagte Helena. Sie hoffte, dass sie dem Ratsherrn gegenüber damit nicht zu viel verriet. »Warum wollt Ihr das wissen?«
»In dieser Stadt wird sich bald einiges ändern.«
»Das ist nicht zu übersehen.« Jetzt war es Singes gelungen, Helenas Neugierde zu wecken. Bisher hatte sie sich dem Mann gegenüber eher abweisend gezeigt. Nun wollte sie wissen, was er ihr zu sagen hatte. Es war nicht zu übersehen, dass sich Osnabrück auf die bevorstehenden Friedensverhandlungen vorbereitete. Die Bürger reinigten die Straßen. Wer die Möglichkeit hatte, Wohnraum zu schaffen, bereitete diesen für die Abordnungen vor, die schon bald in der Stadt eintreffen sollten. Aus den umliegenden Dörfern wurden Vorräte herbeigeschafft und eingelagert.
»Es werden sehr viele Menschen nach Osnabrück reisen«, erklärte der Ratsherr. »Wenn die Friedensverhandlungen beginnen, wird es in der Stadt keinen freien Platz zum Übernachten geben. Es leben derzeit etwa fünftausend Menschen hier. Mit den Delegationen wird sich die Zahl verdoppeln.«
»Übertreibt Ihr da nicht?« Helena versuchte, sich die Überraschung nicht anmerken zu lassen. Ihr war klar, dass die Verhandlungen sehr viele Leute nach Osnabrück bringen würden. Mit fünftausend hatte sie allerdings nicht gerechnet. Sie beschloss, dem Ratsherrn gegenüber vorsichtig zu bleiben. Er tat freundlich. Es gelang ihr bisher nicht, hinter seine Maske zu schauen. Was wollte er von ihr?
»Nein«, antwortete Singes. »Es werden sogar eher mehr.«
»Sind so viele Menschen bei den Verhandlungen?«, stellte sich Helena bewusst dumm.
»Wir erwarten über einhundert Delegierte. Die kommen aber nicht alleine, sondern bringen ihr Gefolge mit; dazu Handwerker und Händler mit ihren Familien. All diese Menschen brauchen eine Unterkunft.«
»Warum erzählt Ihr mir das?«
»Du arbeitest in einem der größten Wirtshäuser in Osnabrück.«
»Das gehört Karzer. Wäre es nicht angebracht, wenn Ihr Euch direkt an ihn wenden würdet?«
»Das versuche ich gerade herauszufinden.«
»Wie meint Ihr das?« Helenas Anspannung stieg. Sie verstand noch immer nicht, warum der Ratsherr gerade sie aufgesucht hatte. Er hätte mit Karzer reden sollen. Stattdessen lauerte er ihr im Regen auf und schien sich nicht daran zu stören, dass seine teure Kleidung nass wurde. Sie schaute zum Fenster der Küche, sah Friedrich dort glücklicherweise nicht. Sie wollte vermeiden, wieder von dem Wirt darüber ausgefragt zu werden, was sie mit dem Ratsherrn zu schaffen hatte. Er hatte schon mehrfach gedroht, sie und Hugo rauszuwerfen, wenn sie gegen seine Anweisungen handelten. Er würde ihr dieses Mal kaum glauben, dass sie lediglich ein harmloses Gespräch mit Singes geführt hatte.
»Ich traue Karzer nicht«, sagte der Ratsherr. »Er hat sich mit den Schweden eingelassen und das Wirtshaus verkommen lassen, nachdem die Söldner verschwunden sind. Bevor du mit deinem Bruder gekommen bist, war der Mann am Ende. Der Stadtrat wollte ihm ein Angebot für das Wirtshaus machen, das er nicht hätte ausschlagen können. Dann hätten wir jemanden eingesetzt, der besser zu den Vorstellungen des Rates passt. Jetzt habt ihr dafür gesorgt, dass sich Karzers Geschäft wieder lohnt.«
»Soll das ein Vorwurf sein?«
»So würde ich es nicht ausdrücken.«
»Wie dann?«
»Karzer wird das Wirtshaus jetzt nicht mehr verkaufen. Der Rat befürchtet aber, dass es zu Problemen mit dem Mann kommen wird, wenn die Gesandten in Osnabrück eintreffen. Sie wollen keinen Querulanten in unmittelbarer Nähe des Rathauses.«
»Er wird wohl kaum freiwillig gehen.«
»Genau da liegt das Problem.«
Helena dachte nach. Kein Wunder, dass der Rat Karzer loswerden wollte. Erstaunlich war nur, dass Singes das ihr gegenüber direkt ansprach. Wie konnte er wissen, dass sie nicht zu dem Wirt ging und ihm alles berichtete? »Was wollt Ihr von mir?«
»Ich frage mich, ob es für die Gäste dieses Hauses nicht besser wäre, wenn es von einer hübschen, ehrgeizigen, jungen Frau geführt würde und nicht von einem alten Griesgram, der den Menschen nur das Geld aus der Tasche ziehen will.«
Helena sah den Ratsherrn überrascht an. Das Gespräch lief in eine ganz andere Richtung als erwartet. Sie hatte selbst schon daran gedacht, das Wirtshaus zu übernehmen, wusste aber auch, dass es ihr Karzer niemals verkaufen würde.
»Warum sagst du nichts?«
»Eure Aussage ist verwirrend«, gab Helena zu. »Wollt Ihr mir damit sagen, dass Ihr beabsichtigt, Karzer loszuwerden und mich an seine Stelle zu setzen?«
»Der Rat der Stadt würde einen Besitzerwechsel für das Haus begrüßen. Natürlich haben wir keine Möglichkeit, diesen auch herbeizuführen.«
»Ihr meint, ich soll Karzer aus dem Weg schaffen?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Es klang sehr deutlich aus Euren Worten heraus.«
»Wäre uns damit nicht allen geholfen?«
In Helenas Kopf überschlugen sich die Gedanken. Hatte ihr Singes gerade den Auftrag gegeben, den Wirt zu ermorden? Sollte es so sein, musste sie genau überlegen, was sie antwortete. Sie wollte sich den Ratsherrn nicht zum Feind machen. Das hätte zur Folge, dass sie Osnabrück wieder verlassen musste. Auf der anderen Seite lieferte sie sich dem Mann aus, wenn sie mit seinem Wissen ein Verbrechen beging.
»Auch wenn Karzer etwas zustoßen sollte, bedeutet das nicht, dass das Wirtshaus mir gehört«, sagte sie nach einer Weile skeptisch.
»Das wäre zu regeln«, entgegnete Singes.
»Wie meint Ihr das?«
Der Ratsherr zog eine Schriftrolle aus der Jackentasche und reichte sie Helena. »Wenn Du Karzer dazu bringst, das Dokument zu unterschreiben, gehört das Wirtshaus dir.«
»Was ist das?«
»Eine Urkunde, die Dich zur Erbin des Sperlings macht. Sie trägt ein Datum von vor zwei Monaten. So gerätst du nicht in den Verdacht, etwas mit Karzers Verschwinden zu tun zu haben, und bist abgesichert.«
»Ich verstehe«, sagte Helena, obwohl sie dies noch immer nicht tat. Was veranlasste Singes dazu, ihr ein solches Angebot zu machen? Wenn herauskam, was er ihr soeben vorgeschlagen hatte, würde auch er Schwierigkeiten bekommen. Offensichtlich hatte er das Gespräch mit ihr von langer Hand geplant. Er war vorbereitet und schien sich der Sache sicher zu sein. »Auf diese Weise würdet Ihr Karzer loswerden und hättet mich in der Hand.«
»So darfst du das nicht sehen.«
»Wie dann? Ihr erwartet bestimmt eine Gegenleistung für Eure Großzügigkeit.«
»Wir leben in schwierigen Zeiten. Da ist es von Vorteil, Verbündete zu haben. Meinst du das nicht auch?«
»Das mag stimmen.« Helena war noch immer verwirrt. In den letzten Minuten hatte sie sich durch das Gespräch mit dem Ratsherrn in Gefahr begeben, gleichzeitig zeichneten sich große Möglichkeiten ab.
»Ich muss jetzt gehen«, erklärte Singes.
»Ja. Wir stehen schon zu lange hier im Regen«, sagte Helena. »Es wird Fragen aufwerfen, sollte uns jemand sehen.«
»Überlege, was du machen willst. Selbstverständlich hat das Gespräch nie stattgefunden. Ich werde es leugnen, sollte man mich damit konfrontieren. Auch über die Urkunde wirst du keine Verbindung zu mir herstellen können. Ich glaube aber ohnehin nicht, dass du so dumm bist, etwas zu verraten.«
Nach diesen Worten drehte sich der Ratsherr um. Jetzt lag es an Helena, wie sich ihr Schicksal weiterentwickelte.
Baden, 6. August 1643
»Es ist ein Junge.«
Peter Hagendorf sprang auf, als wäre er von gleich drei Hornissen gleichzeitig gestochen worden. Die Männer, die mit ihrem Korporal gemeinsam im Lager saßen, brachen in schallendes Gelächter aus und riefen ihrem Kameraden Glückwünsche zu. Der ließ sich jetzt durch nichts mehr aufhalten und stürmte zu seinem Zelt.
»Du musst noch ein bisschen Geduld haben«, sagte die Amme lächelnd. »Die Frauen machen Anna Maria und das Kind sauber. Dann darfst du zu ihnen.«
»Ich will zu meinem Weib«, beharrte Hagendorf. Die Glücksgefühle vertrieben die monatelangen Sorgen und Ängste und übernahmen seinen Körper.
»Lass ihn herein!«
Peter atmete erleichtert auf, als er Anna Marias glückliche Stimme hörte. Das konnte nur bedeuten, dass die Niederkunft gut verlaufen war. Jetzt wollte er sie in die Arme schließen und seinen Sohn sehen.
Im Zelt überkam ihn die Erinnerung an die letzten Male, als er nach der Niederkunft zu seinem geliebten Weib durfte. Bisher waren alle Kinder gestorben. Die Angst war unbeschreiblich, dass auch der neugeborene Sohn nicht überleben würde. Dann sah er das Glück in Anna Marias Augen. Ihre Wangen waren noch rot von den durchlittenen Anstrengungen, ansonsten wirkte sie aber gesund.
»Melchert Christoff ist ein kräftiger Junge.«