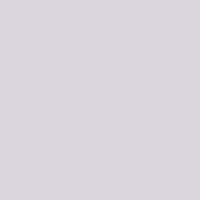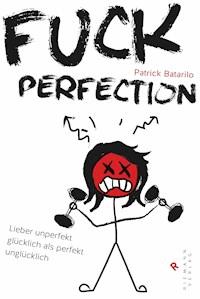
5,99 €
Mehr erfahren.
Lebe lieber unperfekt!
Schlanker, sportlicher, effizienter, 1000 Freunde, Mutter des Jahres und überirdischer Sex: Ständig wollen wir uns verbessern. Und am Ende sind wir oft nur unzufriedener als zuvor. Es treibt einen eben nichts so zielsicher ins Unglück wie die Suche nach dem perfekten Glück. Die Widersprüche dieses Selbstoptimierungswahns und Wege zu einem gesünderen Umgang mit Idealen zeigt ein Selbstversuch des Autors auf: Wie schaffen wir es, uns selbst eine Weile lang nicht verbessern zu wollen – ein umwerfend schwieriges und ergreifend belohnendes Unterfangen. Wir leben authentischer, lernen uns selbst wieder richtig spüren und finden so heraus, was uns jenseits der aalglatten Fehlerlosigkeit eigentlich ausmacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Patrick Batarilo, geboren 1974 in Waldshut als Sohn eines kroatischen Vaters und einer deutschen Mutter, studierte in Berlin, Frankreich und den USA Kultur- und Theaterwissenschaft. Er hat als Redakteur beim SWR gearbeitet und moderiert dort noch immer eine Gesprächssendung. Als freier Hörfunkautor hat er für Radio-Dokumentationen Vietnam, die Türkei, Israel, Mexiko, Argentinien, Westafrika und Kroatien bereist.
Patrick Batarilo
Fuck Perfection
Lieber unperfekt glücklich als perfekt unglücklich
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Originalausgabe
© Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2016 Riemann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Judith Mark
Umschlaggestaltung: Martina Baldauf, herzblut02, München
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-641-18027-0V001
www.riemann-verlag.de
INHALT
Fuck Perfection – Warum mein Leben nicht mehr mir gehört
1 Lächle oder stirb. Die Diktatur der guten Laune
2 Digital optimal auftreten. Die Auslagerung der Selbstoptimierung ins Virtuelle
3 Die Liebe als Optimierungsprojekt. Warum nichts möglich ist, wenn alles möglich ist
4 Schöner, gesünder, fitter. Oder: Wie wir über Muskeln und straffer Haut vergessen, warum wir eigentlich leben
5 Freizeit als Arbeit. Die Optimierung von Genuss und Spontanität
6 Erfolg und Karriere. Klassische Zwänge der Selbstoptimierung in ihrer heutigen Form
7 Perfekt glücklich. Zeitgemäße Anleitungen zum Unglücklichsein
8 Fuck Perfection: Letzte Worte
Liste der Selbstversuche
Dank
Literatur
Anmerkungen
»Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen.«
Woody Allen zugeschrieben
Fuck Perfection – Warum mein Leben nicht mehr mir gehört
Der Selbstoptimierungswahn, um den es in diesem Buch geht, lässt sich auf eine kurze Formel bringen: »Dieser Tag muss einfach dir gehören!«
Es klingt wie ein Versprechen. Doch in Wahrheit verwandelt dieser Satz wie ein Zauberspruch die ganze Welt. Allerdings wird sie nicht zu Gold wie in der antiken Sage vom König Midas, unter dessen Händen sich alles, was er berührt, in edles Metall verwandelt, leider selbst das Essen auf seinem Teller. Statt zu Gold wird unter unserer Berührung alles zu Arbeit: Arbeit an uns selbst. Arbeit an der besseren Version unserer selbst, die gefälligst endlich unser Leben leben soll. Das Ergebnis ist ähnlich zwiespältig: ein scheinbarer Reichtum, der in Wirklichkeit das Lebendige in uns bedroht. Eine goldglänzende Oberfläche, unter der das Echte in uns erstickt. Also in Wahrheit: ein Fluch.
Morgens der perfekte Frühsport, vormittags die perfekte Powerpoint-Präsentation; nachmittags die perfekte Mutter, abends der perfekte Liebhaber. Inzwischen sind wir so weit, dass wir bei allem, was wir tun, ständig den Druck spüren, uns zu fragen, ob wir das nicht noch besser tun können – denn wie sonst sollte »dieser Tag uns gehören«?
Sich verbessern – das war einmal ein Versprechen von Selbstbestimmung, von Freiheit, von Sichlösen und Ankommen. Vom eigenen Weg auf ein selbst gestecktes Ziel hin. Doch inzwischen geht es nicht länger darum, etwas Einzelnes besser zu machen: zum Beispiel zu lernen, wie man besser joggt oder wie man einen Baum richtig beschneidet. Heute steht alles unter Verbesserungsdruck. Und ein Ankommen ist nicht mehr in Sicht: weil jeder Erfolg an der Optimierungsfront nur ein Schritt in einem Prozess ist, der nie aufhört. Optimieren, maximieren, perfektionieren, heute ist das alles dasselbe. Nach oben ist immer Luft. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist.
Wie in dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier sind wir in einem einzigen, sich ewig wiederholenden Tag gefangen. Es ist der letzte Tag des Jahres – und wir nehmen uns ganz viel vor. Unser Leben ist eine permanente Neujahrssituation geworden. Nur erlauben wir uns nicht mehr, nach zwei, drei Wochen mit etwas schlechtem Gewissen, aber ansonsten guter Dinge wieder in den alten Trott zu verfallen. Nein, diesmal wollen wir unbedingt durchhalten. »Dieser Tag muss einfach dir gehören!« Jeder Tag. Ein quälend perfektes Leben lang. Das ist so anstrengend, wie es klingt. Und das Schlimmste: Wir machen da mit.
In meinem Fall sieht ein typischer Optimierungstag inzwischen ungefähr so aus: 7.30 Uhr Wecker. 7.32 Uhr Blick in den Terminkalender. 7.35 Uhr Frühstück. Erste Zielvorgabe des Tages: Bei einer nicht dick machenden und trotzdem energiereichen ersten Mahlzeit (Gesundheit, Leistung), deren genaue Zusammensetzung ich wie jeden Tag erst noch im Netz nachschlage (Abwechslung, individuelle Ernährung), werde ich endlich meine Gedanken klären (Strukturen schaffen), damit das auch finanziell dringend notwendige journalistische Meisterwerk möglich wird, das nun schon einige Zeit auf sich warten lässt (Kreativität, Finanzen). 8.00–8.20 Uhr Yoga (Körper stärken, Geist befreien). Auf dem Weg zur Arbeit checke ich meine Aktienkurse (die Deutschen müssen lernen zu investieren) und unterhalte mich möglichst gut gelaunt mit einem Kollegen über ein neu erschienenes Buch, dessen Inhalt ich währenddessen noch googeln muss (positiv denken, Kontakte knüpfen, neue Medien nutzen). Im Büro erst mal Atemübungen vorm Bildschirmschoner: Heute werde ich nicht nur meine Arbeit doppelt so schnell machen (Karriere), sondern auch endlich selbstbewusst auftreten, ohne dieses Gestotter und die kurzen peinlichen Aussetzer, die sich immer dann einstellen, wenn ich überlege, ob mein Chef mir überhaupt noch zuhört (souveränes Auftreten lernen). Gut, dass ich mich bei all dem Stress immerhin auf eins freuen kann: In jedem Fall werde ich auf dem Heimweg kurz am Bergsee Halt machen und mich eins mit der Natur fühlen, die da draußen irgendwo auf mich wartet, schon ein Leben lang (Achtsamkeit lernen). Als es endlich so weit ist, bleiben mir dafür allerdings nur acht Minuten, besser fünf – um halb sieben habe ich nämlich einen Spanischkurs (weltmännisches Auftreten üben, Korrespondentenkarriere), um halb acht ein romantisches Dinner mit meiner Freundin (Beziehung pflegen); ach nee, das ist morgen, heute Abend ist nach der Sprachschule gleich das Feedbackseminar für meine Ausbildung als Coach dran (Karriere Plan B: Breit-aufgestellt-Sein) … Oder war es das Anti-Aggressions-Seminar (Stressmanagement, Beziehungspflege)? Außerdem werde ich am frühen Abend noch zehn Kilometer in mittlerem Tempo laufen (Fitness), schließlich wird im niedrigen Intensitätsbereich das meiste Fett verbrannt; dabei werde ich wie sonst auch im Laufen alle heute gemachten Fotos auf Facebook posten (Kollege mit Arschfalte in der Bahn, Waldsee in der Dämmerung) und mich erst dann gut fühlen, wenn ich mindestens zwölf Likes habe (Anerkennung, Gruppenstatus). Während ich über Kopfhörer einen Glücksratgeber höre, werde ich mir selbst verzeihen (Glückstipp für heute), dass ich schon nach drei Kilometern Strecke Magenkrämpfe habe – nicht wegen der Anstrengung, sondern beim Gedanken an all die Dinge, die ich morgen wieder tun muss, außerdem von der Angst, was passieren würde, wenn ich sie nicht tue, und sei es nur ein einziges Mal, aber so fängt es an.
Und dabei habe ich noch nicht einmal Kinder.
Zeitkritische Texte beginnen oft mit dem Wort »Unbehagen«. Ein Unbehagen wird formuliert. Unbehagen? Wut. Empörung. Erschöpfung!
Wir erleben es alle am eigenen Leib, Tag für Tag: Ein neuer Druck liegt in der Luft, etwas zieht sich immer enger zusammen. Im Auto unseres Lebens sitzen wir nicht mehr auf dem Fahrersitz – eher ist es so, dass wir wie Unfallopfer weitergeschleift werden, von einem Optimierungsziel zum nächsten. Wie aus heiterem Himmel haben wir uns plötzlich Zielmarken zu eigen gemacht, denen eben noch technikbesessene Subkulturen oder die Oberschicht oder wer weiß welche überambitionierten gesellschaftlichen Gruppierungen anhingen – jedenfalls nicht wir. Müssen wir jetzt wirklich alle twittern und einen Blog schreiben, Geige spielen und Chinesisch sprechen, 24-stündig kreativ und achtsam sein, einen Bauernhof ausbauen und gleichzeitig ein Großstadt-Loft haben? Darf niemand mehr mittelmäßig sein, halbwegs erfolgreich, mäßig attraktiv, einigermaßen gesund, leidlich zufrieden? Vor allem: Wissen wir eigentlich noch, warum und wozu wir ständig an uns arbeiten?
Klar ist: Jeder steht an seiner eigenen Selbstoptimierungsfront. Manche hängen weit zurück und versuchen noch immer, endlich ihre erste funktionierende To-do-Liste am Computer zu erstellen; andere sind als Optimierungsvorhut schon in der Zukunft unterwegs, messen mit Mood-Tracker-Apps fürs Smartphone ihren Glückspegel und lassen sich bei Anzeichen von Depression automatisch von ihrem Smartphone einen Termin beim Psychiater ausmachen. Zwischen diesen beiden Extremen haben die meisten anderen mit der Arbeit an sich selbst begonnen: erstaunt, euphorisch, ausgebrannt.
»Dieser Tag muss einfach dir gehören!« Dieses Buch will zeigen, dass der Satz uns in die falsche Richtung führt. Eitles Anspruchsdenken, Gier, Kompromisslosigkeit, falscher Optimismus, Egomanie und ein gutes Maß Verlogenheit – die ganze Essenz der Selbstoptimierung in ihrer heutigen Form steckt in diesem Satz. Wie jede Form von Perfektionismus, so ist auch die Selbstoptimierung ein Spiel mit tiefsitzenden Wünschen und Ängsten. In einer Welt, in der alles immer schneller und flüchtiger wird, verspricht sie Halt. Alles mag sich ändern, eines bleibt gleich: Wir werden besser. Oder in der bedrohlichen Variante: Stillstand ist Rückschritt.
Die anderen schaffen es doch auch! Und was möglich ist – muss ich das nicht?
Aber was ist, wenn uns genau dieser Anspruch unglücklich macht? Weil wir im Möglichkeitenmodus immer nur nach der besseren Version unserer selbst suchen? Und darüber die wirkliche Version vergessen – die Version mit den zu großen Füßen und Träumen, mit den schiefen Zähnen und alternden Gedanken, der Lust an Albernheit und stinknormaler Faulheit, der Freude an Blumen, die zwar krumm wachsen, aber gut riechen? Die Beta-Version unseres Ich, die manchmal glücklich ist, aber nicht immer; die Gefühle hat, die nicht maßgeschneidert sind, die sich in den unpassendsten Momenten fürchtet, in den unwahrscheinlichsten Momenten liebt, die nicht arbeiten will, wenn sie sollte, und ausgerechnet dann gute Ideen hat, wenn niemand danach fragt?
Es ist nicht »unser« Tag, wenn ein perfektes Double einen perfekten Tag hat. Denn die bessere Version unserer selbst hat ein Problem: Sie muss sich immer kontrollieren. Ständig muss sie über die Schulter schauen, hinter jeder Ecke lauern neue Ansprüche, am Ende jeder Agenda eine neue Woche, ein neues Jahr. Immer ist da im Hinterkopf die Frage: Passe ich zu der Idee, die ich von mir habe? Bin ich genauso erfolgreich, schön und glücklich, wie ich es sein sollte? Ganz zu schweigen von der beunruhigenden Frage: Ist das überhaupt noch mein Leben?
Angst essen Seele auf.
Ganz ehrlich: Ich kann nicht mehr. In dem Kontrollraum, in den sich mein Selbst verwandelt hat, leuchten inzwischen so viele Lämpchen, dass ich mich getrost zurücklehnen und das Farbenspiel genießen könnte. Tue ich aber nicht. Ich weiß nicht wie. Zumindest nicht, ohne dass dieses Zurücklehnen auch noch kontrolliert wäre – ein perfekt durchoptimiertes Zurücklehnen, großes Entspann-Kino, nichts als eine weitere Etappe der Arbeit an mir selbst.
Damit Sie gleich wissen, mit wem Sie es zu tun haben, gebe ich unumwunden zu: Ich bin schon früh zum Selbstoptimierer geworden. Ein Nerd war ich nie, nicht im eigentlichen Sinn, dafür habe ich immer zu viel Sport gemacht, bin immer auch gerne ausgegangen, habe getrunken und gefeiert und bin im Morgengrauen mit bleichen Träumen und schlechtem Gewissen nach Hause gekommen. Aber andererseits hatte ich schon zu Schulzeiten Arbeitspläne, mit denen ich mich Wochen im Voraus auf Klassenarbeiten vorbereitet habe. Ich pflegte den Ruf, dass mir alles zufiele – doch de facto arbeitete ich Listen ab. Listen, mit denen ich mich bis zu dem Moment in Sicherheit bringen wollte, an dem ich mein Leben herumreißen würde. Denn das hatte ich immer vor Augen: Die Selbstoptimierung wird irgendwann aufhören, sobald etwas Bestimmtes, nie ganz Fassbares erreicht ist. Alles wird eines Tages einen Sinn ergeben – ich muss mich nur zu der Art Mensch formen, die ein wirklich gutes Leben verdient. Der Fußballtrainer mit den schlechten Witzen, die erste Freundin, die mich aus Verzweiflung mit Filzstiften bemalte, weil ich mich nicht traute, sie endlich anzufassen, die leeren Momente vorm Ins-Bett-Gehen in den Monaten vor dem Abitur – all das würdeeines Tages einen Sinn ergeben: alles Wegmarken und Straßenschilder, Nebenstraßen und Schleichwege on the way to myself. »Eines Tages«, das hieß: sobald ich meine Berufung entdeckte. Sobald ich mich entdeckte. Sobald ich die Person wäre, auf die ich hinarbeite. Alleswürde sich fügen wie ein Puzzle, das irgend so ein Depp namens Gott durcheinandergeworfen hatte – aber da es ein göttlicher Depp war, würde er es schon wieder in Ordnung bringen. Bis zu meinem 18. Geburtstag. Bis zu meinem 20. Geburtstag. Bis zu meinem 30. Geburtstag. Heute bin ich 40, und das Puzzle ist immer noch nicht in Ordnung. Wer ist nun der Depp?
Schielen Sie auch so gerne auf die Geburtsdaten von Leuten, die irgendwann plötzlich Erfolg hatten und ihr Leben herumgerissen haben? Die Opernsängerin, die überhaupt erst mit 30 angefangen hat zu singen? Der Friedensnobelpreisträger, der bis 35 ein unbedeutender Anwalt in einer Kleinstadtkanzlei war? Ab 40 werden die Vorbilder deutlich weniger. Dafür freut man sich umso mehr über die, die man noch findet. Es hat eben alles sein Gutes.
Immerhin habe ich inzwischen eines verstanden. Wenn unser Problem ist, dass wir immer atemloser den immer idealeren Vorstellungen hinterherlaufen, die wir uns von uns selbst machen – dann liegt das vielleicht ja auch daran, dass es gar nicht unsere eigenen Ideen sind? Vielleicht stammen sie ja von jemand anderem, dienen anderen Zwecken? Und haben deshalb so eine durchschlagende Kraft?
Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2014 spielte etwas eine Rolle, was sonst nicht gerade zu den harten Wirtschaftsthemen gezählt wird: Glück. Ein buddhistischer Mönch hielt Vorträge mit seinem iPad. Manager sollten lernen, sich nicht von ihren Gedanken beherrschen zu lassen, sondern sie gelassen zu beobachten, so wie ein Schäfer auf seine Schafherde blickt.1 Dass der Buddhismus viel Weisheit in sich birgt, ist unbestritten; dass Glück ein wichtiges Thema ist, hoffentlich demnächst auch bei volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Rechnungen, ebenfalls. Doch die Frage muss erlaubt sein: Sind »die da oben«, die mächtigsten Menschen der Welt, jetzt einfach endlich vernünftig geworden? Oder ist Glück eben neben allem anderen auch ganz einfach das nächste große Geschäft? Seit der Jahrtausendwende coacht und motiviert sich die westliche Welt bis zur Bewusstlosigkeit, wie es Ariadne von Schirach in ihrem wütenden Buch Du sollst nicht funktionieren so schön ausdrückt. Das Thema Glück füttert eine ganze eigene Industrie: Glückscoaches, Glücksratgeber, Glückskekse, Smiley-Sticker-Fabrikanten, die ganze Selbstoptimierungsbranche. Doch auch ganz normale Unternehmen profitieren vom neuen Optimierungsglückssoll. In den letzten Jahrzehnten hat in den USA und Europa unter dem Etikett »Globalisierungsanpassung« eine ungeheure Entlassungswelle unsere vertraute Arbeitswelt unterspült. Viele von uns – mich selbst eingeschlossen – verrichten inzwischen als selbständig arbeitende Dienstleistungsnomaden Tätigkeiten, die noch eine Generation zuvor selbstverständlich in geregelte Arbeitsverhältnisse – auf Lebenszeit – eingebettet waren. Unseren Arbeitgebern gegenüber haben wir kaum noch Rechte, aber dieselben Pflichten wie eh und je. Ist es da nicht beruhigend zu hören, dass jedes Scheitern eine Chance ist? Jede Entlassung ein Sprungbrett? Dass wir für unser Glück selbst verantwortlich sind? Dass wir alles können, vorausgesetzt, wir wollen es wirklich und lassen uns nicht etwa von negativen Gedanken stören? Zum Beispiel von dem Gedanken, dass Arbeitgeber eine Verantwortung gegenüber den Menschen haben, die das Unternehmen mit aufgebaut haben? Sich selbst optimierende Mitarbeiter, die auf jede Schwierigkeit mit immer neuen Selbstoptimierungsschüben reagieren und alles, was ihnen widerfährt, als Chance begreifen – etwas Besseres kann einem Unternehmen, das die Verantwortung für seine Mitarbeiter loswerden möchte, kaum passieren.
Natürlich schmeichelt es uns zu hören, dass wir alles können, wenn wir nur wollen. Dass alles gut wird, wenn wir es nur zulassen. Dass wir dann auch Job, Kinder, Freizeit, Fitness, Gelassenheit, Freundschaft und einen perfekten Body-Mass-Index hinkriegen. Doch die Kehrseite der Alles-ist-möglich-, Jeder-ist-seines-Glückes-Schmied-Philosophie ist überdeutlich: Wenn wir keinen Erfolg haben, wenn wir nicht glücklich sind, wenn wir nicht an unseren Krisen wachsen und beharrlich mittelmäßig sind statt die Besten – dann sind wir eben selbst schuld. Immer noch kein neuer Job? Versager. Weiter Single? Loser! Etwas Weiterbildung, Meditation, ein bisschen Gehirntraining, ein paar Monate Coaching – schon wäre der neue Arbeitsplatz da. Der neue Partner. Die Ehe mit Abenteuerurlaub und Strandhaus. Im Beruf, in der Liebe, in der Freizeit, im Hinblick auf das eigene Glück: Überall sind wir plötzlich aufgerufen, zum Unternehmer unseres eigenen Lebens zu werden.
Das nagende Gefühl immerwährenden Ungenügens, das unsere neue Freiheit zum Besseren begleitet, wird noch genährt durch die Technik, die uns umgibt. Es ist bezeichnend, dass viele bei dem Wort »Selbstoptimierung« zuallererst an die neuen Geräte denken, mit denen sich unser Körper nahezu ununterbrochen trimmen und überwachen lässt. Der Herzschlag bei der Meditation, die Denkleistung nach einer Tasse Kaffee: Die Anhänger der »Quantified Self«-Bewegung messen bekanntlich ständig ihre Körperwerte – und versuchen, so ihr Ich zu optimieren. Doch statt uns zu entlasten, führt diese Technik oft nur dazu, dass wir noch mehr von außen, durch die Augen der Geräte auf uns blicken – und am Ende noch weniger über unsere wirklichen Wünsche und Gefühle wissen als ohnehin schon. Noch dazu stellen die perfekten Geräte und Apparate, mit denen wir uns umgeben, unsere reale Unvollkommenheit nur noch deutlicher zur Schau. Die moderne Technik mit ihren immer schnelleren Upgrade-Zyklen ist in sich selbst das Bild einer frenetischen, nie abzuschließenden Suche nach Vollkommenheit; sie beschämt uns permanent – und spornt uns auf diese Weise nur immer noch weiter an.
All das zehrt viel Kraft auf, Energie, die wir dringend für andere Dinge brauchen. Schönere Dinge. Das echte Leben. Die überraschenden Begegnungen mit wirklichen, überhaupt nicht perfekten Menschen. Zufällige Berührungen, Schritte zur Seite, improvisierte Gedanken ohne Fallschirm.
Wir haben vergessen, uns die Frage zu stellen, wozu es sich eigentlich lohnt zu leben.2 Stattdessen bestimmt der Kampf gegen unsere Fehler unser Leben. Und wenn man sich dem entgegenstemmen will, landet man schon in der nächsten Schleife: neue Aufforderungen, neue Ideale. Der Optimierung, dem Stress, dem Funktionswahn, der ständigen Beschleunigung entkommen? Kein Problem: Entspann dich einfach! Sei spontan! Sei zufrieden! Die Selbstoptimierung erreicht dort ihren Gipfel, wo wir uns nicht nur bemühen, hundertprozentig zu funktionieren – sondern auch noch hundertprozentig glücklich sein wollen. Hundertprozentig genießen. Hundertprozentig achtsam sein. Hundertprozentig nicht mehr hundertprozentig sein wollen. Das ist ungefähr so, als würden wir uns selbst anschreien: Mach es mir gefälligst nicht dauernd recht!
Gibt es ein Leben vor dem Tod?, lautet eine berühmte Frage. Wir suchen so sehr danach, dass wir nahe daran sind, es zu verpassen. Wir wollen alles. Und stehen am Ende mit leeren Händen da. Ganz ehrlich: Darauf habe ich keinen Bock mehr.
Was tun? Dazu habe ich dieses Buch geschrieben. Es soll zeigen, wie wir in diese Defensivhaltung geraten sind – statt einfach zu existieren. Und was man tun kann, um dem Druck zu entgehen.
Aber kluge Gedanken kann man sich leicht machen. Und so rein theoretisch bringt das alles ja auch nichts. Deshalb habe ich Folgendes ausprobiert: wie ich mich einmal nicht selbst optimiere – einen Monat lang. Dazu habe ich Experimente durchgeführt, Selbstversuche, die im Buch einen roten Faden bilden, an dem ich die verschiedenen Aspekte der Selbstoptimierung in unserem Leben zeige. Manche der Versuche habe ich nur einen oder zwei Tage lang ausprobiert, andere den ganzen Monat über.
Ich kann sagen: Es war ein herausfordernder, schwieriger, lustiger, spannender Monat. Manchmal am Rand des Wahnsinns, manchmal überraschend normal. Manchmal befreiend, manchmal zäh und mit großen Widerständen – doch fast immer haben meine Experimente Verkrustungen aufgebrochen, die Dinge in Bewegung gesetzt.Ich habe viel über mich gelernt – und über die Intelligenz und manchmal fast unbegreifliche Geduld der Menschen, die mich ertragen mussten, insbesondere meiner Freundin. Ich verstehe jetzt besser, welche gedanklichen und psychischen Mechanismen ablaufen, wenn wir unseren Optimierungszwängen folgen – und wie man sie untergraben kann. Ich habe meine Lust am Unvollkommenen, Einfachen, Stinknormalen neu entdeckt. Und gelernt, wie man die Selbstkontrolle lockern kann.
Was ich auch entdeckt habe: Ganz ohne Selbstoptimierung wird es schwierig. Bequem im »Bleib, wer du bist« zu verharren, macht auf die Dauer auch keinen Spaß. Von daher kann es sich lohnen, zwischen dem zu unterscheiden, was wir an uns ändern können, und dem, was nun einmal zu uns gehört. Herauszufinden, wie wir auf eine Weise an uns arbeiten, die uns angemessen ist. Die zu uns passt – und nicht zu den Verkaufszahlen eines Diätratgebers. Welche Art Soundtrack beispielsweise begleitet unsere Arbeit an uns selbst? Welche Tonlage hat die Stimme, die in unserem inneren Kontrollraum erklingt? Wenn es die richtige Art Stimme ist, der richtige Sound, wenn es vor allem auch mehrere, auch mal widersprüchliche Stimmen sein dürfen – dann ist es schnell kein Kontrollraum mehr, eher ein Partykeller, in dem man gute, entspannte Gespräche mit sich selbst führt, sich ab und zu zum Affen macht, aber auch mal auf die Tanzfläche geht und sich was traut. Und trotzdem die Richtung behält im Leben.
Dass dazu auch ein bisschen lustvoller Trotz, eine Prise »Jetzt-reicht’s«-Attitüde nötig ist, soll schon der Titel zeigen: FuckPerfection. Etwas Stachel muss sein …
Das Buch gliedert sich in acht Kapitel, die jeweils einen Bereich des Selbstoptimierungswahns erforschen: Gut drauf sein – auch wenn es uns scheiße geht (Kapitel 1); digital optimal auftreten – auch wenn unser analoges Leben deutlich suboptimal ist (Kapitel 2); unsere Beziehung harmonisieren – bis es kracht (Kapitel 3); so lange gut und gesund leben, bis wir ganz vergessen haben, wozu (Kapitel 4). Danach geht es um das, was die Selbstoptimierer »Work-Life-Balance« nennen: Karriere machen (Kapitel 5) – und neben der Arbeit noch ein perfekt erfüllendes Leben haben (Kapitel 6). Kapitel 7 ist dann der Königsdisziplin der Selbstoptimierung gewidmet: dem Glück.
Machen wir uns nichts vor – das Optimum erreichen wir nie. Nicht alles wird gut. Dieser Tag muss überhaupt nicht mir gehören. Hat er nie. Wird er nie. Dieser Tag gehört sich selbst. Aber: das Schöne, Wilde, Einmalige, das geht. Doch wenn wir genießen, atmen, tanzen, wenn wir leben wollen, müssen wir auch mal die Kontrolle abgeben können. Wir müssen Anti-Optimierungstugenden lernen. Zum Beispiel, uns selbst nicht so ernst zu nehmen. Dafür müssen wir einen neuen Raum schaffen, innen und außen. Einen nichtperfekten Raum. Einen wirklichen Raum. Genau darum geht es in Kapitel 8: ein Fazit beziehungsweise ein kleines Programm, wie wir gelassen-vernünftig an uns arbeiten können.
Kennen Sie die Geschichte von dem Nomaden, der einen Affen jagt? Um den Affen anzulocken, hat der Jäger Wildmelonensamen in ein Loch gelegt. Der hungrige Affe fasst in das Loch, spürt voller Vorfreude die Samen mit den Fingerspitzen – kann die um die Beute zur Faust geballte Hand aber nicht mehr aus dem Loch ziehen, weil das Loch zu eng ist. Loslassen will er aber auch nicht. So findet ihn der Jäger.
Es kann doch nicht wahr sein, dass wir uns verhalten wie der Affe aus der Geschichte. Alles geht nicht – ist das so schwer? Also: loslassen. Die Hand aus dem Loch ziehen. Und entspannt weiterschlendern. Fuck Perfection …
1Lächle oder stirb. Die Diktatur der guten Laune
Vor ein paar Jahren habe ich eine deutsche Freundin in Istanbul besucht. Tine hatte in der Türkei ein Erasmus-Jahr verbracht, war dann nach Berlin zurückgekehrt, lebte – nach einem kurzen Intermezzo erst in ihrer schwäbischen Heimatstadt, dann in Singapur – nun doch wieder am Bosporus. Eine ganz normale Endzwanziger-Nomaden-Existenz, deren Herzstück ein Laptop ist, sowie eine externe Festplatte mit genügend Fotos und Musiktiteln, um noch ein Gefühl von Heimat zu vermitteln – auch wenn die Heimat meist nur noch aus dem besteht, was unter dem Skype-Logo auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Tine ist zierlich, betont nachlässig, macht gerne große Augen und bestimmt am Ende des Abends immer, wo es langgeht. Emir, der türkische Schauspieler, mit dem sie zusammen war, ist ein »Mann-Mann«, wie sie sagt. Einkaufstüten-Tragen und Bohrmaschinen-Handhaben gehören quasi zu seiner Männlichkeits-DNA. Aber etwas an Emir schien nicht zu dieser gestandenen Männlichkeit zu passen. Am deutlichsten empfand Tine das in der Zeit, als sie in Berlin lebte und Emir in Istanbul. Beide waren sie unzufrieden mit der Situation, beide hatten sie zu wenig Geld, um auf die Jobs zu verzichten, die sie gerade an ihren jeweiligen Wohnorten ausübten. Wenn sie beim Skypen allzu schwarz sahen, reagierte Tine, indem sie einfach das nächste Wiedersehen in Istanbul oder Berlin plante. Irgendein billiger Flug musste doch zu finden sein! Kurz: Sie suchte nach Lösungen. Außerdem: So eine Fernbeziehung hat doch auch Vorteile? Zeit für eigene Pläne, die Vorfreude auf das nächste Treffen … Doch statt gemeinsam mit ihr über Möglichkeiten und Lösungen nachzudenken, lehnte sich Emir auf dem Bett zurück, auf dem er mit seinem Laptop saß. Schweigend starrte er an die Decke, bis irgendwann, wie in einer nicht enden wollenden Zeitlupe, eine große Träne seine stoppelige Wange hinabkullerte. Emir weinte. Er versteckte seine Tränen nicht. Im Gegenteil: Er genoss seine Trauer. Warum sonst die hingebungsvoll-herzerweichenden Seufzer, der leidend der Kamera zugewandte Blick?
In der Türkei existiert eine Form von Melancholie, die uns fremd ist. Sie ist das Gegenteil der guten Laune, die wir uns täglich als Wundermittel gegen alle Widrigkeiten des Lebens verschreiben. In den Straßen von Istanbul kann man der Melancholie überall begegnen. Man muss nur ein bisschen am glänzenden, westlich-optimistischen Firnis kratzen und sich in die Viertel jenseits der Party- und Businessmeilen um den Taksim-Platz wagen. Zum Beispiel den Vorhof einer Meyhane betreten, eines traditionellen Fischmarkts. Dort sieht man sie dann zusammensitzen, zu zehnt, zwölft, an eng zusammengestellten Tischen. Natürlich wird viel getrunken, meist Raki, Anisschnaps; und es wird gegessen, genüsslich. Während hinter ihnen die dampfenden Fliesen gefegt werden, singen sie traurige Lieder von verlorener Liebe und Tod. Und wenn sie nicht singen, klagen sie über ihr eigenes Leben, jammern, wissen nicht mehr weiter – und sagen am nächsten Tag, dass sie einen wunderschönen Abend gehabt haben. Die türkische Melancholie ist nichts, was sich verstecken müsste. Sie hat sogar einen Namen: Hüzün. Orhan Pamuk, der türkische Nobelpreisträger, spricht in seinem Buch Istanbul davon, dass Hüzün in Istanbul überall zu sehen sei – wie ein hauchdünner Dunst über den Wassern des Bosporus, wenn an Wintertagen die Sonne durchbricht. Die Melancholie einer ganzen Stadt – nicht versteckt, sondern stolz empfunden. 3
Als ich mich in Istanbul nach Hüzün umgesehen habe, nach dem Gespräch mit Tine, hat mich vor allem eins überrascht: wie leicht die Menschen in der Türkei von Trauer zu Freude wechseln können. Die Leichtigkeit, mit der sie Gefühle verbinden, die für mich absolute Gegensätze sind. Wenn ich traurig bin, freue ich mich nicht. Wenn ich mich freue, bin ich nicht traurig. Ein türkischer Freund, der Theatermacher Bahtiyar, der selbst als Kind in Deutschland gelebt hat, hat es mir so erklärt: »Ich glaube, ohne Melancholie gibt es kein Gefühl in der Welt. Ohne Melancholie gibt es kein Leben. Manchmal vermisse ich Hüzün. Wo gibt es hier ein bisschen Melancholie? Man braucht es manchmal. Sonst wird man wie eine Maschine.«
Wieso kommt uns das so fremd vor?
Wir leben in einer Gute-Laune-Diktatur. Smile or die, lächle oder stirb, so hat die amerikanische Autorin Barbara Ehrenreich ihr Buch über den Zwang zur strahlenden Fassade genannt. Wir sind angehalten, alles positiv zu sehen – das Glas auch dann noch für halbvoll zu halten, wenn es zerschlagen auf dem Boden liegt.4 Gute Laune, so hören wir überall, ist der Schlüssel zur Selbstoptimierung: Wer gut drauf ist, ist nicht nur zufrieden, er hat auch mehr Freunde, ist erfolgreicher, gesünder, ja er lebt sogar länger. Wer möchte bei solchen Versprechungen noch jammernd in der Ecke stehen? In den Einkaufspassagen unserer Städte werden uns so viele Gute-Laune-Produkte verkauft, dass man sich fragt, wieso überhaupt noch irgendjemand nicht strahlt: Es gibt Gute-Laune-Tassen und Gute-Laune-Pflegeschaumbäder, Gute-Laune-Kräutertee und – etwas Kontrast muss sein – Gute-Laune-Drops mit »leicht saurer prickliger Füllung«. Der Smiley, dieser neongelbe Grinseterrorist, ist eine der berühmtesten und lukrativsten Marken der Welt geworden – auf Augenhöhe mit dem Haken, den ein berühmter Sporthersteller unter seine Erfolgsbilanzen setzt (»Just do it«), oder den goldgelbenBögen des amerikanischen Frikadellenbraters, der uns den Satz »Ich liebe es« für immer mit Frittier-Assoziationen ruiniert hat.
Alles, so wird uns gesagt, ist eine Frage der Einstellung. Wenn Sie die Welt positiv sehen, dann ist sie es auch – jetzt und für immer. Hunderte von Gute-Laune-Glücksratgebern haben dieses Mantra verinnerlicht und veräußern es mit Erfolg. Darunter finden sich zum Beispiel das Hasen-Yoga für gute Laune (das »niedlichste Anti-Stress-Buch seit der Erfindung des Yoga«), Anleitungen zum Gute-Laune-Häkeln (die »schönsten, lustigsten und herzigsten Häkelideen«) oder auch Das ganz persönliche Gute-Laune-Orakel (mit »besonders flauschigem Stoffbeutel«). Und natürlichdürfen Rezepte für gute Laune nicht fehlen – schließlich muss man zwischen Hasen-Yoga und Gute-Laune-Häkeln auch mal ein Häppchen essen. Fassen wir es mit dem Titel eines anderen Ratgebers zusammen: Ganz viel gute Laune für dich!
Die Psychologie hat in den letzten Jahren einen ganzen neuen Zweig entwickelt, die »positive« Psychologie. Die Positive Psychologie beschäftigt sich nicht mehr mit »negativen« psychischen Zuständen wie Neurosen, Ängsten oder anderen psychischen Krankheiten – sondern mit »positiven« Emotionen wie Glück, gute Laune oder Optimismus. Martin Seligman, ein US-amerikanischer Psychologe, hat diesen Forschungszweig quasi im Alleingang erfunden. Dass Seligman als Coach bei seinen Seminaren Hunderten von Menschen gleichzeitig Optimismus beibringt, zu einem Preis von 2000 Dollar pro Person, dass er große Unternehmen berät, wie sie ihre Mitarbeiter zu effizienterer Arbeit antreiben und ihren Absatz steigern können, dass er auf einer kommerziellen Website Glück (in Form von Übungen) gegen Bares verkauft5, all das spricht nicht gegen Seligman. Warum sollte er sich selbst die gute Laune verderben?
Sagen wir es deutlich: Gegen Glück und gute Laune ist selbstverständlich nichts einzuwenden. Ehrlich gut drauf zu sein ist etwas Wunderschönes. Niemand will die altdeutsche Knurrigkeit zurück, das verbissene Herumreiten auf Mängeln, die ständige Angst vor Fehlern. Der Miesepeter lebt schlechter, freudloser – und ist auch nicht näher an der Wahrheit. Etwas mehr Gute-Laune-Kompetenz kann also nicht schaden. Schwierig wird es nur, wenn ein bestimmter Zug alle anderen dominiert. Wenn für die unvermeidlichen Ängste, Schwächen und Hilflosigkeiten, das ganze existentielle Marschgepäck des Lebens, kein Platz mehr ist. Wenn das Echte an uns unter Generalverdacht gerät: Lächle – oder stirb.
Auch die Amerikaner waren übrigens nicht immer die auf Knopfdruck lächelnden Zwangsoptimisten, als die sie heute vielerorts gelten. Im ausgehenden 18. Jahrhundert herrschte in den gerade erst unabhängigen Vereinigten Staaten noch eine ganz andere Gefühlslage. Der Calvinismus, die prägende religiöse Strömung der Zeit, predigte vor allem eins: Härte gegen sich selbst. Die sadistische Grundannahme war, dass nur einige Auserwählte nach ihrem Tod in den Himmel kommen. Der calvinistische Gott lässt sich nämlich nicht durch menschliches Blendwerk wie gute Taten oder Gebete beeinflussen, denn wer sich manipulieren lässt, ist nicht allmächtig. So nehmen wir an einem Spiel teil, in dem die Sieger schon feststehen: Gott hat alles vorherbestimmt. Nur, woher wissen wir, dass wir zu den Siegern gehören? Und nicht zu denen, die dem göttlichen Plan B zufolge automatisch in ewiger Verdammnis landen? Ganz einfach: Wer Schwäche zeigt, sich unmoralisch verhält oder auch nur unmoralische Gedanken hat, der zeigt eben dadurch, dass er nicht zu den Siegern gehört. Dagegen sind Wohlstand und beruflicher Erfolg klare Indizien dafür, dass Gott uns auserwählt hat. Man darf nur nicht in Versuchung geraten, die Früchte seines Erfolgs schon auf Erden zu genießen – denn das wiederum wäre ein Zeichen, dass man doch eher fürs Team Hölle aufgestellt ist. Der Calvinismus der USA war, wie Barbara Ehrenreich schreibt, ein »System sozial auferlegter Depression«6: Zu lächeln galt als liederlich, Freude war unmoralisch. So war das in den USA damals – von lächelndem Optimismus kaum eine Spur. Das änderte sich erst durch die Erfahrungen der »frontier«, der offenen, immer neu zu erschließenden Grenze im amerikanischen Westen. Im Kampf gegen Bären, Sümpfe und unterwerfungsunwillige Ureinwohner wurden tatkräftige, raue, pragmatische Menschen benötigt, die an das Versprechen eines besseren Lebens im Diesseits glaubten. Verstärkt wurde der neue Trend durch eine religiös fundierte Philosophie namens »New Thought«, die im 19. Jahrhundert zum Vorläufer dessen wurde, was wir heute »Positives Denken« nennen. Ein Amalgam aus unbedingtem Optimismus (»Alles ist möglich«), Magie (»Gutes zieht Gutes an, Schlechtes Schlechtes«) und Spiritualität (»Alles ist Geist«). Für den heutigen Selbstoptimierungswahn entscheidend: Die »New Thought«-Bewegung half zwar, den trostlosen Fatalismus zu überwinden, bewahrte aber gleichzeitig einige andere eher ungute Eigenschaften des Calvinismus. Zum Beispiel die Härte sich selbst gegenüber. Die frisch gebackenen Optimisten durchforschten ihre Gedanken zwar nicht mehr auf religiöse Untadeligkeit, doch man beobachtete sich selbst trotzdem wie besessen. Negative Gedanken? Ausmerzen! Denn Schlechtes zieht Schlechtes an! Diese exzessive Form der Selbstkontrolle ist heute einer der dominanten Züge des »positiven Denkens« und der Gute-Laune-Ideologie. Wer wirklich gut drauf sein will, muss die eigenen Gedanken kontrollieren – es könnten ja negative Gedanken darunter sein. So werden in der Einsamkeit der Tagebücher, aber auch bei gemeinsamen Treffen dunkle Gedanken und Gefühle abgeschabt und ausgemerzt, bis nur noch positive Vorstellungen übrig sind – und alle Zweifel und Ängste erfolgreich verdrängt. Es ist, als wäre aus den Zeiten des Calvinismus noch ein letztes Misstrauen gegenüber den positiven, hellen Gefühlen übriggeblieben. Freude darf nicht spontan sein; sie muss ständig beobachtet werden, so, als müssten wir vor ihr auf der Hut sein. Hoffen darf nur, wer streng mit sich selbst ist. Kurz: Positive Gefühle erfordern Arbeit – lebenslang. Und Härte gegenüber sich selbst. Paradoxerweise sogar Schmerz. So werden Glücksaspiranten zum Beispiel auf einer amerikanischen Website dazu aufgefordert, sich ein Gummiband ums Handgelenk zu spannen: »Jedes Mal wenn du einen negativen Gedanken hast, zieh an dem Band und lass es zurückschnappen. Au! Das tut weh. Vielleicht ist da später sogar ein Striemen, wenn das Band zu dick ist. Nimm’s locker, du willst dich nicht selbst entstellen – du versuchst nur, dir etwas Schmerz zuzufügen, damit du in Zukunft negative Gedanken reflexhaft vermeidest.«7
Die Härte im Zentrum des Gute-Laune-Denkens rührt auch von dem magischen Denken her, das sich in die popularisierten Formen der »Positiven Psychologie« eingeschlichen hat. Es ähnelt sehr dem, was die Ethnologen »Analogiezauber« nennen. Sticht man mit Nadeln in eine Voodoo-Puppe, so empfindet die Person, die von der Puppe dargestellt wird, an den entsprechenden Körperstellen einen Schmerz. Im Analogiezauber zieht Gleiches Gleiches an. In seiner modernen New-Age-Variante, der Visualisierung, zieht die Vorstellung ihr Objekt an. In den entsprechenden Ratgebern wird diese Grundidee wie ein Mantra wiederholt: Positive Gedanken ziehen Positives an, negative Gedanken Negatives. Egal, was wir uns wünschen – wenn wir fest genug daran glauben, erhalten wir es. Nicht nur gute Laune, sondern auch gleich noch ein schnelleres Auto, möglichst mit Sitzheizung, und jedenfalls endlich einen leidenschaftlicheren Partner als den, der jeden Morgen in unserer Küche rummuffelt. Wir ziehen an, was auch immer wir »visualisieren« – durch ein magisches Attraktionsgesetz. Das ist eindeutig eine Allmachtsphantasie. Doch wie bei jeder Allmachtsphantasie lauert auf der anderen Seite des Größenwahns die Angst vor der eigenen Ohnmacht. Und genau daher rührt die Härte nach innen, sich selbst gegenüber, die wir auf dem Grund des positiven Denkens finden. Denn wenn sich das Erwünschte nicht einstellt, kann es nur daran liegen, dass wir Zweifel und Ängste zugelassen haben. Dass wir nicht streng genug mit uns selbstwaren. Hinter der Allmachtsvorstellung lauert daher immer eine große Angst, die nur durch ständiges, immer strengeres Selbstbefragen beruhigt werden kann.
Wie heißt es auf einer der vielen Ratgeber-Webseiten: »Wann immer Ihnen auffällt, dass Sie sich Sorgen um Dinge machen, die Sie momentan (oder ohnehin) nicht ändern können, oder sich Ihr innerer Kritiker einfach mal wieder austobt, sagen Sie ›Stopp!‹ und schieben Sie diesen Gedanken nachdrücklich beiseite.«8 Oder, wie eine deutsche Bloggerin ihr neues »gute-Laune-Programm-für-jeden-Tag« beschreibt: »Sobald ich mit negativen Nachrichten oder Gesprächen in Berührung komme, atme ich (…) mit der Absicht ›Freude und Liebe geben und empfangen‹ tief ein und aus. Damit gehe ich nicht mit der schlechten Laune anderer oder mit den schlechten Nachrichten in Resonanz.«9
Womit wir bei mir wären. Schließlich will ich nicht so tun, als hätte ich selbst das Gute-Laune-Gebot nicht auch verinnerlicht. Habe ich, auf meine eigene Art. Ich jammere nicht – ich sehe die Dinge positiv. Ich beklage mich nicht über andere – ich lerne. Und wenn ich doch mal schlecht drauf bin, dann gehe ich in mich oder leiste Trauerarbeit; jedenfalls überwinde ich das negative Gefühl so schnell wie möglich.