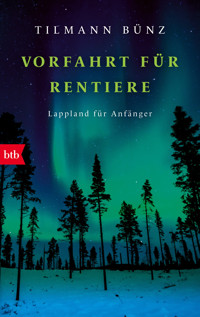5,99 €
Mehr erfahren.
Niederländer kommen ohne Vorhänge vor den Fenstern aus, sie radeln bei jedem Wetter und sind berüchtigt für ihr Gewächshausgemüse. Ihre Sprache klingt vertraut, wenn auch sehr heiser. Sie sind uns nah und doch so fern. Aber wie sind sie wirklich? Die Niederlande sind das einzige Land Europas, das seine Existenz einer reinen Willensanstrengung verdankt; die Niederländer haben ihr Land selbst erschaffen. Das hat die Menschen geprägt zwischen Nordsee und den großen Flüssen. Der ARD Reporter Tilmann Bünz geht den Vorurteilen auf den Grund. Er fragt, was von der sprichwörtlichen Toleranz übrig geblieben ist, und nimmt an einer Einbürgerungsfeier in einem Saal voller Kopftücher teil. Er testet Tomaten, begleitet Fahrraddiebe und segelt über das Eis des Ijsselmeeres. Er besucht alte Widerstandskämpferinnen und fragt nach, warum die Niederländer auf einmal Deutschland mögen. Seine Reise in den Niederlanden beginnt zwischen Millionen von Tulpen und endet in den Grachten von Amsterdam – immer auf dem Fahrrad, weil das die beste Art ist, Land und Leute zu erfahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Niederländer kommen ohne Vorhänge vor den Fenstern aus, sie radeln bei jedem Wetter und sind berüchtigt für ihr Gewächshausgemüse. Ihre Sprache klingt vertraut, wenn auch sehr heiser. Sie sind uns nah und doch so fern. Aber wie sind sie wirklich? Die Niederlande sind das einzige Land Europas, das seine Existenz einer reinen Willensanstrengung verdankt; die Niederländer haben ihr Land selbst erschaffen. Das hat die Menschen geprägt zwischen Nordsee und den großen Flüssen. Der ARD Reporter Tilmann Bünz geht den Vorurteilen auf den Grund. Er fragt, was von der sprichwörtlichen Toleranz übrig geblieben ist, und nimmt an einer Einbürgerungsfeier
in einem Saal voller Kopftücher teil. Er testet Tomaten, begleitet Fahrraddiebe und segelt über das Eis des IJsselmeeres. Er besucht alte Widerstandskämpferinnen und fragt nach, warum die Niederländer auf einmal Deutschland mögen. Seine Reise in den Niederlanden beginnt zwischen Millionen von Tulpen und endet in den Grachten von Amsterdam – immer auf dem Fahrrad, weil das die beste Art ist,
Land und Leute zu erfahren.»Es tut immer gut, ab und zu einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, auch uns Niederländern.«
Monique van Daalen, Botschafterin der Niederlande, Berlin
Zum Autor
TILMANN BÜNZ reist seit zwanzig Jahren als Reporter für die ARD durch die Welt. Er liebt den Norden und die Niederlande. Seine Stationen: Friedensdienst in Amsterdam, Evangelische Akademie Tutzing, Redakteur bei Tagesschau und Tagesthemen, Nordeuropa-Korrespondent der ARD, Auslandseinsätze in Tokyo, Bangkok, Washington, London. Autor von zwei Dutzend Fernseh-Features u. a. »Die Niederlande. Unbekannte Nachbarn«.Tilmann Bünz ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
TILMANN BÜNZ BEI BTB
Wer die Kälte liebt. Skandinavien für Anfänger
Wer das Weite sucht. Skandinavien für Fortgeschrittene
Tilmann Bünz
Fünf Meter unter dem Meer
Niederlande für Anfänger
Mitarbeit: Isabel Wirtz
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. AuflageOriginalausgabe August 2016,Copyright © 2016 by btb Verlagin der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: semper smile, MünchenUmschlagmotiv: © Atlantide Phototravel/CorbisSatz: Uhl + Massopust, AalenUB · Herstellung: scISBN 978-3-641-18337-0V001
www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlagBesuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de!
In memoriam Dik Linthout
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel – Niederlande – eine kleine Liebeserklärung
Zweites Kapitel – Vorurteile und Fettnäpfchen
Drittes Kapitel – Der Geschmack der Freiheit
Viertes Kapitel – Aufbruch ins Wunderland
Fünftes Kapitel – Mühe mit dem großen Nachbarn
Sechstes Kapitel – Neue Niederlande
Siebtes Kapitel – Schwarzer Peter
Achtes Kapitel – Freiräume
Neuntes Kapitel – Winter in den Niederlanden
Dank
Literatur zum Weiterlesen
Erstes Kapitel Niederlande – eine kleine Liebeserklärung
Erklärt, warum die Niederlande kein Naturschutzgebiet sind.
Warum Krisenstimmung nicht zum Repertoire gehört.
Und warum man in Amsterdam drei Fahrräder braucht.
Wie man aus Regen Geld machen kann.
Und weshalb holländische Tomaten wieder schmecken.
Wo der Himmel weiter ist als das Land und Segelboote durch die Wiesen fahren. Wo das Wasser zuerst kam, dann die Gräben und danach erst die Wege.
Seltsam vertraut wirkt dieses Land der Mühlen, Brücken, Wasserläufe, Schleusen, Deiche, der Zugbrücken, Backsteingiebel, Reiher und Trauerweiden. Wer die alten Meister gesehen hat, kennt es schon, bevor er einen Fuß auf den Boden gesetzt hat. Und überall kann man hineinschauen, quer durch die Wohnstuben, durch Grünpflanzen und Familienleben hindurch.
Aus der Luft sieht man, wie die Niederlande mit dem Wasser ringen. Nichtstun hieße hier: untergehen. Sie bauen aus Not und aus Lust. Neue Polder, schwimmende Gewächshäuser und Moscheen für den Export. Die Mühlen dort unten drehen sich nicht zum Vergnügen. Mit jeder Umdrehung pumpen sie das Wasser aus dem Land. Wenn der Wasserspiegel sinkt, trocknet der Untergrund aus, zerbröseln die Fundamente. Wenn er steigt, gibt es nasse Füße.
Wir haben kräftigen Gegenwind. Es ist Ende April. Der Pilot hat die rechte Tür ausgehängt, der Kameramann hängt am Gurt halb aus der Maschine. Von Hilversum sind wir siebzig Kilometer immer weiter nach Norden geflogen, unter uns grüne Wiesen, graue Straßen, rote Ziegeldächer, ein paar Kühe, links das Meer und Strandhafer, Grachten und Polder. Dann am Horizont schreiend bunte Streifen, Rottöne, die sich beißen, kilometerlang, kein Farbtherapeut und kein Modeberater hätte solche Kombinationen gewagt. Wir sind im Reich der Tulpen.
Unter uns stehen zwei Frauen im Tulpenfeld, feiern den Frühling, die Farbenpracht.
Nichts ist Natur, alles ist gemacht.
Leben unter dem Meeresspiegel
Um die Niederlande zu verstehen, muss man raus aus Amsterdam, zwanzig Kilometer nördlich in die Eilandspolder zu den ersten Grachten des Landes, die im 13. und 14. Jahrhundert mit der Hand gegraben wurden. Auf dem Weg links neben der Landstraße wiegen sich Weinranken im Westwind, mitten im Schwemmland, dem Meer abgerungen, wenngleich man vermuten sollte, dass auf Sand und salzigen Wiesen bestenfalls Schilf wächst.
»Wenn man hier geboren ist und Angst vor Wasser hat, sollte man besser wegziehen. Dann kann man hier nicht leben.«
Tineke Hoogenboom sitzt am Steuer des Motorbötchens und streicht ihrem Sohn Noe über den Kopf. Es ist morgens um neun. Mutter und Sohn machen einen kleinen Ausflug im Flüsterboot.
Die Niederländer lieben es, kleine Dinge noch ein bisschen kleiner klingen zu lassen, und sie schätzen es, wenn die Dinge so heißen, wie sie klingen. Der Kahn heißt »bootje«, und weil er einen Elektromotor hat, ist er das »Fluisterbootje«. Eine Sprache wie aus einem Kinderparadies. Tatsächlich darf Noe ans Steuer. Noe ist erst vier. Er lernt steuern, auf dem Kanal hinterm Haus, der schon bestand, als es noch keine passierbaren Straßen gab.
Tineke ist die Nichte meines Freundes Rob. Sie hat mit Roland, ihrem ersten Mann, die Welt umsegelt und zwischendurch zwei Kinder auf die Welt gebracht, sie ist groß und schlank, mit schulterlangem blondem Haar. Im Gartenhaus hat sie ihr graphisches Atelier aufgebaut. Das Haus grenzt an den Kanal, vom dem aus man theoretisch jeden anderen Punkt der Niederlande auf dem Wasserweg erreichen könnte. Das schafft ein Gefühl von Freiheit. Wem es an Land zu eng wird, der kann jederzeit das Weite suchen.
Oma Marianne und Opa Joop sind an diesem Tag zu Besuch im Haus am Wasser. Vom Kanal aus sieht man sie am großen Esstisch sitzen – und dahinter die gepflasterte Dorfstraße und einen kleinen Deich. Das Haus von Tineke ist jünger als die Polder. Es stammt aus dem 18. Jahrhundert.
Der kleine Finn ist gerade aufgewacht und kommt langsam die Treppe aus dem Obergeschoss heruntergerutscht. Sonntags sitzen die drei Generationen gerne etwas länger zusammen.
Joop und Marianne lieben ihr Land und betonen dem Gast aus Deutschland gegenüber gern die kleinen Unterschiede zum großen Nachbarn.
Sind die Niederländer denn so anders als wir?
Marianne überlegt nicht lange: »Was ist typisch niederländisch? Na ja Schokostreusel, Spekulatius, Erdnussbutter, Lakritze, und dass wir immer Fahrrad fahren. Ein fahrradfahrendes Volk. Die ganz Kleinen fahren bei uns schon Rad und – das ist wohl der größte Unterschied – alle fahren ohne Helm.«
Joop, ihr Mann, ergänzt: »Wenn du hier einen mit Helm siehst, ohne dass du auch nur ein Wort von ihm gehört hast, kannst du sicher sein, das ist kein Niederländer, das ist einer von euch.« Helme gehören nicht zur Grundausstattung in den Niederlanden. Bloß nicht zu viele Umstände, nicht zu viel Getue, wo man doch schon einige Meter unter dem Meeresspiegel lebt.
Niederländer sind auf der Hut – aber nur vor den wirklichen Gefahren.
Als alle Kekse aufgegessen sind und der Kaffee getrunken, wird Noe zappelig. Tineke lässt ihren Kleinsten bei den Großeltern, und wir fahren noch eine Runde Boot, Richtung Windmühlen. Noe darf wieder ans Steuer.
Allen, auch Tineke, ist klar, dass ihr tief gelegenes Land als erstes versinken wird, wenn der Meeresspiegel steigt, weil Grönlands Eispanzer schmilzt.
Wie wird es hier wohl aussehen, wenn ihr Sohn Noe ein Mann ist? Werden sie dann auch noch hier wohnen, oder gehen die Niederlande in weiten Teilen zurück an die Fische? Wird Amersfoort, das heute siebzig Kilometer von der Küste entfernt im Inland liegt, dann »Amersfoort aan Zee« heißen?
Doch Tineke hat jenen Optimismus, der vor mir schon anderen ausländischen Besuchern als typisch niederländisch aufgefallen ist. Als die ZEIT vor einigen Jahren ihre Reporter für ein Dossier zum Klimawandel in die Welt hinausschickte, kam nur einer hoffnungsfroh zurück.
Tineke lacht. »Ach ja, natürlich müssen wir unsere Deiche anpassen und mehr Platz für die Flüsse schaffen, wenn sie viel Wasser führen.« Und dann sagt sie noch einmal, als wäre es das Natürlichste von der Welt: »Angst? Nee!«
Die ganze Gegend war früher Morast, alle Häuser stehen auf Pfählen. Wir gleiten geräuschlos mit dem Boot vorüber, unter den Brücken müssen wir die Köpfe einziehen, ein Reiher schaut uns vom Ufer aus zu. Mühlen ächzen leise im Wind.
Tineke zeigt auf ein Exemplar, das in Deutschland die große Zierde jedes Heimatmuseums wäre, eine wunderschöne Mühle mit hölzernen Flügeln, zwanzig Meter hoch. Sie ist ein paar hundert Jahre alt – und immer noch im Dienst.
»Warum sollten wir etwas Schönes abreißen, was noch dazu gut funktioniert?«
Das ist sehr niederländisch: Was schön ist, muss auch praktisch sein, und wenn es beides ist, kann es hier sehr alt werden.
So wie die Hoogenbooms leben Millionen Niederländer – tief unterm Meer und doch gelassen.
Amstel rückwärts
Niederländern ist es Ende August 2003 – in einer Periode großer Dürre – sogar gelungen, die Amstel in ihrem Lauf umzudrehen. Normalerweise fließt sie von Süd nach Nord.
Es war so lange kein Regen gefallen, dass die Wasserstände in der Provinz Südholland zu niedrig wurden. Süßwasser war knapp, also ließ man in der Not Salzwasser aus der Nordsee einströmen. Das stabilisierte zwar die Deiche, bekam aber den Pflanzen schlecht.
Für Krisen dieser Art ist das »Waterbeheer« zuständig, eine Art kollektives Organ für die wirklich wichtigen Dinge in einem Land fünf Meter unter dem Meer. Dort kam man auf die Idee, das nördlich gelegene IJsselmeer mit seinen enormen Süßwasservorräten anzuzapfen. Die Amsterdamer Pumpstation Zeeburg schickt ohnehin fünfzehn Kubikmeter Süßwasser pro Sekunde durch die Grachten. Um zu verhindern, dass das Wasser über die Grachten zurück ins IJsselmeer flösse, mussten in Amsterdam acht Schleusen geschlossen werden. Druck war genug da. Die Männer vom »Waterbeheer« hatten ausgerechnet, dass das IJsselmeer den Lauf der Amstel für dreißig bis vierzig Tage umdrehen könnte. Und so geschah es: Ein paar Hebel wurden umgestellt, riesige Schleusentore kamen in Bewegung – und die Amstel strömte zum ersten Mal in ihrer Geschichte verkehrt herum. Jeder konnte es sehen. Man musste nur einen Zweig ins Amstelwasser werfen und siehe da – er trieb auf einmal stromaufwärts.
Die Pflanzen in Südholland lebten auf. Als dann ein langer heißer, extrem trockener Sommer mit ein paar kräftigen Gewitter zu Ende ging, wurde die Amstel wieder umgedreht.
Die Niederlande sind zwischen zwei Wassermassen eingezwängt, der Nordsee und den großen Flüssen, von hinten und von vorne. Harry Mulisch hat einmal gesagt, sie lebten zwischen den Deutschen und dem Meer, und eines von beidem würde einmal über sie kommen.
Mag der Meeresspiegel auch steigen, es wird gebaut und gepflanzt, auf Böden, die eigentlich nicht zur Besiedlung vorgesehen waren. Ganz so, als ob die Niederlande nicht Klima-Risikozone Nummer eins in Europa wären. Wenn man sich Amsterdam-Schiphol mit dem Flugzeug nähert, fliegt man die letzten fünfzehn Minuten über Neubaugebiete.
Die Niederlande sind das einzige Land Europas, das seine Existenz einer reinen Willensanstrengung verdankt. Die Niederländer haben ihr Territorium großenteils selbst erschaffen. Das hat die Menschen geprägt in diesem Land zwischen Nordsee und den großen Flüssen: Sie sind nüchtern, freiheitsliebend und zupackend, wann immer ein Deich zu brechen droht. Zur Not baut man eben schwimmende Wohnstätten.
Im Büro eines Amsterdamer Stadtrates sah ich 1982 eine Karikatur, die den damals üblichen Postkolonialismus auf die Schippe nahm.
»Amerika zurück an die Indianer!«, hieß es da in großen Lettern, und: »Australien zurück an die Aborigines.« Darunter hatte jemand mit Filzstift geschrieben: »Niederlande zurück an die Fische.«
Unterwegs mit den Fahrradknackern
Jeder Amsterdamer hat drei Fahrräder.
Aber er weiß nicht, wo sie sind.
(Sprichwort aus Amsterdam)
Es ist morgens um zehn. Wir sind in Amsterdam-West, einem alten Arbeiterviertel voller vierstöckiger Wohnhäuser aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Oben auf einem Balkon im ersten Stock steht ein Mann im Bademantel. Die Haare stehen ihm zu Berge, sein Kopf ist rot. Offenbar ist er gerade aus dem Bett gefallen. Das Geräusch einer Flex hat ihn geweckt. Die Flex ist ein Winkelschleifer, den ein unauffällig gekleideter Mann mittleren Alters gerade an einem Kettenschloss ansetzt. Zwei Helfer stehen ihm zur Seite neben einem Lastwagen, auf dessen Ladefläche schon drei Räder liegen. Es ist eine ruhige Anliegerstraße, verkehrsarm, roter Klinker. Doch die Flex sägt sich durch die Morgenruhe.
Das sei Spezialwerkzeug, hatten uns die Fahrradknacker weismachen wollen. Nicht frei erhältlich. Doch der Mann mit der Schweißerbrille hantiert mit einem handelsüblichen Modell, um uns zu demonstrieren, dass man in acht Sekunden selbst ein dickes Kettenschloss knacken kann.
Mark Visser, so sein richtiger Name, gehört einer Bande von Fahrradknackern an, zu deren Verteidigung man zweierlei sagen muss: Ohne die Fahrradknacker würde Amsterdam ersticken an alten Rädern. Kein Fahrradständer wäre noch zu gebrauchen. Außerdem ist Mark mit seinen Kollegen im Auftrag der Gemeinde unterwegs. Ihr Tagessoll sind einhundert Räder.
Die Fahrradknacker können aber nicht nach Belieben Räder auf ihren Anhänger wuchten. Erst müssen sie eine schriftliche Verwarnung hinterlassen – einen Zettel, den sie am Fahrrad anbringen –, wenn ein Rad offenbar eine Zeitlang nicht bewegt wurde. Nach drei Wochen Wartezeit dürfen sie dann zugreifen.
Der dicke Mann aus dem ersten Stock brüllt: »Aufhören! Das könnt ihr doch nicht machen!« Kurz darauf erscheint er in der Haustür, er trägt nur einen Bademantel, der über seinem Bauch etwas spannt. Darunter hat er offensichtlich nichts an. Mit großen Schritten läuft er über die Straße zur Ladefläche des Lasters und greift sich ein Fahrrad.
»Aber wir haben dich doch gewarnt«, sagt Mark.
Der dicke Mann mit dem roten Gesicht knurrt: »Das könnt ihr nicht machen. Fahrräder klauen. Die gehören euch nicht.«
Er hebt sein Fahrrad über die Schulter, wie andere einen Umhang über die Schulter schwingen – und weg ist er. Davor schimpft er noch: »Ich war höchstens zwei Wochen lang weg!«
Zwei ältere Damen schauen von der anderen Straßenseite aus zu. Ihrem singenden Akzent nach zu urteilen, stammen sie aus der ehemaligen Kolonie Surinam (ein Land in Südamerika, das die Niederländer 1667 in einem Tauschgeschäft von den Briten erhielten; die Briten bekamen dafür die Insel Manhattan). Ihren Schwatz haben die Damen unterbrochen, um das kleine Drama, das sich in ihrer Nähe abspielt, zu beobachten. Sie sind Augenzeugen.
Ich gehe zu ihnen hinüber und frage sie, ob das Ganze ihrem Gefühl nach mit rechten Dingen zuging. Die entscheidende Frage lautet: Wie lange standen die Fahrräder bereits dort?
Die beiden entpuppen sich als Cousinen und lassen sich gerne auf einen kleinen Plausch mit mir ein.
»Sehr, sehr lange«, sagt die eine. »Das mit den zwei Wochen hat er nur so gesagt. Das Rad stand da viel länger.«
Da schaltet sich die andere Cousine ein. »Eigentlich sind die Fahrradständer ja genau dafür da, dass darin Fahrräder parken. Die Räder einfach loszuschneiden, das geht nicht. Da müssten sie die Fahrradständer auch gleich mitnehmen oder ganz klare Regeln schaffen.«
Und schon sind sie mitten drin in der schönsten Diskussion.
Ich wusste doch, dass sich, fragt man zwei echte Amsterdamer, und seien es Cousinen, schnell zwei unterschiedliche Meinungen entwickeln, manchmal sogar drei. Amsterdamer gelten als schlagfertig und gewitzt. Nichts ist schöner, als sich zu streiten.
Es ist allerdings auch kein Zufall, dass es in den Niederlanden ausgerechnet über Fahrräder zum Streit kommt. Das Fahrrad ist die Klammer der Nation, ist Lieferwagen und Kindertransporter. Es gibt mindestens so viele Fahrräder im Land wie Bewohner.
Mit Fahrradfahrern legt man sich besser nicht an. So verzögerte sich etwa der Umbau des weltbekannten Rijksmuseums um mehrere Jahre, weil die große Radfahrergemeinde darauf bestand, ihre angestammte Durchfahrt mitten durch das prachtvolle Gebäude hindurch zu behalten, während die Museumsleitung meinte, darauf verzichten zu können.
Das Rad gehört eben zur Grundausstattung. Wer in den Niederlanden einen offiziellen Besuch abstatten will, kommt am besten mit dem »fiets« vorgefahren. Auch die Königskinder fahren mit dem Rad zur Schule, und einige Minister radeln zur Arbeit. Das Fahrrad ist der kleinste gemeinsame Nenner. Es kennt kein schlechtes Wetter: Am Bahnhof von Amsterdam parken auch im Winter 20 000 Fahrräder.
Es gibt nur ein einziges anders Land in Europa mit so vielen Fahrrädern, und das ist Dänemark. Kurt Tucholsky schrieb 1932 von einer Reise in die Hauptstadt Kopenhagen: »Wenn die Kinder anderswo zur Welt kommen, schreien sie – in Kopenhagen klingeln sie auf einer Fahrradklingel. So viele Fahrräder gibt es da.«
Die Nähe der Niederländer zum Zweirad ist noch inniger. Sie scheinen wirklich von Geburt an mit dem Fahrrad verwachsen, so elegant ist ihr Umgang damit. Schön anzuschauen, schwierig mitzuhalten, zumal in Amsterdam, wo Fahrradfahrer eingebaute Vorfahrt haben und ein sehr hohes Durchschnittstempo halten. Rote Ampeln, Passanten und Autos stören da nur.
Es gibt eine richtige Rushhour vom Dam Richtung Amsterdam-West. Man fährt zweispurig, jeder Dritte hat das Handy am Ohr, und die Abstände zwischen den Fahrradgriffen sind knapp eine Handbreit. Diese traumwandlerische Art, durch die Straßen zu gondeln, muss man von klein auf erlernen. Deutsche Touristen tun sich da schwer. Wouter Meijer, ein niederländischer Journalist mit viel Berlin-Erfahrung, sagte einst knapp: »Deutsche können einfach nicht Fahrrad fahren.«
Das ist natürlich Quatsch – und wenn es doch stimmen sollte, reiner Darwinismus.
Glücksgefühle
Es ist Mittag. Die festangestellten Fahrradknacker haben ihre Runde gemacht und ihr Soll erfüllt. Nun geht es zum Depot, einem Areal am Hafen, wo hinter einem hohen Zaun zwölftausend Fahrräder lagern. Ein Teil davon wird von den Besitzern abgeholt, gegen Bußgeld versteht sich. Was stehen bleibt, geht in den Gebrauchthandel, einige werden nach Afrika verschifft, der Rest landet auf dem Schrottplatz.
Im Depot werden die Räder drei Monate aufbewahrt. Wer glaubt, Niederländer seien immer lässig und Bürokratie für sie ein Fremdwort, der kennt den Sachbearbeiter Georg nicht. Er ist ein Musterbeispiel an Gewissenhaftigkeit, wie er da an seinem Schreibtisch mitten in der Halle thront und die Ausbeute mustert.
Mark Visser führt ihm ein Rad nach dem anderen vor. Als Erstes muss er die Fahrgestellnummer unten am Rahmen finden. Viel mehr ist oft auch nicht über die Räder zu sagen. Ein Licht ist bereits Luxus, eine Handbremse sowieso. (Früher galt die Faustregel: Ein Fahrrad mit Licht ist eine Polizeistreife auf zwei Rädern; jedenfalls in Amsterdam.)
Draußen stehen derweil, Regen und Sonne ausgesetzt, die restlichen Fundstücke und warten auf ihre ehemaligen Besitzer. Die Besitzer wiederum laufen die Reihen ab und lassen sehnsuchtsvoll die Blicke schweifen. Es braucht Zeit, um im Depot unter zwölftausend Rädern das stählerne Eigentum zu finden.
Genial und einfach ist hingegen die Auslöse geregelt: Die Räder werden mit ihrem geknackten Schloss ausgestellt, die Ketten hängen über dem Lenker. Wie könnte sich ein Besitzer besser legitimieren, als mit dem passenden Schlüssel?
»Wenn es dann klick macht, ist das schon ein kurzer Glücksmoment für viele«, sagt Mark schmunzelnd. »Unser Job ist manchmal nicht leicht, weil viele nicht einsehen, dass ihre Räder stören. Zum Ausgleich arbeiten wir dann auch mal hier im Binnendienst. Dann kriegen wir mit, wenn Halter und Fahrrad wieder vereint sind.«
So ein Glück wird normalen Fahrraddieben nicht gewährt.
Geborene Verkäufer
Gute Fahrräder verschwinden schnell. Niederländer schleppen ihr Lieblingsfahrrad deshalb oft mit in die Wohnung, während das Zweitrad unten im Fahrradständer rostet und das Drittrad am Bahnhof steht.
Es gibt aber auch den Typus des »Ein-Fahrrad-Besitzers«. Zu denen gehört mein Freund Rob. Sein wunderschönes nagelneues Modell mit zehn Gängen und Naben-Dynamo war am helllichten Tage vor der Universität geklaut worden. Holland in Not! Denn wenn Rob auslüften will, schwingt er sich aufs Rad und fährt fünfzig, sechzig Kilometer, etwa zu Tineke in die Eilandspolder. Ein neues Fahrrad musste her. Aber diesmal vielleicht ein preiswertes Modell. Doch der Händler erkundigte sich eingehend nach dem verschwundenen und stellte dann lapidar fest: Wer gerade ein solch schönes Fahrrad verloren habe, sollte sich nicht zum zweiten Mal an einem einzigen Tag frustrieren. Er sollte sich für den Verlust entschädigen, sprich: ein richtig gutes Fahrrad kaufen!
Und so geschah es.
Diese Methode des Verkaufens nennt man »Framing«. Sie stammt aus der Denkwelt des NLP (Neurolinguistisches Programmieren) und somit von der Westküste der USA. Vereinfacht gesagt liefert man zu einem Verkauf auch noch eine gute Geschichte dazu und präpariert den Kunden somit gegen mögliche Selbstzweifel und Neider.
Niederländische Fahrradhändler beherrschen derartige Psychotechniken von Haus aus. Sie müssen dafür gar nicht erst nach Kalifornien reisen.
Was man aus Wasser alles machen kann
Es gibt eine Gegend in der Provinz Südholland, da wird jeder Meter Boden genutzt. Von weitem sieht Westland aus, als wäre die Region komplett überdacht. Dicht an dicht stehen ein paar tausend Gewächshäuser, acht Meter hoch, fünfhundert Meter lang.
Wer in Westland freie Flächen sucht, Bäume oder gar Wiesen, wird sie nicht finden. Hier hat der Mensch die Natur unterworfen und komplett unter Glas verfrachtet – und dabei zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Den Niederländern ist es hier gelungen, die reichlich fallenden Niederschläge, die ansonsten Überschwemmungen verursachen würden, ohne weitere Umwege gleich in Gemüse zu verwandeln. Sie tun das mit großem Erfolg und auf kleinstem Raum.
Es gab eine Zeit, da haben sie das übertrieben. In den Achtzigerjahren waren Ganzjahrestomaten aus Holland kein Renner mehr in deutschen Supermärkten. Die Verbraucher meuterten und sprachen verächtlich von »Wasserbomben«. Das konnte der größte Gemüseproduzent Europas nicht auf sich sitzen lassen.
Bald begann in den Gewächshäusern eine kleine Revolution, und damit die nicht ins Stocken gerät, gibt es Inspektoren wie Pauline.