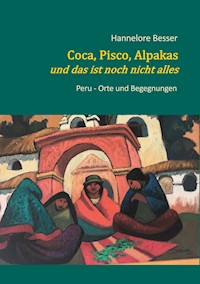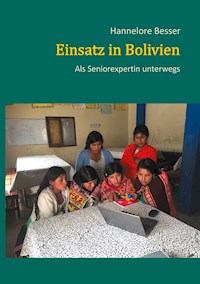Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Pubertierende sind wild und wirr. Sie sind kreativ und provokativ. Sie sind unsicher und verträumt. Sie ahnen alles und sehen nichts. Mit einem Satz: Sie fordern uns heraus. Diesen Herausforderungen hat Hannelore Besser sich fünfzig Jahre lang immer wieder gestellt. Wie sie mit dem Verhalten der Jugendlichen umgegangen ist - vom Erfolg und vom Scheitern erzählt sie ungeschminkt. Anhand ihres eigenen Weges begleitet sie die Youngsters gelassen bei ihrem Flug durch die wirbelnden Hormone. Viele schwierige Situationen hat sie gemeistert, manch dramatisches Ereignis hatte ein Happy End. Gleichheit und Veränderung in diesen fünfzig Jahren würzt werden mit Kommentaren und Reflexionen über den Lauf der gesellschaftlichen Bedingungen für ihre eigene Karriere und die der Heranwachsenden gewürzt. Zum Schluss tröstet sie: Die meisten Kids werden irgendwann sowieso erwachsen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dank
Für Ermutigungen, Geduld, Lektorat, kritische Diskussion und Layout danke ich Ruth Lisa Knapp, Peter Wurzer, Julia Sohnrey, Gisela Lemke und Daniel Besser.
Inhalt
Prolog
Letzter Beifall
Als ich dreizehn war
Die erste Jugendgruppe
Deutsch-schwedischer Jugendaustausch
Das zweite Jahr - Wir bauen eine Mauer
Das dritte Jahr: Schwedischer Sommer
Weiterbildung in Jugendarbeit
Arbeit in der Obdachlosensiedlung
Junge Männer ohne Schulabschluss
Jetzt wird studiert!
Meine erste Lehrerstelle in Schwarzenbek
Die Berliner Kids ticken anders
Problem: Sexueller Missbrauch?
Umgang mit Sucht – zum Beispiel Drogen
Zum Beispiel Magersucht
Herausforderung Klassenfahrten
Auf Rädern unterwegs
Internationale Jugendkurse
Meine Erziehungsgrundsätze
Prolog
Fünfzig Jahre Erfahrungen mit Jugendlichen in der Zeit der wirbelnden Hormone waren abgeschlossen. Auf einer Party erzählte ich zur Erheiterung der Umstehenden launig aus meinen „Geschichten aus fünfzig Jahren“. Interessiert lauschte auch Heike, die Freundin meiner Tochter, sie hatte zwei Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren: „Kannst du diese Geschichten nicht einmal aufschreiben, damit wir ungefähr wissen, was da auf uns zukommt?“, bat sie mich. Liebe Heike, für dich und manch andere Eltern und sonstige Interessierte habe ich die Anekdoten zusammengetragen.
Letzter Beifall
Ich pubertiere seit fünfzig Jahren, nun ist Schluss! Genau genommen sind es sechzig Jahre, wenn ich die eigene Zeit dazurechne − und das muss ich wohl −, denn ohne diese zehn vorausgehenden hätte ich nicht durch fünfzig Jahre so viele Pubertierende begleiten können. Nun kann ich endlich erwachsen werden oder, mit jetzt fünfundsiebzig Jahren, von der einen Grenzaustestung zur nächsten wechseln: In Zukunft werde ich mich mit dem Methusalem-Syndrom beschäftigen oder mich auf der Geriatrischen tummeln.
Am Ende des letzten von mir betreuten Jugendkurses bekam ich viel Lob. Die zwei hochgewachsenen Jungen aus dem Kosovo standen klatschend auf, alle anderen Jugendlichen folgten, das Team schloss sich an und so stand ich gefühlte Stunden in der Mitte der Kapelle des Kolpinghauses in Duderstadt, in der die Abschlusszeremonie des Kurses stattfand, stand etwas verloren und beschämt in der Mitte dieser „Standing Ovations“ und dachte: „Nun ist gut! Mehr Höhepunkt wird es nicht geben.“ Am liebsten wäre ich verschwunden wie der Hobbit, einfach weg, ließ aber weiter dieses Lob wie eine warme Dusche über mich ergehen, fühlte mich ausgebrannt und glücklich zugleich − glücklich vor allem, weil ich gerade eben verkündet hatte: „Dies war mein letzter Jugendkurs. Vor fünfzig Jahren habe ich den ersten deutschschwedischen Jugendaustausch geleitet, fünfzig Jahre mit immer wieder wunderbaren jungen Menschen, vielen Dank für diese letzten drei Wochen mit euch.“ Nach jedem der Kurse in den letzten fünf Jahren hatte ich gemeint, dies sei der letzte gewesen, geäußert stets im kleinen Kreis der Unbeteiligten; jetzt und hier hatte ich es öffentlich gesagt und tief innen verspürte ich ein großes Glück und gleichzeitig ein Gefühl des Versagens, denn war dies eigentlich mein Weg gewesen? Was hatte ich mir zu beweisen versucht, indem ich mich immer wieder mit jungen Leuten abgab, immer wieder Aufgaben mit pubertierenden Jugendlichen übernahm? Da standen sie nun um mich herum: Neunundfünfzig Jungen und Mädchen aus nahen und fernen Ländern, aus Taiwan, aus Brasilien, aus Weißrussland und woher noch alles, dazu die Mitglieder des Teams, der Hausherr des Kolpinghauses, alle klatschend, in ihren Augen Erstaunen und Bewunderung, und endlich sah ich auf Angelika, die Betreuerin, sah in ihren Augen den Neid und das Unverständnis, sie hatte mich in den letzten Tagen oft kritisch betrachtet. Ich spürte deutlich, dass ich alt geworden war, zu alt für diese Tätigkeit.
Und so sollte hier Schluss sein. Ich hatte sie hinter mich gebracht, diese Aufgabe, die immer wieder mir angetragene Aufgabe, diesen Halbwüchsigen, die keine Kinder mehr waren und doch noch nicht für sich selbst stehen konnten, einen Weg zu weisen zwischen Skylla und Charybdis, zwischen Tag und Nacht, zwischen dem Ausprobieren und dem Abgleiten, zwischen Grenzerfahrung und Einsicht in die Notwendigkeit, zwischen Anpassung an die Gesellschaft, wie sie ist, und Widerstand gegen die Welt, wie sie ist, zwischen Revolution und Etablierung − kurz, mit ihnen und jedem Einzelnen von ihnen einen Weg zu suchen für sich selbst und zu sich selbst. Dabei war ich oft gescheitert, wieso auch nicht, sie lebten ja in so ungleichen Umfeldern, kamen aus verschiedenartigen Familien, aus sehr unterschiedlichen Sozialisationen, oft mit einer dramatischen Kindheitserfahrung. Ich kannte den „richtigen“ Weg nicht, es gab ja auch nicht nur einen „richtigen“ Weg, jede und jeder musste den eigenen finden und gehen, ich konnte sie nur begleiten und während dieser Begleitung brachte ich ihnen Geduld und Verständnis entgegen; ich konnte ihnen Pfade zeigen, die sie vielleicht noch nicht gesehen hatten, konnte an Kreuzungen beraten, vor Abgründen warnen, konnte bestärken und Mut machen. Ab und zu hörte ich später, dass ein Weg gelungen war. Ich hoffe, die vielen, von denen ich nie wieder hörte, haben ebenfalls ihren Weg gefunden.
Waren denn die Jugendlichen in diesen fünfzig Jahren gleich, gab es keine Veränderungen? Oh doch, die gab es hinsichtlich der Sozialisation und der Herkunft. Aber grundlegend war und ist die physische Veränderung und unabhängig von allem anderen die Suche nach Zuordnung und dem Platz in der Welt. Und diese Suche ist in gewissen Situationen ähnlich, selbst bei einem Mädchen, das im oberen Niltal geboren wurde und dessen Schicksal es eigentlich hätte sein sollen, mit zwölf Jahren verheiratet zu werden – wenn es diesem Mädchen gelungen war, auf eine Schule zu gehen, wenn man seine Begabungen förderte und es die Möglichkeit erhielt, mit anderen Jugendlichen aus anderen Ländern zusammenzukommen, dann zeigten sich dieselben Muster wie bei allen anderen: Übernahme der Geschlechterrolle, Akzeptanz der eigenen körperlichen Erscheinung, Beziehungen zu anderen Jugendlichen beiderlei Geschlechts aufbauen, emotionale Unabhängigkeit von den Eltern erreichen, Vorbereitung auf eine berufliche Karriere und Eintritt ins Erwerbsleben bis hin zu vollständiger ökonomischer Unabhängigkeit.
Es ist wie in Märchen und Mythen erzählt und im Volkslied besungen: „Hübsche Mädel wachsen immer wieder auf, lass doch der Jugend ihren Lauf“ − die Erde dreht sich und die Probleme liegen mal so und mal so, die Jugend hat aber immer und zu jeder Zeit und bei allen kulturellen Unterschieden etwas Gleichartiges. In den vergangenen fünfzig Jahren sehe ich mich immer wieder dieselben Dummheiten begleiten, denselben ersten Herz-Schmerz trösten, Kids ins Krankenhaus fahren und mit den Ärzten über die Behandlung reden. Sehe die Verwandlung eines Jungen aus etwas Froschähnlichem in einen, nein, keinen Prinzen, aber doch in einen ernst zu nehmenden Gesprächspartner, der nicht unablässig albern kichert; sehe junge Mädchen, die gerade noch mit den Puppen gespielt haben, endlos vor dem Spiegel stehen, um aus sich, nein, keine Prinzessin, aber doch eine begehrenswerte junge Dame zu machen.
Und nun stand ich hier inmitten des letzten Beifalls und dachte: „Wie ist das eigentlich so gekommen?“ Es hat sicher viel mit Zufall zu tun, aber auch mit den eigenen – überwundenen – Schwierigkeiten meiner eigenen Jugendzeit. Ich war eine aufsässige Pubertierende und stelle auch heute noch gern Gesellschaft, Moral, Gesetze und Normen infrage.
Die Zeit zwischen dem dreizehnten und dem siebzehnten Lebensjahr ist dabei am spannendsten. Es geschieht so etwas wie die soziale Geburt und ich betrachte mich gern als Geburtshelferin für Heranwachsende. Die Wissenschaft nennt diesen psychosozialen Prozess „Adoleszenz“ – aber was verbirgt sich praktisch hinter diesem Begriff?
Mit etwa zwölf Jahren widerspricht ein Kind wohl zum ersten Mal bewusst dem Vorbildelternteil, dem es bislang alles so brav aus dem Mund geklaubt hatte.
Als ich dreizehn war
Mein eigenes grenzgängerisches Verhalten begann genau mit dreizehn und dieser Geschichte:
Das Haus steht schmächtig und windschief an der Ausfallstraße nach Osten, es schmiegt sich zwischen die im Krieg stehen gebliebenen Jugendstilbauten der Königstraße, spielt sich in vielen Träumen als baufällige und immer wieder bewohnbare Ruine auf, wird renoviert, bleibt bedürftig. Rotkehlchen wohnt darin in der ersten Etage, wem der Rest des Hauses gehört, bleibt im Dunklen. Rotkehlchen ist der Freund meines Bruders, eher ein Arbeitskollege auf dem Bau und ein Zechbruder als ein wirklicher Freund. Er schaut mir in die Augen, nimmt mich nicht als Kind, sondern als Mädchen mit Brüsten, Hüften und Po wahr. Das ist aufregend und ein bisschen peinlich, aber auch eine Aufforderung, die Grenze auszutesten.
Immer wieder werde ich darüber streiten, wie geschmeichelt man mit dreizehn ist, wenn einem jemand auf eine erotische Art Aufmerksamkeit schenkt, auch wenn einem bewusst bleibt, dass es eigentlich zu früh ist für richtigen Sex. Der Mensch ist von Geburt an ein sexuelles Wesen, diese Seite seiner Natur ist aber das siebte Zimmer, das auf keinen Fall vorzeitig geöffnet werden darf, der Schlüssel dazu muss der Mutter unter dem Kopfkissen weggeklaut werden.
Rotkehlchen heißt mit Vornamen Helmut und ich schleiche mich zu ihm, als ich eigentlich in die Englischstunde der Volkshochschule gehen soll, weil meine Noten in diesem Fach abgefallen sind. Ich willige ein, mich mit ihm aufs Bett zu legen. Das ist gemütlich und hat etwas Verbotenes, erregend ist es auch. Ich kenne meinen Körper nicht, kenne seine Lüste nicht, seine Scham, seine Begierde. Alles ist neu und muss erkundet werden. Die Warnungen der Mutter vor unerwünschter Schwangerschaft habe ich im Hinterkopf, kann die lästige Ermahnung aber leicht wegschieben, denn sie behauptete ja, man würde von einem Kuss schwanger. Ich bin aufgeklärt und weiß, wie Kinder gemacht werden, und das werde ich, da bin ich sicher, nicht zulassen. Helmut streichelt meine Hände, das ist angenehm, meinen Hals bedeckt er mit zärtlichen Küssen. Erst als er mir die Zunge zwischen die Zähne schieben will, finde ich das ein wenig zu aufdringlich und wehre ab. Er lässt sofort ab, streichelt dafür weiter meinen Hals, geht über zu den Schultern, berührt meine Brüste, mein Körper empfindet das als äußerst angenehm und meine Brustwarzen drängen sich Helmut entgegen, während die Alarmglocke im Kopf lauter schrillt. Zum Glück läutet jetzt eine reale Glocke, meine Mutter steht vor der Tür. „Komm sofort nach Hause! Und belüg mich nie wieder!“, ordnet sie an und macht mich damit sehr froh, ich hätte nämlich nicht mehr genau gewusst, wie ich aus dieser gefährlicher werdenden Situation heil herauskommen sollte.
Viele schräge Abenteuer an dieser Grenze sollten folgen. So zum Beispiel beim Trampen durch Frankreich. Der Lieferwagen hielt, ein freundlich-rundlicher Franzose lud mich ein, neben ihm Platz zu nehmen, der große Hund auf dem Rücksitz blickte misstrauisch. Aber ich war ohne Arg und erst beim Abbiegen von der Hauptstraße befiel mich ein Verdacht, der sich ein wenig später am Feldweg bestätigte. Der Mann hielt das Auto an, nahm eine Decke. „Steig aus und leg dich hin“, forderte mich der Mensch freundlich, aber bestimmt auf, der Hund knurrte böse. „Ich bin Jungfrau“, hörte ich meine piepsige Stimme. Er lachte: „Haha, dann pass auf, dass du keine alte Jungfer wirst!“ Ich verstand das Wortspiel, bat aber trotzdem auf lächerliche, schlecht geschauspielerte Weise, mich zur Straße zurückzubringen. Er lachte immer weiter, stieg in sein Auto und ließ mich einfach stehen, zum Glück reichte er mir noch meine Tasche aus dem Auto. Solche Szenen, schlitternd zwischen Angst und Neugier, gab es mehrere. Auch Nächte voller Lebenslust und viel Alkohol am Anfang sowie Verzweiflung am Schluss, alles wie in dem 2014 gedrehten Film „Liebe mich“ - laut, unangepasst, taktlos, ehrlich und provokant. Ich wirkte unverwundbar, doch einsam tropften die Tränen auf meine Tagebuchnotizen. So ist man/frau, wenn man zwischen dreizehn und siebzehn und mal himmelhochjauchzend und dann zu Tode betrübt ist, wenn man mal deprimiert ist und nichts hören und sehen will, sich dann wieder ins Partygetümmel wirft, nur um am nächsten Tag, romantisch gestimmt, einer Spinne beim Weben ihres Netzes zuzuschauen. Ach, wie viele Lieder verdanken wir diesem Tanz auf dem Seil, dem Flattern auf der Linie!
Diese Gefühlswelt aus Neugier und Lust blieb mir stets bewusst, die Not und die Ängste der Dreizehnjährigen kannte ich zudem aus Filmen und Geschichten, später untermauerten viele wissenschaftliche Werke mein Wissen über diese Zeit. Die (V)Erwachsenen sagen: „Das ist wie Grippe, das geht vorbei.“ Sicher, das geht vorüber. Schön ist es aber, wenn ein Mensch mit Verständnis ein bisschen mitleidet und mit Geduld bei der Einordnung von Pflicht und Lust hilft. Mir war immer bewusst, dass das Geschlechtliche DIE große Rolle für den Heranwachsenden spielt. Es sind die erotischen Gefühle und die Sehnsucht nach Liebe und Akzeptanz, die jede neue Generation anfällig für die Übergriffe und Verführungen Erwachsener macht, die eine Abweichung von der Spur bedeuten und ausgelebt werden sollten, damit man nicht sein ganzes späteres Leben pubertär verplempert. Scham- und Verdrängungserziehung in der frühen Kindheit führen zu einem verklemmten Erwachsenen-Ich. Wie spricht man mit jungen Menschen über Liebe und Sexualität? Den Obergärigen half ich mit einem Essensvergleich: „Fast jeder isst gern mal ein Würstchen oder einen Hamburger. Aber soll das die einzige Nahrung sein? Wir schätzen für ein Fest ein mehrgängiges Menü, bestehend aus Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise, vielleicht vorher ein Aperitif, zu den einzelnen Gängen den passenden Wein, hinterher Kaffee oder Tee und einen Digestif – so ein Festmahl macht noch mehr Spaß, wenn es an einem schön gedeckten Tisch mit gutem Geschirr und geputzten Bestecken, mit Servietten und allem Schnickschnack serviert wird.“ Und so ist es mit der Sexualität. Sie gehört zu uns, wir brauchen sie wie die Nahrung. Aber wir sollten dabei weder nur Fast Food akzeptieren, noch jeden Tag auf einem ausgefeilten Menü bestehen. Das gilt für Mädchen wie für Jungen, unabhängig von der sexuellen Ausrichtung. Und mit Liebe hat diese Sexualität noch sehr wenig zu tun. Die romantischen Gefühle, die dem Sex oft vorausgehen, hat die Natur für die Fortpflanzung erfunden. Liebe aber ist umfassender, die Liebe zum Leben ist die Basis unseres Seins. Liebe ist Bindung und Verantwortung, wir empfinden sie gegenüber Kindern und Eltern, Freunden und Freundinnen, dem Partner und der Partnerin – und immer auch gegenüber uns selbst. Diese bei mir sehr frühen Überlegungen prädestinierten mich als Gesprächspartnerin für Generationen von Jugendlichen.
Charakter ist Schicksal und ich fand meine Bestimmung als verständnisvolle Partnerin bei allen Nöten der Heranwachsenden, durchlebte immer aufs Neue das Suchen und die Ängste dieses Alters, dem ich nun, nach fünfzig Jahren, endlich entwachsen bin.
Mit einem Jugendaustausch mit deutschen und schwedischen Jugendlichen hatte ich 1965 angefangen, später machte ich Erfahrungen mit Sinti- und Roma-Kindern (damals sprach man noch von „Zigeunern“), baute die Kinder- und Jugendarbeit in einem Lager für sozial schwache Familie auf (einem „Obdachlosenasyl“, wie man es damals formulierte) und erwarb weitere Kompetenzen in der Kinder- und Jugendarbeit. Anschließend studierte ich, Klassenfahrten und Sportfreizeiten waren die nächsten Herausforderungen und nach der Pensionierung kam die Aufgabe als Leiterin von Jugendkursen. 2015 hörte ich auf.
Die erste Jugendgruppe
Alles fing 1965 in Geesthacht an, einem Zwanzigtausend-Seelen-Städtchen in der Nähe von Hamburg. Ich war aus Lübeck meinem Mann an seinen Arbeitsplatz gefolgt, ein Kleinkind dabei, das ich selbst großziehen wollte, schließlich musste ich nicht „mitarbeiten“. Von der eigenen Karriere der Frau war noch wenig die Rede, sie arbeitete, wenn überhaupt, für die bessere Couchgarnitur, für eine teurere Wohnung oder ein Haus, für eine luxuriöse Urlaubsreise, aber nicht um ihrer Eigenständigkeit willen. Ich kam aus festen freundschaftlichen Beziehungen, hatte mit meiner Mutter gelebt, die als Familienvorstand und Alleinerziehende von drei Kindern die komplette Elternschaft verkörpert hatte. Freunde hatten gelästert: „Wie willst du in einer Kleinstadt überleben?“ Dem begegnete ich mit dem Hinweis, es gebe dort bestimmt einen Arzt, einen Apotheker und einen Pastor, mit dem man Umgang pflegen könne. Und so kam es denn auch erst einmal, aber das reichte mir nicht.
Einsam und frustriert! So stand ich vor der Wickelkommode in der Neubauwohnung, putzte dem Sohn den Hintern, lächelte ein schräges Lächeln, spielte seufzend mit ihm in der Stunde zwischen Nachmittagsschlaf und Abendgebet, wartete auf den Mann − wartete oft lange, er ging eigenen Interessen nach, Freunde hatte ich keine. Das wichtigste Umzugsgut in die Kleinstadt an der Elbe war mein acht Monate alter Sohn. Hausrat und Möbel waren überschaubar, nicht einmal ein Kubikmeter: Ein gebraucht gekauftes, sehr biederes Schlafzimmer, eine Kommode, das alte, von mir fröhlich angestrichene Kinderbett, die Liege aus meinem Jugendzimmer, die als Couch dienen sollte – mehr war es nicht. Mein Mann steuerte einen Schreibtisch bei, die weiteren Möbel kauften wir nach und nach dazu, Esstisch, Sideboard, Couchtisch, alles in Teak, das war der Geschmack der Zeit. Es war die Zeit der Siedlungen am Stadtrand: hell, luftig, Aufbauzeit; der x-te Gastarbeiter hatte gerade ein Moped bekommen. Wir zogen mit anderen jungen Familien in die fast fertigen Häuser ein, die die Nissenhütten verdrängten, zwei oder drei Kinder waren die Norm.
Ich war froh und stolz, einen Ingenieur geheiratet zu haben, dessen Gehalt es mir ermöglichte, Hausfrau und Mutter zu sein, von der Frustration der „grünen Witwen“ hatte ich noch nichts gelesen. Aber einsam war ich schon in dieser ersten Zeit im Elbestädtchen dreißig Kilometer von Hamburg entfernt, mit der Staustufe und einem Pumpspeicherbecken als einzigen Attraktionen, ohne Auto, mit schlechter Zugverbindung nach Lübeck, wo Freunde und Familie wohnten. „Sie sind doch die große, schwarze Frau, die immer allein mit dem Kind und dem Hund spazieren geht“, bemerkte einige Zeit später eine Bekannte, ich war ihr mit meinem schwarzen Mantel und dem traurigen Gesicht aufgefallen. Ja, ich war einsam und frustriert, war für mein Kind da und litt an mangelnder Kommunikation. Kein Vergleich mit den heutigen Cappuccino-Müttern vom Prenzlauer Berg! Was tun? In der Volkshochschule gab es einen Literaturzirkel, einmal wöchentlich ging ich dorthin, aber das war Luxus, ein Gefühl von Zugehörigkeit bot es nicht. Vielleicht könnte eine Mitarbeit in der Gemeinde eine Lösung sein? Durch die Taufe von Söhnchen Johann in der St. Petri Kirche lernte ich den Pastor kennen. Und so machte ich mich eines Tages auf den Weg zum Gemeindebüro. Irgendeine Tätigkeit ehrenamtlicher Art müsste sich doch finden lassen. Mir schwebte die Hilfe für ältere Personen, Einkaufen für eine kranke Mutter oder Ähnliches vor. Beherzt klopfte ich an die Tür und sah mich nach dem Eintreten einem großen, mittelalten Mann mit einem runden Schädel und braunen Haaren gegenüber, der mir Angst machte, auch wenn die braunen Augen mich nicht unfreundlich anblickten.
Rolf A. Peters saß in seinem winzigen, schmucklosen Büro im Torgebäude am Spakenberg und erledigte die Geschäfte der St. Petri Gemeinde in der Geesthachter Oberstadt. Aus seinem Fenster blickte er auf die Kirche, auf ihren wie ein umgedrehtes Schiff geformten Körper und den spitzen Turm. Die Kirche St. Petri, 1963 gebaut, protestantisch karg ausgestaltet und hell im Inneren, wies außen mit spitzem Gottesfinger den Weg in den Himmel − das war wie ein Zeichen, ein Hinweis auf die kommenden Tage, da wir auf dem Meer des Individualismus und Materialismus orientierungslos treiben sollten. Die Dichterin Ingeborg Bachmann sprach es in ihrem Gedicht „Reklame“ aus: „Wohin aber gehen wir … Ohne Sorge sei ohne Sorge …!“ Die Mission, Schutz vor den Unbilden des Lebens zu vermitteln, erfüllt die Kirche heute kaum noch. Aber vor fünfzig Jahren bot sie Halt. Der Forschungsreaktor der „Studiengesellschaft zur Förderung der Kernenergieverwendung in Schiffbau und Schifffahrt e.V.“ bot Arbeitsplätze und lockte junge Ingenieure und Wissenschaftler an; sie kamen aus unterschiedlichen Gegenden der Republik, brachten ihre Familien mit und die Siedlung um die Kirche herum wuchs. Immer mehr Baugelände wurde erschlossen. Aussiedlerfamilien aus dem Osten waren hier heimisch geworden, Ausgebombte aus dem zerstörten Hamburg waren hier gestrandet. Die das Wirtschaftswunder begründende Aufbauphase ging weiter.
Es gab also viel zu tun für den Kirchenbuchführer der Kirche in der wachsenden Siedlung. Jeden Monat wurden neue Wohnungen fertig. Es wurde geheiratet, Kinder wurden geboren und getauft, Konfirmanden wurden auf ihr Ja zur kirchlichen Zugehörigkeit vorbereitet, in der Verwaltung der Kirche fiel eine Menge Arbeit an. Inzwischen ist St. Petri Gemeinde mit der älteren von St. Salvatoris in Geesthacht zu einer Gemeinde zusammengefasst und die Verwaltung wird in acht Stunden in der Woche erledigt.
„Was kann ich für Sie tun?“ Das klang so förmlich, am liebsten hätte ich mich zurückgezogen. „Tut mir leid, ich habe mich verlaufen, ich wollte nur fragen …“ Aber dann brachte ich mein Anliegen doch einigermaßen klar heraus: „Ich hab Zeit, hab nur das Kind und den Hund zu versorgen, ich brauch kein Einkommen, ich möchte etwas Sinnvolles tun.“ „Hm. An was haben Sie gedacht?“ „Vielleicht Müttern, die krank sind, im Haushalt oder bei der Versorgung der Kinder helfen. Ich könnt auch alte Leute betreuen, vielleicht für sie einkaufen oder ihnen vorlesen …“ Der Satz blieb unsicher zwischen den kahlen Wänden hängen. „Für diese Aufgaben haben wir die Diakonie und die dort Angestellten. Aber uns fehlt jemand für die Jugendarbeit. Wir haben zwei Jugendkreise, einen für die gerade Konfirmierten und einen für die ab siebzehn Jahren. Beide betreue ich im Moment und das wird mir zu viel. Könnten Sie nicht einmal die Woche eine Gruppe von Jungen und Mädchen betreuen?“ Das war nicht ganz das, was ich suchte. Ich wollte ja tagsüber eine Beschäftigung haben. Und nun sollte ich einmal wöchentlich abends das Kind allein lassen? Ich besprach das mit meinem Mann. Ein Babysitter? Zu teuer. Zum Glück war im Haus eine junge Familie eingezogen, die bereit war, an meinen „Clubabenden“ nach Johann zu sehen. Und so fand ich mein „Feld“.
1965 hatte man in den Großstädten mit selbstverwalteten Jugendzentren gerade erst begonnen. In kleineren Gemeinden war die Jugendarbeit fest in Vereinen und Verbänden verankert, von offener Jugendarbeit war in Geesthacht noch nicht die Rede. Erst viel später richtete auch Geesthacht ein städtisches Jugendzentrum ein − mit einem langhaarigen, selbstverständlich linken Sozialpädagogen als Leiter −, in dem die Kids am Nachmittag bis zum frühen Abend kickern, Tischtennis spielen, Angebote von Fotografie bis Computer wahrnehmen oder einfach nur herumlungern konnten.
Offene oder geschlossene Jugendarbeit? Heute ist das keine Frage mehr. Wie alles hat sich auch dieser Bereich diversifiziert und es bestehen viele Freizeiteinrichtungen aller Art nebeneinander. Das macht die Einrichtung von Gesamtschulen mit einem verbindlichen Alltag bis 16 oder sogar 17 Uhr schwierig. Viele der Jungen und Mädchen ab zehn Jahren sind in einem Sportverein, sie lernen in der Musikschule ein Instrument, sie engagieren sich bei der freiwilligen Feuerwehr oder dem Roten Kreuz. Das Modell einer Ganztagsschule beruht auf dem Gedanken, dass alle Eltern berufstätig sind und der Abend der Familie gehört. Die Verhältnisse in Deutschland liegen aber anders. Die industrielle Arbeit mit ihren festen Arbeitszeiten ist zurückgegangen, viele Jobs sind zeitlich flexibel ausgestaltbar, Familien bestehen aus mehreren „zusammengewürfelten“ Eltern und Kindern. Die Lebensgestaltung wird immer individueller. Für Kinder aus sozial schwachen Familien hält wahrscheinlich der Ganztagsbetrieb genau die Angebote bereit, die die Kinder sonst nicht wahrnehmen können, da aber die Mehrheit der Familien in Deutschland über ein festes Einkommen verfügt, ist die Schule der Ort, an dem es um Leistung und Aufstiegschancen geht – nicht der Ort einer ganzheitlichen Bildung.
Die Jugendarbeit an der St. Petri Kirche in Geesthacht, meinem Betätigungsfeld, war in festen Gruppen etabliert. Die sich langsam ins Bräsige wendende Republik war dabei, sich zu konsolidieren. Die Gemeinde hatte zwei feste Jugendkreise. Einen, zu dem die gerade Konfirmierten eingeladen wurden, einen für die Älteren. Beide trafen sich einmal wöchentlich, die „Neuen“ um 18.30 Uhr für anderthalb Stunden, die Älteren, so ab siebzehn Jahren etwa, trafen sich in der „Jungen Gemeinde“ zeitlich später. Bei unserem zweiten Treffen im Gemeindebüro besprachen wir die Einzelheiten meiner Arbeit: Kennenlernspiele, überhaupt Spieleabende, Diskussionen, Aufklärungsarbeit, Vorbereitung von Gottesdiensten, Singen, Tanzen usw. Und dann eröffnete Rolf A., wie ich ihn bald nur noch nannte, eine neue Option: „Wir haben Kontakt zu einem schwedischen Pastor in Helsingborg (bis 1971 Hälsingborg). Der drängelt, wir sollen einen deutsch-schwedischen Austausch organisieren.“ Ich war begeistert. In meiner Biografie fiel in dem Moment ein Dominostein. Ich hatte ein paar Jahre zuvor als Au-pair-Mädchen bei einer Familie in Uppsala gelebt und ein wenig Schwedisch gelernt, ich hatte als Mitglied der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft eine Austauschreise mitgemacht und meine Schwedisch-Kenntnisse anwenden können, hier eröffnete sich gerade eine weitere Möglichkeit für meine nordische Affinität, ich war – gelinde gesagt – glücklich. „Machen wir eine Vorbereitungsreise nach Helsingborg“, schlug Rolf A. vor. Meine Begeisterung war groß, die Skepsis meines Mannes auch, denn wer sollte während der Zeit auf das Kind aufpassen? Es lag drohend in der Luft: Du hast in erster Linie Mutter zu sein, danach kannst du dich auch für anderes interessieren! Wir waren ja erst am Anfang der Emanzipation, „Mehr Frauen in die Politik“ wurde zu „Meerfrauen …“ verballhornt, die Diskussionen fingen mit Alice Schwarzer (und mir!) gerade erst an. Die Forderungen nach gerechten Bildungschancen, nach Ausbildung auch für Mädchen, nach Mädchen in Männerberufen, das waren durchaus virulente Themen, denen aber mit vielen Gegenargumenten begegnet wurde. Frauen, so ließen sich kritische Stimmen vernehmen, könnten keinen Bus fahren und „in ein Flugzeug, das eine Frau steuert, steige ich nicht ein“. Und überhaupt: War es richtig, dass Frauen den Führerschein machen durften? Waren sie gar die besseren oder die schlechteren Autofahrer? „Frau am Steuer – das wird teuer!“ Wie fern liegen heute die längst von den Tatsachen überrollten Vorurteile.
Jeden Montag machte ich nun den Weg zum Spakenberg. Nach dem Kreis mit den Jüngeren übernahm ich von Rolf A. auch bald die ältere Gruppe und organisierte mit ihnen wie mit den jüngeren Spiel- und Spaßabende. Die Schwalbacher Spielekartei bot vielfältige Auswahl für „Spiele ohne Sieger“, „Einer gegen die Gruppe“ und Wettbewerbe zur Geschicklichkeit. Manche dieser Gruppenoder Wettspiele tauchen in Interaktionskursen und für die Arbeit mit Kindern zum Abbau von Aggressionen auch heute immer wieder auf. Die Tanzabende waren beliebt, zu den Diskussionsabenden kamen nur wenige, zu fern war das politische Geschehen mit Themen wie: Wohnen als Ware, Trennung von Wohn- und Arbeitswelt, Berufstätigkeit der Mütter, Sexualität und Partnerschaft, Freundschaft mit den zuwandernden Arbeitern, vor allem Italienern und solchen aus Jugoslawien, einem Land, das es heute gar nicht mehr gibt. So viel Entwicklung, so ein dummer Krieg! Wir wurden, man muss es so sagen, zunehmend kritisch gegenüber der Erhard`schen Fortsetzung der Politik des Alten aus Rhöndorf und seiner Partei und diejenigen, die kamen, diskutierten emotional. Nicht so scharf wie die sich langsam formierende studentische Opposition, aber doch sehr engagiert. Zu solchen sehr politisch gefärbten Themen kamen eher die älteren Jugendlichen, die jüngeren wollten tanzen, flirten, brauchten die Propriozeption im direkten Feedback der Peergroup. Die jungen Menschen waren meine Lehrer: Sie lehrten mich, über diese Altersstufe zu reflektieren, in der man nicht Fisch, nicht Fleisch ist, in der man gleichzeitig alles ausprobieren will, die Grenzen austestet und sich im nächsten Augenblick klein und hilflos fühlt, in den Arm genommen und getröstet werden will. Einstieg in die eigene Rolle wird geübt, oft mit wenig Verständnis seitens der Erwachsenen, vor allem der Eltern, die mit ihrer Erinnerung an die eigenen Dummheiten ihr Kind vor Schaden bewahren wollen und damit das notwendige Vertrauen zerstören. Welch ein Feld für meinen Einsatz eröffnete sich durch diese Tätigkeit!
„In der Pubertät lief alles aus dem Ruder. Die Aufsicht meiner Eltern ließ in dieser Zeit etwas nach, sodass ich mich verselbstständigte und in der Schule ein renitenter Flegel wurde. Ich habe mich nicht an die Regeln gehalten, die Schule geschwänzt und stattdessen im Stadtpark Musik gehört“, gab ein Freund von mir zu. Ein anderer saß mit fünfzehn Jahren lieber in der Gartenlaube seiner Großeltern und las stundenlang Nietzsche, fern der Schule lernte er mehr als Physik und Mathe. Derlei Beispiele lassen sich beliebig viele aufführen. Alle paar Jahre gibt mindestens ein Schriftsteller dem Lebensgefühl dieser Lebensphase Ausdruck, so zum Beispiel J. D. Salinger 1951 im „Fänger im Roggen“ und 1999 Benjamin Lebert in „Crazy“. Die Darstellungsform wechselt, der Widerstand gegen das Etablierte, in das man dann doch irgendwann eintreten muss (Lebert machte 2003 den Hauptschulabschluss) bleibt gleich. „Hübsche Mädels wachsen immer wieder auf, lass doch der Jugend ihren Lauf!“ Und man ist so verdammt unsicher über die eigene Erscheinung: zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, gelockte Haare, glatte Haare … Eine Freundin erzählt: „In meiner Klasse hatten alle Mädchen diese hübschen kleinen Stupsnäschen. Meine Nase schien mir zu lang und zu gerade. So schob ich, wann immer ich eine Hand frei hatte, die Nasenspitze mit einem Finger nach oben in der Hoffnung, sie ließe sich ebenfalls ein bisschen nach oben biegen. Eines Tages saß ich in der Cafeteria unserer Schule und bemerkte, wie mich drei Jungen aus der Oberprima am Nebentisch anstarrten. Das geschah wegen meiner unzulänglichen Nase, dachte ich und versuchte, sie zu verdecken. Dann stand einer der Drei auf und sagte zu mir: ‚Entschuldige. Wir bewundern die ganze Zeit deine griechisch-römische Nase‘. Da merkte ich zum ersten Mal, dass man auch bemerkt wird, wenn man nicht so ein gebogenes Näschen hat.“ Nase, Ohren, Ohrläppchen, die Augen, die Augenbrauen, die Wimpern – alles wird mit neuem, kritischem Blick gemustert. Aber die Verrücktheiten heutiger Teenager, die sich allerlei am Körper „richten“ lassen, weil es nicht dem gerade herrschenden oder ihrem eigenen Schönheitsideal entspricht, gab es 1965 noch nicht.
Ja, es ist schwierig, sich mit dem eigenen Körper, dem eigenen Erscheinungsbild zu identifizieren. Man lernt sich ja gerade erst kennen. Nicht ohne Schmerz entdecke ich heute Models, die mit elf oder zwölf Jahren bereits für Magazine posieren, die den Schmelz der eben aufblühenden Blume verkörpern und damit viel zu früh vermarktet werden. Bei einigen Auswüchsen gibt es zum Glück Haltelinien. So zum Beispiel bei der Teilnahme an bestimmten Musik- und Sportwettbewerben.
Für mich gab es häufig Schwierigkeiten, weil ich mich auf die Seite der jungen Menschen stellte. Einmal feierten wir eine Party im Gemeindehaus. Und wie immer bei derlei Tanzvergnügungen spielte sich das Wesentliche vor der Tür ab. Im Saal waren ein paar Tänzer, aber immer wieder verschwand die eine oder andere Gruppe aus dem Licht und huschte ins Dunkle. Ab und zu ging ich auch hinaus, um zu schauen, ob alles im Rahmen blieb, um die Übersicht zu behalten, wer wo draußen herumstromerte. Ja, ich nahm sie wahr, die Pärchen, die herumknutschten und sich auch ein bisschen befummelten. Von Sex konnte bei diesen wohlerzogenen Kindern nicht die Rede sein, aber sie knutschten intensiv. Am nächsten Tag kam ein Anruf von Anwohnern: „Gestern haben Mädchen und Jungen in der Nähe des Gemeindehauses geküsst.“ „Ja, und?“ „Das ist skandalös. Das ist Unzucht in der Öffentlichkeit.“ Ich war irritiert. Für mich war alles im Rahmen geblieben, kein Mädchen war verschwunden, keine Eltern hatten sich beschwert; ich gab der Anruferin eine patzige Antwort und da ging der Sturm erst richtig los: „Ich werde dafür sorgen, dass Sie nie wieder einen Tanzabend machen dürfen. Überhaupt sind Sie eine Gefahr für unsere Jugend. Man darf Sie nicht wieder einsetzen. Ich werde mich bei unserem Pastor über sie beschweren.“
Zum Glück übernahm mein Ehemann jetzt das Gespräch und konnte die aufgebrachte Person beruhigen. So lernte ich, die Jugendlichen vor den Gefahren zu warnen, die von allzu besorgten Erwachsenen ausgehen, und gleichzeitig darauf zu achten, dass sie sich nicht zu obszön in der Öffentlichkeit zeigen. Häufig solidarisierte ich mich mit ihnen gegen die Erwachsenen.
Deutsch-schwedischer Jugendaustausch
Ratata, ratata … Der Zug rollte durch den frühen Morgen nach Norden, Rolf A. und ich waren auf dem Weg nach Helsingborg, dem Einfallstor nach Schweden. Spannend war die Fahrt im Zug auf die Fähre in Puttgarden. Ich kannte von früheren Reisen gen Norden noch die alte Fährverbindung von Großenbrode aus. Seit zwei Jahren gab es den Autofährhafen in Puttgarden und ich fuhr zum ersten Mal über die neue Fehmarnsund-Brücke, diesen ästhetischen „längsten Kleiderbügel der Welt“. Für Rolf A. war es ein großes Abenteuer. Auf der langen Reise erzählte er mir von seiner wundersamen Rettung: „Ich war fast noch ein Kind, als ich in die Endphase des Krieges in der Nähe von Hamburg hineingezogen wurde. Ich wurde durch einen verirrten Bombensplitter verwundet, eigentlich nur leicht, aber im Lazarett bekam ich eine Lungenentzündung, steckte mich mit Tuberkelbazillen an, eine Hälfte der Lunge wurde entfernt, die andere war angegriffen. Man gab mir kein halbes Jahr zu leben mehr, mein Leben schien vorüber, ehe es angefangen hatte.“
Wir wurden unterbrochen, weil die Fähre in Rødby anlegte, dieses Manöver wollten wir uns ansehen, außerdem mussten wir auch wieder in den Zug steigen, den wir während der Überfahrt verlassen hatten. Aber dann erzählte er weiter: „Ich hatte mich in meine Krankenschwester verliebt. Und als ich für den Rest meines Lebens entlassen wurde, heirateten wir.“ Es war unvorstellbar: Ein todgeweihter ehemaliger Soldat saß mir achtzehn Jahre später im Zug nach Schweden gegenüber! Wie hatte er diesen Tod überwunden? „Wenn du einmal stolperst, denkst du vielleicht, du hast nicht aufgepasst. Wenn du wieder stolperst, schaust du, ob da vielleicht eine Schwelle aus dem Boden gewachsen ist. Wenn du das dritte Mal hinfällst, machst du dir Gedanken, ob dich nicht jemand geschubst hat. Für mich war mein dreimaliges Stolpern der Auslöser, mich umzuschauen, und da entdeckte ich das Lächeln Gottes.“
Gott, die Kirche, die Gemeinde! Wie hängt das alles zusammen? Welche Erfahrungen bewirken, dass wir einen Sinn in Gott sehen? Die Gürtel der Wehrmacht trugen den Aufdruck „Gott mit uns“! Lässt sich ein Gott auf diese Weise zum Töten missbrauchen? Was sagt die Ringparabel? Der echte Ring hat die Gabe, „vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug“. Dann konnte der Gott des Krieges kein „wahrer“ Gott sein, denn Krieg macht weder vor einer höheren Macht noch vor den Menschen einen guten Eindruck. Meine Gedanken liefen ins Leere. Sollte Gott vielleicht nur eine Metapher für eine individuelle Erklärung des eigenen Schicksals sein? Einfach ein missbrauchtes Wort? Eine üble Rechtfertigung für Machtgelüste und Allmachtsfantasien? Und in seinem Namen konnten alle Gräuel begangen werden, die sich Menschen nur ausdenken konnten? Folter, Töten, Gaskammern für Andersgläubige? Derselbe Gott? Der Gott des Alten und des Neuen Testaments? Wie sollte ich da weiterkommen? „Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen!“, heißt es, aber so viele Bilder werden in einem Kind erzeugt, die zeigen einen freundlichen alten Mann mit weißem Bart. Und wie oft wurde ein Auge als Sinnbild des Allessehenden in einer Barockkirche an die Decke gemalt?