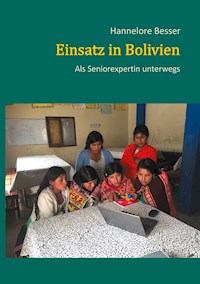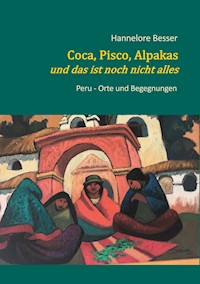
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe in Cusco, eine Ayahuasca-Zeremonie im Urwald, Tanz mit der Cholera in Cajamarca - das sind nur die markantesten Erlebnisse der Autorin in Peru. Bei ihren Reisen zwischen 1985 und 2018 wohnt sie in Lehmhütten, kleinen Schlössern, Abstellkammern, auf einer Hacienda. Sie taucht ein in das Leben der Criollos, lernt die traditionelle Kultur der andinen Menschen kennen, wird konfrontiert mit der Arroganz der Mächtigen, dem Fatalismus und der Lebensfreude der Armen. Die Reisen sind geprägt von abenteuerlichen Begegnungen und gefährlichen Momenten. Auf viertausend Meter Höhe und in den Vorstädten von Lima begleitet sie Frauen in Projekten des Marie-Schlei-Vereins bei ihrer Ausbildung. Sie erzählt von Menschen, denen sie auf ihrem Weg begegnet ist, ihren Schicksalen, Wünschen und Träumen, und macht dabei ihre eigene Entwicklung durch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagungen
Für Ermutigung, Lektorat, kritische Durchsicht, Anregungen, Geduld und Layout danke ich Ruth Lisa Knapp, Julia Sohnrey, Daniel Besser, Brigitte Schmidt-Dethlefsen und Dirk Lausch.
Mein Dank gilt auch dem Marie-Schlei-Verein, der Organisation AFAS in Juliaca und weiteren Frauengruppen, die ich von 1985 bis 2018 begleiten durfte. Ein besonderer Dank gilt dem Maler Juan de la Cruz Machicado, der mich mit der Philosophie der Anden vertraut machte.
Für die Frauen und ihre Selbstbestimmung
Inhalt
Inspirationen
Lima
Heilwig und die Chacra Tres Cañas
Die Geschwister Dasso und Peru Mujer
Unterwegs im Süden
Cusco
Eine Liebe in Peru
Juliaca
Die Gemeinden und das Projekt
Lampa: Begegnung mit den Toten
Unterwegs im Norden: Sullana
Unterwegs im Norden: Cajamarca
Der Urwald
Fazit und Ausblick
Inspirationen
Das Kind
Das Kind liegt bäuchlings auf dem Boden, die Nase tief in ein großes Buch gesteckt. Ganz versunken betrachtet es ein Gebilde, das wie ein Riesenseepferdchen aussieht, mit einem braunen Rücken und einem dicken, grünen, spitzen Bauch. Den Kopf des Tieres sieht man nicht, vielleicht ist der auf einer anderen Seite, aber das kümmert das Kind nicht, denn es betrachtet vor allem die seltsamen Tiere, die in der großen grünen Fläche aufgemalt sind. Das Kind kann bereits lesen, aber so unbekannt-schwierige Wörter wie Lanzen-laub-frosch, Amazo-nasdel-phin, Tapir, Gürteltier, Jaguar, Kaiman, Tukan, An-ako-nda muss es sich mühsam buchstabieren. Der kleine Mund steht offen, die Zunge geht mit, die Lippen formen Buchstabe für Buchstabe die seltsamen Wörter.
Ob es diese Fabelwesen wirklich gibt? Kann man sie sehen, wenn man hinfährt? Und kann man da überhaupt hinfahren? Ein Bus geht wohl nicht, denn auf beiden Seiten des Seepferdchens sind ganz viele blaue Flecken, das ist Wasser.
Ein Schatten fällt auf das Buch.
„Und? Was sieht du denn?“, fragt der Großvater.
Bei den Großeltern gibt es tolles Spielzeug. Der Bruder sitzt in einer Ecke und bastelt Kräne mit dem Stabilbaukasten, die große Schwester spielt mit dem Bauernhof; damit spielt das Kind auch gern, aber heute darf es das Buch haben und verliert sich darin. Am Ende muss alles immer wieder sorgfältig in die richtigen Kästen eingeräumt werden, da passen Oma und Opa auf. Dafür findet man dann auch alles wieder, wenn man das nächste Mal kommt.
„Opa, kann man da hinfahren?”
„Ja, wenn du groß bist und viel Geld hast, dann kannst du eine Reise nach Brasilien machen.“
„Ist das alles Brasilien?“
„Nein, das sind verschiedene Länder, nur das meiste von dem dicken Grün hier ist Brasilien.“ Irgendwann, beschließt die Sechsjährige, werde ich nach Südamerika fahren.
Die Lehrerin
„Bin ich schon in Montevideo?“
Der Flussstreicher auf der Elbe wird immer wieder aufgegriffen. Die junge Lehrerin lässt die Geschichte von diesem ständig betrunkenen alten Schiffer lesen, dessen Traum es ist, mit der Flut aus der Mündung der Elbe hinausgespült, über den Atlantischen Ozean getrieben zu werden und in Montevideo zu landen. Siegfried Lenz beschreibt in einer Kurzgeschichte den Lebenstraum dieses Menschen, der immer wieder an Land gebracht wird, eingesperrt werden soll, aber wieder freigelassen wird, denn er tut ja niemandem etwas zuleide.
Die Schülerinnen und Schüler der achten Klasse haben selbst so eine Geschichte über einen Lebenstraum geschrieben und was passiert, wenn man nichts dafür tut.
Die Lehrerin hat die Aufsätze auf ihrem Schreibtisch, sie muss sie korrigieren, aber ihr Sinn schweift ab. Montevideo und Uruguay, Paraguay, Peru, Brasilien und Rio de Janeiro und Brasilia. Wollte sie dort nicht auch einmal hin? Hatte vor langer Zeit diesen Traum gehabt? Sollte das eine Lebenstraum bleiben, wie die Sehnsucht des Schiffers nach einer Überfahrt, die ihm das Schicksal beschert?
Sie schaut aus dem Fenster, träumt sich auf einen Dampfer auf dem Amazonas. Sie seufzt, steht auf und sieht nach den schlafenden Kindern. Der Große wird im nächsten Jahr Abitur machen, die Kleine kommt in die Oberstufe – nein, eine Reise nach Südamerika muss ein Kindertraum bleiben.
Dennoch wagt sie zwei Schritte, trifft Entscheidungen. Sie schreibt sich für einen Sprachkurs Spanisch ein und legt ein Sparbuch an. Wer weiß, vielleicht kann ein Lebenstraum ja doch Wahrheit werden.
Die gescheiterte Partnerschaft
Er hatte getrunken. Seine Alkoholfahne schwebte in den Korridor, bevor er einen Fuß in die Wohnung setzte. Das ist das Ende, dachte ich. Schon am frühen Nachmittag hatte er getrunken.
„Wir wollen dein Weihnachtsgeschenk kaufen“, sagte er nach dem Kuss, dem ich auszuweichen versuchte. Wir gingen in die Küche, in der mein Sohn hingeflegelt saß, rauchte und Zeitung las. Respektlos fuhr er Heiner an: „Willst du meine Mutter wieder entführen? Mutter, kannst mir mal ‘nen Kaffee rübergeben?“
„Sei mal respektvoller mit deiner Mutter!“, fauchte Heiner ihn an. Und dann gab ein Wort das andere, beide wurden laut, ich stand hilflos daneben und dachte: Was veranstalten die beiden da, welche Vorstellung geben die für mich?
Plötzlich drehte sich Heiner zu mir um: „Und du verteidigst ihn und seine Frechheiten auch noch. Wahrscheinlich, weil du mit ihm geschlafen hast.“
Mein Sohn warf ihm einen eisigen Blick zu, stand wortlos auf und verließ die Szene. Mich flutete kalte Wut. Das Blut schoss mir in den Kopf, ich fühlte, wie ich rot wurde und wieder blass. Hilflos fuhren meine Hände durch die Luft. Schließlich presste ich hervor: „Hau ab! Geh sofort!“
Er war aufgebracht, fand weitere Worte, ich hörte nicht zu. Ich setzte mich, antwortete nicht mehr und nach einigen Minuten merkte Heiner wohl, dass seine Wut ins Leere lief, stand auf und ging. Dann kamen meine Tränen. Es war ja nicht das erste Mal gewesen, dass ich diesen cholerischen Mann mit seinem Alkoholproblem verlassen wollte. Nach dieser Entgleisung gab es keine Versöhnung.
Und nun? Ich starrte in meine Kaffeetasse. Der Sohn kam zurück in die Küche.
„Ist er weg?“
„Ja, endgültig.“
„Das wurde auch Zeit. Er tut dir nicht gut.“
Ich war frei.
Aber ohne Partner. Die gemeinsamen Pläne – wir wollten in den nächsten Sommerferien sechs Wochen Urlaub in Südamerika machen, dafür hatten wir Spanisch gelernt – waren mit ihm gegangen.
Beim Jahreswechsel packte mich das Selbstmitleid. Untröstlich. War ich bindungsunfähig? Erst eine Scheidung vom Vater meiner beiden Kinder, dann ein Liebhaber, den ich abserviert hatte. Erfolgreich mit Freundinnen, aber niemanden für den körperlichen Hunger, keine Partnerschaft. Ich fühlte mich von mir selbst verlassen.
Und meine Sehnsucht nach Südamerika? Der Kindheitstraum von exotischen Tieren und Kulturen?
Ich seufzte und heulte mich ins neue Jahr.
Der Februar kam, mein vierundvierzigster Geburtstag. Mitte Vierzig, mit Lachfalten im Gesicht, der Hingucker war ich nicht mehr. Niemand sprach mich auf der Straße an, bat mich um ein Treffen oder um meine Telefonnummer.
Mein Sohn machte sein Abi, steckte seine Füße unter meinen Tisch und ließ sich das Essen servieren.
„Am besten ist, du ziehst aus.“
„Und ich dachte, ich könnte hier doch ruhig wohnen und studieren. Wir verstehen uns doch gut.“
„Nichts mit Hotel Mama. Wir haben versucht, die Aufgaben ein bisschen zu verteilen, aber das hat nicht funktioniert. Du hast weder die Spülmaschine ein- noch ausgeräumt, du hast nicht ein einziges Mal das Essen fertig gehabt, wenn ich spät von der Schule kam, du hast mit Freunden meine Weinvorräte ausgetrunken. Schluss damit! Ja, noch verstehen wir uns. Aber in mir wächst der Frust und eines Tages mache ich nur noch Vorwürfe. Das will ich uns ersparen.“
Der Zufall spielte mit. Er fand eine bezahlbare Wohnung in einem Altbau im Wedding.
Ein weiterer Zufall: Im Amtsblatt für Schulen stolperte ich über die Bekanntmachung „Beurlaubung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen“. Bislang konnte man sich für die Erziehung der Kinder beurlauben lassen oder freiwillig die Stundenzahl reduzieren. Aber nun hatte man ausreichend Lehrkräfte, sogar einen Überhang, und es gab die Möglichkeit, sich ohne Fortzahlung der Bezüge beurlauben zu lassen. Das war meine Chance. Ich stellte den Antrag auf Beurlaubung für ein halbes Jahr mit Verlängerungsmöglichkeit.
„Wer bin ich?“, fragt Peer Gynt die Sphinx bei den Pyramiden in Ägypten und landet als Antwort in einer psychiatrischen Klinik.
„Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“, fragt Richard David Precht und schildert die verschiedenen Rollen oder Identitäten, die ein Mensch in Laufe seines Lebens einnimmt.
Der aus dem Paradies vertriebene Mensch muss den Widerspruch zwischen Natur und Kultur balancieren, immer wieder. 1985 brauchte ich eine Neuorientierung.
Eine Fee mit einem Zauberstab hatte den Weg geöffnet.
Ich brach auf zu einer neuen Lebensphase.
Aufbruch – 1985
Nun brauchte ich noch ein Thema. Nur touristisch zu reisen, schien mir zu langweilig. Ich verwarf meine angefangene Doktorarbeit „Phänomenologie der Beurteilung“ und einigte mich mit meinem Professor auf „Schule und Demokratisierung der Gesellschaft“. Argentinien hatte nach der Militärdiktatur Wahlen durchgeführt, dort könnte ich recherchieren und die Reformen beobachten, wenn es denn welche gab.
Im Gepäck hatte ich die Adresse der Eltern meiner argentinischen Freundin. Bei ihnen, am Stadtrand von Buenos Aires, konnte ich wohnen. Im Januar hatte ich bei den südamerikanischen Freunden eine Schauspielerin aus Lima getroffen, die mir Quartier angeboten hatte, falls ich nach Peru käme. Ich teilte ihr meine Ankunft für Anfang September mit. Die Wohnung in Berlin vermietete ich, die Miete deckte die monatlichen Ausgaben, ein Freund übernahm die Verwaltung. Die Krankenversicherung musste für den längeren Auslandsaufenthalt geregelt werden, die für den Sohn übertrug ich seinem Vater. Die Bankvollmacht war zu organisieren und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben eine Kreditkarte.
Mit einem Emaillebecher und einer kleinen Reiseapotheke zog ich los. Das Gepäck durfte nicht mehr umfassen, als ich allein beaufsichtigen und tragen konnte, vor Dieben musste man sich hüten. In eine leichte Reisetasche passten sommerliche Kleidung, feste Schuhe und Sandalen, ein paar T-Shirts, ein dicker Pullover, Unterwäsche und ein Waschmittel für eine kleine Wäsche zwischendurch. Der Schlafsack musste mit und sollte sich mehrfach als äußerst nützlich erweisen.
Zur Verabschiedung brachten Freunde mir ein Notpäckchen der Bundeswehr. Sie glaubten wohl, ich flöge in ein unzivilisiertes Buschland, dabei waren Lima und Buenos Aires europäisch geprägt.
1985 landete ich nach Zwischenaufenthalten in Nicaragua und Kuba in Lima. Es folgten zwei intensive Jahre, danach flog ich immer wieder hin, um Freunde zu treffen, um die Projekte des Marie-Schlei-Vereins zu besuchen. 2018 sollte eine Abschiedsreise werden.
Aufbruch – 2018
Wann bekomme ich den ersten Pisco Sour? Wie werde ich diesmal mit der Höhe über viertausend Meter fertig? Welches Kleidungsstück aus Alpaka werde ich kaufen? Vorbereitungen zu einer Reise verursachen mir stets ein mulmiges Gefühl. Am Anfang ist immer der Gedanke im Hinterkopf, diese Reise könnte schiefgehen, wobei ich „schiefgehen“ nicht näher definieren kann; es ist, als lauere hinter jeder Ecke ein Ungemach. Trotzdem freue ich mich auch diesmal auf Peru, spüre den Geschmack des Pisco Sour schon auf der Zunge.
Ich sitze auf dem Boden, um mich verstreut die vielen Kleinigkeiten, die ich für die Reise brauche: ein Taschenmesser, das Ladekabel fürs Handy, die Wurst für Gabi, Kekse, Süßigkeiten, kleine Magnete. Ich hatte offensichtlich falsch gepackt, all das war wieder aus dem Koffer herausgefallen. Ich seufze und fange von vorn an.
Meine Freundin Petra sitzt dabei und blickt leicht amüsiert auf meine Packerei. Sie ist eine ehemalige Schülerin aus Oslo, war einige Monate im Iran und in Indien, durch ihre Erzählungen und mein Interesse daran ist eine Freundschaft entstanden.
„Warum setzt du dich trotz der Anspannung immer wieder so einem Abenteuer aus? Du warst doch schon so viel unterwegs.“
„Stimmt! Muss ich diese Reise noch einmal machen? Ich bin pensioniert, schön eingerichtet, kann zufrieden sein. Am liebsten bin ich sowieso auf dem Sofa vor dem Kamin in meinem Haus in Schweden. Ich darf ein Projekt in Peru besuchen, werde viele Freundinnen wiedersehen. Dies Projekt ist auf dem Altiplano bei den Dörfern der Quechua-Frauen, knapp viertausend Meter hoch. Und dabei habe ich Zweifel an der Wirksamkeit der Projekte. Oft frage ich mich: Welches Interesse haben die Industrienationen am Fortschritt der Länder? Ist nicht jede Entwicklung ein Schritt auf dem Weg zu mehr Kapitalismus und damit Ausbeutung von Ressourcen? Was machen die Frauen, die Familien, die Kinder, wenn sie mehr Geld in den Händen haben? Sie werden in die Stadt gehen und weitere Einkommensquellen erschließen. Sie kommen mit noch mehr Konsum in Berührung und der Wunsch nach mehr Haben anstatt nach mehr Sein wächst. Wir entfernen mit den finanziellen Hilfen die Menschen in anderen Ländern von ihren Wurzeln. Mehr Teilhabe an der industriellen oder postindustriellen Gesellschaft bedeutet auch, den Planeten schneller zu zerstören.“
„Stimmt“, gibt Petra zu, „die Globalisierung scheint eine unaufhaltsame Eigendynamik entwickelt zu haben, in der Menschen aufsteigen, andere untergehen, insgesamt aber mehr Menschen auf dem Planeten wohnen. Und alle möchten sauberes Trinkwasser, Hygiene, ein gutes Gesundheits- und Bildungssystem, aber leider möchten sie auch Autos. Die einen wollen die Autos herstellen und verkaufen, die anderen sollen mehr und mehr arbeiten, damit sie sich ein Auto kaufen können. Die Industrienationen beuten die Rohstoffe aus, wenig wird für die Umverteilung getan. Diese Entwicklungen hab ich in Indien auch beobachtet.“
Ich seufze: „Nur die Begriffe haben sich verändert: Erst haben wir von der ‚Dritten Welt‘ gesprochen, dann von ‚Entwicklungsländern‘, heute sind sie ‚Partner des Fortschritts‘. Die finanzielle Hilfe aus den Industrienationen hat vor allem das Ziel, neue Absatzmärkte für die Industrieproduktion zu erschließen. Beförderung von Gesundheit und Bildung bleibt häufig den Nichtregierungsorganisationen überlassen. Wachstum heißt die Religion.“
„Wie ist eigentlich der Marie-Schlei-Verein entstanden?“, will Petra wissen. Ich überlege und antworte: „So könnte es gewesen sein:
Im Herbst 1977 findet im Kanzleramt ein Gespräch statt. Die Teilnehmer sind Helmut Schmidt und Marie Schlei. Die Protokollanten schreiben eifrig mit.
‚Liebe Marie, ich weiß, was du für mich getan hast und noch immer tust‘, eröffnet Schmidt das Gespräch. Marie Schlei lacht: ‚Ja, ich bin deine Berliner Schnauze. Uff mir kannste zählen!‘ ‚Aber du hast bestimmt den Artikel gelesen, den der Spiegel schon im April über deine Reise als Ministerin für Entwicklung in Afrika geschrieben hat? Die doch wohl berechtigte Kritik kann ich nicht ignorieren.‘ ‚Ich kann nichts Falsches daran entdecken. Ich bin den Leuten da auf Augenhöhe begegnet.‘ ‚Nur verlangt man von einer deutschen Ministerin nicht die Begegnung auf Augenhöhe. Du hast dich protokollarisch falsch, unprofessionell und vor allem völlig undiplomatisch verhalten. Sicher hast du Verständnis, dass ich dich im Zuge der Kabinettsumbildung aus der Schusslinie nehmen muss.‘ ‚Da kann ich wohl nichts machen. Aber eins sage ich dir: Ich werde weiter dafür kämpfen, dass in der Entwicklungspolitik mehr für die Frauen getan wird. Unsere Hilfe kommt nämlich eigentlich nur den Männern zugute. Und oft werden auch noch heimlich Waffen gekauft. Unsere ganze Hilfe muss überdacht werden.‘ Nach einer Pause echot Schmidt: ‚Die Frauen. Ja, ja, die Frauen! Als ob die Frauen in Afrika gerade mein größtes Problem wären‘.
„Und sie hat dann den Verein gegründet?“, hakt Petra nach.
„Nein, Marie Schlei starb 1983. Ein Jahr später holte die SPD-Frau Christa Randzio-Plath in Hamburg ein paar engagierte Frauen zusammen, mit denen sie den Marie-Schlei-Verein gründete. Ich les dir mal die satzungsmäßigen Ziele des gemeinnützigen Vereins vor: ‚Förderung der Zusammenarbeit mit armen Frauen, Gruppen von Frauen und Frauenorganisationen in Stadt und Land, die Förderung der Bildung und Ausbildung von Frauen, die Aufklärung über die Hintergründe von Not und Ungerechtigkeit, die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, die Völkerverständigung, die Verbreitung von Informationen, die das Verständnis für die Situation der Frauen herstellen und vertiefen, um so die Mitverantwortung und Hilfsbereitschaft für die Frauen und damit für die Menschen in den Entwicklungsländern zu verstärken.'“
„Das hört sich doch vernünftig an. Da bewirkt der Verein doch etwas“, überlegt Petra.
„Im Laufe der Jahre hat der Verein weit mehr als vierhundert Projekte gefördert. Eine echte Graswurzelarbeit. Viele Projekte kenne ich aus eigener Anschauung. Viele von Anfang an.“
Petra will wissen: „Macht ihr nur Ausbildung? Oder auch Alphabetisierung und Aufklärung über die Rechte? Wäre es nicht besser, den Kindern Schulbildung zu ermöglichen?”
„Die Kinder drängen in die Stadt, sie tragen zur Urbanisierung bei, das finde ich problematisch. Trotzdem wird sich der Trend verstärken, die Alten bleiben verlassen zurück. Einsamkeit, wie schon heute bei uns, ist die unerwünschte Folge. Depressionen sind die neue Volkskrankheit in Deutschland“, erläutere ich meine Gedanken und ergänze mit leicht trotziger Stimme: „Außerdem kümmern sich andere NGOs um Kinder und Schulprojekte, wir um die Ausbildung von Frauen. Du kannst nie alles machen. Außerdem denke ich ja, dass der Staat für die beiden Basisbedürfnisse, Gesundheit und Bildung, verantwortlich ist. Und wenn man eine soziale Gesetzgebung hat, funktioniert das auch, siehe Bolivien unter Morales. Ausbildung ist die Grundlage. Wenn du was kannst, kann dir das niemand wegnehmen. Sicher ist es prima, die Frauen über ihre Rechte aufzuklären und sie zur Schule zu schicken, aber wichtiger ist ein eigenes Einkommen. Nur wer über finanzielle Mittel verfügt, kann auch Rechte einklagen. Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe und Partnerschaft – keine Patenschaft. Der Schlei-Verein beteiligt sich auch an nationalen und internationalen Konferenzen und Diskussionen zur Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit. Wir machen Infoveranstaltungen und Veröffentlichungen zur Situation der Frauen in Entwicklungsländern. Ich finde, internationale Solidarität ist notwendig. In den Projekten geht es auch um Beteiligung und Rechte zur Mitsprache. In jedem Projekt – zuerst waren es Ausbildungen zur Gesundheitshelferin, als Schneiderin und für einen häuslichen Kleingarten, also traditionelle Frauenaufgaben, später kam Arbeit mit dem Computer dazu, Reparatur von technischen Geräten und Berufe im Bauhandwerk – bei allen Projekten muss zwingend nachgewiesen werden, dass nach der Ausbildung ein höheres bzw. überhaupt ein Einkommen erwirtschaftet wird.“
„Und du besuchst jetzt welches Projekt?“
„Ein Projekt zur Verarbeitung von Alpakas auf dem Altiplano. Ich prüfe die Einnahmen- und Ausgabenrechnung, die Einkommensveränderung und die Nachhaltigkeit. Mein Anliegen ist aber vor allem, die Frauen in ihren Dörfern zu besuchen.“
„Ich war in Indien und im Iran immer nur für mich selbst unterwegs. An Hilfe für die Länder oder so habe ich dabei nicht gedacht“, sagt Petra und spürt ihren eigenen Reiseerfahrungen nach.
„Nur touristisch unterwegs? Da kommt man mit den Leuten nicht ins Gespräch oder nur oberflächlich. Mich interessieren die Menschen. Mir gefällt es, mit den Organisationen in Peru zusammenzuarbeiten, die den Frauen Ausbildung, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit vermitteln. Sicher ist auch immer ein bisschen Projektion dabei, die Übertragung von meinem eigenen Weg auf andere. Tue Gutes und rede darüber. Lebe nicht nur für dich, sondern sorge auch für andere. Wir haben eine kleine Zeit auf der Welt: Sorgen wir, dass wir diese Zeit sinnvoll nutzen und Gutes tun. − Solche Sprüche und moralischen Appelle geistern mir durch den Sinn.“
Petra zieht skeptisch die Augenbrauen hoch, sie glaubt mir meinen Altruismus nicht.
„Bei allem Engagement für andere habe ich immer auch an mich gedacht“, gebe ich zu. „Es soll nicht nur anderen gut gehen, sondern auch mir. Charakter ist Schicksal – das Leben trägt die Aufgaben an mich heran, ich kann mich wehren, aber ich übernehme meinen Part.“
„Wie lange machst du das schon?”
„1985 bin ich nach Südamerika geflogen, um herauszufinden, ob sich die immer wieder vom Militär beherrschten Nationen, zum Beispiel Argentinien und Peru, demokratisch wandeln. Ich wollte wissen, ob mit freien Wahlen das Sozialsystem verbessert würde, vor allem das Bildungs- und Gesundheitssystem. In Peru bin ich hängengeblieben. Zwei Jahre hab ich dort gearbeitet, bin an viele Orte gereist, hab viele Menschen kennengelernt, Freunde gefunden. Das weißt du ja schon. Dies ist vielleicht die letzte große Reise.“
Lima
Kulturschock
1985 landete ich auf dem Flughafen Jorge Chavez und kam mir vor wie in einem Hexenkessel. Das Sprachengewirr und die Nähe der auf mich einredenden Personen bedrängten und bedrohten mich. „Cambio dólares“, wurde mir ins Ohr geflüstert, „Taxi, Taxi!“, schrien etliche Anbieter, sich an Lautstärke überbietend, Hotels wurden angepriesen, aggressiv wollten gleich mehrere Träger sich meiner grauen Reisetasche bemächtigen. Ich hatte viel zu tun, mich diesem Ansturm an Offerten zu widersetzen. Endlich fand ich eine Telefonzelle. In Berlin hatte ich im April von einer netten Theaterfrau eine Telefonnummer bekommen; ich wählte die Nummer, niemand meldete sich. Die lästigen Verkäufer abschüttelnd, trat ich ins Freie.
Wie mit einer Keule verstärkte sich der Kulturschock! Die Übergriffe der vielen Einheimischen, die an den Ankömmlingen verdienen wollten, gingen massiv weiter. Tourismusfirmen boten Ausflüge an, einige Hotels hatten Shuttlebusse bereitgestellt, wieder wollten Träger mir die Reisetasche abnehmen – ich kam kaum zum Atmen. Ach, atmen! Die feuchtkühle Abendluft der Pazifikstadt schlug mir an diesem Oktobertag entgegen, ein modriger Geruch legte sich auf Lunge und Kleidung. Die fremde Stadt überfiel mich mit ihrem Schmutz, mit den verwahrlosten Häusern und ihrem pockennarbigen Putz, den abgeblätterten Farben, den schmierigen Straßen, den Parolen an den zerfallenden Mauern, dem Gestank, dem Chaos auf den Straßen, den weggeworfenen Plastikflaschen, dem Papier- und Plastikmüll in jeder Ecke. Der Uringestank kam dazu, der wurde im Stadtteil Callao durch die nahe Müllkippe und den Geruch einer Fischfabrik überdeckt und noch widerlicher. Ich hatte gedacht, im Oktober müsste der Frühling beginnen, und da es in Lima laut meteorologischen Angaben nie regnet, war ich der Meinung gewesen, leichte Kleidung und ein Pullover seien Ausstattung genug. Ich fror und war in der Vorhölle gelandet!
Ich zeigte die Adresse meiner Bekannten herum und fand ein Colectivo. Diese Kleinbusse können normalerweise neun Personen befördern; in Lima finden bis zu fünfzehn Fahrgäste Platz. Ich quetschte mich eng auf einen ausgeklappten Platz in der Mitte zwischen zwei Bänken. Mit diesem Bus käme ich zu der angegebenen Straße in Callao, so behaupteten es meine Mitreisenden. Ich war misstrauisch, doch nach der Fahrt und kurzem Suchen fand ich wunderbarerweise sowohl die gesuchte Straße als auch das Haus. Auf mein Klingeln öffnete ein junger Mann und gab an, seine Mutter komme bald, ich könne im Salon warten. Als Marta Velasco eintraf, zeigte sich, dass mein vor Monaten geschriebener Brief nicht angekommen war, Handy oder E-Mail gab es damals nicht. Sie zeigte sich überrascht, aber hilfsbereit − schickte mich nicht wieder in den Moloch hinaus, sondern bot mir einen Schlafplatz an. Sie selbst schlief in der Badewanne, das bemerkte ich aber erst später, sonst hätte ich sicher protestiert. Nach zwei Nächten fand sie eine Unterkunft für mich in Miraflores, einem Bezirk im Süden der Stadt, weit wohlhabender und hübscher als Callao oder die nördlichen Stadtteile. Die Schauspielerin Aurora Colina betrieb dort in einem entzückenden grünen Haus mit vielen aufgemalten Blumenranken ein kleines privates Theater mit dem hübschen Namen Cocolido. Ich durfte in einer Kleiderkammer schlafen, in der, wie man mir versicherte, vor einem Jahr der Autor Hans Magnus Enzensberger genächtigt hatte.
Lima sollte damals nur eine Zwischenstation auf meinem Weg nach Argentinien sein. Dort wollte ich über Strukturen der Gesellschaft und die demokratischen Veränderungen recherchieren. Ich hatte nicht vor, mich auf Peru näher einzulassen. Gleich nach meinem Umzug zeigte Fernando, Schauspielschüler und Freund im Hause Auroras, mir den Stadtteil Miraflores. Wir standen im Park nahe des Platzes Ovalo, ich blickte umher, sah die Rabatten und die niederen Bäume; Ich fand alles wunderschön.
„Du wirst dich in Lima verlieben“, meinte Fernando. „Und warum schreibst du deine Thesis nicht hier? Wir hatten gerade Wahlen, Alan García und die APRA haben Reformen angekündigt.“
Peru stand vor einem Neuanfang mit der Partei APRA – der Alianza Popular Revolucionaria Americana. Zwischen 1968 und 1975 hatte die linke Militärdiktatur unter General Juan Velasco Alvarado Landreformen und Verstaatlichungen durchgeführt und Peru war Mitglied der blockfreien Nationen geworden. Die APRA wollte sich nicht völlig von den privaten Investoren lösen, sondern ein gemischtes wirtschaftliches System schaffen. Das Programm versprach weniger private Firmen und mehr soziale Gerechtigkeit; bei allen Veränderungen sollte „die nationale Souveränität und Würde“ gerettet werden. Viele private Investoren zogen ihr Geld ab, die Schulden waren hoch, Rohstoffpreise sanken. Trotz guter Vorsätze etablierte sich ein neoliberales Wirtschaftssystem, das die Hälfte der Bevölkerung noch ärmer machte.
Peru wird zwischen privaten Investoren und sozialen Reformen zerrieben. Zehn Jahre vor der APRA war mit Francisco Morales Bermúdez ein konservativer Präsident an die Macht gekommen. Er war ein Freund der sogenannten Brückenköpfe, den treuen Anhänger der Vereinigten Staaten und vor allem des Kapitals. Das Land war und ist mit seinen Bodenschätzen der „Hinterhof der Vereinigten Staaten“ und damit der Willkür der internationalen Geldgeber ausgesetzt. Die Militärs erarbeiteten eine neue Verfassung, 1980 fanden freie Wahlen statt. Der gewählte Präsident Fernando Belaúnde Terry machte die früheren Verstaatlichungen von Banken, Zeitungen und Fischereibetrieben weitgehend rückgängig. Als ich 1985 in Lima ankam, war der als sozialistisch eingeschätzte Alan García mit der Partei der APRA an der Regierung. Die Sozialistische Internationale setzte große Hoffnungen in den jungen Amtsinhaber.
Trotz einiger sozialer Bemühungen hatte das Land eine Dreiklassengesellschaft. Die öffentliche Verwaltung, die Banken, die Zeitungen und Institutionen lagen in den Händen der Kreolen bzw. Criollos und aufgestiegener Mestizen. Die indigene Bevölkerung schaffte es nicht, sich in den Parlamenten und öffentlichen Institutionen zu behaupten, viele der Nachkommen aus indigenen und kreolischen Ehen oder der Sklaven aus Afrika waren in beiden Gruppen Außenseiter. Aus den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, hohen Auslandsschulden und den politischen Wirren ergaben sich Widerstände − einerseits linksliberal, andererseits umstürzlerisch. Von der gewählten APRA erwartete man eine Versöhnung der Gruppen sowie soziale Reformen.
Ich wandelte mit Fernando durch die Anlagen am Rathaus. In kurzen Stichworten hatte er mir die politischen und wirtschaftlichen Grundzüge des Landes erklärt. Ich war schon halb entschlossen, die versprochenen Reformen näher zu untersuchen.
„Zuerst will ich meine Reise durch den Süden des Kontinents machen. Ich will zu den Highlights in Peru und Bolivien, möchte die Wasserfälle von Iguazú sehen und natürlich will ich zu den Eltern meiner Freundin in Argentinien. Du hast recht, Peru ist interessant, vielleicht komme ich zurück und schreibe meine Arbeit hier.“
In der Zeit des Terrorismus – Peru im Jahr 1985
„Morgen ist ein Empfang in der Botschaft. Komm doch mit“, verkündete Aurora beim Frühstück.
„Ich bin doch nicht eingeladen.“
„Ich kann dich als meine Begleitung mitnehmen.“
„Ist damit nicht ein männlicher Partner gemeint?“
„Früher galten solche Einladung für ein Paar. Aber die Emanzipation geht auch in Peru weiter. Man ist da liberal und akzeptiert den Begleiter oder die Begleiterin, die eben mitgebracht wird.“
„Ich hab für solche Gelegenheit nichts anzuziehen.“
„Auch da ist man nicht so konservativ. Du kannst deine schwarze Leinenhose und eine Bluse anziehen und bist perfekt. Das Einzige, wovor ich dich warne, ist, dass es auf solchen Empfängen meist ziemlich langweilig ist. Du musst versuchen, einen interessanten Gesprächspartner zu finden, und den hältst du am besten fest.“
Das Botschafterehepaar begrüßte die Ankommenden an der Treppe, danach schlenderte man in den Garten hinter den Mauern an der Avenida Arequipa, der sowohl von Wachleuten als auch von Bewegungsmeldern streng bewacht wurde.
Aurora trug ein einfarbiges blaues Kleid; ihr langer, gerade auf den Rücken fallender Zopf war der schönste Schmuck. Meine gelbe Bluse aus reiner Seide und die dunkle Hose passten zum Event. Nachdem mich Aurora ein paar Bekannten vorgestellt hatte, deren Namen ich sofort wieder vergaß, verschwand sie in der Menge. Ich fand mich allein in einer Nische, fühlte ich mich gehemmt, wagte nicht, jemanden anzusprechen. Ein paar Meter von mir entfernt hörte ich dunkle Stimmen.
„Die Senderistas werden keine Ruhe geben. Erst gestern wieder der Stromausfall, weil sie einen der Strommasten oben in Apurímac gekappt haben.“
„Die sozialistischen Vorhaben der APRA sind ihnen zu anpasslerisch. Vor ein paar Tagen haben sie ein paar Bauern in Ayacucho getötet, weil die sich der Revolution nicht anschließen wollten.“
„Das können auch die Tupac Amaru gewesen sein.“
Sie plauderten keine Geheimnisse aus. Anfang der achtziger Jahre hatten sich zwei Guerilla-Organisationen gebildet, die jeden linksliberalen oder Reform orientierten Kurs ablehnten. Die maoistische Gruppe Sendero Luminoso, der Leuchtende Pfad, wollte den Umsturz. Der Gruppe Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, die Revolutionäre Bewegung Túpac Amaru, ging es um soziale Gerechtigkeit und Teilhabe der indigenen Bevölkerung an Verwaltung und Institutionen. Von der maoistischen Gruppe ging Gewalt, ja Terror aus, vom Militär und der Polizei wurde dieser Kampf ebenso unerbittlich geführt. Die USA waren durch die CIA an Gewalt und Terror beteiligt; nur war das schwer nachzuweisen.
Bisher hatte ich wenig davon gemerkt. Ab und an fiel der Strom aus. Das konnte Überlastung des Netzes sein, es konnte aber auch wieder ein umgelegter Hochspannungsmast sein, woher sollte ich das wissen. Ja, es gab die Sperrstunde. Zwischen null und fünf Uhr durfte man sich nicht auf der Straße aufhalten, aber ein Nachtleben brauchte ich in Lima ohnehin nicht.
Später, auf meiner Rundfahrt durch den Andenstaat, wurde ich manchmal nachts geweckt und eine Militärpatrouille forderte: „Papeles en las manos!“ Man wachte verschlafen auf und hatte den Pass bereits griffbereit.
Neugierig schielte ich in die Nische. Der eine der beiden war gemäß seiner Uniform und der Dekoration an der Brust wohl der Militärattaché, den anderen konnte ich aufgrund seines Outfits nicht zuordnen. Viel später begegnete ich ihm wieder, es war der Kulturreferent der Botschaft.
„Hast du den beiden beim Gespräch zugehört?“, fragte Aurora auf dem Heimweg. Ihr war nicht entgangen, wo ich mich während des Empfangs aufgehalten hatte.
„Vielleicht hast du etwas über den Anführer der Senderistas gehört, Abimael Guzmán, er wird gesucht. Eine Deutsche hat man gefangen genommen, die mit einem der Anführer zusammen war und ein Kind mit ihm hat, das ist etwa ein Jahr alt. Rena H. ist im Gefängnis. Würdest du sie besuchen? Ich war schon einmal dort, es würde auffallen, wenn ich schon wieder käme. Ich muss aufpassen, denn der Geheimdienst beobachtet mich sicher. Du als Landsmännin bist unverdächtig.“
Eine deutsche Revolutionärin im Gefängnis? Das klang spannend. Aurora packte Waschpulver, Seife, ein Spielzeug für das Kind und einige weitere Hygieneartikel zusammen, ich fügte Schokolade und ein paar Snacks hinzu.
Am Besuchstag machte ich mich zum Gefängnis Santa Mónica in Chorrillos auf. Es war ein sonniger Tag, ich reihte mich in eine Schlange ein und wartete stundenlang in der Hitze, bis sich endlich einer nach dem anderen der Einlassprüfung unterzogen hatte. Eine ebenfalls wartende Frau machte mich darauf aufmerksam, dass ich auf jeden Fall einen Rock anhaben müsse, mit Hosen würde ich nicht ins Gefängnis gelassen. Was tun? Zum Glück hatte ich einen Pullover mit großem Ausschnitt dabei, der in der Hitze überflüssig war und den ich jetzt wie einen Rock über die Hüften ziehen konnte, mit den seitwärts baumelnden Armen sah es etwas lächerlich aus, aber ich durfte passieren.
Ich hatte keine Ahnung gehabt, wie ein Frauengefängnis aussieht, hatte Zellentrakte erwartet, wie man sie manchmal in Filmen sieht. Hier blickte ich in einen großen Saal mit wohl zehn oder mehr Betten an beiden Seiten, zwischen je zweien stand ein Hocker. Kinder wuselten herum, in einer Nische kochten zwei Frauen, Wäsche hing auf einer Leine, einige Frauen stillten ihre Kleinkinder. Alles wirkte wie eine lockere Frauenkommune. Eine Bewachung war nirgends zu entdecken. Die Deutsche übergab den Jungen, der offenbar gerade laufen lernte, einer Mitgefangenen, damit wir ungestört reden konnten. Wir setzten uns vor dem großen Schlafsaal auf eine Bank. Rena nahm die Mitbringsel eher gleichgültig entgegen, die Stimmung war angespannt, misstrauisch. Ich hätte gern gewusst, wie sie zur Revolution und noch mehr zu den Gewalttaten stand, die man der Gruppe anlastete, aber sie wollte nicht darüber reden. Meine Fragen beantwortete sie wortkarg und mürrisch. Nein, weiter brauche sie nichts. Danke für das Waschpulver. Nein, sie habe nichts getan, und ja, ihr Anwalt in Deutschland schriebe ihr regelmäßig, und nein, die Botschaft könne nichts weiter tun. Auf meine Fragen, ob sie irgendeinen Kontakt zur Gruppe oder wenigstens zum Vater des Kindes habe, antwortete sie ausweichend, und nein, sie erhalte keinen weiteren Besuch.
Unzufrieden kam ich zurück ins Cocolido und berichtete über das Erfahrene. Anstrengungen, den Kontakt mit dem Rechtsanwalt in Bremen zu bekommen, blieben erfolglos. Endlose Diskussionen mit den Freunden drehten sich um Gewalt, um Terrorismus, um Mittäterschaft und darüber, wie ein guter Staat aussehen könnte. Die Ungleichheit im Gefüge zwischen armen und reichen Menschen in Peru sollte ausgeglichen werden, das wollte ich auch. Aber nicht mit solchem Terror. „Sie schreiben mit Blut“, titelte ein Journalist im Spiegel 1992 über die Revolutionäre. Mehrere tausend Tote, vor allem Bauern, forderte dieser jahrelange Krieg der maoistischen Gruppe Sendero Luminoso und der Revolutionären Vereinigung Túpac Amaru gegen das herrschende Regime. Vor allem die Maoisten wollten keine Reformen, sondern kämpferischen Umsturz.
Ich dachte an eigene gesellschaftsverändernde Ambitionen. Die Rote-Armee-Fraktion hatte mit ihrer Kritik an Kapitalismus und Imperialismus einst auch meine Sympathie gehabt. Die war aber angesichts der ausgeübten Gewalttaten schnell erloschen. Studien über den Ausgang von Revolutionen, das Büchner-Zitat von der Revolution, die ihre Kinder frisst, hatten meine Überzeugung gestärkt, dass mit Umstürzen nichts gewonnen werden kann. Ich wollte Reformen und vor allem wollte ich, dass jeder Mensch für sich selbst den richtigen Weg findet und sich nicht zum Erlöser der Menschheit aufspielt.
Mein Besuch im Gefängnis hatte ein Nachspiel. Ich war von der ersten Rundreise zurückgekommen, hatte einen Job im Goethe-Institut und meinen Aufenthalt in Peru verlängert. Das Sommerhalbjahr war zu Ende und im historischen Gebäude des Instituts im Zentrum Limas gab es einen Empfang. Draußen im Hof standen bei Würstchen und Bier unsere Schülerinnen und Schüler, darunter viele angehende und etablierte Ärzte, Juristen, Militärs und Studenten, ungefähr zur Hälfte Männer und Frauen. Drinnen in einem Saal gab es Sekt und Wein und sehr leckeres Fingerfood, wie man es auch auf dem Botschaftsempfang serviert hatte. Mir kam es absurd vor: im Hof die Intellektuellen und die Mittelschicht der peruanischen Gesellschaft, drinnen die Expats. Ich fühlte mich zum Hof hingezogen und wollte gerade hinausgehen, als mich ein Mann von der Botschaft ansprach.
„Ich glaube, wir sind uns schon begegnet“, begann er das Gespräch. „Ich bin der Kulturreferent der Botschaft.“
„Ah, ja, ich erinnere mich“, gab ich zögernd zu, „vor einigen Monaten in der Botschaft.“
„Sie waren im Gefängnis und haben Frau H. besucht.“ Mit barschem Ton kam er zur Sache.
„Ja, und? Ist das falsch? Sie ist Deutsche, sitzt im Gefängnis und ich habe sie besucht. Ich kann nichts Anstößiges daran finden.“
„Wissen Sie nicht, dass eine Deutsche im Gefängnis unter Beobachtung der Botschaft steht? Sie können doch da nicht einfach hinmarschieren. Und dann noch eine Terroristin. Sie dürfen sich nicht wundern, wenn Sie jetzt vom Geheimdienst beobachtet werden. Passen Sie bloß auf, dass man Sie nicht auch festnimmt, weil man den Verdacht hat, dass sie der Gruppe angehören oder sie unterstützen.“
„Sie ist eine Landsmännin. Ich habe sie besucht. Ich bin hier nirgends angestellt, niemandem vertraglich verpflichtet, ich bin ein freier Mensch und kann besuchen, wen ich will.“ Meine Stimme klang eher trotzig als selbstbewusst.
„Nein, das können Sie nicht. Sie sind beim Goethe-Institut angestellt, und selbst wenn nicht – so frei, eine Terroristin aufzusuchen, sind Sie nicht“, zischte er. „Ich rate dringend von weiteren Besuchen ab, sprechen Sie auf jeden Fall vorher mit der Botschaft. Hier ist meine Karte, rufen Sie mich direkt an.“
Damit ließ er mich stehen. Gedankenvoll setzte ich meinen Weg in den Hof fort und war schnell von einigen meiner Schülerinnen umringt, sie hatten andere Themen.
Jahre später zeigte eine Ausstellung, welche Gräueltaten sowohl die Revolutionäre, vor allem der Sendero Luminoso, als auch die Polizei verübt hatten. Inzwischen sind die Bewegungen zerschlagen, Bodenschätze und die neoliberale Wirtschaft ermöglichen vielen Menschen den Aufstieg.
Bald beschäftigten mich meine eigenen Vorhaben, nahm meine Geschichte eine andere Wendung. Das Ministerium für Erziehung hatte einen Vertreter zum Empfang bei der Botschaft geschickt. Er vermittelte einen Termin mit dem stellvertretenden Erziehungsminister, der lud mich zu Konferenzen und Sitzungen ein, bei denen es um die Schulreform ging; ich bekam Verbindungen zu Instituten und Foren, Anregungen, Kontakte und Vorschläge für Recherchen.
Was mag aus Rena H. geworden sein?
Die Freundschaft mit Fernando, mit der Berliner Bekannten Marta, die als Schauspielerin und ehrenamtliche Leiterin einer Theatergruppe Brecht inszenierte, und vor allem mit der schönen Aurora mit den geheimnisvollen Mandelaugen und dem langen schwarzen Zopf, der wie ein Ausrufezeichen ihren Rücken bis zum Po teilte, dauerte lange Jahre, auch als ich längst nicht mehr in der Kleiderkammer wohnte.
Ankunft in Lima 2018
Jetzt ist nicht die Zeit, mir alle Ankünfte in Lima ins Gedächtnis zu rufen, denn endlich erscheint mein primitiver kleiner Koffer – eine Marotte, immer mit ganz wenig Gepäck zu reisen! – auf dem Band. Ich eile durch die grüne „Nichts zu verzollen“-Tür, werde auch nicht aufgehalten und endlich entlässt die elektronische Tür mich hinaus in den Trubel. Wie immer bei der Ankunft auf dem Flughafen in einem fremden Land stehe ich neben mir, beobachte mich dabei, wie meine Augen ein bekanntes Gesicht suchen oder ein Schild mit meinem Namen. Sind die avisierten Abholer verhindert und haben jemand anderen geschickt? Dieses Gefühl, verloren zu sein − nicht nur in ‚Translation‘, sondern insgesamt, als Mensch, bei der Ankunft in diesen so anderen Kulturgegebenheiten − ist nie verschwunden. Mir fällt die Zeile aus „Die Kraniche des Ibykus“ ein: „Sei uns der Gastliche gewogen, der von dem Fremdling wehrt die Schmach!“ Eine Schmach ist es, fremd zu sein. Man zeigt die offenen Hände, man bringt Geschenke, man bittet um freundliche Aufnahme, bis, ja, bis sich jemand erbarmt.
Auch dieses Mal schicke ich den verlorenen Blick in die Runde und der Moment, in dem ich allein bin und der Fremde ausgesetzt, dehnt sich um eine gefühlte Ewigkeit. Endlich ertönt die bekannte Stimme: „Ana!“ Ein Erkennen, ein Glücksmoment − da steht Jaime, da steht Gabi! Ich bin gerettet.
Nicht nur der Flughafen hat sich verändert. Das Weichbild der Stadt, die Atmosphäre, die Gerüche, die gedämpften Geräusche, alles scheint anders. Schon bei meinem Besuch vor zwei Jahren war der Verkehr, war das Verhalten auf den Straßen wesentlich geordneter verlaufen als noch bei den Besuchen am Anfang des Jahrhunderts. Diesmal funktionieren die Ampeln noch perfekter, sind die Autofahrer noch disziplinierter, ist trotz des höheren Verkehrsaufkommens mehr Respekt zu spüren. Vieles andere ist jedoch wie sonst. So rasen die Fahrer auf dem Malecón, der Uferstraße am Pazifik, trotz einiger Schwellen mit überhöhter Geschwindigkeit, wechseln die Spuren, überholen sich wie Pferde beim Trabrennen.
„Hier werden Hochhäuser gebaut“, erklärt Jaime die Baupolitik der Stadt. „Alle kleinen Häuser verschwinden, die Quadratmeterpreise für die Grundstücke sind in die Höhe geschossen, folglich schießen auch die Häuser in die Höhe.”
Schilder fallen auf: „Appartements mit Aussicht über den Pazifik“, „Schwimmbad und Trimmstudio im Haus“. Sie weisen auf ein zu großes Angebot hin. Das Einkommen der Mehrheit scheint mit den explodierenden Preisen nicht Schritt zu halten. Reichtum und Armut in Peru liegen noch immer weit auseinander, die Mittelschicht wächst nur langsam, die Korruption blüht wie eh und je.
Miraflores
Der Stadtteil Miraflores ist ein schöner und geordneter Stadtteil geworden. Spuren für Busse und Fahrräder sind ausgewiesen, die Ampeln geben die Zeit der Rot- bzw. Grünphasen an, auf der Avenida Larco gibt es Fahrradständer, viel Blumenschmuck und Bänke zum Ausruhen. Rund um den Rathaus-Park, der schon immer eine Oase war, glänzen neue Pflastersteine, weitere Blumenbeete und grüne Hecken.
Das kleine grüne Cocolido zwischen all dem grauen Beton gibt es nicht mehr. Das ist das Drama in Miraflores: Ein Einfamilienhaus nach dem anderen wird verkauft und auch das kleine schnuffige Theater hatte einem Appartementhaus weichen müssen.
„Das Viertel erinnert jetzt an New York: Zu viele Menschen wollen an einem bestimmten Platz bauen. Die kleinen Grundstücke mit den hübschen Villen werden durch unpersönliche Hochhäuser ersetzt. Der Ausverkauf von gewachsener Struktur findet statt“, gebe ich leicht melancholisch meine Beobachtung kund.
Appartementhäuser verdrängen die Villen
„Stimmt“, fügt Gabi hinzu, „alles ist zur Ware geworden: Boden, Wasser, die Luft, Saatgut und das Meer. Wir sind froh, dass die Quinta nicht angegriffen wird.“
„Vielleicht muss man umgekehrt denken: Warum nicht? Wer sollte den Prozess der Aufteilung stoppen, seitdem das erste Mal ein Stückchen Land zu Privateigentum erklärt wurde? Umdenken kann nur der Einzelne, eine Gesellschaft kann nicht denken.“ Weitere Überlegungen finden nicht statt, wir sind beim Haus von Gabi und Jaime angekommen.
Das Haus liegt in der Quinta an der Avenida 28 de Julio, in einer kleinen Ansammlung von Einzelhäusern, die um einen Platz wie um einen Dorfanger herum gebaut sind und abgeschottet durch Zäune erhöhte Sicherheit bieten. Die Rasenflächen sind gepflegt, die Büsche geschnitten, die Trompetenbäume hängen voller Glocken, die fleischige Iris wirbt mit obszönen roten Blüten.
Wir betreten den Vorraum von Gabis Haus durch eine Glastür; ich hänge meine Jacke an die alte Holzgarderobe, auf der immer ein Hut von Gabi auf eleganten Ausgang wartet, stelle den Koffer ab. Im Wohnzimmer fällt Gabi aufs Sofa, ich mache ein paar Schritte durch das Esszimmer und werfe kurz einen Blick in den kleinen Patio mit Jaimes Pflanzenzucht (ist das nicht ein Hanfgewächs?) und in die Küche. Alles ist mir vertraut. Vielleicht ist der Modergeruch ein wenig intensiver geworden, hat die Küche noch ein bisschen mehr fettige Patina angesetzt, sind die Stühle ein bisschen wackeliger geworden, fällt ein wenig mehr Putz von den Wänden, aber verlässlich bietet es Obdach für mich, den Zugvogel.
Instabiler ist Gabi geworden. Vor drei Jahren war sie mit dem Fahrrad gestürzt und seitdem mehrfach hingefallen, immer wieder auf das rechte Knie, auch die Hüfte ist in Mitleidenschaft gezogen. Lange Zeit konnte sie sich kaum bewegen, jetzt bewältigt sie mithilfe eines Stockes wieder kleine Strecken. Jaime ist merklich gealtert, aber quirlig wie stets. Er ist ein athletischer Typ, der sich mit Sport fit hält. Er wirkt etwas kleiner, immer noch sehr drahtig mit den breiten Schultern und den schmalen Hüften. Er hält sich mit Badminton in Form. Seine einst schwarzen, gewellten Haare sind immer noch gewellt, aber dünner und mit grauen Fäden durchzogen, die braunen Augen blicken nach wie vor erwartungsvoll aus dem kantigen Gesicht. Zum Glück fasst er mich nicht mehr wie einst begehrlich um die Hüften. Ich höre den Mixer und bevor ich mich im Mädchenzimmer häuslich einrichten kann, wartet er mit dem ersten Pisco Sour auf: „Bienvenidos!”
Der perfekte Pisco Sour
„Ah, wie lecker! Darauf hab ich mich seit dem Kofferpacken gefreut.“
Gabi, die überströmende liebe Gabi! Die Freude, uns wiederzusehen! „Ana, meine Ana!“ Nachdem ich meine Schätze ausgepackt habe – Salami, Whisky, eine Haarschneideschere – fallen wir uns wieder und wieder in die Arme.
„Wie geht es mit dem Knie?“, erkundige ich mich.
„Das tut manchmal höllisch weh und ich vermisse das Schwimmen. Lass uns lieber von alten Zeiten reden. Weißt du noch, wie wir mit den Fahrrädern durch Miraflores gefahren sind? Du mit deinem wehenden Punkterock und dem gelben, ausgeschnittenen T-Shirt ohne BH?“
Gabi wirkt auf eine unbestimmte Weise aufgelöst, über die Ufer getreten, ungebändigt. Ich beneide die Freundin um die absolut korsettfreie Lässigkeit.
„Aber ich hab auch innerlich kein Korsett − das ärgert mich“, gibt Gabi auf die entsprechende Äußerung zu. „Ich trinke abends gern ein Gläschen.“
„Die Hauptsache ist doch, dass du fröhlich und guter Dinge bist. Geburt und Tod – was dazwischen ist, muss ausgefüllt werden. Es gibt keinen Richter, außer dem in dir. Also nimm dich so, wie du bist.“
„Ach, Ana, du bist so vernünftig.“
„Und möchte manchmal viel unvernünftiger sein. Ich muss mich auch so verbrauchen, wie ich bin.“
„Hallo Mädels, hier kommt der zweite Pisco!“
„Oh, gut!“, freue ich mich.
Gabi und Jaime
Ich denke an unsere erste Begegnung. 1985 war ich ins Goethe-Institut gegangen, hatte gehofft, man könne mir mit Kontakten für meine Recherche für die Doktorarbeit helfen, stattdessen bekam ich einen Job als Lehrerin. Im Büro sollte ich meine Daten eintragen und da saß Gabi: Mit einem offenen Lächeln in einem rundlichen Gesicht blickte sie mich an; sie war froh, wieder einmal eine Muttersprachlerin zu treffen, und dann noch aus Berlin.
„Wie ist es in Berlin?“, wollte sie wissen.
Ich erzählte von der Schaubühne, von den Inszenierungen von Peter Stein: „Groß und Klein von Botho Strauß hab ich bei klirrender Kälte gesehen, so dass ich eher gegangen bin; in Kalldewey, Farce wird ein Mann in die Waschmaschine gesteckt und …“ Unvermittelt unterbrach mich Gabi: „Dich möchte ich als Freundin haben.”
Das kam schnell, ungeschminkt und naiv aufrichtig daher; ich war verblüfft und wusste nicht, was ich sagen sollte. Noch war ich nur halb entschlossen, in Peru zu bleiben, noch hatte ich keine Unterkunft für länger, noch wollte ich die touristischen Ziele in Peru und Bolivien aufsuchen, wollte nach Buenos Aires reisen, um die Eltern der Freundin aufzusuchen. Die Freundschaft ergab sich über die Zeit, sie erwies sich als beständig und zuverlässig.
Fröhlich erzähle ich beim zweiten Pisco von einem Vorfall.
„Weißt du noch, wie ich euer Haus hüten sollte? Ich sagte zu und ärgerte mich darüber. Es war eine dieser Situationen, in denen ich hätte nein sagen sollen. Du lehntest alle Einwände ab. Und dann saß ich da, wusste nicht recht, wie mit meiner Arbeit weitermachen, kein Ansatz wollte gelingen. Ich fischte mir einen Krimi, ging abends müde und unzufrieden ins Bett und dann machte eine Kakerlake jedwede Entspannung unmöglich.“ Gabi erinnert sich nicht, ich erzähle weiter.
„Licht an, Kakerlake verschwindet, Licht aus, krsch, krsch! Licht an, nichts zu sehen oder finden! Licht aus, krsch, krsch! So ging es die ganze Nacht; als es draußen hell wurde, fiel ich in einen dämmerigen Halbschlaf. Unausgeschlafen und missmutig hatte ich dir am Morgen danach von der Nachtwache erzählt.“
Gabi lacht herzlich über mein Cucaracha-Erlebnis, lässt die Jahre Revue passieren. Gabi und Jaime hatten sich bei einem Urlaub auf Ibiza kennengelernt, es war Liebe auf den ersten Blick gewesen. Gabi war, frustriert von einer dieser schmerzhaften Aufrichtigkeitsbeziehungen der siebziger Jahre, mit einer Freundin auf die Insel geflohen, Jaime machte Europaurlaub. Beim morgendlichen Brötchenholen sah er sie und wusste: Die ist es! Ein paar Wochen später heirateten sie und Gabi zog nach Peru. Ein festes Einkommen gab es nicht, aber viel Spaß und Sex. Sie versuchten sich in der Eisproduktion, Jaime nahm verschiedene Jobs an, hatte Ideen für einen Handel: Bettlaken wollte er machen lassen und den Hotels verkaufen, die kleinen Päckchen mit Seife und Shampoo beschaffen, irgendwo billig etwas herstellen lassen und dann mit Gewinn verkaufen. Das hatte meist nicht geklappt und dann war wieder kein Geld im Haus. Kurz vor meiner ersten Ankunft in Lima und damit kurz vor dem Beginn unserer Freundschaft, hatte Gabi eine Stelle am Goethe-Institut bekommen. Das sicherte der Familie ein Grundeinkommen. Als in Berlin die Mauer fiel, erbte Gabi ein kleines Grundstück in Brandenburg, vom Verkauf hatten sie sich das Haus in der Quinta gekauft.
Der Sohn war ein paar Wochen in den peruanischen Sommerferien bei mir in Deutschland gewesen, hatte später die Sekundarschule abgeschlossen und war nach dem Studium nach Deutschland gegangen. Dazwischen hatte es zwischen Jaime und Gabi immer wieder heftige Auseinandersetzungen gegeben. Jaime konnte es nicht lassen, immer wieder eine andere Frau vor allem körperlich zu mögen. Einmal war er ausgezogen, Gabi überlegte, ihn ganz rauszuwerfen, er kam zurück und sie nahm ihn wieder auf. Na klar, es war ihr Haus, sie hatte ein festes Einkommen, solche Behaglichkeit wollte er nie ernstlich aufgeben. Diese Achterbahnfahrten hatte ich aus der Ferne verfolgt. Briefe waren hin und her gegangen, später per Mail oder per Messenger bei Facebook, zuletzt über WhatsApp. Ab und zu kam von Gabi die Meldung: Du fehlst mir! Und mir fehlten ihre Direktheit und ihr Lachen. Einmal hatte ich sogar erwogen, ein Haus in der Quinta zu kaufen. Nach der Pensionierung könnte ich in den düsteren deutschen Wintern dort wohnen und den peruanischen Sommer genießen. Aber dann war die Vernunft größer: Zweimal jährlich ein Langstreckenflug? Nein, das wollte ich doch nicht.
Als ihre Mutter starb, musste der Haushalt aufgelöst werden. Gabi kann nach Berlin und wohnte bei mir. Endlose nächtliche Diskussionen zerrten an den Nerven, unserer Freundschaft tat das keinen Abbruch. Gabi war nach Zweifeln, ob sie nicht doch in Berlin bleiben sollte, nach Lima zurückgekehrt.
Jaime und Gabi sind seit Langem Mitglieder im Club Las Terrazas, gehen dort schwimmen und Badminton spielen, im Club spielt sich das Leben für die beiden ab. Dort treffen sie die Freunde, feiern die Geburtstage und den Jahreswechsel. Gabi war immer wieder von ihren Wünschen hin und her geschleudert worden. Sollte sie in Lima bleiben, wo Jaime sie betrog? Würde sie in Berlin Arbeit finden und würden alte Freundschaften halten? In Lima hatte sie ihre oberflächlichen Freundinnen, aus deren Shoppingtouren und Schönheitskuren sie sich schon wegen der fehlenden finanziellen Mittel raushalten musste.
Ich kommentiere ironisch:
„Stell dir vor, du kommst in Berlin wieder an. Und dann wirst du gefragt: ‚Ach, du wirst jetzt hierbleiben?’ Da gibt es lange Gesichter, oder glaubst du, die haben auf dich gewartet? Alle sind eingebunden in ihren eigenen Alltag, ihre Freundeskreise und ihre Gewohnheiten. Man wird sich freuen, dich zu sehen, aber dann geht man zur Tagesordnung über. Du müsstest dir einen Platz erarbeiten. Und das, wo du nicht mehr durch den Job eingebunden bist.“
Inzwischen ist sie im Ruhestand, weiß, dass in Berlin ihre Rente nicht reichen würde. Und hier in Lima ist der Sohn. Er ist verheiratet und es gibt eine bezaubernde Enkeltochter, die Gabi herzlich liebt. Sie hat entschieden, endgültig in Lima zu bleiben.
Gabi lacht ihr unwiderstehliches lautes Gabi-Lachen. Jaime kommt mit der Pisco-Flasche: „Für einen dritten Sour reicht es nicht mehr. Ihr müsst den Rest pur trinken.“
Spät abends stolpere ich beschwipst in die obere Etage. Unordentlich ist das Bad, Kleider über Kleider sowie Schals und Taschen liegen und hängen über dem Treppengeländer, ein dünner Staubfilm verdumpft die Farben, morsche Balken sind mit Klebeband notdürftig überdeckt, Schwamm nistet in den Wänden, vertraut belästigt der klamm-moderige Geruch Limas meine Nase. Das Internet funktioniert nicht, weil die Flatrate aufgebraucht ist. Die Herzlichkeit Gabis überzieht alles mit Liebe wie mit Zuckerglanz. Versöhnlich empfängt mich auch das von der Freundin liebevoll vorbereitete Zimmerchen an der Dienstbotentreppe. Das Bett ist mit Streublümchenwäsche überzogen, ein paar Rosen aus dem kleinen Garten im Hof stehen auf dem Regal, dazu eine Wasserflasche, und es gibt eine richtig helle Leselampe. Die Gute hat an alles gedacht, hat einen Rückzugsort für mich geschaffen und wohl auch für sich, denn wie stets würde es auch diesmal manchen Schwatz und viel Lachen in dieser Kammer geben, würden wir unsere bisherigen Leben reflektieren, unser Scheitern und unsere Glücksmomente teilen.
Sonntagmorgen in Miraflores
„Hola, Ana! Du bist schon aufgestanden?“ Jaime werkelt bereits in der Küche. „Quieres un jugo?“ Klar will ich frischen Fruchtsaft, den Jaime, frisch gewaschen und rasiert, perfekt mit heller Hose und einem schicken Hemd bekleidet, schon im Mixer fertig hat. Köstlich. Die Früchte kommen hier nicht unreif und geschmacklos aus dem tiefgekühlten Flieger, sondern frisch von den Bauern aus dem Umland. Gabi erscheint lätschig im Morgenrock, macht sich ihren vorbereiteten Kaffee, zieht die Mundwinkel genervt nach unten und beschwert sich über die gute Laune in der Küche.
Zu Jaimes Vormittagsritual gehört der Gang zum Markt. Ich begleite ihn. Auf dem Markt ist alles frisch. Aus den Flusstälern an der Küste kommen Obst und Gemüse, die Fische werden in der Nacht gefangen und die Hühner werden oft direkt am Marktstand für den Kunden geschlachtet. Die Cocina Peruana