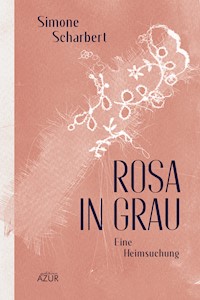Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition AZUR
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anna Atkins, geboren 1799 im englischen Tonbridge, gestorben 1871 in Halstead, gilt heute als eine der ersten Fotografinnen. Mit ihrer unermüdlichen Arbeit leistete sie einen wichtigen Beitrag zur Wissenschaft des viktorianischen Zeitalters — und wurde doch kaum wahrgenommen. Zu einer Zeit, in der Erinnerung, Dokumentation und Bebilderung fast ausschließlich der Malerei und Illustration vorbehalten waren, widmete sie sich einem einfachen manuellen Verfahren, das mit Hilfe von bloßem Licht und UV-empfindlich beschichtetem Papier neue Möglichkeiten der Abbildung schuf. Die so entstandenen Cyanotypien gelten heute als Vorläufer der späteren Fotografie. In ihrem dritten Prosatext nach "du, alice" (2019) und "Rosa in Grau" (2022) verfolgt Simone Scharbert ihr Projekt des Sichtbarmachens weiblicher Biografien weiter. Sie erzählt, wie Anna Atkins gegen viele Widerstände ihre fotografischen und wissenschaftliche Arbeiten vorantrieb, im Gepäck all die Verluste ihres Lebens, Fragen der Erinnerung und der Belichtung. Leise eingestreut sind kleine Einblicke in botanische sowie koloniale Geschichte des viktorianischen Zeitalters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Anna
Simone Scharbert
Für Anna
Eine Belichtung
was sich einprägt
ist nicht Dauer
was sich einprägt
ist nicht Augenblick
was sich einprägt
ist eines Augenblicks Dauer
Monogramm I.
Martina Werner
Für Larenzi
// Lange geschieht nichts. Die Zeit verhält sich leise. Lagert in Pflanzen, unsichtbar. Die einzelnen Tage. Jahrhunderte, bis in die Jahrtausende. Im Farn, in seinen Wedeln. Sorgfältig zurechtgemacht liegt sie dort. In Adern, Fasern und Wurzeln. Glattgezogen, bis in die kleinsten Spitzen. Liegt still, liegt stumm. Wird dünner, von Tag zu Tag, durchscheinend. Die Zeit trocknet. Nimmt neue Formen an, überdauert.
Weiße Linien auf blauem Grund.
Inhalt
1806
1809
1813
1815
1818
1825
1831
1839
1840
1842
1852
1853
1865
1871
WAS FEHLT?
Anmerkungen
GLOSSAR
QUELLEN
ANNA ATKINS
FOTOGRAFIE
BOTANIK
DANK
1806
// Sieben Jahre ist sie alt, als sie das erste Mal danach fragt. Dieses eine Wort aus den Höhlen ihres kleinen Körpers hinauf in den Mund, dann ins Licht schiebt. Warm und weich fühlt es sich an, traurig auch. Sie hängt ein Fragezeichen ans Wort. Einfach so, eine Erwartung. Vater sieht es genau, nickt. Sagt aber nichts. Nimmt ihr das Wort aus dem Mund und streicht darüber. Zart. Hält es wie ein frisch geschlüpftes Küken in der Hand. In beiden Händen. Lange hat er es nicht gehört. Ihm ist, als würde das Wort atmen.
Mum?
Ihr Zögern. Erzählst du mir von ihr?
Von Mum. Über Mum. Ihr Insistieren, sein Nicken.
Vater blickt Anna an. Sieht seine Tochter, sein einziges Kind. Wie sie da sitzt. Klein, schmächtig. Das Haar widerspenstig, schwarz gelockt. Ihr Blick neugierig und klar. Unerschrocken. Sie wartet, ihr Warten tickt stumm mit der Zeit. Vater weiß, dass Anna hartnäckig ist. Sitzen bleiben wird, bis sich aus seinem Gedankendunkel etwas Greifbares, eine Kontur abzeichnet. Ein Bild, endlich. An dem sie sich festhalten kann. Das ihr Gewissheit gibt, eine Lücke schließt. Lange hat er gewartet. Vielleicht zu lange. So viel, das vergangen, verloren, verschwunden ist. In ihm. Und doch immer wieder anklopft, sich bemerkbar macht, als wohnte es in den entlegensten Winkeln seines Brustkorbs. Als wollte es nun endlich ans Licht. Vater aber spricht nicht darüber, schweigt immer wieder in sich hinein, an Anna vorbei.
Diesmal aber ist es anders. Anna sieht Vater, wie er den Stuhl nach hinten schiebt, die Schöße seines Anzugs im Rücken geradezieht, Haltung wahren, eine Haltung haben, egal, was passiert, er kann nicht anders, eingeschrieben ist es ihm, während er Anna nicht aus den Augen lässt. Gegenseitig halten sie sich. Die kurze Strecke, bis er bei ihr ist. Die lange Zeit, die sie schon allein sind.
Komm, Anna. Steh auf.
Seine Stimme. Wie warme Milch.
Ich will dir etwas zeigen.
Vor dem Fenster, überhaupt draußen,
findet sich Licht ein.
Strahlt, überlagert alles.
Vater reicht Anna die Hand. Ihr Blick weiter unverrückt, ernst. Ihr Abwarten. Er sieht es genau. Sieht es, als sie ihm die Hand gibt. Sieht es, als sie vom Stuhl rutscht, mit ihrem kleinen Körper. Sieht es an ihren Kleiderschichten. All diese Stoffberge, die ihm ein Rätsel sind. Schon immer waren. Aber sie fügen sich. Alle und alles. Der Stoff, die Zeit. Er. Und Anna. Er sieht all das, als sie an seiner Seite geht. Zwei kleine Schritte in einem großen: Annas Zwischenklang. Sohlensingsang. Weiter hält er Anna an der Hand, versucht seine Schritte klein zu halten, im Takt zu bleiben, in ihrem Takt, vorbei an Wandgemälden, Wandtapeten, Wandgestecken, an Porträts aus einer anderen Zeit, in Öl, in Farbe, in vielen Pinselstrichen, schwer, dekorativ. Ihm ist das alles zu viel. Menschen, an die er sich kaum erinnern kann, Menschen, die er nicht gekannt hat. Und weiter treibt es ihn. Vorbei an Floralem, an Dekor, an Stuck.
Hier und da ein Aufschimmern.
Als gäbe es sie noch.
Hester. In ihm. Vor ihm. Als säße sie hier im Raum oder stünde gleich in der Tür. Würde seinen Namen sagen. Oder Annas. Ihn ansehen. Unverwandt. Vielleicht hätte sie Anna auf dem Arm. Wie zu Beginn. Die wenigen Wochen und Monate. Als sie Anna noch halten, sie wiegen konnte. Vielleicht. Sein Körper randvoll: mit all den Bildern, Erinnerungsfetzen.
Ihre Schreie, ihr Blut, ihre Blässe.
Ihr Weißwerden, dann: ihr Auflösen.
Im Bett, ihr Unsichtbarwerden.
Und Vater ohne den Anflug einer Idee, womit er sie hätte festhalten, bei sich halten können. Nichts. Was bleibt: der Tag, an dem sie mitten im Raum stehen geblieben ist. Gebrüllt hat. Mit ihrem ganzen Körper. Dass es losginge, er sofort nach dem Doktor schicken solle. Nach einer Hebamme. Egal nach wem, aber dringend sei es. Dass das Kind kommen würde. Die Fruchtblase geplatzt sei.
Um sie das Wasser.
Viel zu früh. Alles viel zu früh.
Und dann das Kind. Ausgewurzelt, wurzellos.
Und wie sie dann da liegt: Anna. So klein, frisch geboren, abgeschnitten. Eingerollt. In sich. Dieser kleine Körper. In all der Unruhe. Um sie herum nur Ärzte: ihr Ein- und Ausgehen. Ihre Ratlosigkeit. Vaters Hilflosigkeit. Ihre Versuche, sein Wunsch, Hester nicht aus diesem Leben zu lassen, die irrsinnigen Blutungen zu stoppen. All die Gespräche, Behandlungen. Dazwischen Vaters Flüstern. Mit sich selbst. Seine Angst. Ins Verblassen hinein, bis zum Schluss. Ins Schwarze. Ein ganzes Jahr. Hesters Sterben. In Zeitlupe. Er erinnert die Tage. Jeder einzelne sitzt in ihm. Ihr unnachgiebiges Wachsen, Treiben. Wie Luftwurzeln. Ihr Ausrollen, Hineintasten. Von einem Jahrhundert ins andere. 1799. 1800. Kein Halt, kein Aufhalten, kein Innehalten.
Vaters Atem geht schwer. Annas Atem so leicht. Und Vater geht weiter, sieht jetzt zu Anna hinab. Sieht, dass etwas an ihrem Kleid, aus einer ihrer Taschen hängt.
Was hängt aus deiner Tasche, Anna?
Annas Blick auf Vater, dann auf sich.
Ein Windröschen-Stiel.
Annas Ton beiläufig. Als wäre es selbstverständlich, dass Pflanzenreste an ihrem Kleid hängen. Was sie damit vorhabe, will Vater wissen. Sie wolle ihn trocknen, ihre Stimme jetzt ernst. Und bevor Vater weiter nachhaken kann, zieht Anna den Stiel aus der Tasche, hält ihn Vater hin. Vater aber sieht nur Anna, sein Kind. Sieht, wie sie den Blütenstiel hält, ein Seil zwischen ihren Händen. Zerbrechlich, verletzbar. Sieht, wie vorsichtig sie ist: den Stiel nicht verlieren will, dieses Seil in eine andere Zeit. Und Vater wünscht, er könnte sich daran festhalten.
Anna spricht weiter. Ihre Stimme jetzt hell, die Worte kurz. Erklärt, dass sie den Stiel pressen wolle. So wie Vater es ihr gezeigt hat. Damit sie eine Erinnerung an ihn habe, ein Bild. Falls er stirbt. Falls er stirbt? Der Stiel? Vater weiß nicht, was er sagen, was er antworten soll. Verwundert ist er, über dieses Kind. Immer wieder. Woher sie solche Gedanken nimmt, einfach aus der Tasche zieht. Mit ihren sieben Jahren. Dass auch Pflanzen sterben. Wann eine Pflanze tot sei, ob Vater das wisse. Annas Stimme jetzt neugierig. Vater schüttelt den Kopf. Nein, genau wisse er es nicht. Schwierig sei das. Vom Tod zu sprechen. Übers Totsein. Überhaupt: totes Sein. So ein Widerspruch. Vater fällt in sich. Immer wieder passiert das. Ein Zusammenklappen. Im Innern. Als falte das Herz sich zusammen, seine Lunge, Flügel auf Flügel, als wäre er ein Klappbild. Könne er sich vor der Welt verschließen. Einfach so. Ein einzelner Begriff manchmal ausreichend. Oder eine Erinnerung. Dieses Aufblitzen. Unverhofft. Eines Bildes. Oder von einem Wort. Totes Sein. Immer wieder denkt Vater darüber nach. Kann nicht anders. Über dieses Paradox. Totes Sein. Ein Nachdenken über das Einsetzen des Todes. Wann er beginnt, wann er aufhört. Dieser Prozess, unaufhaltsam, alle verbindend: das Absterben, das Aussterben. Eines einzelnen Körpers. Wie bei Hester. Aller Körper. Das Sterben an sich. Seine Vermutung, dass der Tod nicht plötzlich kommt, sondern einzieht. Langsam. Sich einschleicht ins Leben. Weiterzieht. Oder immer schon da ist. Von Beginn an in jedem einzelnen Körper nistet. In jedem Organismus ein Zuhause hat.
Falls er stirbt. Vater streicht Anna über den Kopf. Weiß nicht, wie lange sie neben ihm stehen geblieben ist, ganz ruhig, ob Anna schon lange auf eine Reaktion, eine Antwort wartet. Er sagt nichts. Weiß nicht, was er sagen soll. Sagen kann. Diesem Kind. Geht weiter. Vertraut auf die Lautstärke seiner Schritte, dass sie genug sind. Für diesen Moment. Und Anna folgt ihm in einer Selbstverständlichkeit, die ihn schmerzt. Als wären sie verwachsen. Als würde sie aus seinen Füßen wurzeln, aus seiner Anwesenheit heraus. Dieses kleine Kind. Und er.
Das Licht jetzt in Flecken,
flimmert über Annas Hände, über den Stiel.
Wölbt den Stiel zur Schattenbrücke.
Und Anna, wie sie dem Licht gern folgen würde, dann, wenn niemand hinsieht, sie früh aus dem Bett schlüpft, heimlich, Türen öffnet, eine nach der anderen, barfuß ist, der Boden kalt, drinnen, draußen, aber es ihr nichts ausmacht, im Gegenteil: Ihre Füße können gut mit Kälte. Oft steht sie draußen, frühmorgens schon, im Gras, im Sand oder auf Kies, ohne dass jemand davon weiß, am liebsten dann, wenn das Licht es noch nicht richtig in den Tag geschafft hat, das Gras noch feucht ist, in sich gekauert, die Welt noch aus Rundungen besteht. Annas Augen hängen sich dann in den Himmel. Suchen die Baumkronen ab nach Vögeln, ihren offenen Schnäbeln. Diesem Geräusch-Theater, dem Tschilpen. Manche Stimmen erkennt Anna nach ein, zwei Tönen. Vater hat es ihr beigebracht. Ihr die Vögel gezeigt und erzählt: was den einzelnen Vogel ausmacht, nicht sichtbar ist. Die Hohlknochen, so leicht. Die innere Struktur eines Gefieders, so weich. Wie sich Feder um Feder zu etwas Kleidähnlichem fügt. So wie Annas Rockbauschen. An Vaters Schreibtisch, an seinem Schreibfenster, at the dear writer’s window: Buchfinken und Kleiber, Sperling und Rotkehlchen. Vater spricht mit ihnen, lockt sie, versucht, ihnen nah zu kommen. Scheitert, immer wieder, gibt nicht auf. Schreibt Gedichte für sie. Und Anna beobachtet sie. In aller Ruhe. Der ganze Tag aus Zeit gewoben, ein dünnes Flechtwerk, durchscheinend. Anna zieht an den Rändern, zieht die Zeit ins Weite. Mit aller Kraft. Und immer wieder liegt so ein Tag vor ihr: blank, ohne konkrete Vorstellung, ohne Bild.
Anna? Komm, wir gehen weiter. Vater beugt sich zu ihr, bringt sich in ihre Gegenwart. Legt ihr beide Hände auf die Schultern, als wollte er sie losrütteln. Aufrütteln. Aus ihrem Stand, aus den Gedanken. Ich will dir etwas zeigen. Anna aber ist noch versunken, denkt nach. Und es dauert, bis sie wieder ganz bei Vater ist. Mehrmals muss er sie bei den Schultern nehmen, ihr beide Hände auflegen, fest, sie ansprechen, direkt, bis die beiden weitergehen können. Dass sie das kann, denkt Vater. Einfach so verschwinden. In sich. Ohne eine Regung nach außen. Er schüttelt den Kopf, will Annas Hand nehmen. Aber es geht nicht, Anna hält immer noch den Stiel, hält sich daran fest, geht jetzt fast automatisch an Vaters Seite.
Bis zu Vaters Bibliothek sind es nur noch ein paar Meter, die Tür steht offen. Anna kennt den Raum gut, mag ihn. Manchmal huscht sie einfach so hinein. Setzt sich auf den Boden, vor eines der Regale. Streckt die Füße, ihre Stiefelspitzen in den Raum. Groß ist der Raum, mit einer bodentiefen Fensterreihe zum Garten, dazwischen Glastüren, die Oberlichter halbrunde Gussfenster, Lichtkarusselle, funkelnd. Annas Augen steigen sofort ein. Vaters Bücher sind an drei Seiten des Raums untergebracht. Regal um Regal, hoch bis zur Decke. Manchmal versucht Anna zu schätzen, wie viele Bücher es wohl sein mögen, aber die Zahlen laufen ihr davon, wollen keinen Sinn, keine Summe in ihrem Kopf ergeben, zu viele sind es. Und dann treten sie in die Bibliothek, Seite an Seite, Vater und Anna. In der Mitte des Raumes bleiben beide stehen. Anna immer noch den Blütenstiel zwischen beiden Händen, eine kleine Hängebrücke in den Tag.
Vor ihnen: Hesters Stehpult. Aus Holz. Dunkel ist es, glänzend poliert. Die Pultbeine grazil, in der Mitte gedrechselt. Mit einer leicht abgeschrägten Tischfläche. Gerade so breit, dass eine Person daran stehen kann. Eine schmale, quer gesetzte Leiste am unteren Ende der Fläche. Gut einen Meter und zehn Zentimeter wird das Pult hoch sein, deutlich größer als Anna. Immer wieder stellt sie sich ans Pult. Heimlich. Misst die Größe des eigenen Körpers an der Größe des Möbelstücks.
Anna weiß: Meist ist das Pult leer. Kein Buch darauf zu sehen. Sie kann sich zumindest nicht daran erinnern. Was sie auch weiß, weil Vater immer wieder davon spricht: Meist stand Mutter an dem Pult. Mum. Hester. Was sie nicht weiß: Wie viel Zeit Mutter an diesem Pult verbracht hat.
Vater aber geht am Pult vorbei, geht weiter zu den Schreibtischen. Zwei sind es. Für jeden Schreibtisch ein bodentiefes Fenster, für jeden Schreibtisch ein Blick in den Garten, the dear writer’s window. Der eine Schreibtisch ein Textgebirge, der andere Schreibtisch leer, verlassen. Vaters Schreibtisch. Mutters Schreibtisch. Und Anna sieht nun: Vaters Hand, wie sie zur Schublade greift. Anna beobachtet genau. Sieht, wie er sie aufzieht, bedächtig. Folgt weiter Vaters rechter Hand, die den Griff loslässt, sich selbst in der Luft vergisst. Der ganze Vaterkörper eine Verunsicherung. Sieht, wie die Hand in die Schublade greift. Darin verschwindet, der ganze Vaterkörper leicht nach vorn gebeugt, als würde er sich verneigen. All das in Zeitlupe. Und Anna weiß nicht, ob ihre Augen zu langsam sind. Oder Vater nicht schneller kann. Anna sieht auch, wie Vaters Hand wieder auftaucht. Sieht ein schmales Heft darin. Sieht, wie die Hand das Heft hält. Vaters Hand. Als gäbe es nichts Anderes auf dieser Welt. Sieht die Bedächtigkeit. Das Zärtliche. Sieht all das. Dieses kleine Kind.
Anna. Komm. Komm zu mir. Vaters Stimme. Wie dünne Milch jetzt. Weiß, blass hängt sie ihm im Mund. Und Anna geht die wenigen Schritte. Vater ganz still: in der Hand weiter das schmale Heft, der ganze Vaterkörper jetzt gerade. Gespannt. Aufgezogen aus dem Innern. Und Anna stellt sich neben ihn. Zwischen ihnen das Heft in Vaters Hand. Sein Blick immer noch aus dem Fenster. Leer. Als würde ihm die Sicht wegschwimmen. Und dann aber tut sich etwas. Anna sieht es genau. Sieht, wie Vaters Augen zu erzählen beginnen. Wie sie warm werden, sein Blick ins Jetzt will. Und wie Vaters Stimme dann Worte formt, ein Gewölk einzelner Worte daraus wird. Und Anna mittendrin, Vaters Hand jetzt auf ihrer Schulter.
Von Mutter, von Hester erzählt er. Zieht Mutter an, holt sie langsam aus dem Bett, gibt ihr Farbe, gibt ihr Leben. Zumindest für kurze Zeit. Und Anna sieht, wie Mutter durch den Garten geht, wie der Saum ihrer Röcke über den Rasen streift, wie ihr Kleid über Halme schleift, wie sie barfuß ist, darunter, als gäbe es nichts, was zwischen Mutter und den Boden, die Natur passt. Verbundenheit. Anna sieht auch, wie Mutter die Rabatten anlegt, eine nach der anderen. Anemonen-Felder, Hortensien, Lilien. Sieht Mutters Hände, wie sie Zwiebeln in die Erde einbringen, sieht, wie Mutters rechte Hand eine kleine Schaufel hält, der Griff aus Holz, die spitz zulaufende Fläche aus Eisen, und Mutters linke Hand den ganzen Mutterkörper abstützt, ein Mutterkörper, der noch kein Mutterkörper ist, der noch jung, gespannt ist, und sieht auch, wie die Röcke sich zu einem Hügel bauschen und sich doch beugen, sieht, wie Mutter die Schaufel kurz zur Seite legt, nach einer neuen Zwiebel greift, sieht, wie die Grünspitzen schon rauslugen, wie Mutter die Zwiebel in die Erde einbringt, die Grünspitzen noch nach oben zeigen, wie sie mit beiden Händen die Erde zusammenschiebt, die Stelle mit beiden Händen festdrückt, wie die Zwiebel im Dunkeln verschwindet, wie nichts mehr von ihr zu sehen ist und Mutter geschickt nach der Schaufel greift, wieder ein Loch gräbt, ein paar Zentimeter weiter, sieht, wie Handgriff für Handgriff sich wiederholt, wie Mutter sich durch die Erde arbeitet, sieht, wie die Zwiebeln weniger werden, sieht, wie der Korb leer ist, sieht, wie Mutter aufsteht, kurz aus dem Bild zu Anna lugt. Spürt, wie sie selbst erschrickt.
Dann wird es dunkel.
Anna sieht nichts. Vater schweigt.
Und ihr Gesicht? Wie sah ihr Gesicht aus?
Annas Stimme ein dünner Leuchtstift.
Und Anna, wie sie damit malt.
Aber es bleibt dunkel, Vater weiß nichts zu antworten.
In ihm jetzt ein Bildtoben. Hester, wie sie im Korsett vor ihm steht. Sich dreht, langsam. Das Haar offen, die Schnürbänder festgezurrt. Wie ihm angst und bange wird, sie könnte keine Luft bekommen. Hester, wie sie an ihrem Pult steht. Spätabends. Hester, wie sie schreibt, sich Notizen macht. Hesters Schrift. Geschwungen, leicht. Hesters Buchstaben, wie sie manchmal ausreißen, sich verselbstständigen. Sich an nichts halten. Hester, wie sie dann sagt, dass sie schwanger sei. Die Hände auf ihren Bauch, ihren Blick zu ihm legt. Hester, wie sie wartet. Auf seine Antwort. Wie er nickt, einfach nur nickt. Wie er nichts ahnt, nichts ahnen kann. Hester, wie sie auf ihn zukommt. Immer wieder.
Hester Anne Holwell.
Vater lässt Anna im Dunkeln. Er kann nicht anders. Lässt sich selbst im Dunkeln. Weiß nicht, wie er Hester beschreiben soll. Ihr Gesicht. Welche Worte die richtigen sind. Und also schweigt Vater. Und Anna, unnachgiebig, steht immer noch neben Vater, steht still, immer noch den Stiel in Händen. Als wäre keine Zeit vergangen. Das Heft liegt jetzt auf dem Tisch, vor ihnen. Dünn, grau-blau. Keine Schrift, nur eine gepresste Blüte als Titel. Eine Anemone. Windröschen. Gerade noch zu erkennen, mehr verschwunden als vorhanden. Anna wartet. Legt dann ihren Blütenstiel neben das Heft. Legt ihn mit etwas Abstand zum Rand, legt ihn so, als gehörten die Blüten zum Stiel. Legt ihn neben das Heft. Als könnten Blüten und Stiel nicht richtig zueinander, so sieht das aus. Als hätte sie jemand getrennt, sie auseinandergerissen.
Was ist das? Annas Frage kommt unvermittelt, schreckt Vater auf. Ein Herbarium, Anna. Sagt es in einem Ton, als wisse Anna nicht, was das ist. Als habe er selbst all die Stunden vergessen, in denen er es ihr erklärt, gezeigt hat. Schritt für Schritt. Für die Einordnung der Pflanzen ist es wirklich nützlich, Anna, für ihre Ordnung. Vorsichtig aber muss man sein, beim Vorbereiten, beim Pressen. Und, Anna, Zeit braucht es, viel Zeit, bis die Eigenheiten einer Pf lanze sichtbar werden. In Annas Kopf damals Minuten, einzelne Stunden; der langsame Lauf eines Zeigers. Tage, manchmal Wochen kann das dauern, bis man sie einkleben kann in so ein Herbarium. Pause. Vaters kurzes Überlegen. Es ist eine Art Museum für Blumen. Vaters Ton schärfer. Ironisch. Ein weibliches Museum für Blumen, so nennen sie es im Club, Anna. Und dass nur Frauen diese Arbeit machen sollen, es genau das Richtige für sie ist. Blumen pflücken, präparieren, pressen. Nicht besonders anspruchsvoll. Auch das sagen sie, immer wieder. Aber nichts, Anna, rein gar nichts musst du auf solche Aussagen geben. Einfach nichts. Anna nickt.
Stellt sich vor. Mutter.
Wie sie das Heft hält, in ihrer Hand.
Wie das Blattweiß noch leuchtend ist, die Seiten leer.
Vaters Schwere. Annas Leichtigkeit. Dann: Ihr Wortsprudeln, ihre Neugier, ihr Hingerissen-Sein. Darf ich es öffnen?